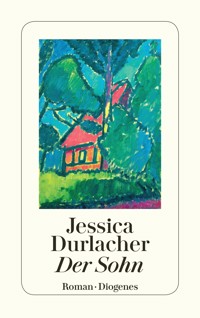11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Somalierin Amal wird Nanny für Zeldas Kinder und entpuppt sich nicht nur als eine Bereicherung für die gesamte Familie, sondern auch als phänomenale Sängerin, weshalb Zelda sie bei der Talentshow ›Die Stimme‹ anmeldet. Nach einem glanzvollen Auftritt nimmt Amal dort vor laufender Kamera ihr Kopftuch ab. Dieser Akt der Befreiung bleibt nicht ohne Folgen. Zeldas Familie möchte Amal beschützen und gerät damit in einen Konflikt, der ihre Welt aus den Angeln hebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jessica Durlacher
Die Stimme
Aus dem Niederländischen von Annelie Bogener
Diogenes
Für meine Liebsten
Es heißt, auf der Welt gebe es zu jeder Zeit sechsunddreißig besondere Menschen, und ohne sie, ohne jeden Einzelnen von ihnen, werde die Welt untergehen, und kein Einziger dürfe fehlen.
Nach dem Talmud
Jetzt, wo wir schon mal in New York waren, hatte Bor gesagt, könnten wir doch heiraten. Als würde er mich zu einem Ausflug einladen, in den Zoo oder so. Das schlug er am Freitag vor. Am Wochenende und am Montag war der Rabbi ausgebucht, und am Mittwoch sollten wir zurückfliegen. Es sei eine Art Gottesgeschenk, fand Bor, dass er am Dienstag noch Zeit hatte, und dann fand ich es eben auch, und sei es mit einer gewissen Zurückhaltung.
Sooft wir später versuchten, den großen Tag in Liebe zu ertränken, mit Restaurantbesuchen und Rosen und Reisen und Alkohol, jedes Mal, wenn meine Gedanken unwillkürlich zu diesem Tag zurückschweiften, schämte ich mich irgendwie.
Als wäre die Welt für unsere Leichtfertigkeit bestraft worden.
In den vorangegangenen zehn Jahren, seitdem wir zusammen waren, hatte Bor (mit vollem Namen Balthazar) nie einen Grund gesehen oder einen Anlass gefunden zu heiraten. Dabei hatte ich es öfter vorgeschlagen: am Anfang ausgelassen und atemlos, weil wir gerade erst wieder zusammen waren und ich fand, unsere neue Liebe schreie nach einem Ritual, dann in gekränktem, etwas entrüstetem Ton, und schließlich mit leicht verärgerter Resignation. Mit der Zeit wurde mein resigniertes Seufzen zur Gewohnheit, beinah hätte mich das Thema gelangweilt, und ich legte Bors Heiratsphobie als eine seiner vielen Marotten ad acta.
Jedes Mal, wenn es ums Heiraten ging, machte Bor sich darüber lustig, selbst nach zehn Jahren. Als wäre er immer noch sechzehn und meilenweit von den dämlichen, deprimierenden Lebenszielen der Erwachsenen entfernt – so sagte ich es einmal zu Martha, meiner Kollegin und gelegentlichen Psychotherapeutin.
Im Lauf der Jahre nahm Bor das Wort »Heiraten« kaum mehr in den Mund, und wenn, dann in so spöttischem und peinlich berührtem Ton, dass ich, die ich auf Hochzeiten von Freunden immer verdächtig emotional wurde, es nicht nur leid war, sondern zu einer Frage der Ehre erkor, es ebenfalls zu meiden.
Wenn ich das Thema doch einmal zur Sprache brachte, vor allem im Beisein anderer, dann mit ironischer Bitterkeit – es wäre »eben anscheinend nichts für uns«, außerdem wären wir längst »zu spät dran«. Bor überging meine Bitterkeit immer mit munterer Miene.
Für ihn war Heiraten etwas, was andere machten. Am Anfang dachte ich, er würde konventionelle Rituale prinzipiell ablehnen. Später, schon etwas verärgerter, warf ich ihm vor, er würde sich aus reiner Überheblichkeit weigern zu heiraten, weil dieser Brauch ihn daran erinnere, dass er genauso sterblich sei wie alle anderen. Oder besser gesagt: genauso ein Trottel wie alle anderen.
Doch nach und nach fand ich mich mit einer etwas milderen Variante der Wahrheit ab; ich erkannte, dass es Selbstschutz war, der Bor schon in seiner Kindheit dazu getrieben hatte, seinen Platz in der Welt in jeder Hinsicht mit Außenseitertum zu verbinden.
Er hatte gelernt, sich von Gefühlen zu distanzieren, die seine von den Launen der Geschichte geplagte Familie immer wieder in gewaltigem, herzzerreißendem Maß erschütterten, selbst wenn alles relativ glatt lief. Und als begabter, lernwilliger kleiner Junge hatte er sich seinen zwei Schwestern und dem brutalen älteren Bruder nie zugehörig gefühlt.
Bor saß seine Zeit dort gewissermaßen aus, seine ganze Jugend lang; kontinuierlich polsterte er Herz und Hirn, um nicht allzu sehr unter der Erschütterung, der Hysterie und Panik seiner Eltern zu leiden, die nie über die Verwüstung hinweggekommen waren, die die Nazis in ihrem Leben angerichtet hatten. Schon als Kind hatte er sich eine Art mentaler Öljacke zugelegt, die ihn vor Regen und Kälte, Hitze und Lärm schützte, sodass niemand ihn, seinen Schmerz oder seine Sehnsüchte sah. Und das war gut so, denn seine ganze Jugend über wünschte er sich nichts anderes, als sie alle zu verlassen, weit wegzugehen, so weit wie möglich, weg von seinen Schwestern, seinem Quälgeist von Bruder, seiner nicht sehr gebildeten, überbehütenden, rührseligen Mutter. Es kostete ihn so viel Kraft, dass es ihn innerlich zerriss, doch niemand ahnte etwas davon, vielleicht nicht einmal er selbst. Das war kein geringes Opfer; und um dieser dringend notwendigen Abschottung und seinem Weggang treu zu bleiben, hatte er das Schutzpolster unbewusst auf alles erweitert, was irdisch und alltäglich war und ihn mit anderen verband – so meine Analyse in den liebevollen Momenten.
In den weniger liebevollen stellte ich fest, dass er sein Außenseitertum manchmal zu einer Art Religion erhob, die er obendrein höher achtete als alles andere.
Zum Glück war ich da, um ihn mit der Menschheit zu versöhnen.
Schon in den ersten Wochen unserer neu erwachten Beziehung war uns klar, dass wir zusammenbleiben würden. Mit derselben Gewissheit, mit der man beim Zufallen einer Tresortür weiß: »Die ist zu«. So stand es in meinem Tagebuch, und so schilderte ich es Martha.
Martha fand diese Beschreibung besorgniserregend, aber das liegt meiner Meinung nach an ihrem Therapiestil: Sie problematisiert Dinge, die andere für normal halten. Ich dagegen neige eher dazu, die Finger von dem zu lassen, was bei meinen Klienten gut läuft. Das, was schlecht läuft, macht mir schon genug zu schaffen.
Trotz Bors scheinbarem Mangel an Selbstreflexion wusste er so gut wie ich, dass die Vergangenheit uns verband, dass unsere gegenseitige Gefangenschaft uns gelegen kam und wir mit derselben Einsamkeit vertraut waren.
Für mich war Bor vor allem jemand, dessen Schüchternheit und Misstrauen ich erkannte. Unsere Väter hatten beide die kulturell-ethnische Mordlust der Nazis überlebt und waren in eine nicht sehr gastfreundliche niederländische Gesellschaft zurückgekehrt. Bei Bors schillerndem Auftreten, der Selbstsicherheit, mit der er als bekannter, ja sogar berühmter Anwalt seine Mandanten verteidigte, kritische Meinungsartikel verfasste und alle Welt für sich einnahm, hätte es ihn sicher verblüfft, wenn man ihn auf sein Misstrauen oder seine Schüchternheit angesprochen hätte. Trotzdem gab es sie, immer. Ich sah sie. Es dauerte lange, bis Bor neuen Situationen und neuen Menschen vertraute, es kam nicht von ungefähr, dass wir uns gegenseitig fürs Leben gefangen nahmen. Aber hatte ein Fremder ihn erst für sich eingenommen, sagte er einmal, tue er sein Möglichstes, um dessen Herz zu gewinnen und ihn als Freund zu behalten – eine beruhigende Eigenschaft für jemanden wie mich.
Meine Beziehung mit Herman Meyer, meiner ersten großen Liebe, war einzigartig und alles versengend gewesen, schlichtweg lebensgefährlich. Deshalb überlegte ich mir ganz genau, ob ich mich noch einmal auf eine Beziehung mit Bor einlassen sollte. Auch Emotionen sind opportunistisch.
Nach Hermans Tod war Bor sofort zur Stelle gewesen, um nach mir und Philip zu schauen, und nachdem er uns ein Jahr lang scheinbar beiläufig umsorgt hatte, wurden seine Besuche wie von selbst zur täglichen Routine. Ich hatte mich in meiner Trauer zu Hause verkrochen, aber das schreckte ihn nicht, er organisierte so oft wie möglich einen Babysitter und führte mich aus. Weitere sechs Monate später zogen wir bei ihm ein. Darauf hatte er strategisch und zielsicher hingearbeitet, aber seine rührende Ausdauer wird mir erst heute so richtig bewusst.
Weil er eine solche Ruhe ausstrahlte, verliebte ich mich intellektuell wieder genauso in ihn wie zu der Zeit vor Herman, vielleicht sogar noch mehr. Wir kannten uns auf Anhieb, ohne uns miteinander identifizieren zu können oder zu wollen, und waren beide ein bisschen stolz auf das angenehm Logische unserer Verbindung, als wäre unsere Liebe nicht nur ein Mix aus Projektion, Trost und Lust, sondern auch eine schöpferische Leistung.
Durch Bor kam ich zu der Überzeugung, dass Liebe, neben der Sehnsucht nach der erregenden Nähe des anderen, auch das Verlangen nach Geborgenheit und Entspannung sein darf. Es gibt keine Sicherheit. Kann man denn je wissen, wie groß die eigene Liebe oder die des anderen ist? Liebe läuft im Wesentlichen auf Interpretation hinaus. Zeichen der Zuneigung können viele Formen annehmen, Zeichen fehlender Zuneigung auch. Nicht jeder ist in der Lage, das auseinanderzuhalten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Bei Bor und mir jedenfalls gaben alle Anzeichen während der langen Zeit vor unserer unerwarteten Trauung Grund zur Hoffnung.
Trotzdem war ein wenig materielle Sicherheit in meinen Augen kein übertriebener Luxus. Ich wohnte schon jahrelang ohne jeden formellen Status oder Rechte mit Philip bei Bor, bevor ich ihn schließlich mit viel Gezeter dazu brachte, diesen Aspekt unserer Beziehung zu regeln. Bis dahin staubte alles, was mir gehörte, in der Amsterdamer Mietwohnung ein, wo ich mit Herman gelebt hatte.
Bor fand mein Bedürfnis nach einer Formalie damals genauso merkwürdig wie meinen Wunsch zu heiraten, doch ich war mittlerweile derart zermürbt von den Unkenrufen und dringenden Empfehlungen meiner Familie und Freundinnen, dass ich wider meine Natur mit Maßnahmen drohte (oder vielmehr einer Maßnahme: ihn zu verlassen), wenn wir keinen Partnerschaftsvertrag schlossen.
Die Vereinbarung wurde von einem Notar beglaubigt, und damit war für Bor, der die Prozedur schmunzelnd über sich ergehen ließ, alles geregelt, was es zu regeln gab. Sein Schmunzeln war umso unverständlicher, als er selbst seinen Mandanten immer zu solchen Verträgen riet. Heiraten würden wir »irgendwann bestimmt auch noch«, fügte er mit einem Blick auf mich hinzu, die ich während der ganzen Verlesung kein Wort gesagt hatte.
Auch am nächsten Tag war ich stiller als sonst. Ich fand, eine Heirat hätte unsere Verantwortung füreinander viel eleganter und liebevoller garantiert. Aber jetzt war das Thema wohl für die nächsten Jahre abgehakt. Also schwieg ich, wohlweislich, wie es heißt, dabei hätte ich nach Herman wissen sollen, dass man sich besser nicht gedankenlos über vage Kränkungen und Ängste hinwegsetzt.
Als ich Bor eines Tages erzählte, ich sei schwanger – eine Erkenntnis, von der ich selbst wie vom Schlag getroffen war –, konnte ich zwar verstehen, dass er erschrak, war aber trotzdem empört. Von einer Schwangerschaft kann man sich doch nicht einfach so distanzieren. Konventionell, ja, etwas für gewöhnliche Sterbliche, natürlich … Ich hatte fast das Gefühl, mein offenkundiges Menschsein verstörte ihn, obwohl Philip doch schon eine ganze Weile der lebende Beweis dafür war.
Meine Euphorie war Bor wohl etwas unheimlich, als würde ich plötzlich einer anderen Spezies angehören, die sich bedenkenlos den widerwärtigen Machenschaften der Natur fügt. Sein eigenes Zutun ließ er der Einfachheit halber unter den Tisch fallen. Es war fast, wie ich im Gespräch mit Martha erschüttert feststellte, als hätte ich ihn und uns verraten.
Natürlich entpuppte er sich, wie alle weltfremden frischgebackenen Väter, nach der Geburt von Samuel (Sam) als manischer, hilfloser Bewunderer des menschlichen Kunstwerks, zu dem er zu seiner Fassungslosigkeit beigetragen hatte. Ein Glück, denn als junge Mutter war ich Bors Marotten gegenüber deutlich weniger mild gestimmt. Das nahm er sich zu Herzen, und als Pol sich ein Jahr später ankündigte, erklärte er dem Ungeborenen schon beim ersten Ultraschallbild seine Liebe.
Wir verbrachten eine Woche in New York, im Spätsommer, in einem Hotel beim Columbus Circle. Philip war fast fünfzehn, Sam inzwischen fünf, Pol vier. Bor hatte alles vorbereitet.
Na ja, alles trifft es nur, wenn man ein Anhänger des Minimalismus ist. Wie dekonstruiert man eine Trauung von A bis Z? Als Erstes mussten wir an besagtem Freitag eine Heiratserlaubnis bei der Stadtverwaltung einholen, vier Tage später sollten wir uns dann bei einem Rabbi zu Hause unter der Chuppa das Jawort geben und das Glas zertreten, im Beisein unserer Kinder.
»Piece of cake«, rief Bor strahlend, sein sonst so blasses feingeschnittenes Gesicht von der New Yorker Sonne braungebrannt und schweißglänzend, sein Haar zerzaust und im Nacken kräftig gelockt, die Augen fast schwarz, mit den langen Mädchenwimpern, die mir nur noch sporadisch auffielen.
Fuchsteufelswild war ich und ärgerlicherweise auch überglücklich. Gleichgültigkeit, Desinteresse – jetzt stellte sich heraus, wie viel Kraft sie mich gekostet hatten. Mein Vorrat an liebevollen Momenten war eindeutig erschöpft. War ich wütend, weil dieser Plan zu einem von Bors vielen Projekten verkommen war, mit denen ich aus Selbstschutz (und Gewohnheit) möglichst wenig zu tun haben wollte? Oder weil ich mir nach all den Jahren keine Illusionen über seine Spontaneität und seinen Sinn für Romantik mehr machte? Der Verdacht, eine Steuerersparnis stecke dahinter, hatte sich jedenfalls in mein Bewusstsein gefressen und nagte an meiner ansonsten dämlich-diffusen Freude.
»So ist es doch richtig schön«, jubelte Bor, der es wohl für das Beste hielt, meine gefährliche Stimmung zu ignorieren. »Wir fünf zusammen? Das wünschst du dir doch schon so lange?«
Aber nicht zwischen Tür und Angel, nicht so, nicht jetzt, dachte ich, außer mir vor Wut und Verzweiflung. Weil ich aber wusste, dass es mein großer Wunsch war, ich es also sowieso geschehen lassen würde, wollte ich uns die Laune nicht durch Schimpfen verderben.
Mit Sicherheit und Rückhalt war ich nicht gerade verwöhnt worden. Schon in der Beziehung mit Herman hatte ich mich wie eine alleinerziehende Mutter gefühlt, lange Zeit war mir nur die Verantwortung für Philip wichtig gewesen. Jetzt war er fast fünfzehn, aufbrausend und brillant, und noch immer dachte ich auf Schritt und Tritt an ihn und seine Zukunft, an das, was meiner Meinung nach in seinem Interesse lag.
»Die Zeit war einfach noch nicht reif. Aber jetzt schon. Und für die Kinder ist es doch auch toll. Stell dir vor, du bist als Kind bei der Hochzeit deiner Eltern in New York dabei!«
»Was für ein Blödsinn … Die Kinder wollen auf den Spielplatz und Eis essen. Aufs Empire State Building. Und Philip …«
»Nein, zu den großen Zwinkertürmen!«, rief Pol.
»Und was ist mit meiner armen Mutter«, jammerte ich noch ein bisschen.
»Die ist bestimmt total glücklich, wenn wir es ihr zu Hause erzählen.«
Die Kleinen waren sofort begeistert von der Idee.
»Bist du da ganz in Weiß?«, fragte Pol. »Oder wieder ein Hippie?«
»Ein Hippie?«, sagte ich beleidigt. »Und wieso ›wieder‹? Nein, ich habe keine Zeit, ein Kleid zu kaufen. Und Weiß trägt man nur, wenn man jung und unschuldig ist!«
Sam fragte, wie lange es dauern würde.
Philip reagierte zurückhaltend. »Super, Mama, aber ich wusste gar nicht, dass du das willst«, sagte er etwas zögerlich. »Warum solltest du heiraten?«
»Ach, das ist eine reine Formsache«, sagte ich heuchlerisch.
»Darf ich das Rüschenkleid anziehen?«, schrie Pol.
»Natürlich. Das musst du sogar!«
»Es dauert nicht lange!«, beruhigte Bor Sam. »In einer halben Stunde ist alles über die Bühne, dann gehen wir was Leckeres essen.«
Philip war inzwischen wieder in seinem Zimmer verschwunden.
»Na toll!«, sagte ich bitter.
Die Kränkung nagte an mir, zwischen Magen und Herz, wo mein Tränenspeicher liegt, und der fühlte sich gerade explosiv an. Im Film dauern Hochzeiten manchmal drei Tage, dachte ich, und bei mir ist in einer halben Stunde alles über die Bühne.
Und alle Kleidung, die wir dabeihatten, war schmutzig. Würde ich es noch schaffen, in den Waschsalon zu gehen? Ein weißes Kleid. Hätte ich das gewollt? Ich war mir nicht sicher. Ein weißes Kleid mit Schleier gar? War ich verrückt geworden? Eine wilde Hochzeit, mit vielen Gästen und Gefühlen, barfuß am Strand einer tropischen Insel, mit Blumen im Haar, während unsere Freunde für uns sangen? War es das, was ich wollte? Nein, auch nicht. Ich merkte, dass mir Gekränktheit vielleicht noch am ehesten entsprach, wie an meinem Geburtstag. Eine Art vorsorgliche, einsame Enttäuschung darüber, dass sicher niemand mein Geburtstags-Ich gebührend überraschen und beglücken würde.
»Dann will ich Pancakes«, kreischte Sam.
Die wollte Pol auch.
»Du darfst meine Brautjungfer sein, Polly-Maus. Und du mein Brautführer, Sam.«
»Nein danke.«
»Ich auch nicht«, sagte Pol sofort.
Von meinem Vater dem Bräutigam übergeben werden. (Dabei war ich schon sehr lange sehr weit weg von ihm … Außerdem lebte er nicht mehr.) Traditionen. Something old, something new, something borrowed, something blue, Brautjungfern, Blumen, Trauzeugen, zu wirbelnder Klezmermusik auf einem Stuhl in die Luft gehoben werden, weinen vor Glück. Der schönste Tag des Lebens.
»Warum weinst du, Mama?«
»Nichts, Süße, es ist nichts.«
»Zel?«
»Schon gut …«
»Meine Güte, Zel, was hast du denn?«
»Nichts! Geht einfach ohne mich heiraten.«
Vor dem Gesetz war ich nicht jüdisch genug, um jüdisch zu heiraten. Aber Bor (oder vielmehr seine Sekretärin) hatte einen fortschrittlichen Rabbi gesucht und gefunden, der bereit war, uns seinen Segen zu geben – im Tausch gegen eine nicht unerhebliche Geldsumme und zu einer unsäglichen Uhrzeit, morgens um zehn vor acht.
Wir verschliefen. Nein, ich verschlief, zwar nur eine Viertelstunde, aber wenn ich nicht wach war, lief alles anders als sonst, nämlich schief. Niemand konnte etwas finden, Bor zog Pol ihr Kleid mit geschlossenem Reißverschluss über den Kopf, es bekam einen kleinen Riss, den ich sofort (»Sofort, Mama!«) nähen musste, und fürs Frühstück blieb keine Zeit mehr. Die Kinder aßen Kekse und Müsliriegel aus meiner Handtasche, während wir viel zu lange durch New York irrten, denn zum ersten Mal in seinem Leben hatte Bor sich bei einer Adresse vertan, sodass das Taxi uns fünf Straßen zu früh absetzte. An jeder Ecke blieb Bor stehen und sagte munter: »Hier muss es jetzt aber wirklich sein.«
Ich trug meine hohen roten Pumps, und unsere zwanzigminütige verzweifelte Suche bescherte mir zwei riesige Blasen, die aufplatzten und scheußlich brannten. Die Kinder hatten immer noch Hunger und machten daraus kein Geheimnis. Beim Versuch, sie zu beschwichtigen, versetzte Bor sich schon einmal in eine Zukunft, in der wir über all das lachen würden, doch insgeheim verunsicherte es ihn, dass er sich derart vertan hatte, das ging ihm gegen den Strich.
Am Ende rief er den Rabbi an und ließ sich die richtige Adresse geben, von der wir inzwischen nicht mehr weit entfernt waren.
Jeder Schritt scheuerte ein bisschen mehr Haut von meinen offenen Blasen. Keuchend standen wir schließlich um zwanzig nach acht bei Zvi Fullermann vor der Tür, die zwei aufgebrachten, quengelnden Elfen Sam und Pol direkt hinter uns und Philip kühl dreinblickend und seufzend als Schlusslicht.
Mein fuchsiafarbenes Flatterkleid (Hippie) passte gut zu meinen blutigen Fersen. Sam trug sein (sehr schmutziges) Lieblings-T-Shirt, und an Pols Rüschenkleid baumelten noch lose Fäden. Bor hatte Schweißflecken auf seinem frischgebügelten kurzärmligen weißen Hemd. Auch ich war verschwitzt und wollte lieber nicht daran denken, wie mein hoffnungsvoll üppig aufgetragenes Make-up inzwischen aussah, doch ich traute mich nicht, bei einem so gläubigen Mann gleich als Erstes nach einem Spiegel zu suchen oder auf die Toilette zu gehen, um mich frisch zu machen. Philip, der ein sauberes Polohemd mit Krokodil-Aufnäher trug, das er hasste, sah als Einziger aus wie aus dem Ei gepellt. Wir haben uns ganz schön ins Zeug gelegt, um beim Rabbi dazwischengeschoben zu werden, dachte ich. Wobei, um diese Uhrzeit wurden wir vermutlich eher davorgeschoben.
Der Aufzug brachte uns in die dreißigste Etage, zum Penthouse. Der Rabbi war ein nervöser Mann von auffällig sportlichem, arischem Aussehen, sofern das blond und blauäugig ist. Er begrüßte uns freundlich und legte es vor allem darauf an, Tempo zu machen. Bor hatte recht gehabt, sofort wurde deutlich, dass die Trauung nicht viel länger als eine halbe Stunde dauern würde, vielleicht sogar weniger, da wir uns ja verspätet hatten. Ohne weitere Umschweife – er bot uns nicht einmal ein Glas Wasser an – erklärte er, was der Text in der Ketuba bedeute, dem Ehevertrag.
Danach fragte er nüchtern nach unseren hebräischen Namen. In der Ketuba stehe alles auf Hebräisch, und jeder Jude habe einen hebräischen Namen. Ich nicht, also musste ich mir spontan einen einfallen lassen.
Batseba? Das war der einzige jüdische Name, der mir in den Sinn kam, von David und Batseba. Er klang romantisch, hatte aber einen Haken. War sie nicht verheiratet gewesen, als David sie begehrte? Schnell suchte ich nach einem anderen Namen.
»Esther?«, murmelte der Rabbi und notierte ihn, dann wandte er sich an Bor. »Und Sie?«
Bor war bei der jüdischen Gemeinde als Moshe registriert, der Schreibprozess konnte also ohne weitere Verzögerung fortgesetzt werden, und danach begleitete die Frau des Rabbis, die weder Esther noch Moshe begrüßt hatte, uns eilig auf die großzügige Dachterrasse ein Stockwerk darüber.
Die Sonne brannte vom Himmel, und ich fühlte mich nackt und unvollkommen im Angesicht G’ttes – was vermutlich der Sinn der Sache war. Die Chuppa sei eine Replik des Himmels, hatte Bor mir erklärt, ein heiligender Ort. Da eine Dachterrasse rundherum von Himmel umgeben ist, braucht man eigentlich nicht viel Aufwand zu betreiben, trotzdem hatte der Rabbi einen selbstgebauten kleinen Baldachin aufgestellt, an dem eine sanfte Brise ein paar neckische weiße Stoffbahnen aufwehte.
Die ganze Stadt, dieses bizarre brummende Tier, lag uns übersichtlich und malerisch zu Füßen. In der Ferne hörte ich Flugzeuge. Ich konnte sogar die Jogger am Hudson entlangtraben sehen, und beim Anblick ihrer sorglosen Routine beneidete ich sie für einen Moment, so groß war mein Drang, mich zu bewegen, meilenweit von hier entfernt.
Sam und Pol rannten fröhlich johlend zum Rand der Dachterrasse.
»Philip, pass bitte ein bisschen auf sie auf«, flehte ich und bemerkte dabei etwas in den Augen meines ältesten Sohnes, das mir neu war. Einsamkeit? Distanz? Jetzt, da ich mich offiziell mit dem Mann verbinden würde, der nicht sein Vater war, spürte ich einen Stich von Kummer. Doch als er mich anlächelte, war es schon wieder vergessen. Lange war er der wichtigste Mensch in meinem Leben gewesen, und mir lag immer noch sehr viel an seinem Verständnis und der Nähe zu ihm.
Sam suchte die Dachterrasse nach einer Möglichkeit ab herumzuturnen. Gott sei Dank waren überall hohe Metallgeländer. »Vorsicht!«, schrie ich schrill, bevor ich dem Rabbi gestattete, uns einen weißen Schleier auf den Kopf zu legen, der mich zum Schweigen brachte. Als wollte er uns einfangen, dachte ich, wie einen zweiköpfigen Thunfisch.
Im Kontakt mit dem Allerhöchsten müsse unser Haupt bedeckt sein, erklärte er, dabei trug Bor schon seine Kippa. Fasziniert hörten Sam und Pol schlagartig auf zu lärmen, sie kicherten nur noch ein bisschen geniert. Philip sah teilnahmslos zu.
Ich schämte mich. Nicht für sie. Für mich, weil ich hier stand und mich nicht über die Zeremonie freuen konnte. Ich hätte so gern etwas Besonderes gespürt, aber meine vielen Nebengedanken schienen meine Rührung zu beschmutzen und auszuschalten. Außerdem war mein Glaube an den eigenen Glauben nicht stark genug, um mich hier wohlzufühlen.
Diese Probleme schien Bor nicht zu haben, stattdessen sah er mich mit einer Innigkeit an, die ich so nicht von ihm kannte. Er ist viel jüdischer als ich, dachte ich. Viel authentischer. So sah seine Liebe also aus. Warum sollte das nicht genügen – wenn es das war, was er zu bieten hatte? Was hatte ich ihm eigentlich zu bieten? Genügte das?
Mir fiel kaum auf, dass die Feierlichkeit, über deren Tempo der Rabbi zu seiner Erleichterung nun selbst bestimmte, schon begonnen hatte. Im Anschluss mussten wir den kurzen hebräischen Text bekräftigen, den Bor verstanden hatte, ich aber nicht.
»Omein«, murmelten wir, wie brave Kinder.
Nach dem Hochzeitskuss (die Kinder klatschten) wickelte der Rabbi mit ernster Miene schnell und geschickt ein kleines Glas in ein Papiertaschentuch, damit die Scherben, wenn wir es dem Brauch gemäß zertraten, sich nicht überall verteilten – sonst könnte der Rabbi ja womöglich seine Zeitung beim Morgenkaffee auf der Dachterrasse nicht mehr barfuß lesen. Zu meiner Enttäuschung war das Knirschen des berstenden Glases kaum zu hören. Das lag am Papiertaschentuch und an dem Verkehrslärm, der von unten heraufdrang, aber auch an einem derart gewaltigen Donner, dass er uns durch Mark und Bein ging. (»Da ist überall Rauch, Mama!«, rief Pol.) Wie aus der Ferne drangen die Worte über die Zerstörung des Tempels zu mir durch, die nicht vergessen werden durfte (und durch das unterdrückte Bersten des Glases symbolisiert wurde). Bor sah mich mit Tränen in den Augen an. Plötzlich musste ich lachen.
»Du Spinner«, sagte ich, »wieso liegt dir eigentlich so viel daran?«
Wir umarmten uns.
Pol rannte über die Dachterrasse. »Mama!«, rief sie. »Da steckt ein Flugzeug in den Zwinkertürmen!«
»In den Zwillingstürmen, Dummkopf«, maulte Sam.
Bor zog sie zu sich heran, doch sie riss sich los.
»Verrücktes Huhn.«
Einen Tag davor hatten wir auf der obersten Etage der Twin Towers gestanden und im Windows on the World, dem Restaurant dort, sündhaft teuren Kaffee getrunken. Das hatte großen Eindruck auf Pol gemacht.
»Sam! Komm zu mir! Wir sind verheiratet«, rief Bor. »Du hast jetzt verheiratete Eltern.«
Er war ganz ausgelassen. Ich umarmte Philip, der es stoisch über sich ergehen ließ. Als ich seinen lieben, ernsten, besorgten Blick sah, brach auch ich in Tränen aus.
»Alles ist gut, Süßer«, flüsterte ich. »Alles ist gut.«
Bor nahm mich in den Arm.
»Seid ihr jetzt verliebt?«, fragte Pol.
Ich lachte. »Wahnsinnig verliebt«, sagte ich ein bisschen spöttisch. »Nein, verheiratet!«
»Was soll das denn schon wieder?«, sagte Bor. »›Nein, verheiratet‹.«
»Pol hat recht«, sagte Philip mit seiner neuen tiefen Stimme und rannte zum Geländer.
»Papa?«
»Meine Güte, stinkt es hier nach Rauch.«
»Es ist wirklich ein Flugzeug!«
Bei uns war es Vormittag. Bei den anderen Menschen, die dasselbe sahen wie wir, war es Nachmittag, Abend, Nacht. Wir begriffen es nicht, obwohl es sich direkt vor unseren Augen abspielte, und dass die ganze Welt Zeuge dieses Ereignisses war, drang erst viel später zu uns durch. Pol hatte wirklich recht. Ein riesiges Flugzeug hatte sich ins höchste Gebäude der Stadt gebohrt, es war absurd, beinah obszön, und die Rauchwolken, die von dort aufstiegen, wo wir noch gestern die oberste Etage erkundet und uns vor der unfassbaren Höhe gegruselt hatten, sahen unheilvoll aus.
Im ersten Moment überraschte es mich nicht, dass ein Flugzeug aus Versehen ins höchste Gebäude der Stadt geflogen sein sollte. Schon am Vortag war es mir viel zu hoch vorgekommen – das konnte doch gar nicht gutgehen, bei den vielen Flugzeugen, die wir zwischen den Wolken treiben sahen wie riesige Fische. Das Feuer, das in rasendem Tempo auf die gesamte Breite des Gebäudes übergriff, die Risse, der ungeheure Zusammenprall – ich begriff es einfach nicht, so fassungslos war ich. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das Flugzeug unsere Trauung kaputtgemacht hatte und nicht einfach Teil des Komplettpakets war, eine fiese verschlüsselte Klausel, über die niemand uns vorab informiert hatte.
Philips Blick ist ernst, vor allem aber hoch konzentriert. Er ist fasziniert und aufgeregt, nicht panisch, genauso wenig wie Sam.
»Wie kann das sein, Papa?«, fragt er immerzu, ohne sich vom Wolkenkratzer abzuwenden.
»Ich weiß es nicht, Sam, ein Unfall, schätze ich, aber bestimmt ist das Feuer bald gelöscht.«
»Glaub ich nicht«, sagt Philip.
Der Blick, den Bor mir zuwirft, lässt mich erstarren.
Ruhig und brüderlich stehen Sam und Philip nebeneinander, während ich mich bemühe, gegen Pols zunehmende Panik anzukämpfen. Nur: Woher kommt die, wenn nicht ich, ihre Mutter, sie damit angesteckt habe? Ich zittere, schreie vielleicht sogar. Und wenn das so ist, warum verberge ich meine Angst dann nicht besser, warum reiße ich mich nicht zusammen, um mein Kind zu beschützen?
Pol klebt an mir wie Metall an einem Magneten. Während sie sich an mich klammert, wende ich mich ab, vom Chaos, von der makabren Szene, dem Qualm. Pol sieht immer andere Dinge als ich, sie zeichnet immer andere Dinge als die anderen Kinder. Niemals kleine Dinge, Pol macht alles groß. Sie zeichnet sogar sich selbst groß. Sie zeichnet mein Zimmer mit allen Details, auch denen, die ich noch nie bemerkt habe. Sie sieht jede Schnecke im Garten, jede Raupe, und rettet mit Hingabe jedes noch so kleine Tier, selbst Grillen. Doch jetzt sehe ich dasselbe wie sie, und ich will nicht, dass sie das sieht. Ich will es selbst nicht sehen. Sie klammert sich so fest an mich, dass wir zu einem Körper verschmelzen, und es ist, als käme das Kreischen von ihr, aber da bin ich mir nicht sicher. Mit vier Jahren haben die Dinge nicht dieselbe Bedeutung wie später. Wie soll man in diesem Alter verstehen, was man sieht? Ich kann nichts daran ändern: dass sie sieht, was ich sehe, durch meine Augen, mit meinem Körper. Ich sollte sie eigentlich von mir lösen, um ihr das zu ersparen, stattdessen drücke ich sie noch fester an mich. Ich fürchte, die Panik, die ich ausstrahle, hebt den Trost und Schutz auf, den ich ihr biete. Sie weint.
Geistererscheinungen sind sie, diese Gestalten, die nur so kurz zu sehen sind, dass sie eigentlich gar nicht real sein können. Oder ist das ein Traum? Vorbeiflitzende kleine Figuren, Puppen. Die Vergeblichkeit all dessen, was Menschen sind und tun. Anzüge, Röcke und Kleider, verzweifelt aufflatternde Krawatten, fallende Schuhe und von den Gesichtern gleitende Brillen. So schnell segeln sie vorbei, dass es nicht echt sein kann, das können keine Menschen sein. Ich will die Zeit anhalten, um sie in die Welt von vorher zurückzuschicken. Sie fallen vom Himmel. Für einen kurzen Moment ist es sensationell, aufregend – wenn bloß Pol nicht so untröstlich weinen würde, oder bin ich das?
»Hör auf, Mama, hör auf damit!«, sagt Philip. »Mama, bitte!«
Erst durch mein Heulen wird es zu dem grässlichen, unleugbaren Horror, über den man später lesen wird. Und dann diese Täuschung. Du glaubst, es besser zu wissen – wo so freimütig gesprungen wird, müssen Fangnetze sein, in der Welt, wie du sie kennst, gibt es Fangnetze, Hilfstruppen, Beruhigung, Lösungen für verängstigte Menschen. Die Welt, wie du sie kennst, steht im Unglücksfall sofort parat, genauso wie die Welt, wie du sie kennst, immer gesagt hat: »Nie wieder Auschwitz!« Bis zum Erbrechen hat sie das gesagt. Du lenkst den Blick nach unten.
Da sind keine Fangnetze.
Und während dir das bewusst wird (woher kommt es eigentlich, dieses Gefühl der Verlangsamung in solchen Momenten, es kann doch nicht länger gedauert haben als ein paar Millisekunden?), versucht jetzt auch Sam, die Arme um dich zu legen, um euch beide, Pol und dich, als wärst du bärenstark und dein Körper lebensrettend. Oder will er dich beschützen? Auch ihm wird bewusst, was er da sieht, nachdem er kurz auf das Chaos aus Metallstücken und Papierfetzen (und anderen, größeren und vageren dunklen Formen) dort unten gestarrt hat.
Du bekommst so wenig Luft, dass du glaubst, jeden Moment ohnmächtig zu werden.
»Um Himmels willen«, sagt Bor.
Und zu allem anderen, was ich spüre, kommt das noch hinzu: furchtbares Mitleid mit Bor. Bor, der seine Ängste beiseitegeschoben hat und heiraten wollte, Bor, der mich immer beruhigt und lachend sagt: »Steiger dich da nicht so rein, Zel«. Bor sieht fahl aus.
»Ganz ruhig bleiben, Kinder«, sagt er dann, wie zu sich selbst, fast belustigt, irgendwie autistisch, während der Luftraum sich mit Geräuschen füllt, die wir nicht deuten können.
»Bor?«, sage ich.
Aber meine Stimme trägt nicht, ich kann mich selbst nicht hören. Aus der Stadt dringt immer noch Verkehrslärm herauf, Sirenen, genau wie sonst. Trotzdem scheint alles innezuhalten, wie ist das möglich? Auch der Rabbi hat vergessen, dass er es eilig hatte. Ernst, schweigend und verständnislos starrt er auf das, was sich vor unseren Augen abspielt. In welcher Entfernung? Dutzende Stockwerke weiter oben jedenfalls. Ein grässliches Feuer, rasend schnell erfasst es den ganzen Nordturm und tropft hinunter wie Blut aus einem Beutetier in den Fängen eines Hundes. Aus dem Turm leckt das schrecklichste, heißeste Feuer, dieser Hund ist der bösartigste aller Hunde, es hört nicht auf, im Gegenteil, das Feuer wird immer schlimmer und größer, die Risse, aus denen es leckt, werden breiter, und der Geruch wird intensiver. Wir sehen Menschen auf der Straße stehen, sie starren nach oben, wie wir, alle starren, alle warten. Nur worauf? Faszination der Zerstörung – die keine Hoffnung spendet, uns aber trotzdem aufsaugt, fesselt –, obwohl dieses Feuer bald schon zu einem morbiden Fakt wird, zu einer Konstante, so wie ein Feuer von Weitem manchmal etwas beinah Freundliches, Lebendiges hat, eine unvermeidliche Präsenz, mit einem Charakter und einer Identität … Sie haben etwas Resigniertes, diese gewaltigen züngelnden Flammen, als bliebe ihnen nichts anderes übrig, als aus der furchtbaren Wunde da oben zu lodern. Wir halten es nicht länger aus, gehen nach unten, in die Wohnung.
Die Frau des Rabbis fuchtelt panisch mit ihrem Telefon herum. »Ich komme nicht durch«, ruft sie ins Leere. Sie merkt gar nicht, dass auch wir im Zimmer stehen. Ich spüre, dass wir hier wegmüssen, wir gehören nicht hierher. Die Unsicherheit unserer Lage trifft mich mit derselben Heftigkeit wie der Brandgeruch, der sich überall ausbreitet, auch drinnen.
»Es ist ein Passagierflugzeug, Zvi«, sagt die Frau keuchend. »Das World Trade Center … Das World Trade Center, es brennt wie Zunder! Dieses ganze Kerosin. Und die vielen Menschen!«
»Wir müssen die Ruhe bewahren«, sagt der Rabbi. »Vielleicht werden wir evakuiert, vielleicht auch nicht. Wir müssen überlegen, was zu tun ist. Es muss ein fürchterlicher Unfall sein.«
Inzwischen sind überall Sirenen zu hören, eine Kakofonie von Sirenen. Wieso gibt sich dieser Mann so merkwürdig ruhig? Von seiner Eile ist nichts mehr übrig. Er ist ein Mensch unter den Menschen geworden, die Statur eines Rabbis passt nicht länger zu ihm. Nichts scheint noch zu ihm zu passen. Er wirkt viel weniger sportlich und arisch. Jetzt erst sehe ich, dass er mager ist und seine Haut wächsern.
»Die Menschen!«, ruft seine Frau. »Zvi! Die Menschen sitzen fest! Und Rachel und Darren arbeiten im obersten Stockwerk!«
»Pst«, macht der Rabbi. »Denk an die Kinder.«
»Das ist kein Unfall«, sage ich.
Philips Blick.
Ab dem Moment, in dem wir uns umgedreht hatten, Bor und ich, gehörte unsere Hochzeit einer Welt an, zu der wir nie mehr Zugang haben würden, doch das wussten wir damals noch nicht. Ich wusste nur, dass die Stadtgeräusche sich verändert hatten – es brummte weiter, wie es für Manhattan typisch ist, und doch war etwas anders geworden. Hier und da waren Schreie zu hören und lauter Lärm und überall heulende Sirenen. Doch die Geräusche waren noch nicht durchdringend genug, um uns völlig zu verunsichern. Der Rauch wehte nicht in unsere Richtung, war aber trotzdem beißend – wir glaubten, die Hitze zu spüren, die von dort kam.
»Können wir hin?«, fragt Sam, und genau in dem Moment, als ich ihn anfauchen will: »Bist du total verrückt geworden?«, und mich frage, wie dieser schaurige Katastrophentourismus wohl entwicklungsgeschichtlich einzuordnen ist – habe ich ihn unserem Kind etwa versehentlich selbst mitgegeben? –, spüren wir ein so starkes Beben, dass es uns durch und durch geht, und hören erneut einen ungeheuren Donnerschlag, der alles andere übertönt. Wie im Krieg, denke ich unwillkürlich. Ein Gedanke, der mir auf eine seltsame, kraftlose Weise vertraut ist. Als hätte ein Krieg in meinem Herzen auf der Lauer gelegen und auf seine Chance gewartet.
Zuerst sehen wir nicht, woher diese neue Explosion kommt und was sie bewirkt hat, bis Sam auf den Südturm zeigt: Eine Flugzeugnase hat sich in den Wolkenkratzer gebohrt.
»Holy shit«, sagt Philip. Er wirft mir einen scheuen Blick zu, in dem ich mich selbst, vor langer Zeit, erkenne. Ich spüre, dass ihn unsere Verletzlichkeit abstößt, schäme mich. Wir alle starren ungläubig schaudernd auf die Flammen, die aus dem zweiten Turm des World Trade Center züngeln, diesem Sinnbild unseres Wohlstands.
Die Erkenntnis, dass hier von Zufall keine Rede sein kann, entzieht unseren Knochen die Wärme und unseren Adern das Blut; nein, das ist kein tragischer, unvorhersehbarer Unfall. Es ist ein Angriff, und die Wucht des Angriffs ist größer, grausamer und erbarmungsloser als alles, was wir je erlebt haben. Es ist die schaurige Einsicht, dass unsere Feinde sich verbündet haben, um zu zerstören, was uns lieb und teuer ist, um Menschen zu töten. Sie überbringen uns eine Botschaft: In dieser Welt der Gewalt spielt es keine Rolle, was du tust oder wer du bist, du stehst nur zur Verfügung, als anonymes Menschenmaterial, das man töten kann, mir nichts, dir nichts, ein Gestus höchster Macht.
Das ändert alles, nichts ist mehr sicher.
Wie glücklich wir doch waren. Jetzt ist alles möglich geworden, was bisher undenkbar war. Erneut wird mir bewusst, dass ich nur einen einzigen Bezugspunkt habe, um dieses Gefühl der Unsicherheit in Worte zu fassen.
Danach sehen wir uns alles im Fernsehen an. Ein weiteres Flugzeug schlägt in ein Gebäude. Ins Pentagon. Der Himmel ist grau vom Rauch. Wir sind höchstens zwei Blocks vom brennenden ersten Turm entfernt.
Ich habe Sehnsucht, aber nach wem oder was? Meine Lieben sind doch fast alle bei mir. Mir ist, als hätte ich einen Teil meiner selbst verloren.
Ich versuche, meine Mutter zu erreichen. Es würde mich entspannen, wenn ich sie beruhigen könnte. Sie nimmt nicht ab. Vielleicht weiß sie es noch nicht.
»Ob es klug ist hierzubleiben?«, flüstere ich Bor ins Ohr.
»Was bleibt uns anderes übrig?«, flüstert er zurück. »Rausgehen, mit den Kindern? Da ist die Hölle los, das ist lebensgefährlich, alles Mögliche fällt aus der Luft. Hast du gesehen, wie es da unten aussieht?«
Unruhig kommt Sam zu uns.
»Was habt ihr gesagt, Mama?«
Der Rabbi sitzt mit uns vorm Fernseher, wir sehen CNN, die wissen auch nicht mehr. Unterdessen brennen diese irrsinnigen Symbole von Kühnheit und Vorstellungskraft weiter, die wir gestern noch besucht haben, still, energisch und doch extrem leblos.
Da ist sie, die Katastrophe, auf die ich schon mein ganzes Leben gewartet habe, wie konnte ich mir nur einbilden, wir würden drum herumkommen? Es ist so weit. Wir sind in Gefahr.
»Wir müssen hier weg, sofort«, zische ich Bor zu. »Wir sind viel zu weit oben, hier sind wir nicht sicher! Komm!«
Bor wendet sich an den Rabbi.
»Sollten wir das Gebäude nicht besser verlassen?«
Der Rabbi schüttelt entschieden den Kopf. »Wenn es besser wäre zu gehen, würde man uns das sagen.«
Ich hasse dieses naive Vertrauen auf Hilfe von außen. Man?
»Wir sind hier nicht sicher. Das ist Krieg. Wir müssen weg.«
»Krieg, ist jetzt Krieg, Mama?«, fragt Sam mit offenem Mund. »Papa, ist jetzt Krieg?«
Selbst Philip sieht Bor angespannt an.
»Ich habe solchen Hunger«, jammert Pol.
»Es ist Krieg, du Nerd!«, faucht Sam sie an.
Pol fängt an zu weinen. Philip will sie auf den Arm nehmen, aber sie windet sich los.
»Krieg? Wie kommst du denn auf die Idee!«, sagt Bor, will mir mit wilden Gesten etwas zu verstehen geben, verdreht die Augen. »Natürlich ist kein Krieg. Das ist einfach nur ein großes Feuer, und wir müssen jetzt entscheiden, ob wir ins Hotel zurückgehen oder noch eine Weile hierbleiben.«
»Du tust so, als ob ich vier bin«, mault Sam. »Ich bin fünf! Warum löschen sie es nicht? Es stinkt.«
»Schau raus, Sam. Hörst du die Feuerwehrautos?«
Ich stehe auf und nehme die Kleinen bei der Hand. Gehe wortlos zur Tür und bedeute Bor ungeduldig mitzukommen.
Er sieht mich wütend an, aber das ist mir egal.
»Kommt, ihr Süßen, wir gehen. Kommst du, Polly-Maus?«
Pol sagt keinen Ton, Sam auch nicht, sie rühren sich nicht, bis ihr Vater etwas gesagt hat.
»Wir gehen mit den Kindern jetzt nicht auf die Straße, Zel.« Bors Wut und Panik sind unüberhörbar. Ich lasse die Kleinen los. Wer hätte gedacht, dass unsere Ehe so schnell auf die Probe gestellt wird?
Der Rabbi hat sich in der Stunde, die wir ihn kennen, nicht anmerken lassen, dass er Niederländisch kann, jetzt aber drückt er Bor ohne Umschweife den Ehevertrag in die Hand. Er flüstert ihm etwas zu, was ich nicht höre.
»Ich habe solchen Hunger«, jammert Pol erneut.
»Was hat er gesagt?«, frage ich Bor. Er schüttelt nur den Kopf.
»Meine Tochter hat Hunger. Haben Sie vielleicht eine Kleinigkeit zu essen für sie?«, frage ich. »Was hat er gesagt, Bor?«
Der Rabbi sieht mich zum ersten Mal wirklich an.
»Natürlich, für Ihre Söhne auch?«
Seine Frau verschwindet in der Küche und kommt mit drei einzeln in Plastik verpackten Scheiben Trockenkuchen zurück – wie man sie in einer Tankstelle zum Kaffee bekommt, denke ich wütend.
»Was ist, Papa? Was hat der Rabbi gesagt?«, fragt Sam.
»Hier, iss ein Stück Kuchen, Sam«, sage ich und suche Bors Blick. Er weicht mir aus. Pol krümelt auf den weißen Teppich, aber das ist mir egal.
»Wir gehen hier noch nicht weg, Zel«, sagt Bor. »Um keinen Preis der Welt gehe ich jetzt mit den Kindern da raus.« Tonlos fügt er hinzu: »Jetzt, wo auch das Pentagon angegriffen wurde …«
»Ich will weg, Papa«, jammert Sam.
Bor hört ihn nicht, er ist ins andere Zimmer gegangen, wo der Fernseher steht. Ich schaue Sam an, schüttle heftig den Kopf und stelle mich zu ihm ans Fenster.
Meine Knie zittern, als wir zusehen, wie das Feuer in den Rissen auflodert, die die Flugzeuge in Stein und Stahl gefressen haben; der Lärm klingt immer bedrohlicher. Krankenwagen kommen an und fahren wieder ab, bleiben unterwegs stecken oder manövrieren sich mühsam durch das Chaos aus kleineren und größeren Trümmern, zwischen den verschütteten Autos hindurch, von denen einige vergeblich versuchen, dem unkenntlichen Zeug zu entkommen, mit dem alles übersät ist.
Etwas Unausweichliches und Furchterregendes geschieht hier. Amerikas Macht wird angegriffen, die Macht des Landes, in das mein Vater so großes Vertrauen hatte, in das wir alle so großes Vertrauen hatten, und Amerika, verwöhnt und arglos, wie es ist, wirkt hilflos.
Ich muss so intensiv an meinen Vater denken, dass ich seine Stimme höre, als wäre er bei uns, hier oben in dem belagerten Wolkenkratzer, und würde meiner Schwester und mir zum x-ten Mal den Mythos von Masada erzählen, dem Berg in Israel, wo neunhundertsechzig Juden (Zeloten) sich freiwillig von einem tapferen Rabbi erdolchen ließen, der sich ebenfalls tötete, als Letzter, um nicht unter die Vorherrschaft der Römer zu fallen. Eine heldenhafte und tragische Geschichte über Unbeugsamkeit, voller Symbolik.
Später erfuhr ich zu meiner Enttäuschung, dass es eine apokryphe Geschichte ist, gefärbt durch die Darstellung von Flavius Josephus, doch als Kind war uns der Wahrheitsgehalt egal. Wir fanden es vor allem beängstigend, dass mein Vater so leidenschaftlich von Dolchen und Freitod erzählte, und jedes Mal, wenn er wieder davon anfing, hielten wir uns die Ohren zu und schrien, er solle aufhören.
Zur Wiedergutmachung erzählte er dann in beschwörendem Ton die talmudische Legende der sechsunddreißig Gerechten, der lamed-waw zadikim. Das Schicksal der Welt, sagte mein Vater, liege in den Händen dieser sechsunddreißig besonderen Menschen, die sich äußerlich nicht von den anderen unterschieden, über die jedoch »all unsere Nöte« ausgegossen wären; sie seien untröstlich über das Leiden der Menschheit und sich dabei ihres Ausnahmestatus nicht einmal bewusst. Und wenn in einer Generation auch nur einer der sechsunddreißig Gerechten fehle – hier senkte mein Vater meistens die Stimme –, würde das Leiden »selbst die letzte Kinderseele vergiften und die Menschheit in einem Schrei ersticken«. Ich hatte den Verdacht, mein Vater hoffte, einer dieser sechsunddreißig zu sein.
Als ich Bor gerade kennengelernt hatte, erzählte ich ihm davon. Ich schenkte ihm sogar André Schwarz-Barts unendlich trauriges Buch Der Letzte der Gerechten, obwohl ich selbst nie über das erste Kapitel hinausgekommen war.
Nicht daran denken. Gott gebe, dass am heutigen Tag genügend Gerechte zur Stelle sind, wer sie auch sein mögen. Wir wissen nicht, ob sich anderswo auf der Welt noch weitere Flugzeuge in Gebäude bohren.
Bis jetzt bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es sich richten lässt, merke ich, dass die Feuerwehr es in den Griff bekommt, dass die meisten Menschen gerettet werden. Zugegebenermaßen fühle auch ich mich hier in diesem Wolkenkratzer, bei unserem Hochzeitsrabbi, sicherer als draußen, aber ich habe Angst, dass es eine trügerische Sicherheit ist.
Pol muss pinkeln und traut sich nicht. Bor geht mit ihr aufs Klo.
Philip, Sam und ich nehmen uns bei der Hand, als wir sehen, wie der Südturm von einem Moment zum nächsten in sich zusammenbricht. Es geht so schnell, dass ich aufschreie, so groß ist der Schock, so heftig die Implosion. Das Haus bebt.
Sam drückt sich die Nase am Fenster platt. Bor kommt zurückgerannt.
»Mein Gott, was war das?«, schreit er. Wir sehen nichts mehr. Gewaltige Staubwolken steigen auf. Alles ist grau, alles ist verdunkelt, an der Stelle, wo der Turm stand, erhebt sich eine Nebelwand, als würde der Geist des Gebäudes sich weigern aufzugeben. Der Turm ist verschwunden. Es ist herzzerreißend. Tiefe Trauer überfällt mich.
Sam ist gegen seinen Willen ganz aus dem Häuschen. »Wow, Mama, hast du das gesehen?« Er wiederholt es fünfmal. Pol weint und klammert sich an mich.
»Das kann nicht sein«, sagt der Rabbi, zerbrechlicher denn je, und vergräbt das Gesicht in den Händen. Er tut mir leid, und gleichzeitig ärgere ich mich über ihn. Die hilflose Ungläubigkeit des Rabbis und seiner Frau zeigt, dass sie nie begriffen haben, wie hart die Welt ist.
Auch ich hätte es besser wissen müssen, aber ich habe mich einlullen lassen. Die Welt hat die Wahrheit, vor der ich mich immer gefürchtet habe, in eine neue Form gegossen. Mir laufen Tränen übers Gesicht. Sam nimmt meine Hand. Bor die andere. Die Erde bebt, oder sind wir das? Selbst durch die geschlossenen Fenster riechen wir den Rauch und atmen den Staub ein. Philip hustet. Nüchtern und pragmatisch fragt Sam, ob auch unser Haus einstürzen kann. Verzweifelt schaue ich zu Bor.
»Ach, Zel«, sagt er, »ach, Liebste.« Unsere Blicke verhaken sich ineinander. Seine streichelnde Hand ist tröstlich und zwingend zugleich. Weil ich mich vor den Kindern zusammenreißen muss, schweige ich.
Zehn Minuten später werden wir durch die Feuermelder, die Megafone der Feuerwehr und im Fernsehen aufgefordert, das Haus zu verlassen.
Feuerwehrleute kommen die Treppe hochgestürmt. Ihre lauten Stimmen und das Schrillen einer Sirene machen Sam und Pol Angst, weinend klammern sich beide an mir fest. Philip steht steif und kerzengerade da, in Alarmbereitschaft, mit großen Augen. Unsere Blicke treffen sich.
Zuerst wollen Bor und der Rabbi nicht akzeptieren, dass wir wegmüssen. Auf meine dringende Bitte hin verabschiedet sich Bor dann von unseren Gastgebern, die etwas Zeit brauchen, um ihre Sachen zu packen. Die Frau des Rabbis gibt uns, wiederum auf meine Bitte hin, tropfnasse Geschirrtücher und Kissenbezüge, die wir uns vors Gesicht binden. Später werde ich mir selbst dankbar sein für diese Eingebung.
Sie gibt mir auch Blasenpflaster und ein Paar alte Turnschuhe, die mir etwas zu groß sind. Wir bedanken uns bei ihnen wie Flüchtlinge, die nicht wissen, ob man sich je wiedersehen wird. Vielleicht dürfen sie bald nicht mehr in ihre Wohnung – oder sie können es nicht, weil das Haus gar nicht mehr steht. Mittlerweile ist es zwanzig nach zehn.
Und dann, als wir fast unten angekommen sind, bricht der Nordturm mit einem solchen Donnern zusammen, dass unser Gebäude erneut von einem heftigen, tiefen Beben erschüttert wird. Der Einsturz des zweiten Turms jagt eine ungeheure Menge Steine und Schutt durchs südliche Manhattan. Pompeji, denke ich, so war es in Pompeji. Das muss ich laut gedacht haben, denn Philip lacht ein freudloses Lachen. Ein Feuerwehrmann begleitet uns zu einem Seitenausgang, erklärt uns hektisch, in welche Richtung wir müssen, und dann treten wir ins Freie, auf die Straße, die nicht wiederzuerkennen ist, und bahnen uns einen Weg durch die ungeheure Staubmenge, die noch viel schlimmer ist, als von oben zu erahnen war. Eine Wand aus schwebenden Staubteilchen, mit denen die Luft gesättigt ist und die allen Sauerstoff verdrängen. Trotz der nassen Tücher dringen sie uns in Augen und Nase, als wollten sie uns annektieren, uns begraben und für immer unsichtbar machen.
Dann beginnt die große Flucht, die mich noch Jahre später in meinen Träumen verfolgen wird, mitten durch die Sturzflut aus Stein und Stahl, die sich durch die Straßen presst und alles verdunkelt. Wir entdecken eine Kraft und einen Überlebenswillen in uns, von denen wir zuvor nichts gewusst haben. Philip nimmt Pol auf den Rücken und Bor Sam, meine Beine bluten, aber ich spüre es nicht, mein Hippiekleid reißt, aber ich merke es nicht, überall Staub, überall Blockaden in bizarren Formen, und ich fürchte, Bor könnte stürzen oder einen Herzinfarkt bekommen, Philip könnte Pol fallen lassen, die Kinder könnten sterben. Um mich fürchte ich nicht, ich bin eine Läuferin und außerdem wütend, manchmal rennen wir, aber die meiste Zeit stolpern wir nur voran, nach Norden, obwohl ich keine Ahnung habe, wo Norden ist, doch Bor zeigt in eine Richtung und ich vertraue ihm, ich vertraue Bors Instinkt, trotz des Fiaskos von heute Morgen, das Jahre her zu sein scheint. Sind wir auf dem West Broadway? Auf der Sixth Avenue? Geradeaus, bedeutet er mir, und ich gehe geradeaus. Ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, ich will ihm vertrauen, ich muss ihm vertrauen. Weg hier, nur weg hier. Bisher konnte Bor sich immer orientieren, egal, wo wir waren, aber jetzt ist alles anders, es gibt keine Sonne, die uns die Richtung weisen könnte, keinen Himmel, nur Staub.
Da und dort liegen oder sitzen Menschen auf der Straße, unter Schutt begraben, blutend. Weinende Menschen, schreiende Menschen. Still vor sich hin starrende Menschen. Reglose Menschen, ich traue mich nicht, genauer hinzusehen. Allem Möglichen müssen wir ausweichen, Papier, Taschen, Tischen, Glas und Stein und Stahl. Einem einzelnen Schuh. Auf gut Glück gehen wir weiter geradeaus, saugen mühsam etwas Sauerstoff aus dem undurchdringlich dichten Nebel. Mal gehen die Kinder selbst, mal hängen sie totenstill an unseren Händen oder auf unseren Armen, anscheinend im Schock. Philip ist so tapfer, sein Gesicht wie aus Granit, seine Züge starr. Es liegt nicht nur am Staub, dass ich Probleme habe zu atmen, es liegt auch daran, dass meine Wut immer mehr von Angst verdrängt wird; meine sonst so kräftigen Beine werden mit jedem Schritt schwerer. Unsere Kinder sind der verletzlichste Teil von uns, sie müssen wir beschützen, sie allein sind wichtig, unsere Kleinen, sie müssen gerettet werden, sie müssen leben, alles andere ist nebensächlich. Wir kämpfen uns weiter voran, vorbei an Häuserblocks, die wir nicht erkennen, mit verstopfter Nase, schmerzender, rauer Lunge. Jeder Schritt ist ein Sieg und birgt zugleich eine Gefahr, weil eine kaputte Welt vor uns liegt und wir unsere Route ständig anpassen müssen, um uns keine üble Verletzung zuzuziehen. Es ist, als würden wir in einem Labyrinth feststecken, für immer, ich erinnere mich vor allem an meine ungeheure Klaustrophobie, aber irgendwann werden wir nicht mehr vom Schutt verfolgt, versperrt er uns nicht mehr den Weg, und wir erlauben uns, langsamer zu gehen, drei, vier Blocks noch. Dort steht ein Polizist, zwei Wasserflaschen in den Händen, und fragt, ob alles in Ordnung sei. Wasser! Wasser!
»Wo sind wir?«, frage ich.
»Immer weiter geradeaus, da wird es heller.«
»Meine Augen tun so weh. Ich kann nichts sehen!«, schreit Pol, und jetzt, wo die größte Anspannung vorbei ist, fängt Sam an zu weinen, während Pol ständig wiederholt, sie könne nichts sehen. Philip stolpert vor Anstrengung, ich sehe, dass er nicht mehr kann, und nehme ihm Pol ab, auch er fängt an zu weinen, und ich sage ihm, er solle damit aufhören, um seine Augen zu schonen, befehle beiden, die Augen zu schließen, und tupfe ihre geschwollenen Lider mit meinem Tuch ab. Grauweiß sind sie, sie sehen aus wie Statuen, auch Bor. Mir wird klar, dass auch ich so aussehen muss. Wir sind nicht wiederzuerkennen. Blut färbt meine Beine, rote Rinnsale, beginnend bei den Schenkeln, heben sich gegen das Staubgrau ab. Bor hat Blut am Ohr.
»Wo sind wir?«, wiederhole ich.
»An der Kreuzung von West Broadway und Worth«, sagt der Polizist. »Sie sind in Sicherheit. Ihre ganze Familie. Aber Sie brauchen einen Arzt.«
Philip kippt Pol Wasser in den Mund, sie spuckt es aus, weint.
»Gehen Sie bitte weiter«, drängt uns der Polizist, der doch so beruhigend sein möchte, »immer Richtung Norden halten.«
»Pol«, sagt Bor, »wir gehen Richtung Sonne, okay, Pol? Und wenn wir in Sicherheit sind, kannst du alles haben, was du willst. Aber jetzt musst du noch kurz tapfer sein, wie die Kinder im Märchen.«
Mit brennenden Augen suche ich unter den Menschen unwillkürlich nach dem Rabbi und seiner Frau. Wo sie wohl sind, inmitten all dieser grauen Gestalten?
Nachdem wir uns die Augen, so gut es geht, ausgespült haben, ziehen wir wieder los, weiter nach Norden, weiter weg von der Zerstörung. Wir sehen uns nach Autos um, nach einem Taxi, doch hier fährt nichts. Pol hängt uns mal schwer am Hals, dann wieder auf dem Rücken. Sie hat aufgehört zu weinen, Sam geht inzwischen immer wieder ein paar Meter auf eigenen Beinen, und wenn er nicht mehr kann, trägt Bor ihn, stehen zu bleiben fühlt sich zu unsicher an. Der Brandgeruch ist auch hier noch beißend.
Vor uns hält ein Polizeiauto. Ein Polizist steigt aus und fragt, wo wir hinmüssen. Die Kinder weinen, sie können nicht mehr.
Der Polizist wird uns zum Hotel bringen. Dort werden Ärzte sein, wir werden Hilfe bekommen, Wasser, eine Badewanne und Essen.
Es wird über eine Woche dauern, bis unsere Augenlider und Nasenschleimhäute allmählich wieder abschwellen.
Und es wird einige Tage dauern, bis das Flugverbot wieder aufgehoben ist. Die längsten Tage, die wir je in New York verbracht haben.
Teil 1
Kapitel 1
Wie ein Finger in ein heißes Bad taucht die Sonne am Horizont ins silberne Mittelmeer. In zehn Minuten wird es dunkel sein, aber der Verkehr ist noch unvermindert laut und fordernd.
Das letzte, fahle Tageslicht gibt zwischen tiefroten Wolken allmählich den Kampf auf, eine Kulisse wie die eines surrealen Dramas. Am Vormittag hat eine der hier typischen Regenattacken, die die Rinnsteine zum Überlaufen bringen und die Straßen in Wadis verwandeln, den Staub und Schmutz weggespült und woanders angeschwemmt. Im Lauf des Tages brach die Sonne dann mühsam durch, und bald machten sich im Dunst der trocknenden Pfützen die Gleichgültigkeit und die Hektik des Alltags bemerkbar, mit dem nervösen Hupen der Autos, dem Getöse von Passanten, Händlern und Straßenmusikern und dem fernen Ruf des Muezzins im Süden, der die frommen Muslime zum Gebet rief.
Orthodoxe Juden mit Schläfenlocken, die Bänder ihrer Gebetshemden lose und wild, unbeabsichtigt modisch an den Seiten flatternd, gehen schnellen Schrittes zu ihren Gebetshäusern, ohne einen Blick nach rechts oder links zu werfen. Musikfetzen, die hier und da über den Balkon zu den Nachbarn herüberwehen, aufheulende Motorsägen, das warnende Piepen von Lastern, die beladen werden, Hämmern, singende Kinder und das Schnurren vieler E-Bikes erzählen von einem arbeitsamen Leben, von Ambitionen und Sehnsüchten. Was auf der anderen Seite des Meeres passiert, spielt hier keine große Rolle. Wer hohe Erwartungen hat, muss zusehen, dass sie zwischen all den Resten von Kichererbsen und Obst, Smoothiebechern und Pita-Krusten frisch bleiben. Ganz zu schweigen von den Kakerlaken, die überall herumwuseln, und den vielen alten Matratzen und kaputten Möbeln, die, kaum wurden sie ausrangiert, von der Straße gepflückt werden wie eine kostbare Beute. Tel Aviv.
Aber für uns spielen sie heute eine Rolle, die Ereignisse in der Ferne.
Bereits vor einem Monat bin ich für die Geburt von Philips drittem Kind nach Israel gekommen. Die große Familie von Herman, Philips Vater, lebt hier. Ich habe in der Wüste Negev gewohnt, mitten in Be’er Scheva, in der Nähe des Hauses, wo Philip seit ein paar Jahren mit Chaya und den Kindern lebt, unweit seiner Militärbasis. Die Geburt (ein Junge, fünfzig Zentimeter, vier Kilo, volles schwarzes Haar) lief glatt, meine Unterstützung wurde ein paar Wochen lang geschätzt, aber als ich nicht mehr so dringend gebraucht wurde, nahm ich mir eine Wohnung in Tel Aviv, an der Rehov Pinsker, dicht beim Meer.
Bors Tag fällt dieses Jahr mit dem der Amtseinführung der neuen Präsidentin der Vereinigten Staaten zusammen, ein Fernsehspektakel, das wir uns nicht entgehen lassen wollen. Pol übernachtet bei mir. Sam tourt wie üblich durch die Welt und hat sich zu meinem Bedauern nicht einmal den heutigen Tag freinehmen können. Er tritt abends in Salzburg auf und ruft uns danach an, hat er versprochen. Philip hat zum Glück Sonderurlaub und kann bei uns sein.
Er ist am späten Vormittag in Tel Aviv angekommen, mit Chaya und den Kleinen. Wir haben nichts Besonderes vor, aber für mich ist es an sich schon besonders, wenn wir diesen Tag zusammen verbringen, jetzt, da wir überall in der Welt verstreut sind.
Obwohl wir nur aus diesem Anlass zusammen sind, herrscht eine Atmosphäre des Leugnens, ich kann es nicht besser beschreiben. Ich möchte den Tag – wie immer – in Ehren halten, weiß aber – wie immer – nicht genau wie, und das setzt mich derart unter Druck, dass ich trotzig werde vor lauter Hass auf meine Trauer und Wut, wie auch auf dieses willkürliche Datum, das mich zwingt, noch mehr zu spüren als sonst. Am liebsten würde ich den Tag einfach übergehen, samt den Presseartikeln in den Niederlanden, wo man mich nach so vielen Jahren noch immer um Interviews bittet, obwohl ich jedes Mal ablehne. Im Fernsehen werden dort am Jahrestag des Vorfalls Sendungen ausgestrahlt – zum Glück werden es allmählich weniger.
Zum x-ten Mal begebe ich mich in meine giftige Vergangenheit und unterziehe mich der rituellen Folter, mich an alle Einzelheiten zu erinnern, von Anfang bis Ende, obwohl es letztlich nur darauf hinausläuft, dass wir den ganzen Tag mit schmerzendem Kopf und schmerzlichen Erinnerungen zusammen vor dem Fernseher hocken, als würden wir wirklich auf die verdammte Antrittsrede warten.
Dass ich schon am frühen Nachmittag den Fernseher anschalte, ist ungewöhnlich, nur selten hole ich die Welt ins Haus. Zeitungen lese ich nur flüchtig, im Fernsehen zappe ich bei den Nachrichten weiter. Ich habe die Hoffnung auf Meldungen, die mich aufmuntern könnten, längst aufgegeben. Oder ist es nur Furcht vor der nächsten Enthüllung, dem nächsten Schock, der nächsten Enttäuschung?
Heute steht von vornherein fest, dass der Tag Geschichte schreiben wird, noch bevor er zu Ende geht. Alles ist nur Protokoll, wie bei einem Hochamt. Wir erwarten ein Spektakel, ein gewaltiges Theaterstück, wie es solch einem historischen Ereignis gebührt.
Philip sieht nur unaufmerksam zu und füttert zwischendurch Yaeli (zwei Jahre), während Pol und ich schon wie gebannt auf den Bildschirm starren. Moran (vier Jahre) kleckert mit ihrem Brei herum, und Chaya stillt den kleinen Bor.
In Washington ist der große Tag gerade erst angebrochen, bis zur offiziellen Feierlichkeit sind es noch ein paar Stunden. An der Sonne, die alles in ein zartes silbernes Licht taucht, ist selbst im Fernsehen zu erkennen, wie jung der Tag ist. Man riecht förmlich die Zahnpasta, das Aftershave, den unschuldigen Duft frischgewaschener Kleidung. »Der Schein der täglichen Wiedergeburt der Welt«, hatte Bor die Jungfräulichkeit des Morgens einmal genannt. Warum der Schein?
Was sei denn in Gottes Namen echter, hatte ich protestiert, als Erneuerung und die Hoffnung auf einen neuen Tag? Und was gebe es Schöneres als Morgenrot und taufeuchtes Gras?
Was für bescheuerte Klischees, hatte Bor widersprochen. Tau sei doch nur Kondenswasser. Und die Erde erneuere sich nicht, sie drehe sich nur im Kreis.
Dass sie sich aber drehe, dazu noch um die Sonne, und sich immer wieder der Erwärmung und Abkühlung aussetze – das sei doch in seiner majestätischen Pracht zumindest herrlich und hoffnungsvoll. Warum sollte alles, was sich physikalisch erklären lasse, im selben Atemzug entzaubert sein?
Bor hatte schließlich eingeräumt, dass es herrlich sei. Aber er sei einfach noch nie gern früh aufgestanden. Er hatte gelacht.
Die Maschinerie kommt langsam in Gang, die Parade wichtiger Menschen, von den Asteroiden bis zu den Monden, von den Planeten bis zu den Sonnen: Sämtliche Fernrohre zeigen heute zielgenau auf die Milchstraße der Macht. Alle defilieren sie vorbei, mit feierlichem Schritt.
Einer nach dem anderen wird von dem amerikanischen Kommentator angekündigt, mit der schweren Stimme, die man von Baseballspielen kennt, einer Stimme, so tief und schwungvoll wie die Geschichte des Fernsehens selbst.
Auch Pol gibt zu allem einen Kommentar ab, besonders zu der feinen, langweiligen Kleidung und der großen Arroganz, die sie den vielen Gästen zuschreibt – bestimmt seien das alles bedeutende Persönlichkeiten, ihr aber weitgehend unbekannt.
Ich bin still.
Feierliche Anlässe finde ich immer ergreifend, große wie kleine. Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen, Zeugnisvergaben: Tränen. Die Ordnung, die Symmetrie, die Symbolik. Die Kultur, all dem Form zu geben, was dem menschlichen Leben Bedeutung verleiht. Das hatten Bor und ich gemeinsam, obwohl wir nur an hohen Feiertagen in die Synagoge gingen und uns nicht an die jüdischen Speisegesetze hielten. Dennoch legte er nach unserer Hochzeit Wert darauf, sich an bestimmte Traditionen zu halten. Äpfel mit Honig an Rosch ha-Schana, fasten zu Jom Kippur, Seder am Abend vor dem Passahfest und Kerzen zu Chanukka.
Diese Amtseinführung hätte ihm auch gefallen.
Ich rufe Philip, als ich die Hauptperson näherkommen sehe, die designierte Präsidentin, eine eindrucksvolle Frau halb indischer Abstammung mit attraktivem, intelligentem Gesicht, die die ganze Welt mit ihren Ideen, ihrer Redegewandtheit und Ausstrahlung in Erstaunen versetzt.
Laut frage ich mich, wie sie sich in diesem Moment fühlen mag. Wir würden uns mit dem wichtigen Amt wohl erst auseinandersetzen, sagt Pol etwas verächtlich, wenn eine Frau es bekleiden soll. Pol hat ein Händchen dafür, jede Situation darauf zu reduzieren, wie unausgewogen die Wertschätzung Männern und Frauen gegenüber verteilt ist.
Der aus dem Amt scheidende Präsident reckt den roten Kopf fast possierlich in die Höhe, seine zur Schau getragene verbissene Ungläubigkeit soll über die Schmach seiner Niederlage hinwegtäuschen. Er trotzt den Gegnern, die er geringschätzt, mit leicht tragisch anmutender Verachtung – tragisch, weil man ihn kaum beachtet. Sein Auftritt geht unter in der zeremoniellen Ankunft der Gäste und dem damit einhergehenden heiteren und gewichtigen Stimmengewirr.
Plötzlich schreie ich vor Schreck auf und schlage mir die Hand vor den Mund, aber nicht wegen seines peinlichen Auftritts oder der Ankunft der designierten Präsidentin.