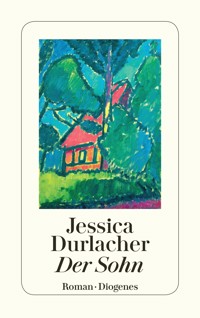10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Emoticon‹ erzählt die Geschichte von Daniel, einem niederländisch-israelischen Jugendlichen, und von Aischa, einer jungen Palästinenserin, die für die Weltöffentlichkeit ein Zeichen setzen will – und Daniel in eine tödliche Falle lockt. Ihr Lockmittel: das Internet und seine Zeichensprache, die Emoticons.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jessica Durlacher
Emoticon
Roman
Aus dem Niederländischen von
Hanni Ehlers
Titel der 2004 im Verlag
De Bezige Bij, Amsterdam,
erschienenen Originalausgabe: ›Emoticon‹
Copyright © 2004 by Jessica Durlacher
Die deutsche Erstausgabe erschien
2006 im Diogenes Verlag
Eine Liste der Emoticons
befindet sich im Anhang des Buches
Umschlagfoto von Todd Wright
Copyright © Todd Wright/Blend Images/
Getty Images
(((Leon))): xx
(((Moos))): xx
(((Moon))): xx
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23657 6 (2. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60169 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Inhalt
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Vierter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Fünfter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Sechster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Siebter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Achter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Neunter Teil
Zehnter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Elfter Teil
Kapitel 1
Später
Im Text verwendete Emoticons
Liste der Emoticons
[5] Jerusalem, 30. Mai 2001
Vom Damaskustor aus hatte sie ein Taxi zum zeitweiligen Busbahnhof in der Salah ad-Din Street genommen. Es war voll, auch außerhalb der Altstadtmauern waren an diesem Mittag viele Menschen auf den Beinen.
Sie schwitzte ungebührlich. Hätte sie doch bloß etwas anderes vereinbart als die schwarze Hose und die karierte Bluse! Die Hose spannte, und unter dem dicken Blusenstoff lief ihr der Schweiß in Strömen herunter.
Sie wußte sofort, daß er es war – von dem Foto her und weil so etwas Erwartungsvolles in seinem Blick lag. Wider Willen war sie einen Moment lang verlegen. Barsch sagte sie seinen Namen, beinahe ohne die Augen zu ihm aufzuschlagen.
Er antwortete mit einer Gegenfrage: »Bist du Mischa?«
Danach liefen sie nebeneinanderher. Es vermittelte ihr ein eigenartiges Gefühl, neben einem Jungen herzugehen, dem sie von Gefühlen und Begierden erzählt hatte. Den sie hatte glauben machen, das Wort Brüste stünde für ihre Brüste und es erregte sie, an seinen Blick zu denken. Hart und stark machte sie das. Sie wußte, daß es gut war, was sie tat.
Er war groß, aber jung, jünger, als sie angenommen hatte. Auch das war gut – jung mußte er sein, noch an seiner Mutter kleben. So sah siebzehn in Israel und im Westen aus, glatt und sauber. Weiß. Unlädiert. Bei ihr waren [6] Siebzehnjährige älter, schmutziger und kaputter. Nur Raschid bildete vielleicht eine Ausnahme, der war vierzig und sah aus, als wäre er jung. Aber der war ja auch ein halber Amerikaner, der weichliche Arschkriecher.
Der Junge hatte ein klein wenig Ähnlichkeit mit Ibrahim, wie er früher, mit dreizehn, gewesen war. Aber vor allem die Haare waren ganz anders. Sie standen ihm wie Stachelschwänzchen vom Kopf ab, sorgsam nach dem Vorbild amerikanischer Skater gestylt. Und er roch nach After-shave.
Dieser blöde Duft machte sie noch zorniger. Keine Spur von Rührung über seine defensive Schüchternheit. In ihrem Kopf quengelten die Sätze, die sie ausgetauscht hatten, und ein leichter Schauder überlief sie, vor Abscheu, aber auch einem letzten Rest der Lust, die sie beim Schreiben empfunden hatte. Nie zuvor hatte sie ihre Worte so sehr gemeistert.
Mit dem Taxi fuhren sie in den Osten Jerusalems, wo sie das Auto abgestellt hatte.
»Ist das deins?« fragte er.
»Mm«, summte sie bejahend. Es war Hadis Auto, aber was machte das schon.
»Wohin fahren wir?« fragte er. Sie hörte die Erwartung in seiner Stimme.
»Zu einem Haus von Freunden. Steig ein.«
Raschid. Raschid, der mit der Amerikanerin herumscharwenzelte. Raschid, der Verräter, der feige Hund, der einer amerikanischen Schlampe wegen alles andere vergaß. Der würde nicht mal auf die Idee kommen zu wagen, was sie wagte, der mit seinen soften Sprüchen. Mach doch die Augen auf, Mann!
[7] Lammfromm stieg der Junge ein. Auch das war gut und genau so, wie es sein sollte. Gesprochen wurde nicht. Sie fühlte seinen Blick, einen leichten Hauch auf ihrer rechten Wange – nichts wußte er, nichts. Sauberer, geiler Milchbubi, der keine größere Sorge hatte, als an möglichst viel frischen Sex zu kommen.
Wenn sie so darüber nachdachte: Sauber fühlte auch sie sich, rein, als desinfizierte das Feuer in ihr alles Ungute, das in ihr umging, die Hintergedanken, die Ängste, die Zweifel. Noch konnte sie sich nicht mit einem Schahid, einem Märtyrer, messen, doch während sie so dahinfuhr, gewann sie eine ungefähre Ahnung davon, wie sich ein Schahid auf dem Weg zu seinem Ziel fühlen mußte. Rein, präzise, himmlisch, wie ein brennender Pfeil, ein kurzlebiges Feuer, nur Augen und Ohren, einen hohen Pfeifton im Kopf vom Gott der Gerechtigkeit. Und durch diesen hindurch hörte sie von irgendwo weither das Weinen der Mütter, das sie so gut kannte und das sie begleitete wie ein Klagegesang.
Von jetzt an führte sie die Regie. Das war ihre Geschichte.
[9] Erster Teil
[11] 1
Ein guter Tischler war er gewesen, Arik.
Stundenlang hatte Ester vorher zugeschaut, wie er ein Stück Holz so fräste und schliff, daß es sich präzise mit dem Gegenstück verband. Es war herrlich anzusehen, wie er die Teile mit seinen breiten, trockenen Händen zusammensetzte – als würden alle Neurone in ihrem Hirn für einen Augenblick geordnet: Ruhe, Stille!
Das war danach vorbei gewesen. Hatte sie später je noch einmal so in sich geruht?
Zwei Dinge hatte sie daraus gelernt. Es war schwer vorherzusagen, was bleibende Erinnerungen liefern würde, so sehr man sich auch bemühte, sich alles gut einzuprägen. Und völlig unvorhersehbar war, wann Erinnerungen wiederkamen. Von dem einen Mal waren ihr sämtliche physischen Details glasklar vor Augen geblieben; es erstaunte sie immer wieder, wenn die Bilder aufschienen, wenn das Gefühl wieder da war. Wenn sie einen schönen Tisch sah, den Geruch von Holz auffing. Manchmal waren Assoziationen naheliegend. Hinterher. Doch warum, wenn sie im Supermarkt eine Packung Milch aus dem Kühlfach nahm oder die Dekanatssekretärin, mit der sie befreundet war, von weitem »dieser Scheißcomputer!« schreien hörte und danach einen Knall, als werde etwas auf den Boden geworfen?
[12] Jedesmal – heute noch! – spürte sie, wie ihr das Blut in den Kopf stieg und ihr Körper zu glühen begann, wenn sie wieder vor sich sah (oder fühlte: War es nicht nur eine Erinnerung ihres Körpers?), wie sie in der Hitze jenes kleinen Zimmers auf dem niedrigen, harten Bett gefangen war, während er vor ihr kniete und mit der gleichen schweigsamen, überlegenen Geduld agierte, die sie in seiner Werkstatt so fasziniert hatte, vor hundert Jahren oder so. Wie er sein Geschlechtsteil aus der Hose hervorholte, als handle es sich um einen Schatz, und es, als sei er selbst darüber erstaunt, andächtig auf der flachen Hand wog.
Das war geblieben, und nicht das endlose stumme Werben, die Spannung, die unter ihren Rippen gepocht und in ihren Kleidern geklebt hatte. Verweht der Anlauf voller Frust und Qualen. Geblieben war die Katharsis in ihrem wahrsten Sinne – kein Drumherum mehr. Was zählte, war allein dieses Ergebnis. Und natürlich die Wut über das, was dann folgte.
Quadratisch, hatte Ester mit noch erstaunlicher geistiger Präsenz festgestellt: rechte Winkel, gerade Seiten. Das also war ein Mann. Da waren auch noch das Gesicht, die leuchtendblauen Augen, die muskulösen Schultern, aber mehr als alles andere war er vielleicht quadratisch, massig gewesen. Eine erschreckende Feststellung – bedrohlich, aber auch erregend. Zumal für sie, die sich damals sogar noch an die eigene Nacktheit hatte gewöhnen müssen.
Manchmal kam es ihr unerträglich vor, daß sie ihn nie wiedergesehen hatte, daß seine Existenz kaum zu beweisen war.
Wie Arik trotz seiner Masse und seiner Eckigkeit mit [13] der Präzision eines Ingenieurs sicher und ohne Eile in sie eingedrungen war, sich scheinbar festgeschraubt hatte, trotz seiner vermeintlichen Eckigkeit überzeugt von seiner technischen Erkenntnis: daß er passen würde. So konzentriert, fast ohne eine Bewegung, nur dieses sanfte und doch erbarmungslose Schrauben, das sie beide so fest ineinandersetzte – sie war beinahe ohnmächtig geworden. Ein kurzer, flammender Schmerz hatte sich mit etwas wunderbar Überwältigendem vermischt, wobei sie gleichermaßen von ihm weg wie sich an ihm festklammern wollte, ihm etwas antun wie von ihm beschützt werden wollte.
Sie wußte noch, wie sehr es ihr geschmeichelt hatte. Daß ihr Körper stimmte. Daß sie paßte. Herrliche Herabwürdigung, erfüllende Erniedrigung. Sie war noch so jung gewesen, daß sie an diese Vollkommenheit glaubte. Rechte Winkel waren heilig, die Geometrie auf die Liebe anwendbar. Damals war Ester noch mit tiefem Glauben ausgestattet gewesen.
An jenem Tag war die Ordnung zerstört worden. Ihre Ordnung. Doch das wußte sie damals noch nicht.
Das kam später.
2
Schiphol, 2. April 2001, vormittags
Als sie frühmorgens auf dem Flughafen Schiphol, in der hintersten Halle, endlich für sich war, um sich den Fragen der Sicherheitsleute zu stellen, kam ihr die Erinnerung an [14] den Kibbuz fremd vor, als sei sie zu einem Zitat geworden, zu einer Erinnerung an eine Erinnerung.
Daß sie erneut auf dem Weg nach Israel war, hatte unbestreitbar etwas zu bedeuten, und das mußte auch so sein. Die zurückliegenden achtzehn Jahre konnten nun zusammengerollt und weggelegt werden, die Geschichte konnte von vorne beginnen. Philip hatte sich immer lustig gemacht über ihr Bedürfnis, in Zyklen zu denken. Sie hörte es ihn förmlich sagen: »Ja, ja, und jetzt hat sich der Kreis wohl wieder geschlossen. Wenn du das glaubst, dann ist es auch so. Du machst wahr, was du wahrhaben möchtest. Kunststück!« Aber jetzt war es unleugbar, das würde selbst Philip zugeben müssen.
Das letzte Mal hatte sie in einem anderen Leben hier gestanden, neunzehn Jahre alt, voll jugendlicher Unbändigkeit. Oder waren es die Fotos, die das suggerierten: strahlend junges, verlegen unausgeschlafenes Gesicht, Rucksackgurte über den Schultern, viel zu weit oben abgeschnittene Shorts, Beine – die sie zwar als die ihren erkannte, die aber doch mittlerweile anders geworden waren, dünner, härter, älter. Ihr Tagebuch und ihre Erinnerungen waren viel zurückhaltender, als es das verspielte, leichtsinnige Wesen auf den Fotos hätte erwarten lassen, die Nervosität über diese erste große Reise im Tagebuch aus der Detailliertheit der Beschreibungen spürbar.
Inzwischen wußte Ester: Je mehr sich tatsächlich eine Geschichte entsponnen hatte, desto stummer war das Tagebuch geworden. Von ihren extremsten und somit interessantesten Erinnerungen an jene Zeit fand sich letztlich so gut wie gar nichts auf dem Papier.
[15] Daß sie ihren Koffer öffnen mußte, machte nichts. Auch ihre Schuhe zog sie ohne innere Gegenwehr oder Verärgerung aus. Die Detektoren schnupperten still an ihren Besitztümern, ohne Ansehen der Person. Es war nicht viel los, die Zahl der Sicherheitsleute überstieg mit Leichtigkeit die der Passagiere, aber dennoch ging es nur langsam voran, an den vielen Röntgenapparaten und den kräftigen jungen Frauen und Männern entlang, denen jeder Reisende erklären mußte, was er oder sie in Israel suchte.
So eindringlich und drohend die Fragen auch gestellt wurden, sie klangen müde und bedrückt. Ein Land am Ende seines Lateins, dachte Ester, die aufgekrempelten Hemdsärmel zerfranst, die strahlendweißen Zähne matt, ein solches Maß an Bedrohung und Sicherung erschöpfen ein Land. Tag für Tag passierte dort gerade etwas zuviel, und das schon so lange.
Die Spannung bewirkte, daß ihr Körper wie gefühllos war. Und bei dem Gedanken, daß Philip nicht da stehen würde, wenn sie in einer Woche wiederkam, ergriff sie ein Schwindel – der wieder abebbte, wie sie es in einem ganzen Jahr vorweggenommenen Heimwehs geübt hatte.
Ob sie Angehörige in Israel habe, wollte der junge Sicherheitsbeamte wissen, und sie konnte nicht umhin zu registrieren, wie umwerfend gut seine schmucke Uniform zu seiner Haut und seinem kurzen schwarzen Haar aussah, das glänzte, als wäre es naß. Der Anblick der zarten Haut seines Halses und seines kräftigen, wehrlosen Nackens schmerzte, weil sie dabei erneut an Philip denken mußte – an das, was blieb, wenn man alle Streitereien und chaotischen Entscheidungen vergaß. Sie könnte ihm jetzt [16] beruhigend und mütterlich über den Hals streichen. Wenn sie nicht hier wäre. Wenn sie ihn nicht verlassen hätte.
Angehörige in Israel? Wenn es doch so wäre. Sie hatte schon hier in den Niederlanden niemanden mehr. Ihre Mutter war gestorben, als sie vier war, ihr Vater vor sechs Jahren, und sie hatte keine Geschwister. Es gab nur noch einen Onkel in der Schweiz.
Sie dachte kurz an Daniel, ihren Leihsohn, wie sie ihn nannte, ihren Schatz, der wuchs und wuchs und wuchs, mit seinen großen Händen, die sie so rührten, weil sie nach wie vor die Babyhändchen darin sah, mit den kleinen Polstern und den kurzen, ungeschickten Fingerchen, die vor langer Zeit ihre Nase und ihre Wangen betastet hatten. Daniel, der Junge, den sie schon sein Leben lang kennenzulernen versuchte.
Sie antwortete mit niedergeschlagenen Augen, als führte sie etwas im Schilde. Daß sie eine Spionin sei, konnte sie abstreiten, aber letztlich reiste sie nicht nur zum Vergnügen. Dennoch sagte sie, sie wolle Urlaub machen.
Wer machte noch Urlaub in Israel, außer vielleicht in Eilat?
Doch die jungen Beamten nahmen es hin, als wäre es völlig selbstverständlich, daß immer noch Menschen zum Vergnügen in ihr lebensgefährliches Land reisten. Sie selbst wohnten ja auch dort – sei es vielleicht auch mit Tunnelblick, dachte Ester, während sie die resoluten jungen Frauen musterte, die nach routinierter Entschuldigung geduldig mit ihren Apparaten ihre noch saubere Kleidung und ihre Bücher und Papiere durchpflügten.
Selbst die schlimmste Angst wird offenbar normal, wenn sie Tag für Tag da ist, dachte sie. Am Ende ist dir gar nicht [17] mehr bewußt, daß diese innere Ungeduld, diese Effizienz, mit der du dich außerhalb deiner vier Wände bewegst, diese Hast und Gleichgültigkeit in deinem Herzen und dein zerstreutes, unwirsches Gehabe gegenüber Freunden und Fremden Angst heißt. Angst wie eine problematische Liebe: Du weißt, daß du bei ihm bleiben willst, nein, bleiben mußt, aber jede Minute mit ihm bist du im Widerstreit und unsicher. Nein, nicht so wie bei Philip. Bei ihm war sie am Ende nur noch über ihre eigene Grausamkeit beunruhigt gewesen.
Ester hatte geglaubt, sie könne die Angst von sich fernhalten, indem sie, bei aller Zwiespältigkeit, Kritik an Israel übte. Als würde ein kritisches Bewußtsein kugel- und bombensicher machen. Doch schon gleich nach dem Passieren der Sicherheitsschranken für Reisende in das am strengsten bewachte Land der Welt drängte sich ihr das Bewußtsein auf, daß in Israel allwöchentlich Anschläge verübt wurden, und da verging ihr die Lust auf einen Kaffee, geschweige denn, daß sie der zollfreie Einkauf von Parfüm und Gesichtscremes noch reizen konnte.
Grau und starr kam sie sich vor. Der Ernst des Landes, in das sie reiste, versetzte sie unwillkürlich in Alarmbereitschaft.
3
Tel Aviv, 2. April, 16.00 Uhr
Die Miene des Taxifahrers, an den eine energische junge Jüdin in einem Glashäuschen Ester verwiesen hatte, [18] verfinsterte sich. Auf Ostjerusalem hatte er keine Lust. Dangerous, rief er, expensive! Und auf hebräisch schrie er dem jungen Mädchen, das ihm diesen Fahrgast hatte aufhalsen wollen, Verwünschungen zu.
Auch der zweite Fahrer, dem Ester den Namen ihres Hotels nannte, erteilte ihr eine Abfuhr: Er habe Feierabend und müsse nach Tel Aviv zurück. Er rührte sich nicht vom Fleck, bis Ester wieder ausstieg.
Der dritte nannte lediglich den Fahrpreis, der hoch war. Sie stieg ein. Während der Fahrt wurde nicht gesprochen, und Ester hatte reichlich Gelegenheit, nach draußen zu starren. Durch das Fenster wehte ein laues Lüftchen herein, in das sich hin und wieder scharfer Petroleumgeruch mischte, und sie wurde sich schockartig bewußt, wie echt dieses Land nun geworden war.
Vor achtzehn Jahren war Israel einer jungen, nicht allzu übermütigen Abenteurerin als das absolute Schlaraffenland erschienen, dessen hübsche, kunterbunte Städtchen, exotische Dörfer und Viertel – arabische wie jüdische –, Wüsten und Seen, Meeresstrände und Berge allesamt binnen weniger Stunden zu erreichen waren, indem man sich einfach an den Straßenrand stellte und den Daumen hob. Die heutigen Bedrohungen existierten zwar auch damals schon, hatten für sie aber noch etwas Unwirkliches gehabt, das das Abenteuerliche dieser urwüchsigen Welt höchstens erhöhte. Daß alle jungen Leute, gleich welchen Geschlechts, zum Militär mußten, hatte Ester seinerzeit für eine zwar aufregende, aber überholte Tradition gehalten, die aus den unbegreiflichen Kriegszeiten lange vor ihrer Ankunft herrührte. Wie frisch der Libanonkrieg 82 noch war, hatte sie [19] sich nicht bewußt gemacht. Sie war neunzehn und hatte Semesterferien – wie Lola.
Sie war in einem Kibbuz gewesen (mit Lola) und danach (ohne Lola) durchs ganze Land gezogen. Für eine noch nicht mal Zwanzigjährige hatte das Israel des Jahres 1983 einen geradezu feierlichen Charakter gehabt: die Welt im Kleinformat, noch nicht ausgewachsen, nichts war ganz fertig, vieles improvisiert, der westliche Einschlag bereits vorhanden, aber die Kibbuzim immer noch überall im Land als leuchtende Beispiele für ein ideales sozialistisches Gemeinwesen lebendig und präsent.
Das heutige Israel hatte inzwischen richtige Autobahnen mit Autobahnkreuzen wie im Westen, sah Ester durch ihr Autofenster. In den Hunderten von Dörfern und Städten lebten Millionen Einwohner, und nicht überall bekam man etwas von den Verbrechen, Anschlägen und Scharmützeln mit, von denen man täglich in der Zeitung lesen konnte. Sie wußte: Die Bedrohung, die sie damals zu Unrecht nicht so ernst genommen hatte, war überaus real und hatte sich fest in der Gesellschaft eingenistet. Hier war der Wurm drin, und die Wahrscheinlichkeit, daß dem beizukommen war, ging mittlerweile gegen Null.
Ester erinnerte sich noch genau, was seinerzeit den Schatten auf diese spannende, wilde kleine Welt geworfen hatte, die sie von den Golanhöhen bis nach Eilat bereiste.
Im Jerusalemer Suk hatte sie Dschihan und Lifta kennengelernt, israelische Araber, bei denen sie ein paarmal Datteln gekauft hatte, kultivierte, liebe Menschen mit Sinn für Humor, beide Mitte Sechzig. Sie hatten nicht immer auf diesem Markt gestanden. Früher einmal waren sie reich [20] gewesen, und ihre Kinder hätten studieren sollen. Sie hatten in einem schönen, geräumigen Haus auf einem kleinen Hügel in einem Dorf südlich von Jerusalem gewohnt, das schon seit Generationen im Familienbesitz war, mit Olivenbäumen darum herum, von denen sie gut hätten leben können.
Dann war der Brief gekommen, in dem stand, daß ihnen ihr Haus nicht länger gehöre. Die Olivenbäume waren konfisziert, viele auch vor ihren Augen zerstört worden. Sie hatten fliehen müssen, im eigenen Land. Daß sie ihre israelischen Ausweise behalten durften, mußten sie als großes Privileg betrachten. Und sie durften froh sein über ihren Marktstand und ihre winzige Wohnung in Ostjerusalem, wo auch ihre verheiratete Tochter mit ihrer Familie wohnte.
Zweimal waren Ester und dieser Australier – hieß er nicht Bratt? – von Dschihan und Lifta in ihre primitive Mietwohnung eingeladen worden. Und diese mit viel Essen und langen Geschichten angefüllten Abende waren vielleicht der Auslöser für Esters Sympathie für die Palästinenser gewesen. Während Lifta die tiefgreifenden Veränderungen im Laufe ihres Lebens schilderte, fuchtelte die kleine, rundliche Frau lebhaft mit den zarten Händen. Und bewegt hatte Ester festgestellt, daß die Gestik dieser Hände nichts von ihrer quirligen Eleganz eingebüßt hatte, obwohl doch alles im Leben dieser Menschen stetig bergab gegangen war. Sie hatte in dieser Fuchtelei eine verinnerlichte, beherrschte Verblüffung über das Schicksal gesehen, machtlose kleine Menschenhände, und das war ihr auf ganz eigentümliche Weise zu Herzen gegangen. Die Geschichte von Lifta und Dschihan hatte die ohne weiteres [21] von ihrem Vater übernommene bedingungslose Liebe zu Israel erstmals angekratzt, und sie hatte begonnen, über die Paradoxe nachzudenken, die auch Lola wenig kümmerten. Lola, die sich nicht schämte zu rufen: »Diese Scheißaraber, das sind doch keine Menschen!«
Dabei war es ironischerweise gerade Lolas entschiedene Loyalität gegenüber Israel gewesen, die Ester am Anfang ihrer Freundschaft so ein unergründliches Gefühl von Sicherheit gegeben hatte. Mehr noch: Diese Loyalität war vielleicht sogar der Grund für ihre Freundschaft gewesen.
Was würde Lola wohl dazu sagen, daß sie jetzt hier war? Nach all den Jahren hielt sie ihre älteste Freundin nicht mehr unbedingt über ihre Reisen auf dem laufenden.
Lola. Immer wieder Lola.
4
Das Taxi fuhr durch einen chaotischen Teil Jerusalems, wo eine breite Straße zwei Viertel voneinander trennte. Auf der einen Seite der Fahrbahn sah man Frauen in dunkelblauen langen Röcken und mit so dickem, glattem Haar, daß es sich nur um Perücken handeln konnte, den mageren Rücken häufig über einen Kinderwagen gebeugt, hinter ihren Ehemännern herschlurfen, die schwarze Mäntel und schwarze Hüte trugen. Auf der anderen Seite, hinter einem kleinen Steinwall, liefen Musliminnen mit Kopftuch, Plastiktüten mit Lebensmitteln am Arm, lebhaft miteinander redend.
Sie waren hier noch nicht in Mea Shearim, dem Viertel [22] der ultraorthodoxen Juden, doch auch in dieser Gegend wohnten jetzt schon viele orthodoxe Familien, erzählte der Fahrer ungefragt.
Wie identische Puppen gingen sie, ungewaschen wie im neunzehnten Jahrhundert, in die Schul oder kamen von dort nach Hause zurück in eine, angesichts zahlreicher Nachkommen, beengte Etagenwohnung über irgendeinem der schmalen, dunklen Devotionalienlädchen in irgendeiner der engen, zugemüllten alten Gassen.
Das Taxi fuhr kreuz und quer durch die Stadt, und hin und wieder tauchten auch Neubausiedlungen auf: diagonal angeordnete, gleichförmige Betonblöcke. Daß sie danach plötzlich wieder in einem arabischen Viertel waren, erkannte Ester an der Straßenbeschilderung, dem noch graueren Grau des Straßenbildes und den Kindern, vor allem kleinen Jungen, die dort herumlungerten.
Esters Hotel fand sich im ärmlichen Wirrwarr einer Straße direkt um die Ecke einer der Hauptquartiere der Palästinensischen Autonomiebehörde. Auf Anraten eines befreundeten Journalisten hatte sie hier auf eigene Faust ein Zimmer gebucht, während die anderen Konferenzteilnehmer in Hotels am anderen Ende der Stadt untergebracht waren. Und sie war froh, daß sie darauf bestanden hatte, hier zu übernachten (die Universität kam für einen Teil der Kosten auf), denn es war ein Gebäude wie aus einem orientalischen Märchen, arabisch-christlich, üppig begrünt, mit einem elegant geschwungenen Eingangstor, blauen und türkisfarbenen Wandkacheln und Holzschnitzereien. Auf dem Parkplatz standen Geländewagen von Fernsehsendern; hier stiegen viele Journalisten ab.
[23] Durch die Lobby, die auf mehrere Räume rund um einen langgestreckten Innenhof verteilt war, führte Esters Weg zu ihrem Zimmer über schöne alte Steinböden, an Tischen und langen Bänken entlang, auf denen Männer saßen und rauchten. Sie hörte zwei Männer laut debattieren. Anderswo saßen ältere Leute redend um einen Tisch. Überall wurde konferiert, schien es.
Es kam ihr eigenartig vor, daß immer noch so leidenschaftlich mit Worten gearbeitet wurde, selbst hier, im Zentrum des Geschehens, mitten in der Welt der Konflikte, die sie aus Zeitung und Fernsehen so gut kannte, im alten Jerusalem, dem Ort, der wohl von alters her von jedermann als das Gewissen der Menschheit betrachtet wurde.
Sie hatte unwillkürlich erwartet, daß in diesem Brennpunkt alles stillstehen würde, wie im Auge eines Orkans.
5
Das herzförmige Schwimmbad war zu dekorativ für Esters verbissene Zielsetzung. Nach langen Bahnen war ihr, nach schnellem, befreiendem Fortkommen, und nicht danach, die hier sachte vor sich hin dümpelnden Objekte zu umschiffen: drei sogar im Wasser noch mächtig nach Parfüm riechende deutsche Damen, die ihre gutfrisierten Köpfe über Wasser trocken zu halten trachteten. Auch einen männlichen Schwimmer sah sie, schwergewichtig und träge.
Sie stellte sich vor, ein Seehund zu sein, der glatt und [24] pfeilschnell das Wasser durchschnitt, im Slalom um die drei fülligen Badeanzüge und den trägen Einzelgänger herum. Ihr war klar, daß ihre Anwesenheit deren ach so statischen Badespaß trübte, und ja, als sie bei ihrer vierten unvergleichlichen Wende prustend neben dem am vorsichtigsten manövrierenden, weil am aufwendigsten toupierten und geschminkten Kopf auftauchte und geräuschvoll nach Luft schnappte, wurde ihr der erste böse Blick zugeworfen.
Ein stiller Krieg setzte ein. Sie war das U-Boot aus Amsterdam, jünger, hübscher und unendlich viel schneller. Ein Schwimmbad ist zum Schwimmen da, nicht zum Schwatzen und Sichtreibenlassen, fand Ester. Sie wollte hören, wie ihr der Wind um die Ohren pfiff und wie das Wasser klatschend gegen die Kraft ihrer flossengleichen Arme, ihres geraden, schmalen Körpers protestierte.
Es war ein ungleicher Kampf, und sie siegte. Die Damen zogen sich beleidigt in eine der Buchten am oberen Ende des Beckens zurück. Schuldbewußt herrschte Ester über ihre freigeräumte Strecke. Jetzt war nur noch der Schwimmer da, der sie mit seinem langsamen Tempo quälte. Er meckerte nicht und ließ sich auch nicht vertreiben. Er wurde zu ihrer Bake, um die sie herum- und an der sie vorbeischoß. So schnitt sie unverwandt durch das weiche, laue Wasser. Seine Anwesenheit förderte ihren Fanatismus.
Ob einem nun Beachtung geschenkt wird oder nicht, man wähnt sich immer von einem Zuschauer bewundert, dachte sie. Komisch, sich vorzustellen, daß sich vielleicht jeder so beobachtet fühlt.
Sie zählte. Achtzig Bahnen waren ihr Quantum. Die Bewegung, im Grunde nichts weiter als eine statische [25] Mechanik des Hin und Her, nichts Darüberhinausgehendes, einfach nur sinnlose Bewegung, vermittelte ihr die schöne Illusion des Vorwärtskommens. In großen, unbekannten Seen zu schwimmen reizte sie nicht. In solchen unüberschaubaren Gewässern war die Bewegung beängstigend, führte zu nichts – jedenfalls nicht zu der Klarheit und tiefen Zufriedenheit, die ihr die statische Bewegung innerhalb des gesteckten Rahmens, der Grenzen eines Schwimmbeckens brachte. Zuviel Abenteuer lenkte ab. Nur die Wiederholung förderte die innere Bewegung.
Achtzig Bahnen und ein leerer Geist voller Erwartung.
6
Auch nach dem Schwimmen fühlte sich ihr Magen noch seltsam taub an. Ester sah sich in ihrem Zimmer um, das quadratisch und geräumig war. Auf dem bernsteinfarbenen Steinfußboden lag ein kostbarer alter Teppich. Darauf stand das Bett, über dem ein Baldachin angebracht war. Das Badezimmer schien dem Boudoir einer Haremsdame aus einem Märchen von Tausendundeiner Nacht nachempfunden zu sein, mit filigranen blauen Lämpchen an den Wänden und einem Mosaik am Kopfende der Badewanne.
Gerade als sie sich in die Wanne setzen wollte, klopfte es an der Tür. Im ersten Moment fürchtete sie, sie könnte sich in der Zeit vertan haben und es wäre schon die Kontaktperson von der Kongreßorganisation, doch ein Blick auf ihre Armbanduhr beruhigte sie. Sie schlug sich ein Handtuch um und ging zur Tür. So geräuschlos wie möglich [26] hängte sie die Sicherheitskette vor und öffnete die schwere Tür einen Spaltbreit.
»Ja?«
»Entschuldigen Sie die Störung«, tönte es auf englisch aus dem großen Gesicht eines kräftigen Mannes mit wildem, grauschwarzem Haar. Es war der Schwimmer.
»Ja?«
»Ich habe das hier am Schwimmbeckenrand gefunden. Ich sah Sie schwimmen… und bin der Spur zu Ihrem Zimmer nachgegangen.«
Ungläubig faßte sie sich an den Hals. Nichts. Das Goldkettchen mit dem sentimentalen kleinen Davidstern war weg. Sie streckte die Hand aus, panisch, gierig. Als sei es selbstverständlich, daß der Gegenstand sofort wieder den Besitzer wechselte, ohne das Opfer der Höflichkeitsfloskeln.
»Ich dachte mir, ich bringe sie Ihnen am besten gleich selbst, bevor sie jemand stiehlt. Ich brauchte ja nur den Fußabdrücken zu folgen.«
Hinter ihm sah Ester in der Tat noch feuchte Flecken auf den Fliesen, die von ihren nackten Füßen stammten.
»Gehört sie Ihnen?«
»Ja!« Mit einer Hand krampfhaft das Handtuch festhaltend, öffnete sie die Tür ganz. Weiterhin bemüht, die Formalitäten auf ein Minimum zu beschränken, streckte sie erneut die Hand aus, ganz Bettlerin. »Ich hatte sie noch gar nicht vermißt, was für ein Glück. Meine Mutter…«
Ihre Stimme erstarb – war so viel Demut nötig? Es war ja ihre Kette!
Sachlich und ohne weiteren Kommentar ließ er die Kette [27] in ihre Hand gleiten. Ester zuckte zusammen und bog sich im selben Moment vornüber, weil sie spürte, daß ihr Handtuch ins Rutschen geriet. Sie stießen mit den Köpfen zusammen. Sie roch sein Haar, ganz kurz nur, ein leichtsinniger Erdgeruch. So viel Nähe hatte sie nicht erwartet.
Er lachte. »Harter Kopf!« In seinem Gesicht blitzte gelassener Spott auf. »Halten Sie Ihr Handtuch fest«, fügte er hinzu, und in seinen zuvor distanzierten, fast schon desinteressierten Blick schlich sich für den Bruchteil einer Sekunde Neugierde. Eine leichte Verschiebung, die etwas veränderte.
Esters Erinnerungsvermögen würde damit noch Probleme haben, das wußte sie schon jetzt. Nur mit Mühe würde sich aus dieser Folge von Wahrnehmungen: daß dieser Mann nach Erde roch, daß die Zeit seinem Gesicht und seinem Körper heftig, aber in beruhigender Weise zugesetzt hatte, und dann diese zugekniffenen Augen, die sich mit einem Mal durch ihr Handtuch zu brennen schienen, eine Logik des Geschehens machen lassen.
Es hatte etwas Unwirkliches, so gut wie nackt zu sein. Vor allem das nicht vorhandene Höschen war ihr bewußt, die nassen Füße, die Blöße ihrer Schultern. Sie fühlte, wie sie für einen Moment zu einer anderen wurde, einer Frauenfigur, einem Abziehbild des Verführerischen. Aus dem festen Griff um die Handtuchecken wurde eine subtile Geste: eine lockende Möglichkeit. Sie sahen einander an, nicht mehr spöttisch, sondern besiegelnd, mit dem Ernst einer Verabredung, die unausgesprochen blieb. Ein kleines Auflachen folgte, und es trat eine kurze Stille ein.
»Also vielen Dank.«
[28] Hochgezogene Augenbrauen, herablassend. »Keine Ursache.«
In seinem Blick lag etwas atemberaubend Kühles. Er drehte sich um und ging, den Flur hinunter. Das Kettchen mit dem kleinen Davidstern fiel nun doch noch auf den Steinboden.
7
Restaurant Luce, Jerusalem, 2. April, 20.00 Uhr
»Ich mache das, weil deutsche Kinder nicht mehr wissen, wer Hitler war!« sagte die alte Dame mit dem ausgeblichenen roten Haar. Ruth Lasker hieß sie. Mit gekrümmtem, leicht gelblichem Finger grub sie das weiche Innere aus ihrem Brötchen und klemmte es, während sie sprach, zwischen Zeige- und Mittelfinger.
»Ich habe einen Dokumentarfilm gesehen. Darin hat ein junger Deutscher auf die Frage, was Hitler für ihn bedeute, gesagt, Hitler habe viel für Deutschland getan, die Autobahnen gebaut, die Wirtschaft angekurbelt. Vom Rest wußte er nichts – oder wollte er nichts wissen.«
Jetzt fuchtelte sie mit der Hand, in der sie das Brot hielt, als wollte sie jedermanns Aufmerksamkeit darauf lenken. Eine Inszenierung, sah Ester, die fasziniert zuschaute, eine Inszenierung aus Unsicherheit.
Sie hatte sich schon an den Tisch gesetzt, Ruth schräg gegenüber, obwohl die Runde, der Zahl der Stühle nach zu urteilen (acht), noch nicht komplett war. Außer Ester [29] hatten sich zwei Soziologen von der Hebrew University sowie ein Schriftsteller dazugesellt, von dem sie noch nie gehört hatte. Keiner von ihnen durfte wohl den Krieg mitgemacht haben.
Ruth schien die neuen Tischgenossen kaum registriert zu haben. Sie redete einfach weiter. »Und eines der interviewten Mädchen, ich schätze, sie war um die Zwanzig, rätselte doch tatsächlich: ›War das nicht der Erfinder des Fahrrads?‹ Ungelogen, das hat sie tatsächlich gesagt! Erschreckend, finden Sie nicht?« Sie schnaubte und zog geräuschvoll die Nase hoch. Ihre Klauenhand bewegte sich über den Tisch. Ester sah, daß sich das Stück Brötchen allmählich zu einer kleinen Kugel formte.
Rundum wurde respektvoll und beipflichtend genickt.
»Ihre Großmütter und Großväter haben mich früher im Namen des Monsters verhöhnt und verfolgt«, sagte die alte Frau. »Drei Jahre war ich als Kind in vier verschiedenen Konzentrationslagern eingesperrt. Und jetzt, jetzt wissen ihre Enkel nicht einmal mehr, wer er war? Selig sind die Unwissenden und die Armen im Geist, aber ich klappere die Schulen ab mit meiner Geschichte, und die hat es in sich! Sollen sie ruhig ein bißchen unseliger werden. Und wenn ich mit ihnen fertig bin, ist es immer totenstill.«
Ruth warf einen Blick in die Runde – alle starrten auf die Tischplatte: totenstill, dachte Ester – und steckte sich das Brotkügelchen in den Mund.
Ruths Stimme war anfangs tief und laut gewesen, hatte aber im Laufe ihrer Erzählung immer höher und dünner geklungen, als sei sie allmählich selbst nicht mehr so ganz von ihrer Geschichte überzeugt. So recht sie auch hatte, da [30] war etwas in ihrer Art zu sprechen, etwas Grobes, Heftiges, weshalb ihre Worte nach anfänglichem Wohlwollen keine Resonanz in der Runde fanden, schon gar nicht bei Ester. Alle waren bewegt, doch es blieb unbehaglich still.
Daß der Krieg in dieser Runde Gesprächsthema war, verwunderte nicht, aber Ester spürte sofort die altvertraute Müdigkeit in ihrem Rücken und die dumpfen Kopfschmerzen wiederkehren – ihre Examensarbeit war beinahe fertig gewesen, aber das Essen schmeckte ihr nicht mehr, und die Stimmen anderer klangen immer so hohl.
8
Daß es Ester sein würde, die Karriere an der Universität machte, noch dazu mit Tagebüchern, und nicht einer der ehrgeizigen Knaben ihres Jahrgangs, war für alle, nicht zuletzt für sie selbst, eine Überraschung gewesen. Examen zu machen war ihr lange utopisch erschienen, doch als sie dann ihr Abschlußzeugnis hatte, wurde ihr bewußt, daß ihr die Ruhe der Forschung fehlen würde. Nachdem sie sich jahrelang schwergetan hatte, Disziplin und Kontinuität zu entwickeln, war ihr die Besinnlichkeit der Lektüre von handschriftlichen Aufzeichnungen, des geduldigen Suchens nach Konstanten und Parallelen in den darin festgehaltenen Beobachtungen und Gedanken zu Zeit und Leben und der Anfertigung von Notizen dazu zu einem wirklichen Bedürfnis geworden. Sie hatte das leise Geräusch ihres Füllers auf dem glatten weißen Papier der alten Schulhefte, die sie benutzte, zu lieben begonnen.
[31] Nur in den Stunden an ihrem Schreibtisch war sie ruhig und fühlte sich am richtigen Platz. Da war sie ein Mensch mit Plan und Ziel und mit einer Persönlichkeit, die sie überschauen und steuern konnte, ohne allzusehr in Verwirrung zu geraten. Es schien ihr, als seien diese Stunden aus einer reizvolleren, unbeschwerteren Substanz als die Zeit, die sie unter Menschen zubrachte. Sobald sie ihren sicheren Ort verließ, war ihr, als verliere der Boden unter ihren Füßen an Festigkeit, und überzeugt von Unzulänglichkeiten auf breiter Front, entwickelte sie leichte Symptome von Seekrankheit.
Ester war süchtig nach Tagebüchern. Zwar verbannte sie alle ihre eigenen alten chinesischen Notizbücher, schwarzen Moleskinkalender und Schulhefte voller zwanghafter Gedanken und Beobachtungen immer mal wieder in einem weißen Pappkarton in den hintersten Winkel, um sie ein für allemal aus ihrem Gedächtnis zu streichen, doch auch auf dieser Reise steckte wieder ein Notizheft in ihrer Tasche, das danach schrie, beschrieben zu werden.
Das Angebot zur Promotion hatte wahrhaft befreiend auf Ester gewirkt, denn sie war sich schnell darüber im klaren gewesen, daß das unter anderem dank der verschlungenen Wege der Fördergelder Jahre in Anspruch nehmen würde. Manchmal mußten Untersuchungen für Monate unterbrochen werden, weil das Geld ausblieb und sie gezwungen war, sich mit Artikeln und Buchbesprechungen in Wochen- und Monatszeitschriften etwas dazuzuverdienen.
Die Tagebücher, die sie untersuchte, stammten vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts und waren von ganz [32] gewöhnlichen Menschen geschrieben. Material, das bei Haushaltsauflösungen, in Archiven und Nachlässen aufgetaucht war. Ester mußte sie sichten und analysieren. Verblüffend für sie war, mit welcher Selbstverständlichkeit die Laienschriftsteller offenbar die nachweislichen Neuerungen ihrer Zeit hinnahmen. Mit sehr viel größerer Leidenschaft widmeten sie sich dagegen den universellen persönlichen Angelegenheiten: Liebesdingen, Klatsch und Tratsch, Vorsätzen und anderen allzu menschlichen Umtrieben – woran Ester ihre Freude hatte.
Auf die Einladung, bei einer Konferenz über Holocaust-Unterricht in Yad Vashem, Jerusalem, von ihrer früheren Arbeit und deren Ergebnissen zu berichten, hatte Ester zuerst gar nicht reagiert. Die Kriegstagebücher hatte sie nach ihrer Examensarbeit erleichtert ad acta gelegt, das Thema war für sie passé. Sie war bei ihrer Untersuchung seinerzeit beinahe verrückt geworden. Verrückt über den Krieg, das Elend, die Assoziationen mit dem Ungesagten ihres Vaters, verrückt über die Erkenntnis, daß sich so vieles Entsetzliche der Wahrnehmung der Tagebuchschreiber entzogen hatte. »Tragische Ironie« hieß so etwas in der klassischen Literatur, aber sie als Forscherin hatte allmählich ein immer größeres Schuldbewußtsein beschlichen. Erst als sie ein sanftmütiger alter Therapeut davon hatte überzeugen können, daß es bei ihrem familiären Hintergrund nicht unbedingt sinnvoll sei, sich andauernd mit dieser einen widerwärtigen Periode der Geschichte zu befassen, hatte sie beschlossen, das Thema nach dem Studium abzuhaken und sich etwas Neuem zuzuwenden. Damit wurde zugleich eine Phase großer Ruhe, ja buchstäblicher Stille [33] eingeläutet, nachdem ihre Recherchen sie zuvor wer weiß wohin geführt hatten.
Gerade in Israel war sie aber nie mehr gewesen. Und so war es außer der Möglichkeit, sich physisch von Philip zu entfernen, vor allem die Aussicht darauf, dieses Land wiedersehen zu können, die sie schließlich doch für die Teilnahme an der Konferenz hatte zusagen lassen. Ja, sie glaubte an Kreise, die sich schlossen.
9
Am Tisch begann nach höflichem Schweigen ein Amerikaner von einem Holocaust-Museum zu erzählen, mit dessen erzieherischem Konzept ein ungeahnt hohes Maß an Holocaust-Empathie erzielt werde. Mit auf den Arm gestempelter Nummer dürften die Besucher dort einen gewöhnlichen Tag in Auschwitz erleben. Die Leute seien hinterher fix und fertig, behauptete er freudig.
Ruth schien den Mann kaum gehört zu haben, denn sie hatte sich mit mächtigem Appetit über ihr Essen hergemacht. Das Zuhören lag ihr offenbar weniger als das Reden.
Unglaublich, wie sich diese Frau binnen weniger Sekunden zur Außenseiterin gemacht hat, dachte Ester. Und das, obwohl sie doch so umgänglich als erste das Wort ergriffen hat. Ester selbst hielt sich immer eher zurück und hoffte, irgendwie aus der Lähmung ihrer Schweigsamkeit errettet zu werden.
Zwischen zwei Bissen lancierte Ruth schnell noch einen [34] Satz: »Ich möchte, daß Menschen begreifen, was Krieg für den einzelnen bedeutet. Was ist erschütternder und beeindruckender als das Persönliche? Dieser Krieg darf einfach nicht vergessen werden, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.« Obwohl sie über ihren Teller gebeugt war, tönte ihre Stimme wieder so laut wie zu Beginn.
Es wurde zustimmend gemurmelt.
Im Zusammenhang mit dem Krieg konnte Ester bestimmte Dinge kaum noch ertragen. Zum Beispiel, wenn darauf hingewiesen wurde, wie notwendig es sei, darüber Bescheid zu wissen. Das war doch eine so unumstößliche Tatsache, daß es schon fast etwas Beschämendes hatte, überhaupt daran zu rühren. Der Banalität des Bösen stand die Banalität des Guten gegenüber, in dem sich alle einig waren: Nie wieder A. Natürlich nicht, klar.
Oder war das etwa nicht mehr so selbstverständlich?
Die Soziologin, die zu den Organisatoren gehörte, eine tadellos gekleidete Frau mit sanften Augen, versuchte nun auch etwas einzuwerfen, zögernd, mit ängstlichem Blick auf Ruth. »Ich wollte vorschlagen…«, sagte sie, doch weiter kam sie nicht, denn es trafen neue Gäste ein. Flüsternd wurden Begrüßungen ausgetauscht, Hände geschüttelt. Leise setzte man sich dazu, um die Unterhaltung nicht zu stören.
»Aber ich spreche bei Tisch nicht gern von meiner Arbeit«, fuhr Ruth fort und drehte ihre Lautstärke erbarmungslos noch höher, während sie den Neuankömmlingen gemessen zunickte. »Reden wir lieber über Politik, die verdammte Politik der schmutzigen Hände, die diese Regierung betreibt. Eine Schande für die Geschichte ist das! Für [35] mich gehört Scharon auf den elektrischen Stuhl. So wie der die Palästinenser in unserem Namen verrät!«
Die Runde schreckte auf. Es war, als gehe ein Beben durch die Anwesenden, und es wurde unangenehm still – wie in der Achterbahn, unmittelbar bevor man aus der Schwebe nach unten kippt, dachte Ester.
Der israelische Autor, dessen Gesichtsausdruck bei Ruths vorherigen Worten unergründlich, aber respektvoll geblieben war, holte tief Luft. Mit starrem Blick auf Ruth sagte er: »Eine Schande, ja, ja! Zumal man jetzt in jedem x-beliebigen Café in die Luft gesprengt werden kann! Wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden?« Er bemühte sich sichtlich, seine Stimme zu beherrschen. An seiner wütend erhobenen Gabel zitterte ein Stückchen rotes Fleisch. Als Ruth seinen Blick nicht erwiderte und auch nicht antwortete, ließ er es in seinem Mund verschwinden und kaute schnell und wild.
Die beiden Soziologen von der Hebrew University sahen einander mit aufkeimender Verzweiflung im Blick an. Der Mann begann Ruth zu erklären, daß die Palästinensische Autonomiebehörde eine korrupte Bande sei, die die eigene Bevölkerung benachteiligt und sich selbst bereichert habe. Die sanfte Frau löste ihn mit einer langen Reihe von Beispielen ab. Ein amerikanischer Psychologe mit langem, pockennarbigem Gesicht, der müde und grau aussah, schaltete sich mit vorsichtigen Rückschlüssen auf die menschenfreundlichen Ideen der Palästinenser ein, die er aus einem Interview mit der Mutter eines Selbstmörders gezogen hatte, was den israelischen Autor erneut in Rage brachte.
Als hätte Ruth einem Rudel Wölfe ein Stück Fleisch [36] hingeworfen, dachte Ester. Zunächst nähern sie sich vorsichtig und mit scheinbarem Widerstreben, doch wenn sie einmal angebissen haben, wird gekämpft und gezerrt und nach einander geschnappt, bis kein Härchen und kein Knöchelchen mehr von der Beute übrig ist.
Sie dachte an den Wachtposten, der draußen vor dem Restaurant auf seinem Stuhl gehangen und interessiert auf ihre Beine unter dem kurzen Rock geguckt hatte. Zu dem kurzen Rock trug sie ein tailliertes weißes Jäckchen. Ihre langen rotbraunen Haare hatte sie hochgesteckt, und den Lidstrich hatte sie heute abend nicht zu vorsichtig aufgetragen. Wie ein läufiger Teenager. Bescheuert.
Es gebe keine Hoffnung, hörte sie den Schriftsteller im Brustton der Überzeugung sagen, es gebe keine Lösungen mehr. Nicht von ungefähr sei ein zweiter Aufstand ausgebrochen. Warum hätten die Palästinenser nicht einen einzigen Kompromiß akzeptiert?
Jetzt hatte jeder eine inbrünstige Überzeugung und sprach sie aus, ob man ihm nun zuhörte oder nicht. Nur Ruth war derweil definitiv verstummt.
Auch Ester, die nun endlich Worte in sich brennen fühlte (»Und wenn die Israelis ihre Siedler endlich irgendwo anders unterbrächten als in diesen vermaledeiten Siedlungen in den besetzten Gebieten?«), schwieg. Sie hatte keine Lust, Ruth beizuspringen. Sie trank zwei Gläser Wein und nahm einen Bissen Pittah mit Humus. Es schmeckte ihr nicht. In ihrem Magen hatte sich ein höllischer Kreisel in Gang gesetzt. Einen Moment lang schien sich der Tisch, an dem sie saß, zu bewegen, als triebe er auf dem Wasser, und es war ihr fast unerträglich, sitzen zu bleiben.
[37] 10
Restaurant Luce, Jerusalem, 2. April, 22.00 Uhr
Hinter dem gläsernen Vorbau, in dem sie gegessen hatten, befand sich, wie sich zeigte, ein beachtlicher Saal, in dem der offizielle Empfang stattfand. Schon während des Essens hatte Ester in einem fort Leute hereinkommen sehen und sich gefragt, wo sie alle blieben.
Kaum daß sie den Saal betreten hatte, schlug ihr die leicht hysterische Atmosphäre entgegen, die sie schon von anderen Zusammenkünften in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg her kannte. Da gab man sich die größte Mühe, sich ja nicht zu amüsieren, war aber zugleich sichtlich entzückt über die Begegnung mit Menschen, die die gleiche Obsession hatten. Und da diese Obsession mit Geschehnissen verknüpft war, die schon vor ziemlich langer Zeit stattgefunden und dementsprechend nivelliert worden waren, sah Ester auch hier wieder Leute, die trotz ihrer aufrichtigen und ernsten Betroffenheit nicht verschleiern konnten, daß sie sich ganz in ihrem Element fühlten. Ester hörte, wie sich geübte Konferenzgänger in vertrauter Weise begrüßten: gefühlsbetont und herzlich, aber auch gelangweilt, da mittlerweile routiniert im relativ ungerührten Umgang mit den grauenhaften Erfahrungen und Erinnerungen, die sie miteinander verbanden und vom Rest der Welt trennten.
Flott gekleidet und frisiert spazierten die verantwortlichen Damen umher, stolz auf die harte Arbeit, dank deren diese vortreffliche Gesellschaft nach Israel und hierher gekommen war.
[38] Ester schlenderte zum Getränketisch hinüber. Sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut, wie immer bei Treffen, die mit dem Krieg und dem Judentum zu tun hatten. Wie ein Eindringling kam sie sich vor, illegal durch die Maschen des Netzes geschlüpft, zu jung und eigentlich auch, ohne es zu wollen, zu frivol. Daß sie schon siebenunddreißig war, sich dieser Materie etliche Jahre ihres Lebens gewidmet hatte (und dabei rechnete sie noch nicht einmal die Jahre mit, in denen sie sich um ihren Vater gesorgt hatte) und meistens eher introvertiert als leichtfertig war, änderte nichts daran. Überdies war es ungewohnt, sich der Welt wieder allein stellen zu müssen. Das war lange her.
Es hatte Zeiten gegeben, da sich Ester auf gesellschaftliche Ereignisse gefreut hatte, auf Semesterfeten, Kneipen- und Diskothekbesuche und die großen anonymen Partys, die früher oft gegeben wurden. Mit Lola zusammen hatte sie eine Zeitlang jede Möglichkeit zum Ausgehen wahrgenommen, und eine Party war ein vollkommener, sei es auch vorübergehender Lebenszweck gewesen. Etwas, worauf man sich freute und was man anschließend, mit hemmungslos mythisch verklärenden Partygeschichten, gerne erinnerte. Auch sich selbst hatten Lola und Ester seinerzeit als Figuren in Geschichten betrachtet. Manchmal hatten sie die Geschichten sogar in Briefen festgelegt.
Nachdem sie mit Philip zusammengezogen war, hatte sich Ester allmählich immer mehr zu Hause verschanzt. Nun, da sie mit ihm zusammen war, erschien ihr das Ausgehen, ob zu Ausstellungseröffnungen, Universitätsfesten oder Restaurantbesuchen, immer weniger nötig, weniger interessant und somit auch immer weniger reizvoll. [39] Komischerweise hielt sie das für ein gutes Zeichen, einen Beweis dafür, daß sie mit Philip ein wahrhaftiges, ruhiges, glückliches Leben führte, schlicht und rein, ursprünglich. Das Berufsleben an der Universität, die Geborgenheit zu Hause, mit dem Besuch von Verwandten und Freunden als hauptsächlicher Ablenkung, das alles paßte zu alten Vorsätzen, zu ihrem Bild davon, wie das Leben zu sein hatte. Sie war stolz auf die Präzision, die Übersichtlichkeit, stolz, daß es funktionierte und sie es im Griff hatte. Die Briefe und E-Mails von Victor L. vor vier Jahren, das Geknutsche mit Ad Z., dem Professor ihrer Fakultät, ein halbes Jahr danach und die vielen Flirts mit anderen bei Studientreffen oder Gesprächen in der Mittagspause hatten so wenig damit zu tun, daß keiner dieser Vorfälle für sie ins Gewicht fiel. Selbst das eine Mal vor knapp zwei Jahren, als sie sich im Archiv von einem ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter, Allard E., oberhalb ihrer halterlosen Strümpfe hatte befummeln lassen, hatte keinerlei Raum in ihrem Leben mit Philip eingenommen (und war auch Gott sei Dank folgenlos geblieben). Lola, die immer alles herausbekam, hatte über ein solches Maß an Heuchelei nur den Kopf geschüttelt.
Und dann, urplötzlich, war es vorbei gewesen mit der Ruhe. Ester konnte nicht mehr schlafen und erbrach regelmäßig alles, was sie zu sich genommen hatte. Wie sie sich mit Philip verstehe, wollte der Therapeut wissen, den sie erneut zu Hilfe gerufen hatte. Wolle sie denn keine Kinder?
»Natürlich möchte ich Kinder!« hatte sie in einem Ton entgegnet, als handle es sich dabei um ein gewagtes [40] Unternehmen, das sie noch längst nichts anging. Und dann hatte sie einen Lachkrampf bekommen, der unmerklich in Weinen übergegangen war.
Zum erstenmal hatte sie sein Gesicht wahrgenommen. Mit, wie es schien, aufleuchtenden runden, braunen, klaren Augen lächelte er sie an, sein Bart so rot, daß er flammte. »Du bist siebenunddreißig«, sagte er. »Noch ist es nicht zu spät!«
»Zu spät!?« Sie war hochgefahren. Ja, was hatte sie denn gedacht? Etwa, daß sie noch viel zu jung dafür sei? Und dann hatte sie ihm erzählt, was bis dahin niemand wußte, nicht einmal sie selbst. Daß sie wegen Philip kein Kind haben konnte oder wollte. Weil sie selbst mit ihm Kind bleiben wollte, Studentin, nicht Mutter. Weil sie bei ihm niemals genug Bodenhaftung entwickeln würde, um Mutter werden zu können.
Sie hatte zwei Koffer gepackt, Essen gekocht und auf Philip gewartet. In geradezu amtlichem Ton hatte sie ihm ihren Entschluß mitgeteilt. Sie wußte, daß sie keine Zeit mehr zu verlieren hatte. Sie mußte weg.
Er war in Tränen aufgelöst gewesen, als sie ihn zurückließ, bis ins Innerste seiner Seele verletzt. Er habe schon seit Jahren von Kindern gesprochen, hatte er gesagt.
»Wirklich?« hatte sie gefragt, ohne grausam sein zu wollen, denn ihr Erstaunen war aufrichtig. Sie konnte sich tatsächlich nicht erinnern, je mit ihm darüber gesprochen zu haben.
Bis auf ein vages Schuldgefühl hatte sie bei dem Gespräch nicht viel empfunden. Nüchtern und hart war sie gewesen, als ginge es sie nichts an. Philip hatte einen vollen [41] Aschenbecher nach ihr geworfen, der sie nur um ein Haar verfehlte. Sie war Philip dankbar für den Versuch, aber geholfen hatte es nichts. Kalt wie Stein war sie geblieben.
Die Einladung nach Yad Vashem hatte zu dem Zeitpunkt schon seit einer Weile neben ihrem Computer gelegen. Nun überwand sie ihr Widerstreben. Eine Reise würde die Trennung festigen. Und in weniger als einer Woche fand sie eine Wohnung im Amsterdamer Pijp-Viertel.
11
Von seiten der Organisation wurden Begrüßungsworte an sie gerichtet, und ein Konservator von Yad Vashem erläuterte Sinn und Zweck der Konferenz. Es wurde geklatscht, und danach stand es jedem wieder frei, umherzugehen und sich mit den anderen bekannt zu machen. Auch hier im Empfangssaal – modern und hell, viel Glas und Holz – gab es mehr als reichlich zu essen. Gierig bediente sich eine lebhaft redende Menge von dem Büfett mit Dolmas, Humus, Tehina und Pittah; nicht jeder war wie Ester vorher zum Abendessen eingeladen gewesen.
Leicht beschwipst von dem Weißwein, den sie zum Essen getrunken hatte, blieb Ester einige Minuten lang stehen und schaute sich um. Die seltsame, fast schon sündhafte Erwartung, die sie im Laufe des Abends verspürt hatte, hatte sich noch nicht verflüchtigt, und so war sie leicht verärgert, als ihr jemand zuwinkte, dem sie lieber nicht wieder begegnet wäre: Aram, der israelische Autor. Er stand im Kreis einiger anderer Männer und lachte ihr entzückt zu. [42] Sie lächelte schwach zurück, begann sich aber dennoch einen Weg durch die Menge zu bahnen.
»Heee«, sagte der Autor. Seine Stimme klang freudig und schmeichelnd, ganz anders als beim Essen, bei dem er sich als kurzsichtiger rechter Falke erwiesen hatte. Ester bedachte ihn mit einem leicht spöttischen Blick. Männer, die einen in seriöser Runde als Gesprächspartnerin aufgegeben hatten, aber plötzlich einen ganz anderen Ton anschlugen, wenn das Licht schummriger wurde, der Wein floß und die Arbeit getan war, vor denen mußte man sich in acht nehmen.
»He, Schönheit, leiste uns doch Gesellschaft! Ich stelle dich allen vor.« Dieses Zwinkern! Sie gab den drei anderen Männern die Hand, alle Israelis, deren Blicke sich erwartungsvoll aufhellten.
»Aus welchem Krieg?« fragte einer von ihnen, blaß, schütteres Haar, als er hörte, daß Ester über Kriegstagebücher geschrieben hatte und deswegen zu der Konferenz hier war.
»Dem zweiten, Weltkrieg, Juden, die untertauchen mußten. Ester hat viel über Kriegstagebücher geschrieben, sie ist zu der Konferenz hier.«
Es folgte eine kurze, peinliche Stille. Man beäugte sie neugierig, beinahe scheu, als käme sie vom Mond, mit Problemen aus einem anderen Universum. Und sie hatte gedacht, daß alle hier etwas mit der Konferenz zu tun hätten. Dann fragte der Israeli weiter, und die drei anderen versuchten schmunzelnd, ihr in dem Lärm die Reaktion vom Gesicht abzulesen: »Und, was war die Schlußfolgerung?«
Der Autor nahm ein Getränk für sie von einem Tablett. [43] Durch die Oberlichter des Restaurants schallten Fetzen von arabischer Musik aus einem vorüberfahrenden Auto in den Raum hinein.
Ester antwortete wie aus der Pistole geschossen, sie machte das nicht zum erstenmal. »Daß Menschen sich zum Gegenstand einer Geschichte machen, um nicht im eigenen Vergessen zu verschwimmen. Daß die wahren Menschen, die, die nicht so leicht aufgeben, die, die überleben, ihre Erinnerungen pflegen und ordnen. Daß es hilft, wenn man die Welt, die man kennt, festzuhalten versteht, und sei es nur auf Papier.«
»Wow.«
»Ja, wow. Aber trotzdem haben Tagebuchschreiber nicht immer überlebt. Meistens überlebte nur ihr Tagebuch.«
»Warum beschäftigst du dich damit?«
»Oh, das war einmal. Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört. Inzwischen untersuche ich andersartige Tagebücher. Ich hatte genug vom Krieg.«
»Bist du Jüdin?«
»Teilweise.«
Hier griff der Autor, der amüsiert, ja fast schon mit Beschützermiene zugehört hatte, mit strengem Auflachen ein: »Du kannst doch nicht teilweise Jüdin sein.«
»Doch. Ich bin Halbjüdin. Durch meinen Vater…«
Die Männer scharrten mit den Füßen und lachten blöd. Als Vaterjüdin zählte man praktisch nicht, das wußte Ester. Sie wollte sich gerade empört dazu äußern, als sie neben sich einen tiefen Seufzer hörte. Es war Ruth, die Frau mit dem fahlroten Haar.
»Hach«, entfuhr es Ruth sichtlich erleichtert, als hätte sie [44] alte Freunde wiedergefunden. Das Gespräch verstummte augenblicklich. Ester sah, daß die alte Frau viel kleiner war, als sie bei Tisch gewirkt hatte. Und die vermeintliche Unerschrockenheit, mit der Ruth in ihre Gesichter aufschaute, ließ zum erstenmal blanke Angst erkennen. »Schon wieder Essen!« stöhnte Ruth laut. »Da tue ich heute nacht bestimmt kein Auge zu.«
Die Augen der vier Männer wurden glasig. So gierig ihre Blicke bei einer relativ jungen Beute geworden sind, so rasch flaut das Interesse im Beisein dieser schwermütigen alten Frau ab, dachte Ester. Schnippischer als beabsichtigt entgegnete sie: »Keiner zwingt uns, davon zu essen.«
»Du gehörst offensichtlich einer anderen Generation an«, sagte Ruth beinahe vergnügt. »Wenn etwas zu essen da ist, muß es gegessen werden. Das läßt sich nicht mehr austreiben.«
Darauf stahlen sich die Israelis wie auf ein vereinbartes Zeichen hin leise davon. Als sei Ester nun, da sie mit Ruth sprach, in derselben deprimierenden Aura gefangen. Da standen sie denn. Ester war in Verlegenheit, mit einem Mal empfand sie unendliches Mitleid.
»In welchem Hotel sind Sie?« fragte sie.
»Weitestmöglich von der Altstadt entfernt. In Neubauten fühle ich mich viel wohler als in all diesem vornehmen, alten Mist.«
»Oh«, sagte Ester.
»Michaels war doch dein Name, nicht?« fuhr Ruth fort, lebendiger denn je. »Kann es sein, daß ich deinen Vater gekannt habe? Aus Westerbork? Ich kannte einen Simon – hieß er Simon? – Michaels.«
[45] »Mein Vater hieß Jacob«, sagte Ester. »Aber in Westerbork ist er in der Tat gewesen.«
»Verdammt, Jacob! Jacob? Nein – oder doch? Jetzt muß ich mal ganz genau nachdenken. Das ist das Abscheuliche am Alter, daß man so viel vergißt. Jacob…«
Ester antwortete nicht. Sie spürte das Brennen eines Blicks im Rücken.
12
Es gab nicht viel, worauf man zurückgreifen konnte. Da war er, der spöttische Riese, mit seiner sympathischen Mission: Das Kettchen bringen wir dem Mädchen einfach mal eben. Oder hatte schon gleich etwas mehr hinter dieser Geste gesteckt? Und da war sie: mit dem umgeschlagenen Handtuch für einen Augenblick ein verführerisches Filmwesen, verhalten anfangs, und danach dieser eigenartige Moment. Ihre Überraschung, daß das Los auf sie gefallen war, wo sie doch gänzlich, na ja, fast gänzlich arglos gewesen war. Gesehen und bemerkt zu werden war wunderbar, und zugleich hatte es etwas Unheimliches, wie zu fallen. Ihr Schnauben und Prusten beim Schwimmen: Was war zum Beispiel damit? Und wie hatten ihre Schenkel ausgesehen, als sie sich aus dem Becken hochstemmte?
Es war nur so wenig passiert. Er hatte kurz ihre Hand berührt, als er ihr die Kette gab, das war alles. Das hätte auch gar nichts bedeuten können. Verdammt, sie hatte keine fünf Minuten mit dem Mann geredet. Trotzdem hielt irgend etwas sie davon ab, sich umzudrehen.
[46] Daß sie nicht zuhörte oder antwortete, fiel Ruth offenbar nicht auf. »Einen Jacob Paardekooper habe ich gekannt, in Theresienstadt.«
Und da trafen sich ihre Blicke. Seine Augen erstarrten kurz in der gleichen Ausdruckslosigkeit wie die ihren, klammerten sich dann aber (wenn sie sich nicht täuschte) an ihnen fest. Es dauerte einen Moment, ehe sie sich wieder an ihre Manieren erinnerte. Nun ja, Manieren: Ruth war vergessen.
»He, was machst du denn hier?« fragte sie heiser. Angesichts einer solchen Schicksalhaftigkeit kam ihr Reden banal und unnütz vor. Daß Ruth kopfschüttelnd und in sich hineinmurmelnd davonging, nahm sie nur halb wahr.
Er hatte sich, ohne sich zu verabschieden, von dem lachenden Grüppchen abgewandt, mit dem er sich zuvor unterhalten hatte. Der Ausdruck in seinen Augen blieb konstant, ein konzentrierter Blick, der nichts verriet. »Ich wurde eingeladen. Man lade mich ein, und da bin ich.«
»Ich auch.« Jetzt kam das schiefe Grinsen von ihr: Einvernehmen über geteilte Lasten der Konversation. Nur hatte sie eigentlich nichts für Ironie übrig.
Die war auch schon nicht mehr nötig. Er faßte sie sanft beim Oberarm und sagte tatkräftig: »Raphael Goldberg, BBC. Soll ich ein Interview mit dir machen?«
»Ester Michaels. Ein Interview?«
»Auf zweieinhalb Stunden Band kriegt man schon ein ordentliches Stück Leben.« Er kniff die Augen zu und grinste. »Und es ist ein Alibi, um eine ganze Weile mit dir in einem geschlossenen Raum sein zu können, ohne daß irgendwer mißtrauisch wird.«
[47] »Das hast du bestimmt schon öfter gesagt«, sagte Ester und schnappte verstohlen nach Luft. »Du weißt ja nicht mal, was ich mache.«
»Ebendarum. Und du unterschätzt mich.«
Wie wir einander jetzt anstarren, so nehmen auch Tiere aus der Distanz Witterung von den gegenseitigen Intentionen auf, dachte Ester. Sie sah, wie sein Gesicht beschaffen war. Der erste, oberflächliche Eindruck von Wildheit rührte von seinen Augen her, die dunkel waren, mit schweren, schwarz umrandeten Lidern. So verlebt sein Äußeres auch auf den ersten Eindruck gewirkt hatte – vielleicht hatte er sich nicht rasiert gehabt –, er hatte ein ebenmäßiges Gesicht. Die wirren Locken sollten bestimmt kaschieren, daß sich sein Haar schon ein klein wenig zu lichten begann. Es störte sie nicht. Vielmehr konstatierte sie mit leichtem Schwindel, daß alles an ihm sie ruhig machte. Es gefiel ihr, daß er so kräftig war und sich sein Haar lichtete. Das machte ihn nicht weniger anziehend, im Gegenteil.
»Na?« fragte sie.
»Ich weiß, weshalb du hier bist.«
»Woher weißt du das?« fragte sie beinahe patzig.
Er antwortete nicht gleich. Vielleicht aus Effekthascherei. »Du kommst mir auch wie eine Tagebuchschreiberin vor, weißt du das?« sagte er dann.
»Ist das ein Makel?«
»Keineswegs! Ich führe selbst seit zwanzig Jahren Tagebuch. Kurze Notizen, um mir bei all dem Irrsinn hier den Kopf freizuhalten.«
Sie schwieg.
»Ertappt! Du erforschst Tagebücher, da wirst du dich [48] doch wohl deines eigenen nicht schämen!« sagte er lachend.
Es tat ihr gut, daß er allem Anschein nach wußte, wer sie war und was sie machte. Sie faßte sich wieder. »Mein eigenes Tagebuch ist wirklich nicht für andere bestimmt«, sagte sie und bedauerte sogleich ihren Ernst. Daher fügte sie hinzu: »Trotzdem… hoffe ich auf so etwas wie einen allwissenden Strandräuber, der die Flaschen mit meinen Botschaften findet. Dann kennt mich wenigstens einer.« Sie dachte an das Motto in ihrem Tagebuch: Unbemerkt ist so gut wie tot.
Er musterte sie einige Sekunden lang beinahe ernsthaft. Sie fragte sich, ob sie betrunken war.
»Ein allwissender Strandräuber – das kann nur einer sein, scheint mir. Jetzt verstehe ich, warum dir unwohl dabei ist: Das klingt religiös!«
»Mir ist durchaus nicht unwohl«, sagte sie. »Und religiös bin ich auch nicht.«
Sie sah, wie er auf ihre Beine schaute.
»Nein«, sagte er. »Den Eindruck hatte ich auch nicht. Bist du allein hier?«
Sie tat so, als beobachte sie mit großem Interesse ein junges Mädchen, das seinen Hund zu dem Empfang mitgebracht hatte. »Die Tagebücher, die ich untersuche, enthalten eine Fülle von Fakten und Begebenheiten und sind doch alle beinahe genauso persönlich wie meines. Ja, ich bin allein.«
Sie lächelten unterdessen einfach weiter, als sei die Unterhaltung eine Art Alibi, um lächeln zu können.
»Was ist denn?« fragte sie.
[49] »Nichts. Du hast eine ulkige Nase. Sie bewegt sich ein bißchen, wenn du sprichst.«
Sie bemühte sich, nicht zu lachen. Von anderen, die vorübergingen, fing sie Gesprächsfetzen auf. »Und bin dann allein aus Theresienstadt zurückgekommen… Mußte dann sehen, wo ich unterkomme…«, hörte sie, und unvermittelt überkam sie das Gefühl, daß sie träume und alle ihre Erinnerungen, Eindrücke und Empfindungen der vergangenen Jahre wie Gegenstände durch die Luft schwebten. Als wohne sie in diesem Augenblick einem Finale bei und ihr Leben werde nun die Richtung finden, in der sie weitergehen würde.
Wahrscheinlich hörte Raphael nichts, so intensiv sah er sie an. Plötzlich sagte er: »Ich beschreibe Fakten, nichts als Fakten, ich verstehe nichts, analysiere nichts. Ich ersaufe in Fakten und Realitäten. In Israel ersäufst du in der Realität – und von daher ist hier alles wie eine Art Traum. Beziehungsweise ein Alptraum.«
»Bist du schon lange hier?«
»Arbeitest du für den Mossad?«
»Als Korrespondent, meine ich.« Sie sang es, um nicht lachen zu müssen.
»Ach so. Ja, schon Jahre. Seit 1997. Davor war ich in Istanbul. Herrlich, der Nahe Osten, hier gibt es immer was zu tun…«
Sie bemerkte, daß Ruth sich wieder näherte, und versuchte, sich so von ihr wegzudrehen, daß es nicht auffiel.
»Machst du etwas über diese Konferenz fürs Fernsehen?« fragte sie. »Wozu bist du eigentlich hier?«
Er lachte nicht.
[50] »Um dich schwimmen zu sehen, wozu sonst? Kommst du mit?«
Seine Hand krümmte sich sanft und doch fest um das weichste Stück ihres rechten Oberarms. Auch er hatte Ruth gesehen.
»Bitte?« bat er.
13
23.10 Uhr
In seinem Jeep sagten sie zunächst eine Weile nichts. Sie schaute auf seine Hände am Lenkrad. Seine Finger waren behaart. Ihr war schwindlig, sie vergaß beinahe zu atmen. Langsam und schwer klopfte ihr das Herz in der Kehle.
»Wohin fahren wir?« fragte sie.
»In unser Hotel?«
»Ach, du wohnst auch dort?«
»Wenn ich in Jerusalem zu tun habe, schon. Ich wohne in Tel Aviv, aber nachts fahre ich nicht gern.«
Sie starrte nach draußen. Diese Stadt war unbekannt, dunkel und wutgeladen, und sie kannte sich nicht in ihr aus, und dennoch hatte sie keine Angst. Sie kannte diesen Mann nicht, aber das war ihr einerlei. Sie erkannte sich selbst nicht wieder, und das war wunderbar.
Sie fuhren am verlassenen Jaffator vorüber und weiter an der hohen Mauer entlang, die majestätisch die Altstadt schützte. Bis auf einige lärmend hupende Autos war es still und ruhig auf der Straße zum Damaskustor, und doch war [51] hier für Ester latent alles da: die Hitze, die Menschenmengen, die geschäftstüchtigen Händler, die kauflustigen Kunden. Nur den Haß, den Haß, der Menschen einander töten ließ, den konnte sie sich in diesem weichen Licht, dieser erwartungsvollen, mit orientalischen Lauten angefüllten Stille nicht vorstellen.