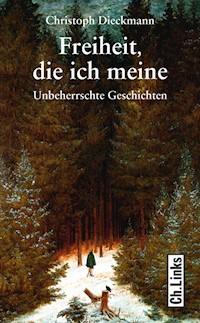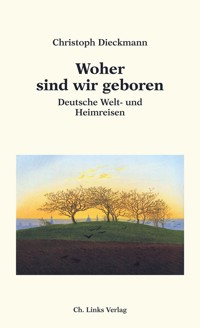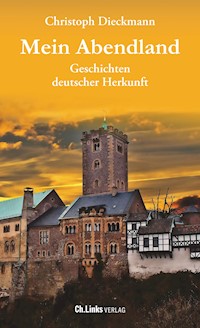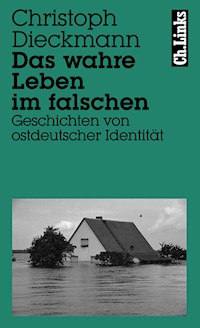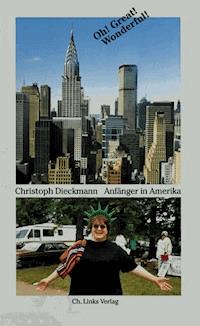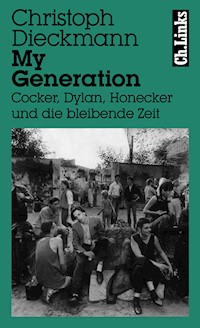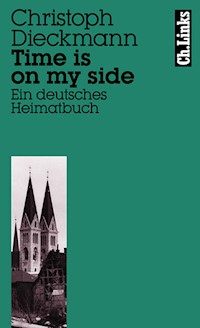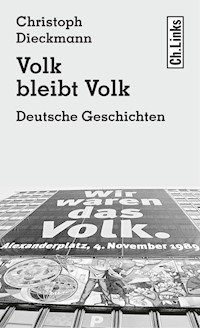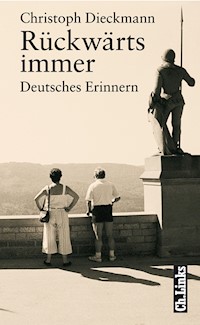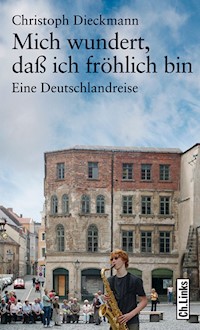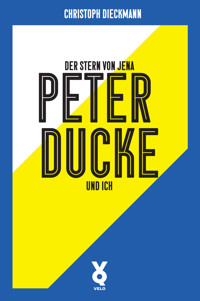
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1965 entdeckt der neunjährige Pfarrerssohn Christoph den Fußball – in doppelter Gestalt. Der sichtbare Fußball rollt auf dem Sportplatz von Traktor Dingelstedt am Huy, der unsichtbare im Radio, draußen in der weiten Welt. Dort gibt es eine sagenhafte Stadt namens Jena. Ihr Stadion liegt im Paradies, ihr Stern heißt Peter Ducke. Sieben Jahre später trifft der Jena-Fan sein Idol. Eine herbe Enttäuschung – zum Glück nicht die letzte Begegnung. Christoph Dieckmann schildert die kurvige Laufbahn des ungewöhnlichsten Kickers der DDR. Zugleich erzählt er Fußball als deutsche Zeitgeschichte, vom Nachkrieg bis in die Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Dieckmann, 1956 als Pfarrerssohn in Rathenow/Brandenburg geboren. Kindheit am Harz (Dingelstedt bei Halberstadt, ab 1968 Sangerhausen). Facharbeiter für Filmwiedergabetechnik. Studium der Theologie in Leipzig und Ost-Berlin. Danach Vikar und kirchlicher Medienreferent. Freiberuflicher Autor für DDR-Kirchenzeitungen und die kulturpolitische Wochenzeitung „Sonntag“ (ab Herbst 1990 „Freitag“). Seit 1991 Autor und Reporter der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“. Viele Buchveröffentlichungen, zuletzt „Woher sind wir geboren. Deutsche Welt- und Heimreisen“ (2021). Zahlreiche Ehrungen, u. a. Egon-Erwin-Kisch-Preis und Theodor-Wolff-Preis. Mitglied des PEN. Lebt in Berlin-Pankow.
© Verlag Voland & Quist GmbH
Berlin und Dresden 2024
Reihen-Hrsg. IKONEN:
Frank Willmann
ISBN 978-3-86391-370-0
eISBN 978-3-86391-413-4
voland-quist.de
Umschlaggestaltung und Satz:
Guerillagrafik
Druck und Bindung:
BALTO print, Vilnius
CHRISTOPH DIECKMANN
DER STERN VON JENA
PETER DUCKE
UND ICH
Denn schnell und spurlos geht des Mimen Kunst
Die wunderbare, an dem Sinn vorüber,
Wenn das Gebild des Meisels, der Gesang
Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben,
Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab,
Und wie der Klang verhallet in dem Ohr,
Verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung,
Und ihren Ruhm bewahrt kein daurend Werk.
Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preiß,
Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze,
Drum muß er geitzen mit der Gegenwart,
Den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen,
Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern,
Und im Gefühl der würdigsten und besten
Ein lebend Denkmal sich erbaun – So nimmt er
Sich seines Nahmens Ewigkeit voraus,
Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Gethan, der hat gelebt für alle Zeiten.
Friedrich Schiller, Jenaer Stürmer, 1798
Das erste Fußballspiel meines Lebens sah ich 1965, im Alter von neun Jahren, in Dingelstedt am Huy. Mein Vater war Pfarrer. Unser Pfarrhaus, 1580 erbaut, umgab ein riesiger naturwüchsiger Garten. Sein Wald stieß an eine Mauer. Sie schied mein Kindheitsparadies von der Welt.
Eines Sonntags – die Eltern ruhten zwischen Mittag und Kaffeetrinken – durchdrang die dörfliche Stille ein fernes Geschrei. Es schwoll an und ab, Signalhörner mischten sich ein. Ich kletterte über die Mauer und lief in Richtung Lärm. Ich endete auf dem Sportplatz oben am Huywald und war sofort gebannt. Zwei bunt bedreßte Männerhorden kämpften um einen Ball. Ein Polizist in Schwarz versuchte den Streit zu schlichten. Wenn er in seine Trillerpfeife blies, stoppte das Getümmel, dann tobte es fort. Fünfhundert Dingelstedter umdrängten die Stätte. Sie brüllten, tuteten, schmähten die Gelben, befeuerten die Blauen. Ich erfuhr, hier spiele Traktor Dingelstedt gegen Traktor Ausleben. Die Masse war Einheitspartei, die Fremdlinge erfuhren keinerlei Sympathie. Mitleidig wählte ich ihre Seite. Als ihnen ein sogenanntes Tor gelang, wüteten etliche Erwachsene in Gossensprache. Ich jubelte, insgeheim.
Ausleben siegte 2:1. Die Geschlagenen trotteten hinunter ins Dorf. Gesenkten Hauptes schritten die Spieler durch das Spalier des Publikums. Ihre Schuhe schnalzten auf dem Kopfsteinpflaster wie alltags die Hufe der schweren Harzer Pferde. Dann verschwanden sie in Schmagolds Gaststätte. Daheim wurde ich schon vermißt. Das Kaffeetrinken war längst vorbei. Ich bekam noch ein Stück Bienenstich, doch mein sprudelnder Bericht wurde kaum verstanden. Ich rannte zu Vaters Schreibmaschine und hackte das übergroße Erlebnis ins Papier. Als könnte ich es vergessen!
Mein zweites Fußballspiel sah ich am 8. Mai 1965. Das hatte ich nicht vor, als ich zum Fernsehkukken Nachbar Krems besuchte. Wir besaßen nur ein Radio. Neidvoll lauschte ich, wenn Klassenkameraden von televisionären West-Genüssen schwärmten: von den Serien „Flipper“, „Lassie“ und „Fury“, von „Rauchende Colts“ und „Am Fuß der blauen Berge“. Mitunter lud ich mich bittstellerisch ein. Das konnte mißlingen. Die schwerhörige Tante Schiefler, die oben im Pfarrhaus eine muffige Kemenate bewohnte, schätzte meine Gesellschaft während der so entsetzlichen wie unendlichen Volksmusikschau „Zum Blauen Bock“. Auch Onkel Krems schaute heute nicht, wie erhofft, „Spiel ohne Grenzen“, den Städtewettkampf mit Camillo Felgen, sondern Osten: das Fußballpokalfinale SC Aufbau Magdeburg gegen SC Motor Jena.
Magdeburg war unsere Bezirksstadt. Jena, das klang wie Harem oder Samarkand, nach Orient und Tausendundeiner Nacht. Und diese Märchenmannschaft stürmte und traf, durch den unorientalisch benamten Helmut Müller. Der Reporter rief: Das ist die Führung für die Männer aus dem Paradies!
Welche Botschaft! Waren Jenas Spieler Engel, zumindest Pastorensöhne wie ich? Das Märchen endete rasch. Der Magdeburger Walter köpfte den Ausgleich. Onkel Krems brüllte lustvoll auf – und wenig später wieder, als der Schiedsrichter einen Elfmeter verhängte. Hirschmann lief an, Jenas weißbehoster Torwart Fritzsche flog in die falsche Ecke. Schlußpfiff. Onkel Krems griff in die Bierkiste, ließ die Bügelflasche ploppen, trank und las behaglich auf dem Harzbräu-Etikett den Vers:
Es grüne die Tanne,
es wachse das Erz,
Gott schenke uns allen
ein fröhliches Herz.
Meins blutete. Ich sah die traurigen Männer aus dem Paradies. Sie sanken hin. Die Magdeburger stemmten den FDGB-Pokal, ein bronzenes Ballarbeiter-Denkmal, jubelnd gen Himmel. Perfekt!, rief Onkel Krems. Jetzt kotzt Jena ab!
Dieser Siegersatz trieb mich für immer zu den Opfern. Ich glaubte, es wäre es den Männern aus dem Paradies ein Trost, wenn sie mich fortan auf ihrer Seite hätten. An diesem 8. Mai 1965, dem 20. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, begann für mich eine lebenslange Liebeshaft. Für‘s erste belehrte mich der Atlas, wo Jena lag. Vom Nachspiel erfuhr ich viel später. Etliche Jenaer hatten wütend diskutiert. Das 1:1 sei Abseits gewesen, der Elfmeter unberechtigt. Schiedsrichter Riedels ultimatives Bubenstück war sein letzter Pfiff. Er beendete die Partie bereits nach 82 Minuten. Das enthüllte der Zeiss-Chronist Udo Gräfe in „Jenas Fußball-Journal. Geschichte und Statistik“ (2001). Das Finale war acht Minuten zu kurz. Warum?
Wegen der Friedensfahrt. Es drohte Verlängerung. Nach meiner Erinnerung füllte das Pokalendspiel die Zeit zwischen dem Etappenstart „Rund um Berlin“ und der Zielankunft im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. In der „Neuen Fußballwoche“ („Fuwo“) schrieb Günter Simon von einem „zeitlich frühen Beginn vor Eröffnung der XVIII. Friedensfahrt“, so daß die Radsport-Zeremonie wohl auf das Fußballspiel folgte. In jedem Fall sollte es ohne Extrazeit enden.
Ein Jenaer erstritt eine persönliche Verlängerung. Die „Fuwo“ meldete: „Peter Ducke schädigte durch sein Verhalten in grober Weise das Ansehen der sozialistischen Sportbewegung. Obwohl in diesem Endspiel mehrfach dramatische Höhepunkte auftraten, kann dies in keiner Weise ein Verhalten rechtfertigen, das in grober Disziplinlosigkeit zu Beleidigungen und Unsportlichkeiten führte, wie dies nach diesem Endspiel durch den Sportfreund Ducke der Fall war.“ Der Unhold hatte der Gewerkschaftsführung mitgeteilt: EUREN SCHWEINEPOKAL KÖNNT IHR BEHALTEN! Für dieses Angebot wurde Peter Ducke zehn Wochen gesperrt.
Noch ist er mir nicht besonders aufgefallen, geschweige denn mein Stern. Das ändert sich mit meinem ersten Länderspiel. Am 9. Oktober 1965 laufe ich durchs halbe Dorf, zum Fußballfan Onkel Rittmüller, dem Sohn der alten Küsterin und Vater meines Klassenkameraden Ulli. Die DDR spielt in Budapest gegen die hochfavorisierten Ungarn. Aus der „Volksstimme“ weiß ich, daß der Sieger zur Weltmeisterschaft nach England reisen darf. Wobei den Magyaren bereits ein Unentschieden reicht.
Ich sehe mich noch auf Rittmüllers Bauerncouch. Der Reporter, den ein orkanisches Tosen umbraust, ruft mehrfach das Wort Hexenkessel. 80 000 Magyaren wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Einer nicht: der Budapester Károly Sós, seit 1961 Nationaltrainer der DDR. Seine Schützlinge sind unsere Jungen. Sie heißen Horst Weigang, Otto Fräßdorf, Manfred Walter, Manfred Geisler, Waldemar Mühlbächer, Herbert Pankau, Henning Frenzel, Jürgen Nöldner, Dieter Erler. Der ist Mittelfeldregisseur und unser Kapitän. Im Sturm wirbeln die Jenaer Gebrüder Roland und Peter. Vorerst freilich tun sie nicht dergleichen, sondern die feurigen Szardas-Kikker, die Söhne der Pußta machen das Treiben verrückt. Ihasz, Sipos, Bene und der elegante Dr. Fenyvesi – diese Männer haben Paprika im Blut, wie Farkas und Rákosi auf den Flügeln, und in der Mitte feiert Flórián Albert, der Ferencvaros-Wunderkicker, sein 50. Länderspiel. Gleich nach dem Anpfiff knallt er haarscharf vorbei! Dann hält Weigang bravourös. Dann Tor, nein, aberkannt! Wieder Reflex von Weigang! Latte! Doch da, da, in der 31. Minute: Mühlbächer, 40-Meter-Paß auf Nöldner, der gibt nach halbrechts auf Peter Ducke, der geht auf und davon und schießt aus spitzem Winkel ins lange Eck. Gelei ist geschlagen! Das ist die Führung in diesem Hexenkessel, das ist das Tor, von dem Millionen Fußballanhänger in unserer Republik geträumt haben!
Na, nu übertreib man nich, sagt Onkel Rittmüller zum Fernsehapparat.
Zehn Minuten später rutscht Benes Eingabe unserem Torwart Weigang durch die Beine. Hinter ihm steht Rákosi und schiebt ein. Der Ausgleich. Was für ein Geschenk zum 27. Geburtstag des sympathischen Magyaren! Kurz nach der Pause knallt Novaks Freistoß an Mühlbächers Hacken, und der Ball liegt abermals in unserem Netz.
Doch dann zaubert die DDR und erblüht wie nie. Ungarns Abwehr steht unter Druck. Pankau, Schuß, abgewehrt, Mühlbächer, abgewehrt, Ecke, Kopfballverlängerung durch Erler nach halblinks auf Peter Ducke. Volleyschuß, Tor, Tooor! Torhüter Gelei war noch mit der Hand am Ball. 2:2!
Alles ist wieder offen, alles ist wieder möglich, liebe Fußballfreunde in der Heimat. Wieder Erler auf Ducke, der steht plötzlich vor Gelei, und er müßte schießen, und er schießt, und Gelei liegt am Boden, und der Ball ist nicht im Tor. Fortuna, die launische Dame, hat es anders gewollt. Sie wünscht vielmehr, daß im Gegenzug Farkas trifft, zehn Minuten vor Ultimo, nach Weigangs Fehler. 3:2. Doch unsere Jungen geben sich nicht auf, sie kämpfen, sie zerreißen sich, Peter Ducke, was macht er, Schuß, nein, Mátrai hat den Ball. Und jetzt führt Schiedsrichter Andsjulis, der famose Referee aus der Sowjetunion, die Pfeife zum Mund und beendet dieses denkwürdige Spiel.
Wie 1954, sagt Onkel Rittmüller, bloß andersrum. Unsre von hier sind eben nicht unsre von drüben.
Ich trolle mich mit meinem Ball zum verwaisten Fußballplatz und schieße Tor um Tor, immer eins für Ungarn und dann eins als Peter Ducke. Mit dessen letztem Schuß, schon in der Dunkelheit, qualifiziert sich die DDR sensationell doch noch für England. Der Wald steht schwarz und schweiget. Auch das Dorf ist stumm, wie 80 000 erschütterte Magyaren. Vaters Kirche läutet mich heim.
Mein erstes Länderspiel war das einundzwanzigste von Peter Ducke und das zweiundsechzigste der DDR. Die firmierte damals als „Deutsche Nationalmannschaft“, so vermerkt es die „Große Länderspiel-Ausgabe“ der „Fuwo“ Nr. 41 vom 12. Oktober 1965. Zehn seiner sechzehn Seiten widmet das Fachblatt dem Budapester Spiel. Die Titelseite zeigt Peter Ducke und meldet: „Trotz des 2:3 können wir zufrieden sein“. Die Druckqualität der Photos auf Holzpapier ist dürftig, doch die schiere Menge an Sachtext, die epische Erzählung des Spiels entstammt einer verlorenen Hochkultur des Sportjournalismus. Zunächst berichtet Chefredakteur Klaus Schlegel doppelseitig unter der Schlagzeile: „WM-Tickets verloren - dennoch ziemlich viel gewonnen“. „Zehn Minuten führten wir, zehn Minuten winkte uns England, dann unterlagen wir in einem international erstklassigen Spiel nach eindrucksvoller Leistung einem großartigen Gegner, erhielten aber die Gewißheit, daß von unserer Elf noch viel zu erwarten ist. So begeisternd, so prachtvoll trumpften wir noch nie auf wie in der zweiten Halbzeit“. Gewonnen, „und das auf lange Zeit“, habe man „das Vertrauen der Fußball-Öffentlichkeit in unserer Republik“. Zahlreiche Telegramme seien eingetroffen: „´Herzlichen Glückwunsch für unsere Mannschaft. Danke für schönes Spiel.´ Das telegrafierte Otto Mellies vom Deutschen Theater (wobei unsere Jungen sicher froh wären, wenn sich mal ein Treffen mit dem bekannten Schauspieler vereinbaren ließe). ´Ihnen, lieber Herr Soos, und Ihren Spielern möchte ich als Nichtfußballer herzlich für das schöne Spiel danken.´ So hieß es in einer Depesche von Ingenieur Meinhold von der Großbaustelle des Zementwerkes Rüdersdorf.“
Etwas gedämpfter äußern sich die Rundfunk-Reporter Wolfgang Hempel und Werner Eberhardt. Hempel bemängelt die wackelige Abwehr, Eberhardt bekennt seine Panik nach den ungarischen Auftakt: „da änderte ich meine optimistische Prognose, daß wir zwei Tore schießen und damit vielleicht gewinnen können, spornstreichs in ein 5:0 für den Gegner um“. Die ausführliche Einzelkritik ist überschrieben: „Alles war sich einig: Peter Ducke war der Beste!“ „Wie er antrat, seine Gegenspieler mitunter reihenweise stehenließ, gefährlich schoß, zwei Treffer erzielte, dabei trotz harter Attacken fair blieb, nie meckerte oder aufsteckte, das rechtfertigt das hohe Lob, das er gut verstehen und als Ansporn und Verpflichtung für künftige Spiele betrachten sollte. ´Ich könnte mich ohrfeigen´, sagte er selbst, ´bei der Großchance nach dem 2:2 nicht die Nerven behalten zu haben.´“
Auffällig ist das Loblied auf die sowjetischen Unparteiischen. „Selten haben wir ein so harmonisch aufeinander abgestimmtes Kollektiv erlebt. (…) Schiedsrichter Andsjulis stand den Besten nicht nach, bot eine tolle Leistung“. Der 36jährige Litauer, „von Beruf Journalist“, pfiff erst sein zweites Länderspiel und „war eine der großen Entdeckungen dieses Tages. Dieser Mann könnte in absehbarer Zeit selbst ein WM-Finale leiten.“