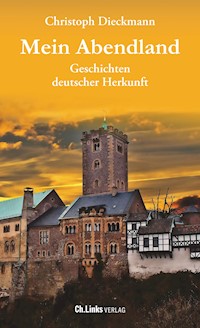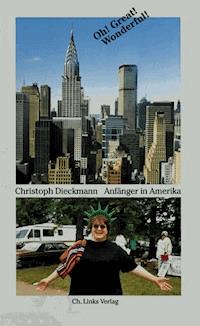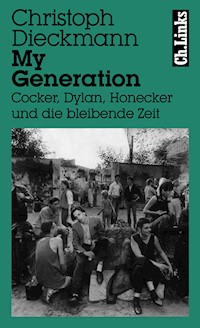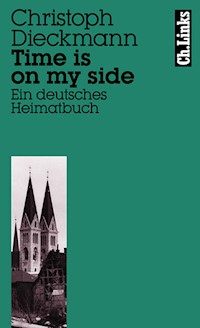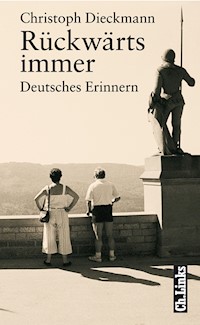4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Christoph Dieckmann, vielfach preisgekrönter Reporter der ZEIT, hat sein fünftes Buch einem Reizthema gewidmet: der ostdeutschen Identität. Gibt es sie überhaupt? Verklärt sie nicht die DDR? Sabotiert sie »die Einheit«?
Dieckmann hält nostalgische Verstockung und eilfertige Anpasserei für zwei Seiten derselben Gefahr: der Zerstörung von Persönlichkeit. Wirkliche Identität braucht Selbstbewußtsein.
Er hat mit Bürgerrechtlern und Stasispitzeln gesprochen, besuchte Jens Weißflog und Karl-Eduard von Schnitzler, er berichtet vom Kindermord in Saalfeld, von der Oderflut und den Geisterdörfern am Krater des Tagebaus, und natürlich wird auch das unendliche Drama des Fußballclubs Carl Zeiss Jena fortgeschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph Dieckmann
Das wahre Leben im falschen
Christoph Dieckmann
Das wahre Lebenim falschen
Geschichten vonostdeutscher Identität
Meinen Kindern Sophie Luise und Cornelius Lin
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2017
entspricht der 3. Druckauflage vom Dezember 2000 (Erstveröffentlichung 1998)
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von Christoph Dieckmann: Die Ernst-Thälmann-Siedlung während des Oderhochwassers 1997
Lektorin: Dr. Petra Kabus
eISBN 978-3-86284-386-2
Inhaltsverzeichnis
Kindheitsmuster oder Das wahre Leben im falschen
Zeitlese
Literatur als Asyl
Dichters Ort
Die Weihnachtsgeschichte
Die Freiheit der Zensur
Heimatkundliche Betrachtungen zum Erlaubniswesen
Schalke, Krenz und König Hettel
Sieben Kapitelchen ostdeutsche Identität
Das Hirn will Heimat
Der Abendschein des Stephan Hermlin. Ein Sermon wider die Kampfgruppen der Selbstgerechtigkeit
Das schweigende Land
Ost und West driften wieder auseinander
Was Sachsen gerne sehen
Ossis Fernbedienung
Das letzte Westpaket
Günter Grass’ »Ein weites Feld« wird im Osten geliebt als Verteidigung des Lebens in der DDR
Die preußische Verlobung
Berlin und Brandenburg sollen fusionieren müssen
Die deutsche Trennung
Grenzen der Einheit
Danke, Herr Ampelmann!
Ein schwäbischer Jungkapitalist verherrlicht das SED-Regime
Die heilige Schrift
Eine Rede wider das Verschwinden der Sprache in der Gegenwart
Bis hierher. Und wie weiter?
Ein Tag der Einheit mit den Erfurter Erklärern
Das normale Rechts-Gefühl
Zwei Begegnungen mit Peter Hintze
Heldendämmerung
Ehrhart Neubert und die Rockband Pankow sind nicht mehr, was sie waren
Der Spitzel und sein Dorf
Ostrau bei Halle will seinen Stasi-Bürgermeister behalten
Das Herz der Welt
Leben im Geisterdorf
Ein feste Burg
Horno läßt sich nicht verheizen
Grenze Oder Heimatland
Der Sommer der Flut
Die Fahnen im Wind
Saalfeld zwischen rechts und links
Die Politik der Kinder
Der Mord an Jana
Achtzig verweht
Karl-Eduard von Schnitzler ist so unverbesserlich wie der Kapitalismus
Bundesadlers Feierobnd
Jens Weißflog ist für immer gelandet
Der Opportunist
Georg Buschner hat sich lieber nur für Fußball interessiert
»Wir sind Jena und ihr nicht!«
Der FC Carl Zeiss Jena muß begreifen, daß er größer ist als Thüringen
Die Auswärtsschwäche
Ein Requiem auf die Fußball-Sommerpause
Das Leben nach dem Tod
Axel Jüptners Abschiedsspiel
Mein Osten
Grenzerfahrungen eines Befindlichkeitsreporters
Quellenverzeichnis
Bildnachweis
Über den Autor
Kindheitsmuster oder Das wahre Leben im falschen
Diese kleine Geschichte wurde im September fünfundzwanzig Jahre alt. An ihrem Ende steht der Tod, was man gar nicht denken sollte von so einer kleinen Geschichte. Doch bis dahin sind’s noch dreizehn Tage – eine Ewigkeit für Kinder und vielleicht die Rettung, da doch die Erinnerung nichts mit dem Tode beschließt. Wir sehen das Kind, den Jungen, wie er das backsteingelbe Schulhaus verläßt. Er läuft die Borngasse entlang, hält ungeduldig inne an der vielbefahrenen Hüttenstraße, überquert sie riskant. Am elterlichen Pfarrhaus stürzt er die Treppe hoch. Er klingelt wild. Die Mutter öffnet. Er wirft den Ranzen hin. Ein Mittwoch ist; die Erinnerung vermutet Suppentag, Linsen mit Knackern und Senf. Der Junge schlingt. Am Bahnhof steht er viel zu früh, denn er ist zu einer Freude unterwegs.
Stunden später sehen wir den Jungen wieder, in der großen Stadt. Im Zug hat er, und nicht zum ersten Mal, die »Neue Fußballwoche« mit der Vorschau auf das große Spiel gelesen. Sein feuerrotes Kassettentonbandgerät steckt in Vaters alter Ledertasche, aus der sich, am Kabel, ein erhebliches Mikrophon ziehen läßt. Denn heute abend wird der Junge ein Reporter sein. Jetzt sitzt er auf einer Parkbank vor dem Klinikum, ißt langsam einen Florentiner und studiert abermals die »Neue Fußballwoche«. Ein Mann erscheint. Mitte Zwanzig ist er vielleicht, und ganz gewiß quillt rechts an seinem Hals ein riesiges violettes Ei.
Na, Meiner? sagt der Mann. Stück mal ’n Rück! (Nimmt Platz.)
Guten Tag, sagt der Junge und schielt auf die Geschwulst.
Ich hab’ auch mal Fußball gespielt, sagt der Mann. Ich hab’ so allerhand gemacht. Bis das da kam. (Zeigt auf den Hals.)
Der Junge weiß nichts zu sagen.
Meiner, ich sage dir, der liebe Gott hat keinen Plan. Sonst hätt’ er Ulbricht oder Sindermann den Tumor drangehext und nicht mir.
Sindermann ist der SED-Bezirksfürst, Ulbricht seit kurzem Pensionär. Der Junge fühlt sich nicht befugt, die Planlosigkeit Gottes unwidersprochen hinzunehmen. Das violette Ei gebietet freilich Takt.
Man kann sich ja auch für Fußball interessieren, wenn man selbst nicht spielt, sagt der Junge.
Mich interessiert nur noch das Wetter, Meiner. Wenn ich raus kann, kann ich rauchen. Drinne meckern die Schwestern.
Der Junge beendet den Florentiner schneller als geplant und sagt: Ich glaube, ich mach’ mich mal los.
Zweiunddreißigtausend Menschen füllen das Stadion mit den fiebrigen Geräuschen, die der Junge aus dem Radio kennt. Es dunkelt. Im Flutlicht gleißt der Rasen. Ein Schalmeienzug bläst schrill die Erregung auf, bis aus dem Tunnel die Spieler kommen – rot-weiß die Hallenser, weißgrün Eindhoven, der hohe Favorit. Da, der lange Jan van Beveren, der Nationaltorwart. Da, auf Linksaußen der bullige Belgier Johan Devrindt. Pfiff: Hoekema und Mulders stoßen an …
Es wurde kein großes Spiel. Halle hatte Respekt, und die Holländer kontrollierten alles ganz zufrieden, so daß der Junge mit dem Mikrophon viel Raunen und Stöhnen aufnehmen konnte, aber nicht den Großen Schrei. Als es vorbei war und die Massen heimwärts schoben, drängte der Junge gegen den Strom hinab zum Innenraum und sprang über die Brüstung auf die Aschenbahn. Die Ordner, ältere Männer, ergriffen ihn. Er zeigte ihnen das Tonbandgerät. Sie lachten und schoben ihn in den Kabinengang. Halles Spieler kamen aus der Dusche: der bissige Riedl mit dem lädierten Bein, Meinert, der Schrank, der seriöse Kapitän Bransch. Dem großen Klaus Urbanczyk rutschte das Handtuch. Splitternackt schrieb er das Autogramm.
Auch die Holländer spendeten Autogramme, schwungvolle Kringel, kaum zu entziffern. Anders als in der sozialistischen Sportbewegung wurden im Kapitalismus die Stars wohl nicht zur leserlichen Unterschrift erzogen. Endlich Jan van Beveren, Devrindt gleich dahinter. Mit fliegender Hand hob ihnen der Junge das Mikrophon vor die Nase.
Die Dingelstedter 5. Klasse auf ihrem Schulausflug in den Harz (1967).
Sind Sie zufrieden mit dem Unentschieden?
Wenn man als Torwart Nullen behalt, is gutt, sagte van Beveren.
Wie lautet Ihr Tip für das Rückspiel?
Wollen wir ja gewinnen, sagte Devrindt.
Jaja, sagte van Beveren.
Wie gefällt Ihnen Halle?
Wir haben noch nicht so viel gesehen, sagte Devrindt.
Ich glaub is gutt hier, sagte van Beveren, worauf ein Herr im Anzug erschien und dem Jungen erklärte, seine Spieler müßten jetzt ins Hotel.
Wer sind Sie? fragte der Junge und hielt ihm die Autogrammkarte hin.
Ich bin der Manager vom PSV Eindhoven, sagte der Herr und unterschrieb ganz leserlich: Bernardus van Geldern.
Da wagte der Junge zu fragen: Haben Sie bitte ein Clubabzeichen für mich?
Bernardus van Geldern betrachtete den Pulk von Autogrammjägern, der die Szene gierig verfolgte, und sagte leise: Hier ist nicht so gut. Kommen Sie ins Hotel, da geb’ ich Ihnen eins.
Ins Hotel. In welches? Der holländische Bus war fort. Der Junge fragte einen Kerl nach Halles bester Bleibe, wo möglichst auch ausländische Westsportler wohnten. Interhotel, entschied der Befragte, roch nach Schnaps und zeigte sich erbötig zur Begleitung.
Der Suffke kannte die schrägsten Abkürzungen, die finstersten Gassen. Er plapperte trunkenen Stuß, er trug dem Jungen sogar die Tasche, er legte ihm die Pranke auf die Schulter und fuhr ihm seltsam freundlich durch das lange Haar. Dann sagte er: Das wär’s.
Wo ist denn das Hotel?
Täubchen, du pennst bei mir. Du bist ’ne ganz Scharfe. Das wird unsere Nacht.
Ich muß ins Interhotel, sagte der Junge entsetzt. Ich bin doch ein Junge.
Der Kerl schwieg ins Dunkel. Dann brüllte er: Du bist ’ne Alte! Hose runter!
Der Junge entriß ihm die Tasche und raste davon. Schwitzend und hechelnd fand er das Interhotel, huschte durch das prächtige Foyer, folgte dem Wegweiser »Restaurant« und sah sich unverzüglich inmitten der Eindhovener Spieler. Sie lümmelten in Trainingsanzügen auf kostbaren Polstern. Sie alberten und aßen Trauben und Braten von silbernen Platten. Ein Livrierter erschien. Er packte den Jungen am Arm, musterte angewidert die Kutte und die Fransenjeans und kommandierte: Raus! Aber ganz plötzlich! – Ganz plötzlich war van Geldern da. Ich bin mit diesem jungen Mann verabredet, sagte er scharf. Wenn wir Probleme haben, rufen wir die Polizei. – Augenblicklich war der Ober Untertan und dienerte davon. Bernardus van Geldern zog eine Schatulle hervor und entnahm ihr ein Kleinod von Clubabzeichen, eine goldene Nadel mit schwerem ovalen Wappen. Der Junge stammelte Dank, schwebte zum Bahnhof und wartete in der Mitropa zwei Stunden auf seinen Zug in Richtung Harz.
Zum ersten Mal durchfuhr er die Nacht. Er war benommen vor Freude. Er tastete nach seinem Schatz und spielte sich leise das Raunen und Stöhnen des vergangenen Spiels vor. Der Zug hielt in einem Nest. Der Junge schaute hinaus und sah, wie ein großer Zeiger auf die Zwölf schwang; der kleine stand auf drei. Der Junge wußte, daß er immer wissen würde, daß er glücklich war. Aber das mußte er behalten und markieren, wie Taucher eine Boje setzen über einen Schatz im See. Es war der 16. September 1971, drei Uhr nachts, in Röblingen am See.
War der Osten wirklich so, wie Sie erzählen? fragen Westler manchmal, und Ostler: Wie kannst du dir bloß alles merken? – Alles nicht, nur manches. Viel mehr ging verloren – immer das Wichtige, ringsum Anerkannte, die Errungenschaften bildungsbürgerlicher Vernunft. Die alten Sprachen soffen ab, philosophische Terminologien stürzten ein, meine theologische Bewanderung reduzierte sich auf die Brühwürfelkunst gelegentlicher Aufgüsse. In politicis dasselbe. Und wovon handelte gleich noch »Der Ekel«, »Die Erziehung der Gefühle«, »Das Glasperlenspiel«? Sicher, alles wäre nachzuschlagen, doch was ist der Mensch ohne seine Apparate und die Bibliothek? Was fällt ihm im Traum ein? Aquarelle kindlicher Provinz, Trivialitäten, Ängste und Lust.
Nach manchen akademischen Gedächtnisexerzitien wider das Triviale habe ich mit meiner Erinnerung Frieden schließen müssen. Sie bleibt ein Magazin des Sentiments. Sie hütet Färbungen, Musiken, Liebes- und Fußballgeschichten. Wer ihre Auswahl achtet, dem dient die Erinnerung als getreue Archivarin höchsteigener Vergangenheit. Es kann der Mensch, was er nicht ist, erlernen, aber nicht behalten. Wir sind, was uns behält. Erinnerung ist weder praktisch noch komplett, nur wahr. Verallgemeinert, in Ämter gezerrt, aufgeputzt als Zeitgeist oder Theorie, verliert sie ihre Wahrheit: die Einzelexistenz des Menschen, seine Bindung an die ungewählte Zeit.
Wie fragmentarisch und egoman sich die Erinnerung beträgt, darüber hat Ingo Schulze seine »33 Augenblicke des Glücks« gedrechselt: eine russische Absurditäten-Matrjoschka über Glück im Unglück der anderen und die Unkonvertierbarkeit der Seele. Wieviel Ideologie war nicht ursprünglich individuelles Sentiment und wurde kollektiv entseelt, ausbetoniert mit Objektivität und Anspruch aufs Ganze. Und marschierte los, hochgerüstet mit Rassengesetz und Klassenmoral, Tochter ihrer Partei, Sohn seines Volkes, ehrenvoll soldatisch handelnd, auf daß keiner, der zu den Fahnen läuft, hören muß, was doch jeder hört aus der Erinnerung: Gedenke, du bist nur ein Mensch!
Daß sich viele Ostler ihrer Vorzeit schlecht erinnern können, liegt mittelbar an der gestrigen Ideologie. Dem Vergangenen fehlen die Kontraste. Allzu seßhaft lebte man in einem allzu kleinen Land mit allzu sicheren Grenzen und genormten Lebensplänen, die verläßlich garantierten, was nie geschehen würde und worauf man Anspruch hätte, falls man unsere gesellschaftliche Wirklichkeit akzeptierte und nicht fortging aus der größten DDR der Welt. Ja, man konnte sich das eingezäunte Gärtchen Erde weiten durch Grübelei, Lektüre, Liebe, Langsamkeit, in gemütlicher Kollaboration mit der Deutschen Reichsbahn, deren Tempo das Durchqueren der Republik zur kontinentalen Erfahrung machte.
Aber ich ging fort, beweist mir mein gutes Gedächtnis und gliedert mir die Zeit. Meine DDR-Jahre sacken nicht ineinander. Ich verließ ein Dorf, eine Kleinstadt, eine Kindschaft, noch ein Dorf, eine Großstadt, etliche Lehrer, etliche Lieben, oder sie verließen mich. – Nein, du bist geblieben, sagen mir mein alter Personalausweis und jene eingeborene Eifersucht, die sich immer meldet, wenn so ein zugereister, reingeschmeckter Broderbillermatussek sich publizistisch erkühnt, meinen Osten mit seiner Schnellfeder zu karikieren. Pfoten weg, spricht der Dörfler zum Städter, unsere Hühner treten wir selber.
Hanns-Joachim Friedrichs hinterließ bei seinem Tod den Imperativ, niemals dürfe sich der Journalist mit seinem Gegenstand verbinden, nicht einmal mit dem besten. Dieser ehrenwerte Unabhängigkeitstraum entstammt dem amerikanischen Positivismus, demzufolge die gesellschaftliche Vernunft erstens existiere, zweitens ein allgemeiner Konsens souveräner Fakten sei; die Fakten aber trügen ihre Deutung in sich selbst. Demnach wäre der gute Journalist zuerst ein Versammler von Daten, was der amerikanische ja ist. Er treibt Aufklärung, enlightenment. Immer mehr wissend, erhellt sich die gewußte Welt. Daß sie vergißt, vergißt sie.
Wir Deutschen neigen zu hohen und profanen Einwänden gegen den Faktenfrohsinn, vom anthropologischen Irrationalismus bis zum schlichten Fernsehverdruß. Die antiaufklärerische Mystik mag ich so wenig verstärken, wie ich Hajo Friedrichs’ Testament befolgen kann. Ich bin nicht unabhängig. Ich schreibe aus Verbundenheit mit meinem Gegenstand, dem Osten Deutschlands. Mich bindet Herkunft. Mich treibt Erinnerung. Ich bin nicht befangen, ich bin gefangen. Nur vom Irrtum der Interessenlosigkeit weiß ich mich gänzlich frei: Ich will, daß meine Welt geschrieben stehe.
Nein, der Osten war nie, wie ich erzähle, nur der meine. Der Osten ist ein Konstrukt anhaltender Ideologie, die wie zu Ostzeiten verhindern möchte, daß ihre Beute in ganz verschiedene Erinnerungen und Milieus zerfällt. Was hätte denn der Eichsfelder Katholizismus mit Ostberlin zu tun? Was, außer der Arbeitslosigkeit, verbindet das abgewickelte Ingenieurproletariat von Zeiss Jena mit den Kohlepressern von Lauchhammer? Der 89er Zeitenbruch, die Erfahrung des Scheiterns. Aber worin einer scheitert, welche Lebenszeit ihm brach, das entzieht sich der Gattungsanalyse, das ist gänzlich individuell.
Darüber schweigt der Osten. Er weiß es ja. Sich selbst ist er bekannt. Mitteilung ins andere Deutschland unterbleibt, denn die nationalen Medien, die Deutungshoheit hat der Westen. Manchmal schickt der Westen einen Auslandskorrespondenten herüber, zur vertiefenden Verallgemeinerung des Bekannten: Arbeitslosigkeit, Stasi, Ausländerhaß. Mehr und mehr wird auch mein Osten ein mir westlich vermitteltes Summarium altbundesdeutscher Medien. Hin und wieder rufen Westredaktionen an und fragen besten Willens: Welcher ostdeutsche Autor könnte uns dieses oder jenes ostdeutsche Thema näherbringen? Mir fallen die paar Etablierten ein, die ich aus Westmedien kenne. Und ich weiß längst, daß die Imagekultur Bärbel Bohley nicht zu ökologischen Fragen vernehmen möchte, Sahra Wagenknecht ungern zum Jubiläum kirchlicher Mahnwachen, und daß immer Friedrich Schorlemmer und Richard Schröder in die Talk-Shows müssen, Martin Uhle-Wettler und Wolf Krötke nie.
Da sitzen also die Üblichen, der Fuchs und der Wolf, der Weiß und die Roten, und reden und schreiben – das Ihre? Das Übliche, deswegen man sie rief. Und fallen sich selber nie in den Gedanken und ins Wort, immer nur einander. Ich ertrage nicht länger das Allgemeine. Ich bedaure die Ostalgiker und sozialistischen Errungenschaftler. Ich verstehe und bedaure deshalb noch mehr ihre Yin-Yang-Partner, die Generalisten des Unrechtsstaats. Man kann auch auf der richtigen Seite als Wachsfigur enden.
Allen Anhängern der DDR hat Kurt Hager ein Weihnachtsgeschenk gebastelt: 460 Seiten »Erinnerungen« vom SED-Chefideologen. Demokratieverächter genießen eine orthodoxe kommunistische Lebensgeschichte, inklusive Übungen in Selbstkritik. DDR-Dauertöter erfreut die berechtigte Entrüstung, die sich aus der unverbesserlichen Lektüre ziehen läßt. Das Buch ist gar nicht schlecht, nur bedrückt die Ärmlichkeit der persönlichen Erinnerung. Kein Zweifel bohrte zur Unzeit, keine Leidenschaft spleißte quer durch Hagers Hirn. Das Kapitelchen »Familiäres« beschreibt ein bißchen Urlaub. »Am 1. Dezember wurde unsere Tochter geboren. Jetzt hatten wir einen Sohn und eine Tochter. Würden sie sich vertragen?« Wir erfahren es nicht. Erfuhr es Hager?
Hager hatte nicht, er war Ideologie. Das Individuelle galt als das Mindere. Das ist es, was ich für die Oppositionellen der DDR befürchte: daß sie Ideologen werden, weil sie Opfer bleiben wollen, historisch rückversichert und verbittert, weil niemand hinhört, wenn die Wahrheitsabonnenten rufen: Es gab kein wahres Leben im falschen! – Doch, das wird gehört. Dieser rigorose Dissidentensatz hat schon viel Erinnerung verschreckt und Verdrängung produziert. Das ist schlimm, denn wir durchreisen unser Leben anhand von frühen Analogien und ureigenen, stetig wiederholten Konstellationen, die kein Systemwechsel beenden kann. Niemand lasse sich seine Erinnerung bestreiten, aber eben das geschieht: die Denunziation sentimentalischer Prägungen durch das Verdikt, sie seien minderwertig, denn sie stammten aus der Diktatur.
Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen, lautete vor zwanzig Jahren der erste Satz der »Kindheitsmuster« von Christa Wolf. Der zweite: Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Ist Individualerfahrung gegen die höhere, die allgemeine Wahrheit legitim? fragte das Buch, durchaus antifaschistisch besorgt. Darf man sich bei aller heutigen Kenntnis der Naziverbrechen seiner glücklichen Kindheit im »Dritten Reich« erinnern? – Es ist erlaubt und nötig und als Individualgeschichte vielfach wahr. Als Epochenbeschreibung ist es Lüge. Aber wer wäre Epoche? Wer sich heute noch erinnern darf, weiß mehr über Gnade als über Hitler. Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, zitiert der Exideologe Paulus, was Gott ihm offenbarte (2. Korinther 12,9). Das ist Ich-Erfahrung, kein Epochenwort; und der Gnade läuft kein Verdienst voran, aber das Glück hinterher. Wie sollte der Einzelmensch Ernst Jünger nicht als Erwählter lieben, was er so unbegreiflich lange überlebte? Und Victor Klemperer errettete die Zerstörung Dresdens.
»Von denen, die im Kriege waren, habe ich fast niemanden getroffen, der ihn geliebt hätte«, sagte der russische Filmregisseur Grigorij Tschuchraj (»Ballade vom Soldaten«). »Aber ich habe viele Menschen getroffen, die Sehnsucht nach dem Krieg zeigten. Das sind verschiedene Dinge. Eine Trauer um die eigene Jugend ist in dieser Sehnsucht verborgen. Die jungen Leute aber, die die romantischen Erinnerungen der Alten aus dem Krieg hören, verstehen die Rückseite dieser Erzählungen nicht. Sie möchten auch kämpfen. Das ist ein tragisches Mißverständnis.«
Für die DDR will gewiß kein Junger kämpfen, freilich auch nicht dagegen. In zehn, fünfzehn Jahren, dachte ich nach der Wende, wird das junge Ostvolk seinen Eltern ähnliche Fragen stellen wie die jungen Westdeutschen 1968. Ich glaube das nicht mehr. Diese Gesellschaft leidet nicht Mangel an aufklärerischen Fakten, sondern daran, daß jedwede Wahrheit spielerisch verbraten wird. Die DDR ist ein Witz. Oppositionelle sind ernst, also komisch.
Ja, endlich. Die DDR war kein Witz, Widerstand tat weh, die oppositionellen Analysen werden nicht bestritten, doch es ist vorbei. 1996 hat man ein Recht auf Entlassung aus dem SED-Regime. Die DDR wird relativ, Osten ihres Westens; und ich werde frei. Es scheint Verdrängung, wenn Erinnerung sich von der Diktatur befreit. Sie erfüllt aber nur ihr Wesen, die glücklichen Inseln aus dem Toten Meer zu heben. Das bringt die Fakten nicht um.
Und warten wir nicht auf Wenderomane. Viel später, wenn der Buchmarkt längst keine Galopperpreise für raschen Einlauf mehr vergibt, werden uns Erinnerungsbücher erreichen, wie Semprun, Canetti, Sperber sie geschrieben haben – Erzählungen von endlich Einzelnen, die nicht mehr an Geschichte reklamieren, als ihnen selber widerfuhr. Das hat Zeit, solange wir leben. Günter de Bruyns spröde »Vierzig Jahre« sind nur ein Frühstart. Je später es wird, desto weniger bedarf Erinnerung der Fiktionen von der runden Welt.
Es gibt Glück im Unglück anderer, wahres Leben im falschen. Was, falls nicht Honeckers Sturz, wäre sonst zu Ostzeiten der Sinn von Widerständigkeit gewesen? Und wie könnte ich meine kindliche Nachtfahrt von vor fünfundzwanzig Jahren bis heute bewahren als Heimholung des Glücks? Denn am Ende der Geschichte, dreizehn Tage später, steht immer noch der Tod. Das Rückspiel zwischen Halle und Eindhoven fand nie statt. In der Nacht zum 28. September 1971 brach im Eindhovener Hotel »Silbernes Seepferd«, worin die halleschen Fußballer untergebracht waren, ein Brand aus. Viele Hotelgäste starben, darunter der einundzwanzigjährige Spieler Wolfgang Hoffmann. Ein Auswärtstod. Hoffmann stammte aus unserer kleinen Stadt, und dort wurde er begraben, auf dem Friedhof hinterm Sportplatz, wo nun auch mein Vater liegt.
Am Tage der Beerdigung verließ ich das backsteingelbe Schulhaus und lief die Borngasse entlang. Ich hielt ungeduldig inne an der vielbefahrenen Hüttenstraße und schlüpfte, als die Fahrzeugschlange zum Stehen kam, zwischen den Autos hindurch. Genau vor unserem Haus hielt eine schwere schwarze Westlimousine mit holländischem Kennzeichen. Im Heckfenster schaukelte sacht der Wimpel des PSV Eindhoven. Drinnen saßen zwei Männer, einer war Bernardus van Geldern. Ich überlegte aufgeregt, ob ich ans Fenster klopfen dürfte, da löste sich der Stau, und der schwarze Wagen rollte fort, dem Friedhof zu.
November 1996
Zeitlese
Literatur als Asyl
Time reads daylight savings.(Neil Young)
All that you’ve done is true.(Townes Van Zandt)
Mein Vater ist ein wahrhafter Schriftsteller gewesen. 1920 geboren, begann er sein riesiges Werk im Alter von elf Jahren, am 1. Januar 1932, auf dem holzhaltigen Papier von »Lucas’ Schülerfreund«. Es ist unter diesem Datum der Besuch des Vetters Heinz festgehalten, eines Buckligen, wie ich noch selber weiß von den viel späteren, längst vergangenen Familienfesten, da das Greislein Heinz samt seiner Mutter, der uralten Tante Anni, einfältig lächelnd an Omas Halberstädter Kaffeetafel saß. Zu Neujahr 1932 war dies bucklicht Männlein ein Kind gewesen und stritt mit jenem anderen Kinde, das einst mein Vater werden würde, unterm Weihnachtsbaum um die Märklin-Eisenbahn. Am 2. Januar wurde dann der Baum geplündert, wie man lesen könnte.
Aber man kann es nicht lesen. Die Werke meines Vaters sind zur Edition weder geeignet noch jemals bestimmt gewesen. Er schrieb allein für sich. Täglich füllte er den Raum, den »Lucas’ Schülerfreund«, später der Deutsche Wehrmachtskalender, später der Kirchliche Amtskalender den einzelnen Tagen zugestanden hatte. Es findet sich in diesen Niederschriften keine Deutung der Zeit, kein Aufputz, keinerlei Spekulation, nur das wirklich Stattgehabte eines DDR-Landpfarrerlebens: Karte von Günther Mehler aus Bremen, Brief an Reinhold Weygandt nach Stuttgart, Päckchen von Frau Langhans aus Essen. Vormittags Krankenbesuch bei Walter Gutjahr. Nachmittags in Huy-Neinstedt Beerdigung von Marga Siebenhüner (86). Stürmisches Aprilwetter. Herrlicher Pfingstsonntag. Erstmals in diesem Jahr Gottesdienst in der Kirche, noch recht kühl. Predigt über Johannes 4,24: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nachmittags mit den Kindern Radausflug zur Sargstedter Warte. In Dietrichs Gaststätte Kaffee, Brause und la Rhabarberkuchen. Heiligabend: Nachmittags Christvesper in Eilsdorf, um 18 Uhr in Dingelstedt. Guter Besuch. Danach Bescherung.
Und dann folgt ein erschütternder Ausbruch sonst versagten Gefühls: Die Kinder leider sehr anspruchsvoll und undankbar.
Den Sensationen verschloß sich dieses Leben. Es schätzte aber keinen Tag gering; alle waren gleichermaßen würdig ihrer Niederschrift. Ein ausgefeiltes Rezeptionssystem sorgte dafür, daß die Notate in geregelten Abständen gelesen werden mußten, und zwar allmorgendlich zum Frühstück. Zwischen Brotkorb und Serviettentasche erhob sich das Erinnerungsgebirge: der Stapel von Kalendern, die Vater, wenn er aufgegessen hatte, aufschlug, um uns Kindern und der seufzenden Mutter vorzutragen, was sich vor fünfzig, vierzig, dreißig Jahren zugetragen hatte, vor fünfundzwanzig Jahren, vor zwanzig, vor zehn, vor fünf Jahren.
War’s das endlich, Jochen?
Fast. Jetzt nur noch: vor einem Jahr.
Jochen, wirklich! Ich hab soviel zu tun heute.
Islein, es geht doch ganz schnell. Vor einem Jahr war Sonnabend. Im Garten die Erdbeeren gemacht. Hummelchen gewaschen. (Hummelchen war der Trabant.) Abends Dias gerahmt. Gemütliches Glas Wein. Im Radio »Allein gegen alle« mit Hans Rosenthal, wieder sehr nett. Anruf von Großmutter Lietzau: Es geht ihr besser, sie will nun doch zu Tante Erika nach Preetz.
Stimmt, und dort hat sie dann wieder schlappgemacht.
Nachts furchtbarer Regen, Keller überschwemmt.
Na, das war vielleicht ’ne Schweinerei, sagte Mutter, und wenn sie derart in den Köder der Memoria gebissen hatte, vergaß sie den Einkauf und die große Wäsche und erzählte ihrerseits: von der Flucht. Davor die Bombennacht in Schwedt. Davor Kindheit in Westpreußen. Wie der Lehrer König immer so anzüglich war, und wie Opi ihr einmal den daheim verschmähten Teller Suppe in die Nachmittagsschule hinterdreintrug, so daß sie feuchten Auges Graupen mampfen mußte im grinsenden Angesicht der Klasse. Und Jochen, weißt du noch, unsere Hochzeitsreise, wie du mir den starken Mann markieren mußtest? Da hast du den ollen Vulkanfiberkoffer so richtig mit Schwung ins Gepäcknetz geschleudert, daß die Deckenlampe in Scherben runterregnete, gerade als der Schaffner kam. Der hat so gebullert, und du warst mit einem Mal ganz klein. Das hast du bestimmt nicht aufgeschrieben, guck doch mal nach.
Das war 1952, vor siebzehn Jahren, sagte Vater. 1952 kommt erst in drei Jahren wieder dran.
Einst saß ich, kurz nach der Wende, im »Metzer Eck« im Ostberliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg und hörte einen schnöseligen Hamburger räsonieren, die Ossis hätten hinterm Mond gelebt, die wüßten ja nicht mal, was Postmoderne ist. Darauf ein östlicher Zecher: Sone Sauereien hamwa hier nich jebraucht.
Wie wahr. Der Osten lebte linear, im historischen Längsschnitt lokaler Betrachtung, nicht im Querschnitt der globalen, disparaten Welterfahrung, die ihre Bildnisse verzweifelt virtuos zusammenpuzzeln muß aus tausend schiefgestanzten Teilchen verschiedenster Vorlagenspender. Gerade wegen seiner Isolation war dem Ostler die Einheit der Welt kein simultanes Erkenntnisproblem. Lebhaft erinnere ich mich des allgemeinen Rätselns am Theologischen Sprachenkonvikt, als unser Dozent Wolfgang Ullmann im Romantik-Seminar von der Gleichheit des Ungleichzeitigen sprach. Er hat uns damit Postmoderne definiert – erfahren konnten wir sie nur ästhetisch, theoretisch, aus zweiter Hand. Die Heimsuchungen der rasenden Welt drangen nur gedämpft ins seßhafte Republikchen, da es Geschichte nicht gab, nur Geschichten.
Aber die Ruhe trog. Die Lebensuhren liefen. Rastlos besorgte uns, wie ungehindert unsere innere Zeit entwich und sich nicht halten, nicht füllen ließ mit Ereignissen, Bewegung, Leben. Doch eine umgekehrte Postmoderne war dem Osten eigen: gänzliche Immunität gegenüber Mode und Trend, damit auch gegen Aktualität von Literatur und deren Wirkungsambition. Mit Leopold Ranke gedonnert, war uns jede Zeit unmittelbar zu Gott, folglich auch aller Zeiten Kunst. Man las den »Homo faber« nicht, als Max Frisch ihn geschrieben hatte, sondern als er in der DDR erschien. Camus und Sartre kamen Mitte der siebziger Jahre heraus. Auch Kafka nahte höchst verspätet, aber pünktlich, da doch geduldigst erwartet. Und als die DDR – sie rüstete sich bereits zum Hintritt in diese bessere Welt – endlich Sigmund Freud edierte, war auch ihm noch eine schöne Kammer reserviert in unserem Gemüte, Südfenster, zwischen Canetti und Werfel. In meines Vaters Haus, erfahren die Pharisäer, sind viele Wohnungen.
Wir lasen harmonisch, ästhetisch verträumt, ohne Ernst des Widerspruchs; den legten allenfalls die DDR-Verlage ein, wenn sie in voluminösen Nachworten den Leser um Verzeihung baten dafür, daß ihm dies Gewerke zugemutet werde, da doch des bürgerlichen Autors Auge umnachtet gewesen sei, was den klaren Blick für Klassenkampf betraf. Mit einem Satz: Wir lasen Klassiker. Alles Fremde langte schon als Klassik an. Was blieb, was war der Ertrag? Das Glück des Lesens. Urteil, Weltanschauung im Sinne von Ideologie stellte sich nur als Secundum ein. Darum lasen wir ja: um die Weltanschauung zu vertreiben durch die Schau der mannigfachen Welten, wie sie draußen gaukelten und sprangen – ineinander, durcheinander, aber alle gleichermaßen nicht von hier.
Unser Hiersein war nie selbstverständlich, aber Bleibensgründe gab es viele. Der Mensch hat Wurzeln; man goß sie mit Literatur. Als ich William Faulkner las, war ich tief zufrieden, daß ein so schwarzrot durchglühtes Riesenwerk auf einer Briefmarke Erde wohnen konnte: Yoknapatawpha County DDR. Mich beglückte die lautere Klarheit von Carson McCullers, ihr Universum der Provinz. Später entdeckte ich, daß einer sogar malen konnte, wie sie schrieb und wie auch ich mein Ländlein sah: Edward Hopper.
Niemals trug ich Bedenken, die Bücher meines Herzens gegen ihre Mängel zu schützen. Der Knabe war klein, die Berge waren ungeheuer, so begann mein Lieblingsbuch. Von einem der schmalen Wege zum anderen kletterte er durch eine Wildnis von Farren, die besonnt dufteten oder im Schatten ihn abkühlten, wenn er sich hineinlegte. Der Fels sprang vor, und jenseits toste der Wasserfall, er stürzte herab aus Himmelshöhe. Die ganz bewaldeten Berge mit den Augen messen, scharfe Augen, sie fanden auf einem weit entfernten Stein zwischen den Bäumen die kleine graue Gemse!
Der Schriftsteller Hans-Joachim Dieckmann im Kreise seiner sämtlichen Leser (Oktober 1961).
Den Blick verlieren in der Tiefe des blau schwebenden Himmels! Hinaufrufen mit heller Stimme aus Lebenslust! Laufen, auf bloßen Füßen, immer in Bewegung! Atmen, den Körper baden innen und außen mit warmer, leichter Luft! (…) Er hatte kleine Freunde, die waren nicht nur barfuß und barhäuptig wie er, sondern auch zerlumpt oder halb nackt. Sie rochen nach Schweiß, Kräutern, Rauch wie er selbst (…). Sie lehrten ihn Vögel fangen und sie braten. (…) Dies waren die ersten Mühen und Freuden des Knaben, er hieß Henri.
Heinrich Manns »Die Jugend (…)« und »Die Vollendung des Königs Henri Quatre« sind klassisch lineare Schmöker (großes Kompliment!), voll der gefühligen Manierismen, die ich dann an Jakob Wassermann so liebte, zusamt seiner psychologistischen Raserei. Stefan Zweig und der eitle Feuchtwanger hielten da nicht ganz Schritt. Dann kam Thomas Mann, nun ja, ein etwas hagestolzer Autor, obwohl gar nicht ungeschickt. Dann amerikanische Intermezzi: Salinger, Kerouac, Tom Wolfe. Joseph Heller mochte ich, wobei ich, was er schrieb, zu schnell vergaß. John Updike war zu seicht, Norman Mailer zu willentlich tough.
Endlich entdeckte ich den DDR-Autor schlechthin. Er lebte tragisch und schrieb deshalb sehr schön. Er kannte alles Menschenleid und konnte sich deshalb nicht helfen. Er war, im Unterschied zu uns, schon überall gewesen und brachte Botschaft heim: daß andere Welten auch nur Welten sind, weil Alles unter einem Himmel lebt und gräbt und pflanzt und hofft und stirbt. Dieser Autor hat das SED-Unrechtsregime stabilisiert, weil er sich abfand, und mir bejahte er wie kein Zweiter die juvenile Frage aus Arnold Zweigs »Verklungene Tage«: Blieb Lesen nicht berauschender als Leben? Politischer Protest wurde dankbare Ästhetik, Dichtung, Passionschoral und Freude am schönen Moll. Trotta trank. Das kahle Zimmer wurde heimlicher. Die nackte elektrische Birne am geflochtenen Draht, umschwirrt von Nachtfaltern, geschaukelt vom nächtlichen Wind, weckte in der bräunlichen Politur des Tisches trauliche flüchtige Reflexe. Allmählich verwandelte sich auch Trottas Enttäuschung in wohliges Weh. Er schloß eine Art Bündnis mit seinem Kummer. Alles in der Welt war heute im höchsten Maße traurig, und der Leutnant war der Mittelpunkt dieser erbärmlichen Welt. Für ihn lärmten heute so jämmerlich die Frösche, und auch die schmerzerfüllten Grillen wehklagten für ihn. Seinetwegen füllte sich die Frühlingsnacht mit einem so gelinden, süßen Weh, seinetwegen standen die Sterne so unerreichbar hoch am Himmel, und ihm allein blinkte ihr Licht so vergeblich sehnsüchtig zu. Der unendliche Schmerz der Welt paßte vollkommen zu dem Elend Trottas. Er litt in vollendeter Eintracht mit dem leidenden All. Hinter der tiefblauen Schale des Himmels sah Gott selbst auf ihn mitleidig hernieder. (…) Und auf dem Fensterbrett lagen nicht weniger als drei nicht geöffnete Briefe seines Vaters, der vielleicht auch schon gestorben war. Ach!
Ach, als ich Joseph Roths »Radetzkymarsch« ausgelesen hatte, bestürzte mich Abschied. Das nächste Buch, zu dem ich griff, war das verkehrteste: Thomas Pynchons »V«. Es gibt gar nicht viele Bücher, deren Geschichte erinnerlich bleibt, vor allem, wenn sie keine haben, aber man merkt sich die Stimmung, die sie beim Lesen erzeugten: zapplige Qualen auf der alten Couch. Denn dieser Autor erzählte nicht, er machte Zicken, trieb Allotria, legte und verwischte Fährten seines kryptischen Titels. Ob aber »V.« nun für La Valetta stünde, für die Anarchistin Veronika Wren, Botticellis Venus oder den Vesuv, das war mir weder klar noch wissenswert. Besonders mißfiel die nervtötende Originalitätssucht des Verfassers: Mafia Winsome ist geschickt genug, sich eine eigene Welt zu schaffen, aber zu blöde, in ihr zu leben. (…) Ein Betrunkener, der unten im Hof pinkelte, schaute hoch und begann zu schreien, damit alle Welt dem Selbstmord zusehen könnte. (…) Es war zu einem ihrer Hauptvergnügen geworden, die Invaliden jede Nacht zu besuchen, ihnen Wein einzuflößen und sie sexuell zu erregen.
Das also war die Postmoderne, und ihre polygame Flatterhaftigkeit entlarvte sich prahlerisch auf Seite 468, wo ein Ego, gewiß dieser Pynchon, sich persönlich für das 20. Jahrhundert hielt: Ich bin Ragtime und Tango; Groteskschrift, saubere Geometrie. Ich bin die Peitsche aus Mädchenhaar, die kunstreichen Fesseln dekadenter Leidenschaft. Ich bin jeder einsame Bahnhof in jeder Hauptstadt Europas. Ich bin die Straße, die trostlosen Regierungsgebäude; ich bin das Tanzcafé, die Puppe auf der Spieluhr, das Jazzsaxophon; ich bin die Perücke der Touristin, die Gummibrust des Schwulen, der Reisewecker, der immer die falsche Zeit zeigt. Ich bin die tote Palme, der Tanzschuh des Negers, der schweigende Brunnen am Ende der Saison. Ich bin alles Zubehör der Nacht.
Derweil ich mich noch empörte, wie ein derart unehrlich zusammengeschustertes Plagiat seinem Kompilator Ruhm eintragen konnte, überlas ich Verfassers Geständnis: Zumindest hatte sich in ihm ein seltenes Grundphänomen offenbart: die Entdeckung nämlich, daß sein Voyeurismus allein von gesehenen Ereignissen bestimmt wurde und nicht von einer freiwilligen Wahl oder vorherbestimmten, in ihm liegenden Notwendigkeiten. Das beschreibt den Endsieg der Werbung und des freien Menschen Ende, Gottes Tod.
Die Postmoderne war kein Stil, bestenfalls eine Haltung, schrieb Gustav Seibt in der »Frankfurter Allgemeinen« vom 4. Oktober 1994. Die Postmoderne hatte verkündet, daß alles möglich sei, doch im selben Augenblick behauptet, es sei schon alles gesagt. Seibts Aufsatz ist betitelt »Damit wir wissen, was wir erlebt haben«, beharrt auf der Endlosigkeit der Welt, die darauf wartet, in Sprache erlöst zu werden, und teilt mit, die Postmoderne liege hinter uns. Mich überfordert das, denn ich bin kein Literaturdesigner, sondern ein Reporter und erzählerisch bedarfter Leser. Vor allem gehöre ich zu jenem verslawten ostgermanischen Stamm, der für das Ende der Postmoderne die Gewöhnung an die Postmoderne hält; und wir haben uns noch nicht gewöhnt, oder verweigern wir einfach die Welt? Ständig rammen die Ostler den Monolithen Damals ins befremdliche Heute – befremdlich, weil die westlich dominierte Gegenwart uns bestreitet, Damals sei Leben gewesen.
Doch, Leben war’s, und war doch so schön, ihr glücklichen Augen … Gleich dem Weibe Lots starren wir zurück. Und wehe, es bedient sich einer an unserem Salz, sein westliches Süppchen damit zu würzen. Dem geben wir’s, dem werden wir’s versalzen: Du hast keine Ahnung, Freundchen, du warst nicht dabei, ein Bildnis machst du dir vom Hörensagen – Karikatur, Fälschung; das Wahre verwahren wir im östlichen Herzen.
Zeigt doch mal!
Das zeigen wir nicht, weil ihr sonst unsere Seelen in eure vorgedruckten Tüten steckt: »Normen und Verhaltensweisen der Mehrheit der Bewohner der neuen Bundesländer weisen noch immer eine signifikante Prägung durch die Mechanismen des SED-Regimes. …«
Es ist möglich, dachte Gregor, vorausgesetzt, man ist nicht bedroht, die licht stehenden Kiefern als Vorhang anzusehen. (Alfred Andersch, »Sansibar oder der letzte Grund«) Die fast schwarz makadamisierte Straße deutete man dann als Naht zwischen den beiden Vorhanghälften; man trennte sie auf, indem man sie mit dem Fahrrad entlang fuhr; nach ein paar Minuten würde der Vorhang sich öffnen, um den Blick auf das Szenarium freizugeben: Stadt und Meeresküste. Da man jedoch bedroht war, dachte Gregor, war nichts wie etwas anderes. Die Gegenstände schlossen sich in die Namen, die sie trugen, vollkommen ein.
So kommen wir Deutschen nicht zueinander. Die Erlebtes haben, behalten es für sich und verweigern die Überführung des einmalig Widerfahrenen ins verständlich Allgemeine. Die nichts erlebten, jedenfalls nicht unseres, sind Medienmeister des Allgemeinen. Sie basteln sich aus Kürzeln fremden Lebens unstet blinkende Collagen und geben ihr geschickt montiertes Material für Literatur aus. Ich bin Realist. Mich bewegt Geschichte. Mich interessiert, ob einer Handwerk lernt und lehrt, ob er gegraben hat, bevor er erntet, ob er sich selbst riskiert oder nur von fremden Äckern stiehlt. Mein Interesse als Leser ist biblisch einfach: Ich wünsche mich zu erfahren. Von den Trickdieben erfahre ich nur eitles Know-how.
Es gibt eine präpostmoderne Autorin, die mich verstädtertes Landkind gewann wegen ihrer bukolischen Sujets. Virginia Woolfs stream of conciousness entsprang nicht nur dem Ich, er umfloß und schützte es wie der Wassergraben seine Burg. Möglicherweise kann man auch in virtuellen Welten authentische Erfahrungen machen. Allein darauf kommt es an: daß ein Mensch das Maß der Menschheit bleibt, Individuum, und Sprache das analoge, verbindliche Medium der Kommunikation zwischen dir und mir. Ich liebe keine Bücher, die Gewimmel knipsen. Ich mag nicht Klangcollagen, ich höre Songs, Geschichten als Geschichte ihrer Bindung an Zeit. Mich interessiert Zeit. Ich will sie nicht postmodern überfliegen wie eine Belästigung. Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hochkommt, so sind’s achtzig.
Unvergeßliches Entsetzen bei etlichen pietistischen Kommilitonen, die im Studium der Theologie erfahren mußten, daß der Glaube denken will, so wahr das Denken glaubt. Sie erschreckte, daß die Bibel nicht nur das Buch göttlich autorisierter Geschichten sei, sondern selbst Geschichte derart, daß Generationen an diesem Buche schrieben, Älteres übermalten, Unverstandenes tilgten, glätteten, interpretierten, so daß nicht einfach säuberlich zu scheiden war, wo der Fakt ein Ende hatte und wo seine Deutung begann. Und eben dieses Vage, wurde uns gelehrt, sei des Ewigen Offenbarung, also daß Gott nicht am siebten Tag nach Hause ging, weil doch alles sehr gut war, sondern sich je und je dem Menschen menschlich offenbarte als Beigesell der Geschichte, als ihr Opfer, als ihr Oberlicht.
Das war kompliziert fürs Pastorenkinderherz, das aus der Gewißheit, das Wort sei gesprochen und gebucht, kein geringes Selbstvertrauen gezogen hatte. Mehrere Studenten stiegen aus, denn sie empfanden die unentrinnbare Geschichtlichkeit des Christseins als Skeptizismus, Relativismus, Unglauben und was Satan sonst noch aufzubieten hatte. Diese Not, im bislang Gewußten das eigene Leben zu sichern, sehe ich überall am Werk. Verlustangst – nichts anderes ist Ideologie: ein Versuch der Heimat.
Mein Vater ist ein wahrhafter Schriftsteller gewesen. Er hat ein Werk geschaffen, das die Utensilien seines sorgfältigen Lebens in den Tagen ihrer Echtheit verwahrte. Er entzog sie den Verkürzungen der Retro-Perspektive, der Ideologie sowieso. Mochten sie sich hundertfach wiederholen, die Karten von Günther Mehler, die Gottesdienste in Eilsdorf und Huy-Neinstedt, die sonntäglichen Radausflüge, die Beerdigungen – aber die Beerdigungen wiederholten sich nie. Die Hybris dessen, der tausendmal am Grabe sprach und zwanzigtausend Tage protokollierte, hat mein Vater gebüßt mit einer Demut, die Erkenntnis war. Er beschied sich mit seinen Notaten, und sein gesamtes Publikum paßte an den Frühstückstisch. Vater wußte, oder mußte wissen, daß, wer sein sämtliches Leben festhält, keine Extrazeit bekommt, es für andere zu raffen, zu schmücken, zu deuten; das nennen wir ja Schreiben. Was wir Denken nennen, ist Erinnerung. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast.
Ein Nachwort: Ich schrieb dies vor zweieinhalb Jahren. Alles stimmt noch, nur ich bin nicht mehr völlig derselbe. Ich lebe heute weniger aus Büchern, und meine eigenen Sätze sind kürzer, direkter geworden, aus wachsender Scheu vor Hermetik und Manie und aus Lust an Geistes Gegenwart. Was ich dabei an Gewinn und Verlust empfinde, erzählt wunderbar eine Geschichte von Peter Rosegger, dem Herrgottsschnitzer der österreichischen Literatur. Sie heißt »Der Fahrplanschuster« und stand in meinem DDR-Schullesebuch. Sie handelt vom Schuhmacher in Roseggers steirischem Heimatdorf, den der Waldbauernbub Peter oft besuchte, weil der Schuster, der das Dorf sein Lebtag nie verlassen hatte, sämtliche Verbindungen der österreichischen Eisenbahn im Kopfe trug und daraus herrliche Fahrten spann. Viele Jahre später traf Rosegger, längst fortgezogen, auf einem größeren Bahnhof den Fahrplanschuster. Freudige Begrüßung. Dann bat Rosegger den alten Mann um Auskunft über einen Anschlußzug. Früher wußte ich das, sagte der Greis. Heute reise ich selbst.
März 1995 / September 1997