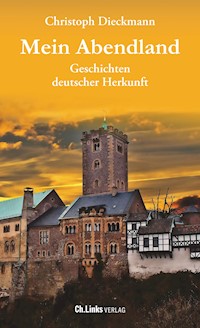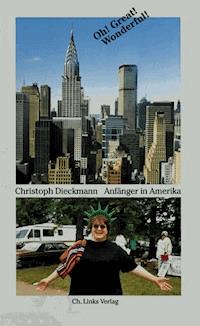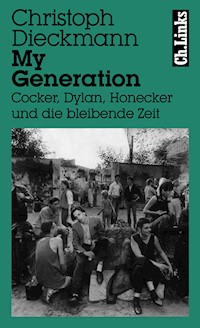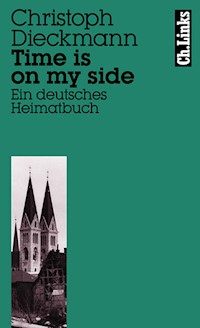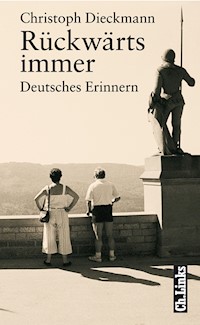
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Was macht ein Land, das sich schwer tut mit dem Blick nach vorn? Es schaut zurück, es sucht nach Halt im Gestern.
Christoph Dieckmann, vielfach preisgekrönter ZEIT-Autor, erzählt von der Macht des Vergangenen. Hitler verschwindet, Ulbricht kommt, die DDR-Gewaltigen erscheinen – auf der Tribüne und vor Gericht. Doch im Neuen lebt das Alte fort. Den Ritualen öffentlichen Gedenkens – 17. Juni, Mauerbau, verklärende Ostalgie – begegnet Dieckmann mit lebendiger Erinnerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph DieckmannRückwärts immer
Christoph Dieckmann
Rückwärts immer
Deutsches Erinnern
Erzählungen und Reportagen
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2017entspricht der 1. Druckauflage vom März 2005
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign Berlin
unter Verwendung eines Photos von Rolf Zöllner: Burg Hechingen/Schwäbische Alb, Stammsitz der Hohenzollern
eISBN 978-3-86284-389-3
Inhalt
Rückwärts immerErinnerungen an den Frieden
Die Lebenden und die TotenDie Mauer ist auch heute noch zu spüren
Der Fall Erna DornStephan Hermlins »SS-Kommandeuse« und der 17. Juni
Vernichtung eines UnpolitischenWerner Hartmanns Leben im Schatten der Geschichte
California DreamingJena versucht, sich über ein Geschenk zu freuen
Nachbeben einer BarbareiLeipzig streitet um die gesprengte Paulinerkirche
Honis heitere WeltWohl und Wehe der Ostalgie
So oder so, die Erde wird altWolf Biermann feiert den 25. Jahrestag seiner Ausbürgerung
Spur der SchmerzenEin Besuch bei Christa Wolf
Schaudernd freut uns, daß wir recht behalten werdenDer 11. September und die Logik der Revanche
Dresden, Chile, Rock ’n’ RollEin Versuch, ostdeutsche Amerika-Gefühle zu erklären
Der sächsische WeltfriedenDie Leipziger Montagsdemonstrationen können kein glückliches Ende finden
Das Volk zerfällt, die Klassen kehren wiederVorrevolutionäre Vermutungen
Ein Dorf fährt in die GrubeHorno hat verloren
Ins Paradies!Der FC Carl Zeiss Jena wird hundert und sehnt sich das Herz aus
Der Mönch am MeerEine irische Reise
Quellenverzeichnis
Bildnachweis
Über den Autor
Rückwärts immer
Erinnerungen an den Frieden
I am a childI last a while.
Neil Young
Marta hatte gelernt, ein erinnertes Detail, das sie zu einer bestimmten Zeit zurückführte, mit der Schattierung der Welt zu assoziieren.
Olga Tokarczuk, »Taghaus, Nachthaus«
1
Vor vielen Jahren machten Kinder auf dem Halberstädter Domplatz einen Fund. Bei der Liebfrauenkirche, nahe dem Portal, lag ein rostiges Schwert. Unverzüglich begannen Ritterspiele, aber bald kam ein Mann vorüber, sah die Waffe, nahm sie den Kindern fort und trug sie heim.
Dies ist die Geschichte des Schwerts: Auf einer Burg nahe Halberstadt lebte einst ein Ritter namens Hug. Sein Ruf war übel. Er spielte, soff, feierte mit seinesgleichen und nährte sich vom Raub. Die Frau war ihm gestorben. Er besaß eine Tochter, die fürchtete den Vater. Ihr einziger Freund war Teutbold, der Pflegebruder. Als Knabe war er auf die Burg gekommen; sein Vater, Hugs Freund, hatte, der Reichsacht verfallen, außer Landes fliehen müssen. Wie die Zeit verging und die Kinder erwuchsen, blieb es nicht aus, daß Bertha und Teutbold sich ineinander verliebten.
Häufig kam ein Herr von Assen auf die Burg, begleitet von seinem Sohn Eberhard. Mit denen zechte der Ritter besonders wüst. Bei einem dieser Gelage versprach Hug dem Junker Eberhard seine Tochter zur Frau. Indessen beschloß Teutbold, ins Morgenland zu ziehen, um – gewiß doch mit dem Blut der Kinder Mohammeds – jene Flecken abzuwaschen, die der verbannte Vater seinem christlichen Namen zugefügt hatte. Bevor er aufbrach, begab er sich zu Hug, der wieder mit den beiden von Assen bei Trunk und Würfeln hockte. Teutbold gab bekannt, er ziehe aus, weil er den Ruhm der Welt begehre und, bei seiner Wiederkehr, Berthas Hand. Erheitert grölten die Zecher; Eberhard nannte ihn Weiberknecht. Hierauf feuerte Teutbold dem Junker seinen Handschuh ins Gesicht und ziemliche Worte hinterdrein. Dann eilte er zu Bertha, umarmte sie, schwur das Nötige, bestieg sein Pferd und sprengte ins Heilige Land.
Und mähte unter den Heiden. Dies stand in anderen Büchern. Jener gilbe Band mit Harzer Sagen, der die Geschichte des Liebfrauen-Schwerts erzählt, vermerkt lediglich, daß Teutbold »in Palästina manchen Kampf siegreich bestanden« habe. »Reich mit Schätzen beladen, das Ritterschwert an der Seite, die goldenen Sporen an den Füßen und mit dem heiligen Kreuz geschmückt, trat er die Rückkehr an; klopfenden Herzens freilich, ob wohl die geliebte Bertha noch seiner harre. Immer näher rückten ihm die heimatlichen Berge; endlich befand er sich in der nächsten Umgebung von Ritter Hugs Burg.« Unerkannt holte er Kunde ein, wie sich das Fräulein befände, und erfuhr, all die Jahre habe sie dem Werben des von Assen widerstanden. Nun aber gehorche sie dem Vater, denn ihr kreuzfahrender Geliebter gelte für tot. Morgen sei Trauung, und just zu dieser Stunde beginne das Fest.
Teutbold jagte zur Burg. Passierte die Wachen, eilte in den Saal. Setzte sich an die Tafel, mit geschlossenem Visier. Bertha nahte, an Eberhards Seite und gebührend blaß. Erblickte den Fremden. Erkannte Teutbold an der gestickten Binde, die sie ihm beim Abschied um den Arm gewunden. Entschloß sich zu einer Ohnmacht. Besorgt fragte Eberhard, was ihr denn fehle. Da sprach Teutbold: »›Was Eurer Braut fehlt, fragt Ihr? Nun, ich denke, die Frage wäre leicht zu beantworten: Der rechte Bräutigam ist’s, der ihr fehlt, denn sie schaut nicht drein wie eine Braut, die freiwillig und glücklichen Herzens zum Altar tritt.‹ Zornbebend blickte der Ritter von Assen auf den kühnen Sprecher und rief: ›Was wagt Ihr? Was wollt Ihr davon wissen? Was hängt Ihr Euch in anderer Sache? Oder ist auch die kindische Mär von der Jugendliebe zu Euch gedrungen? So will ich Euch ’s sagen, daß meine Bertha mir gern und willig folgt; denn der, dem sie einst in unreifer Neigung zugetan war und dem sie Treue geschworen, ist längst von den Saracenen getötet!‹«
Nun mußte Teutbold sich natürlich offenbaren, Bertha erwachen, einen Schrei ausstoßen, an des Geliebten Schulter sinken und unter heißen Tränen wispern, nichts und niemand werde sie in Assens Brautbett zwingen. Jetzt aber möge er fliehen. Teutbold entwich in die Nacht und ritt nach Halberstadt. Von der Liebfrauenkirche sah er im Mondschein die Madonna mild auf ihn herniederblicken. Er stieg vom Pferd, kniete und betete Dank. Hinter sich vernahm er Schritte. Er wandte sich um, da fuhr ihm Eberhard von Assens Klinge ins Herz. »›Mörder‹, hauchte der Sterbende mit schwacher Stimme, ›den ehrlichen Zweikampf meidest du, um mich hier hinterlistig zu töten. Wisse denn, nie wird Bertha dein Weib!‹« Blutbesudelt kehrte Assen aufs Fest zurück. »›Elender!‹ schrie Bertha bei seinem Anblick auf. ›Du hast mir den Geliebten erschlagen!‹ Mit höhnischem, wutentstelltem Antlitz rief Eberhard: ›Du hast’s geraten, Liebchen, und jetzt bist du ganz mein, und keiner soll dich mir entreißen!‹« Doch, der Tod. Leblos sinkt Bertha zu Boden. Erst jetzt wird sich Assen seiner Tat bewußt. Er rennt aus der Burg, sprengt zurück zur Liebfrauenkirche und stürzt sich ins Schwert.
Es tagt. Die Chorherren schreiten zur Messe und finden die Entseelten. Der Mönch Hugbert von Treseburg zieht das Schwert aus Assens Brust und hängt es an der Kirchenmauer auf. Dort soll es bleiben, den Kommenden zur Mahnung, bis die Seelen von Mörder und Opfer Ruhe finden.
Jahrhunderte gehen. Es verlöschen die Geschlechter der Assen und Hug. Das Schwert hängt und schaukelt im Wind. Leise klirrt Eisen an Stein, und wenn sich die Mordnacht jährt, fällt von der Spitze ein Tropfen Blut. Darunter wächst keine Blume, kein Gras; falls doch, hilft der Liebfrauenküster der Sage gärtnerisch ein bißchen nach. Längst ist die Geschichte Folklore geworden und ihre Mahnung Mär. Die Materie vergeht, die Kette rostet, das Schwert fällt unter die Kinder. Der Mann, der es ihnen fortnahm und nach Hause schaffte, später ins Museum, war mein Onkel Armin, der letzte Ritter von Halberstadt.
2
Du glaubtest früher auch, daß sich Geschichte nicht wiederhole. So zu denken ist ja nötig; es hält die Zukunft offen und den Willen frei. Aber je älter du wirst, desto stärker empfindest du die Gegenwart als Variante der Vergangenheit. Was heute wirklich passiert, ist oft ein Anderes als das, was dich berührt. Du läßt nicht mehr alles in dich dringen. Du schickst es durch die Schleusen deiner Prägungen und Wünsche. Und mit Staunen, aber immerhin nicht unironisch siehst du, wie sich das Vergangene verschönt, wie Erinnern Heimat schafft. Memoria wandelt Zeit zum sicheren Hort. Nicht, daß wir die gestrige Angst vergäßen, den Kinderdurst und wie krank auch jene alte Welt gewesen ist. Wir fälschen ja keine Daten. Wir hüten nur, was war, weil wir es glimpflich überstanden haben und weil es unweigerlich zu uns gehört. Wir machen mit uns Frieden. Auf unser altes Eisen geben wir ein bißchen Chrom, damit wir Geschichte besitzen, nicht bloß eine Kiste Ramsch. Also steh auf, nimmt dein rotes Fahrrad und prüfe die Reifen. Pumpe Luft nach, füll die Thermosflasche, schmier dir für unterwegs eine Kunsthonig-Stulle. Versprich Mutter, vorsichtig zu fahren. Nun los. Schon hast du das Dorf im Rücken.
Bald Arbketal, nur ein paar Gebäude an der Chaussee: die Marmeladenfabrik der Familie Weitemeyer mit Tankstelle und Kneipe. Dort saß einst unter den Napoleonspappeln beim hellichten Trunk Herr Pastor Schröder, Vaters Vorvorgänger im Dingelstedter Pfarramt. Das Bier erheiterte ihm die schöne Gotteswelt, die Sonne färbte die Kirschplantagen, da klang über die Felder Glockengeläut. Schröder fragte, warum man in Dingelstedt läute. – Na, die Beerdigung vom Soundso, Herr Paster. – Wer hält die denn? – Na Sie, Herr Paster! – Schröder fuhr auf, jäh sein Versäumnis begreifend, jagte zum Friedhof und entrang sich am Grab eine rauschhafte Rede, von der das Dorf noch lange sprach, wie auch vom Schicksal jenes Jungarbeiters, der in Weitemeyers Fabrik eine Wespe verschluckte. Sie stach ihn in den Rachen. Man rief Hilfe, doch als der Krankenwagen Halberstadt erreichte, war der Junge erstickt.
Du selbst erlebtest in Arbketal eine Paradies-Vision. Freund Ulli wußte in der Schule, heute nachmittag würden bei Weitemeyer Apfelsinen angeliefert. Das Gerücht stimmte. Vor dem grauen Gemäuer prunkten, orange überladen, ein Laster und ein Hänger mit den Früchten des Orients. Ihr standet starr, das Wunder begaffend. Ein Arbeiter stiefelte herbei, drückte jedem eine Apfelsine in die Hand und schickte euch fort. Tags darauf kamt ihr wieder. Der Ort lag öde wie sonst. Das Wunder war aus der Welt.
Erst einen Kilometer gefahren und schon so viel Erinnerung. So kommen wir nicht voran. Jetzt Röderhof, der Teich, die Huysburg auf dem Berge. Dietrichs Gaststätte mit dem Gambrinus im Giebel. Der Wald, im Dickicht der Schwedenstein. Steil wird’s. Du mußt schieben, bis zum Paß. Von nun an geht’s bergab, bis die Buchen enden und du windumsaust ins freie Harzvorland hinunterschießt. Von ferne, bald näher, leuchten die Türme der Stadt. Der Weiler Neu Runstedt – vorbei. Schon städtisches Pflaster, die erste Straßenbahn. Da bist du angekommen. Oma bützt dich; das ist uckermärkisch für küssen. Opa drückt dir männlich die Knabenhand. Onkel Armin öffnet unverzüglich seine Destille. Du hast dich zu entscheiden zwischen Vita-Cola, Orancia-Limonade (von Weitemeyer) und 21-Pfennig-Brause, wahlweise mit Zitronen-, Himbeer- oder Waldmeister-Geschmack. Du wählst Waldmeister, immer. Du streichelst die Katzen. Du begrüßt Vetter Thomas. Tante Inge, die Lustige, kommt die Treppe herunter. Onkel Armin demonstriert, wie weit sein Kettenpanzerhemd seit deinem letzten Besuch gewachsen ist. Auch darfst du die Hundskugel überstülpen und behutsam mit dem Schwerte fuchteln. Es soll ja nicht passieren, was zum Fasching geschah, als Ritter Armin mit der blanken Klinge in den Festsaal stapfte, stolperte, mangels Sicht im Helm längs hinschlug und mit gestrecktem Schwert die Butter teilte. Da, jetzt gongt Oma zum Essen. Ist Wochentag? Dann gibt es Linsen, sonntags Gulasch und Götterspeise. Kaffee trinkt man im Garten, in der wild umwucherten Burgruine.
Huhu! schreit es durchs Gebüsch. Huhu, Einlaß bitte!
Onkel Armin ruft: Parole?
Oma sagt: Das ist doch Frau Lindemann.
Onkel Armin verfügt: Ohne Parole kommt mir keiner in die Burg.
So ein Unfug, sagt Oma.
Huhu! ruft Frau Lindemann erneut.
Onkel Armin: Parole?
Ich bin’s, Frau Lindemann! Ich bringe Bienenstich!
Parole?
Gut Freund, Armin! Parole gut Freund!
Onkel Armin entrammelt die Sperranlagen, öffnet das Drachenloch und gewährt der alten Dame Gastrecht an der ritterlichen Kaffeetafel. Später wird Opa nicht versäumen, zur Gitarre und auf allgemeinen Wunsch den »Räuber Heising« vorzutragen. So hat Walter Gemm, Halberstadts malender Chronist, seinen Freund Wilhelm konterfeit: im Arm die Klampfe, die aus altdeutschen Gründen eine Laute ist. Und Wilhelm Dieckmann klampft und tremoliert mit dramatischem Bariton die vielstrophige Moritat von dem Unhold, der in des Huywalds finstren Gründen eine Marktfrau überfällt. Die Ärmste leidet Todesangst, denn Heising greift zum Dolche. Vom Butterkloß der Händlerin säbelt er ein schieres Pfund herunter und entläßt das schlotternde Weib mit dem Schlußvers:
Und nun merke dir noch dieses:
Meinem Stahl verfallest du,
bringst du mir nicht auf dem Rückweg
Brot und Mettwurst noch dazu.
Halberstadt, 15. Mai 1969. Goldene Hochzeit der Großeltern Marie-Luise und Wilhelm Dieckmann. Hintere Reihe v.l.: C.D., die Eltern, die Brüder, rechts Onkel Armin.
All das ist überliefert aus dem Land des Lächelns Halberstadt, in Photoalben und Briefkartons und durch Bandaufnahmen, deren biedermeierliche Komik rührt. Es ist der 26. März 1972, Oma feiert ihren 80. Geburtstag. Großer Familienauftrieb. Die Photo-Torturen sind glücklich überstanden. Vater und Onkel Armin haben die Feiergemeinschaft vors Haus befohlen, gruppiert, immer wieder umgestellt und mit je zwei Kameras je viermal abgelichtet, auf daß die kommende Welt der Jubilarin und ihrer Sippe per Farb-Dia, Schwarzweiß-Rollfilm 6x6 (chamois glänzend) wie auch im Querformat ansichtig werde. Jetzt zieht Vater mit dem Mikrophon um die Kaffeetafel. Tante Inge gratuliert scherzig, Mutter sprudelt nervös. Onkel Erich teilt mit, er sitze mit Stephan, dem jüngsten Enkel, im Uhreneck; und der alte Regulator spendet der Nachwelt seinen silberdunklen Stundenschlag. Opa erzählt zur allgemeinen Begeisterung, wie er vorhin mit dem Stuhl zusammenbrach. Hauptsache sei jedoch, daß die ganze Familie beieinander weile und daß er seine liebe Matza habe. So nennt er Marie-Luise, das Geburtstagskind. Und nun das Wichtigste, moderiert Vaters lächelnde Stimme, nun kommt endlich auch die Hauptperson zu Wort: unsere Mutti. – Oma resümiert ihren großen Tag uckermärkisch resolut – eine fröhliche Greisin, unsterblich, wie wir wußten. Abends Aufbruch. Die Großeltern geleiten ans Gartentor. Da stehen sie in der Heckenpforte unterm blühenden Rosenbogen: Philemon und Baucis, winkend.
Blühende Rosen im März. Siehst du, wie die Erinnerung dekoriert?
Sie weiß auch das andere: wie Opa dir das Adamsohn-Buch aus dem Schrank holte, den geliebten Comic-Band vom dreihaarigen Zigarren-Gnom, der immer in die Schlaglöcher des Lebens fällt. Ihr sitzt am Tisch, Opa liest Zeitung, du kicherst: Opa, hier, guck mal, wie Adamsohn den Tisch immer kürzer sägt. Opa antwortet nicht. Schaut ins Leere, in der rechten Hand die Brille, damit klopft er auf den Tisch. Tock, tock, tock. Opa, sagst du ängstlich, Opa. Keine Reaktion. Du läufst aus der Stube, Oma holen. Sie eilt, sie kennt das schon, aber du sollst in der Küche bleiben. Am nächsten Tag ist Opa ganz der alte. Ein andermal findest du ihn draußen bei der Treppe. Er ist gestürzt. Er liegt ganz still. Aus seiner Schläfe sickert Blut. Er schaut zu dir empor wie in die Ferne, erkennt dich oder jemand anders, lächelt und sagt leise: Na?
Er starb 1973. Da war ich Lehrling im Erzgebirge und konnte nicht zum Begräbnis. Oma erhielt uns Halberstadt, doch ihre Kräfte schwanden. Daß meine Tochter nach ihr Sophie Luise heißt, hat sie noch erfahren, aber ihr erstes Urenkelkind nicht mehr gesehen. Sie starb 1983, mit 91 Jahren. Ich lag krank in Berlin und verfolgte im Fernsehen deprimiert die Bundestagsdebatte um den sogenannten NATO-Doppelbeschluß, dem wir nach heutiger Doktrin die deutsche Einheit verdanken, weil es dem Westen gelang, den Osten totzurüsten.
Omas Tod beendete das kinderzeitliche Halberstadt. Tante Inge war umgezogen, Vetter Thomas inzwischen Berliner. Onkel Armin hielt die Stellung. Er zog vom Obergeschoß hinab in Omas Räume und ließ sie unverändert, neunzehn Jahre lang. Oben wohnte nun ein Informatiker, Parteigänger der DDR, dessen rationales Wesen mit dem von Ritter Armin trefflich kollidierte. Polterte oben das Kind, mutmaßte Armin, jetzt sei gewiß die Leninbüste heruntergefallen. Auch der Garten war zu teilen. Der Informatiker schor und frisierte seine Hälfte, Armin blieb der Vätersitte treu. Eine Kette, frisch geteert, markierte, wo Germanien begann. Noch immer kam Frau Lindemann mit Bienenstich herüber, gern auch die Jugend der Nachbarschaft. Zur Adventszeit sägte Armin Runen-Leuchter, ließ Harzer Wichtel räuchern, kredenzte Sonnenwend-Gebäck und schwadronierte ritterdeutsch, daß den Bengels die Mäuler klafften.
Was sein Beruf war? Goldschmied hatte er gelernt. Er machte den Meister, durfte aber nicht selbständig werden, weil er den staatlichen Instanzen mit Protestaktionen gegen den Abriß historischer Bausubstanz verdächtig wurde. Dann arbeitete er als Kraftfahrzeugschlosser, trotz einer Kriegsverletzung. Nach seiner Invalidisierung versah er jahrelang ein Amt wie aus dem Märchenbuch: Er war Türmer. Im Wächterstübchen der Martinikirche saß er hoch über der Stadt, empfing Geschichtspilger und versorgte sie aus dem unerschöpflichen Fundus seiner lokalgeschichtlichen Bewanderung. Dann versagten beide Nieren. Dreimal wöchentlich mußte er zur Dialyse. Daß er 76 wurde, ist erstaunlich. Seinen Gewohnheiten blieb er treu wie ein Stein. Niemals wäre er ins Pflegeheim gegangen, obschon er zum Schluß, fast blind, nur noch im Rollstuhl saß. Er hatte eine Pflicht: seine beiden Katzen. Und einen Traum: Alt-Halberstadt. Und eine Wut auf alle, die es verdorben hatten – die Amerikaner im Feuersturm des 8. April 1945, dann, in Jahrzehnten Gammelwirtschaft, die SED-Kommunisten. Du sahst ja selbst, wie man die Fachwerkquartiere verfallen ließ. Zum Schluß vermauerte man die leergezogenen Gassen und ließ eine Geisterstadt zusammensacken: Abriß durch Regen und Ratten. Ja, Armins Zorn war begreiflich. Nicht verstehen könntest du vermutlich, was er empfand, als er – reisemündig, da Invalidenrentner – nach Westberlin fuhr und hinaus nach Spandau. Da stand er vor dem Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten. Drinnen wußte er Rudolf Heß, den Stellvertreter jenes Toten, dem Armin Dieckmann einmal einen Eid geschworen hatte.
Armin erfuhr noch eine Freude. Bis 1998 hatte Halberstadt-Mitte ein Parkplatz geziert. 53 Jahre nach der Zerstörung bekam die Stadt ein neues Zentrum, das in Grundriß, Traufhöhen und mit vielerlei Zitaten des verschwundenen gedachte. Wäre es nach Armin gegangen, hätte natürlich alles in historischer Kopie erstehen müssen. Erbittert stritten Investoren, Bauherr und Heimatvereine um das Rathaus. Der Kompromiß lautete: Neubau in historischer Dimension, mit einer gotisch befensterten Rolands-Front; die alte Ratslaube würde später in originalgetreuer Steinschnitzung nachgebaut, falls private Sponsoren das Geld aufbrächten. Armin finanzierte von seinem Geringen drei Fassaden-Elemente, für Tausende von Mark. Ungeduldig harrte er, daß der Bau voranginge und seine Steine vermauert würden.
Als er gestorben war, sah ich noch einmal das Zimmer, die Herzkammer unserer großelterlichen Welt. Wahre Erinnerungsgebirge hatte Armin hinterlassen, Zeitschriften-Massive, Türme von Dia-Kästen und Photo-Stapel, die Halberstadts Wandel durch die Zeiten dokumentieren. Schlösser sicherten, was ihm doch niemand nehmen wollte. Am Fenster thronte Omas alter Sessel. Die Löwenköpfchen an den Lehnen fletschten noch ihre Zähne, aus dem Polster wuchs Heu. Gegenüber stand das Röhren-Radio mit dem grünen Bullauge. Wie hatte dich vor vierzig Jahren das Pausenzeichen des NDR, des Hambürgers, fasziniert: Dum – dom – dem – dim – dimdim. Unbeirrbar hingen an den Wänden die oval gerahmten Urgroßeltern, die apfelfutternden Kinder von Boitzenburg – Vater, Tante Inge und die Brut der Nachbarschaft – und Walter Gemms Alt-Halberstadt-Gemälde: Königs Hotel, ein Lichtlein in jenem Fenster, hinter dem 1867 Urgroßmutter Dieckmann geboren worden war. Ich erbat mir das kindliche Soldatenbildnis des Hans Heinrich Nagel, der sich begeistert in den Ersten Weltkrieg stürzte und 1915 im Osten fiel. Oma hat ihren einzigen Bruder um 68 Jahre überlebt.
Manche Hinterlassenschaft war skurril. Fünf Stahlhelme, hundert Batterien, zweihundert Kerzen … Der Krieg kann kommen, sagte Tante Inge, gelinde verzweifelt. Stromsperren müssen wir nicht fürchten, Helme haben wir auch genug. – Ich stöberte ein bißchen in den Briefen, die Armin, nach Arbeitsdienst und Flakhelfer-Zeit Wehrmachts-Rekrut geworden, 1944 aus der Nähe von Warschau nach Hause geschrieben hatte: Banalitäten in Schülerschrift und gemäßigte Wehrbegeisterung. Hier deutsche Sache, dort der Feind, der, wie sich am 20. Juli 1944 schockhaft zeigt, sogar im eigenen Lager steht. Da ruckt der Ton etwas an. Ansonsten hat Mutti ein Päckchen geschickt – Bonbons, prima Kuchen –, hat Armin ein Munitionslager bewacht, hat er sich einen Finger geklemmt, der nun eitert, das tut weh. Das meiste klingt wie der Feldpost-Schrieb an den großen Bruder, meinen Vater, vom 7. Juni 1944:
Lieber Jochen!
Vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe ihn am 5. Juni bekommen. Gestern habe ich eine Zeitung von Vati bekommen. Er schrieb, daß Halberstadt wieder mit Fliegerbomben angegriffen wurde. Du warst wohl sicher noch da, was? Ich hätte das auch mal gern erlebt. Wir bekommen leider keinen Urlaub. – 8. Juni 44 – Morgen ist für uns Scharfschießen. Die Ausbildung ist für mich manchmal langweilig, da ich ja alles schon kenne. Gestern abend sind wir zu einer Variétévorstellung nach Sochaczew marschiert. Am 4. Juni sind wir vereidigt worden. Es ist hier sonst nichts Neues oder Besonderes vorgefallen. Hier regnet es in letzter Zeit oft, und da muß man achtgeben, daß das Gewehr nicht rostet. Nun herzliche Grüße
Dein Bruder Armin.
Das Photo im Wehrpaß zeigt den Idealtypus des germanischen Hitlersoldaten: blond, hübsch, gläubig, kühl. Zuletzt war Armin in Ostpreußen. Als Elbing verteidigt wurde, mußte er doch noch ins Feuer. Er wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft. Im August 1945 entließen ihn die Russen. Vom Krieg hörte ich ihn nie erzählen. Einmal sah er im Fernsehen »Die Kraniche ziehen«, die berühmte sowjetische Soldaten-Ballade, die Michail Kalatosow 1957 mit Tatjana Samoilowa gedreht hat. Das sei ein guter Film, sagte Armin. Der sei einfach wahr.
Er hat sein Lebtag ein penibles Tagebuch geführt. Er schrieb jahrzehntelang das Halberstädter Wetter auf, inklusive Windrichtung, und jegliche Geldausgabe. Es fanden sich auch etliche DDR-Auszeichnungen. Seine Brigade wurde immer wieder »Kollektiv der sozialistischen Arbeit«, da trafen die Plaketten mit Hammerzirkelährenkranz auch ihn. Ach, da ist ja die Unterschriftenliste, mit der Armin 1969 gegen die Sprengung der Paulskirchen-Ruine zu Felde zog. Guck, da steht in Kinderschrift dein Name. Danach geriet Armin ins Blickfeld der Stasi. Man attestiert ihm: anscheinend positive Haltung zur DDR, soziales Verhalten, Abstinenz von Rauch und Trunk. »Kontakte zu Frauen bestehen nicht.«
Es scheint, daß Onkel Armins Leben nachholende Kindheit war: daß er sich ertrotzte, was es nicht mehr gab. Viele der Steine, die Armin zum Burgbau in den elterlichen Garten karrte, stammen von abgebrochenen Gemäuern der Halberstadt-Geschichte. Ein Schuppen barg die elektrische Eisenbahn. Den Zugverkehr flankierten zwei polnische Plattenspieler des Typs »Mister Hit«. Links drehte sich die LP »Stimmen der Singvögel Mitteleuropas IV«, von rechts tuteten Dampflokomotiv-Signale. In der Heimatzeitschrift »Zwischen Harz und Bruch« wird Armin von Gesinnungsfreunden aus Photoclub, Numismatik-Verband und Geschichtsverein viel Rühmendes nachgerufen. Abgedruckt ist auch die schöne Trauerrede der Dom-Vikarin Angela Kunze-Beiküfner. Sie lackt und schmeichelt nicht, sie benennt die verquaste Hitler-Jugend, sie rühmt Armins Kinderliebe, sie spricht von Verläßlichkeit und Freundestreue wie von Intoleranz und Eigenbrötlerei.
Es ist ihre erste Beerdigung. Dreißig Menschen lauschen ihr in der Friedhofskapelle. Dann wimmert das Keyboard »Befiehl du deine Wege«. Die Tür der Kapelle wird aufgetan. Der Urne folgend zieht Armin Dieckmanns letztes Geleit zum Grab. Vom Dom weht Geläut herüber. Nachher sitzen die Getreuen noch im »Alt-Halberstadt«, quasi im Armin-Ambiente. Auf dem Heimweg gehst du an der Ratslaube vorbei, da vermauern die Bauleute gerade Armins Steine.
Ich blieb nicht in Halberstadt, sondern mußte zum Bahnhof. Ich fuhr nach Süden, in die Gegenwart. Kurz vor Mitternacht war ich in F. Ich freute mich auf Heike, aufs Reden und aufs Trinken. Ich erzählte ihr vom Begräbnis, von Onkel Armins lebenslänglicher Seßhaftigkeit, durch die er meiner Kindheit ein Blaubart-Zimmer bewahrte. Er verschloß es, verhängte die Fenster, verpichte die Fugen. Nichts ließ er herein und nichts entkommen, bis er sterben mußte und ich 46 war. Da wurden die Fenster und die Türen aufgerissen. Zeit strömte ein, und im harten Licht zerfielen die Gespinste der Kindheit zu Plunder. Das ist ja natürlich, sagte ich und goß mir immer wieder ein. Es mußte ja so kommen, eines Tags. Es war einfach schön, daß diese Kaverne der Vorzeit noch existierte. Jetzt wird man alles schleifen, die Grotte, den Bunker, die Burg …
Aber das bleibt dir doch, sagte sie. Wer sollte dir das nehmen? Du erinnerst dich und kannst es erzählen, da behältst du es, solange du willst. Was ist aus den Katzen geworden?
Die haben die Nachbarn genommen.
3
Es blieb nicht aus, daß der Junge erfuhr, was die treuen Teutbolds in Palästina so getrieben hatten. Dies vermeldete kein Harzer Sagenband, sondern ein anderes von Vaters Jugendbüchern. »Schwäbische Kunde« hieß es – Ludwig Uhlands Ballade, erschienen als Scholz’ Künstler-Bilderbuch Nr. 330, gemalt in schöner Fraktur und unvergeßlich illustriert von Wunibald Großmann.
Als Kaiser Rotbart lobesam
Zum heil’gen Land gezogen kam,
Da mußt’ er mit dem frommen Heer
Durch ein Gebirge, wüst und leer.
Daselbst erhob sich große Not,
Viel Steine gab’s und wenig Brot,
Und mancher deutsche Reitersmann
Hat da den Trunk sich abgetan …
Heiliges Land, feindliche Erde. Man sieht die Steine, die Kakteen, das karge Gebirge, der grünen Harzwelt gar nicht zu vergleichen. Der deutsche Held ist abgesessen und zieht sein mürbes Rößlein am Zaum.
Er hätt’ es nimmer aufgegeben
Und kostet’s ihn das eigne Leben.
So blieb er bald ein gutes Stück
Hinter dem Heereszug zurück.
Die Sonne sinkt, fast auch der Mut von Christ und Tier. Aber nun naht Erfrischung: viel Feind, viel Ehr.
Da sprengten plötzlich in die Quer
Fünfzig türkische Reiter daher …
Wunibald Großmann bringt auf seinem Bild nur drei Antichristen unter, die er als Neger koloriert. Sie triezen den Weißen mit Speerwurf und Pfeilbeschuß. Unser Mann bleibt kühl.
Der wackere Schwabe forcht sich nit,
Ging seines Weges Schritt vor Schritt,
Ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken
Und tät nur spöttisch um sich blicken,
Bis einer, dem die Zeit zu lang,
Auf ihn den krummen Säbel schwang.
Nun hat’s der Türke doch ein wenig übertrieben. Er bedarf einer Lektion.
Da wallt dem Deutschen auch sein Blut,
Er trifft des Türken Pferd so gut,
Er haut ihm ab mit einem Streich
Die beiden Vorderfüß sogleich.
Erschrocken betrachtet das Türkenpferd seine abgehackten Unterschenkel, die, wie auf einem roten Teppich, in blutiger Lache liegen. Das war nur der Anfang. Abermals holt unser Recke aus:
Als er das Tier zu Fall gebracht,
Da faßt er erst sein Schwert mit Macht,
Er schwingt es auf des Reiters Kopf,
Haut durch bis auf den Sattelknopf,
Haut auch den Sattel noch in Stücken
Und tief noch in des Pferdes Rücken.
Und jetzt des Dichters schönste Tat:
Zur Rechten sieht man wie zur Linken
Einen halben Türken heruntersinken.
Bei Gott, man sieht’s. Der Maler feiert den deutschen Hieb mit einer Doppelseite. Säuberlich gehälftet kippt das Objekt vom sterbenden Rappen. Grell sprudelt eine Blutfontäne auf. Die Türken türmen.
Und jedem ist’s, als würd’ ihm mitten
Durch Kopf und Leib hindurchgeschnitten.
Wahrlich, auch dem Jungen in Vaters Bücherkammer. Die Kunde von des Schwaben Schlag drang bis ans Ohr des Kaisers. Der ließ den Wackeren zwecks Pokalverleihung vor sich treten:
Er sprach: »Sag an, mein Ritter wert!
Wer hat dich solche Streich gelehrt?«
Der Held bedacht’ sich nicht so lang:
»Die Streiche sind bei uns im Schwang,
Sie sind bekannt im ganzen Reiche:
Man nennt sie halt nur Schwabenstreiche.«
Das vergißt du nie. Das ist untilgbar: die Angstlust, der erregte Ekel, deine Ohnmacht gegenüber diesem Sound der humorigen Barbarei. Der halbierte Türke war dein erster Toter, viel entsetzlicher anzuschauen als dann der gute Schwedenkönig Gustav Adolf, den ein Katholik in der Schlacht von Lützen meuchlings vom Schimmel schoß (1632, Fleißbildchen für beständigen Kindergottesdienst-Besuch). Der Schwabe mordete in Christi Namen. Da kniet der Brave vor dem Kaiser, gestützt auf sein rühmlich gerötetes Schwert, und Barbarossa reicht ihm einen Goldkelch, als erteile er das Sakrament. Immer wieder hast du zurückgeblättert zum Türken und seinem leergebluteten Pferd. Drei Ritter, Kreuze auf den Schilden, sprengen vorüber.
Drauf kam des Wegs ’ne Christenschar,
Die auch zurückgeblieben war:
Die sahen nun mit gutem Bedacht,
Was Arbeit unser Held gemacht.
Sie sehen nichts anderes als du: die entseelte Menschenschlaube, die ausgesuppte Kreatur. Aber sie lachen. Und der Maler und der Dichter sind auf ihrer Seite.
Der Tag, da dies erinnert wird, ist der 21. Mai 2004. Die »Berliner Zeitung« veröffentlicht Photos aus dem Bagdader Abu-Ghraib-Gefängnis: Da liegt, mit offenem Mund, ein toter irakischer Häftling. Darüber beugt sich der US-Korporal Charles Graner, sadistisch grinsend, mit gerecktem Daumen. Auf dem nächsten Bild derselbe Tote, mit der Soldatin Sabrina Harman. Sie strahlt in die Kamera – eine schöne junge Frau, die der Mord erotisch zu beflügeln scheint. Da lacht das Menschentier in seiner geilen Lust, damals wie heute, wie in jedem Krieg.
4
Ein Halberstadt-Buch ist erschienen, das liest du elektrisiert: Wibke Bruhns’ »Meines Vaters Land«. Du kanntest die Geschichte ungefähr. Hans Georg Klamroth, der Vater, wurde am 26. August 1944 als Mitwisser des Attentats auf Hitler hingerichtet. Elf Tage zuvor starb am Galgen Bernhard Klamroth, sein Schwiegersohn, der Stauffenberg den Sprengstoff besorgt hatte. Davon erzählte dir 1994 Sabine Klamroth, Wibke Bruhns’ ältere Schwester, am Kamin ihres elterlichen Hauses. Die Villa, anfangs des Jahrhunderts von Hermann Muthesius erbaut, ließ immer noch den Bürgerstolz der wilhelminischen Gründerzeit spüren. Die Klamroths waren so etwas wie die first family von Halberstadt. Nach 1945 gingen sie in den Westen. Das Haus wurde HO-Hotel. Nach der Wende verkaufte Sabine Klamroth ihre Heidelberger Anwaltskanzlei und zog zurück in die niemals vergessene Vaterstadt. Das bundesdeutsche Heldengedenken zum 20. Juli, sagte sie, sei ihr immer suspekt gewesen, wegen des Vielen, das sich hinter diesem Ehrenschild verbarg. Stauffenbergs Putschversuch? Das hätten die mal eher machen sollen, nicht erst, als der Krieg verlorenging. Aber lange guckten sie schön zu, was diese Verbrecher taten. Man hat doch gewußt, was mit den Juden geschah.
»Meines Vaters Land« beschreibt exemplarisch den vaterlandswahnsinnigen Militarismus des deutschnationalen Bürgertums und dessen Verhitlerung. Die Klamrothsche Familiensaga wird umstellt mit Zeitgeschichte. Zugleich ist dies ein Buch über die Bedürfnisse autobiographischen Erinnerns. Keineswegs verschwiemelt Wibke Bruhns des Vaters trübe Seiten, von seiner Schürzenjägerei bis zur martialischen Volkskampf-Romantik. Bereits 1916 entlädt sich die Kriegsbegeisterung des Schmächtlings Hans Georg in dem Ruf: »Hurra! Hurra! Endlich felddiensttauglich!« Der Ton der Kriegs-Korrespondenz ist unsäglich. Im Triumph meldet Jung Georg den Eltern, er habe einen russischen Offizier erlegt. »Das dumme Gesicht von dem Mann hättet ihr sehen sollen, es war zum Malen! Schon knallte meine gute Parabellum zweimal, worauf er links vom Sattel sank. Der erste Mensch, den ich bewußt getötet habe; Krieg!« Die Mutter freut sich allgemein an »Deinen vielen herrlichen Erlebnissen«. Freilich bekommen die Eltern Anfang 1918 auch zu lesen: »Meine erste Begeisterung und mein erster Blutdurst sind gestillt, so was verschwindet merkwürdig rasch, durch die erste Feuertaufe schon.« Eine Tat wird Hans Georg Klamroth sein Leben lang verfolgen: Er erschießt einen deutschen Infanteristen, der im Suff ein Schwein gestohlen hat. Die Mutter schreibt ihm, biblisch autorisiert: »Denke daran – ›es kann mir nichts geschehen, als was er hat versehen und was mir selig ist‹ – und ich hoffe doch, Du sagst Dir auch, daß es um solch aufwieglerischen Patron nicht schade ist. Gott sei Dank, daß es nicht umgekehrt war. Heute kam wieder ein so schönes Butterpaket von Dir, wir alle danken Dir, und von der anderen Sache erfährt einstweilen niemand.«
Als Leutnant kehrt der junge Klamroth heim nach Halberstadt. Dort ist er nichts, da pariert ihm keiner. Nun soll er erst mal in die Lehre. Auch Deutschland ist nichts mehr nach Versailles. Wie dieses durchgemangelte, desorientierte Volk fast zwangsläufig an seinen Führer fiel, diese Geschichte vom Wiederaufstieg in die Katastrophe hat wohl niemand fühlsamer erzählt als Anna Seghers in »Die Toten bleiben jung«. Man begreift, daß Hitler für die Mehrzahl der Deutschen eine Fortschrittshoffnung war, der Wiedereintritt in die Nationalgeschichte, nicht das Desaster unserer aufgeklärten Retrospektive. Wibke Bruhns’ recherchierende Erinnerung kann hart reden und spricht das nötige Urteil aus. Aber diese Nachgeborene will eben nicht nur begreifen, sie wünscht auch die eigene Abkunft zu hüten – durchaus mit einem Quantum Ahnenstolz. Das muß mitunter korrumpieren, wenn sie etwa offenbart, was Major Klamroth im Zweiten Weltkrieg kaum umwunden von der Ostfront berichtet: daß er Partisanen zu vernehmen hat, viele noch halbe Kinder, die nachher »the way of all flesh« geschickt werden. »Ich weiß nicht, wie ich mich dazu verhalten soll«, zaudert die Tochter und flapst: »Krieg ist keine Schönwetter-Angelegenheit. (…) Soll ich mich empören, daß HG sie erschießen läßt? Keine Besatzungsarmee läßt sie gewähren und im Krieg schon gar nicht.«
Diese mißlungenste Passage des Buchs ist nicht typisch, gleichwohl eine Schlüsselstelle. Sie zeigt, wie befangen wir das Ureigene erinnern. In die Erkenntnis stehlen sich Interessen. Die Fakten werden von Gefühlen unterspült. Die schroffen Linien, die harten Farben verschwimmen zu einem Aquarell der Milde. Vater mußte das schreiben, so wolltest du denken, als dir beim Kramen in der Ahnenkiste jenes gräßliche Blatt Zeichenkarton in die Hände kam. Darauf hatte der Halberstädter Gymnasiast Hans-Joachim D. mit Ausziehtusche kalligraphiert:
Ihr Sturmsoldaten, jung und alt,
nehmt die Waffen in die Hand!!
Der Bolschewist, der dringt ganz fürchterlich
in das deutsche Vaterland.
War einst ein deutscher Sturmsoldat,
ei, dazu war er bestimmt,
daß er sein Weib, sein Kind
verlassen muß geschwind.
Alte Weiber weinen fürchterlich,
junge Mädchen noch viel mehr;
so leb denn wohl, mein geliebtes Kind,
wir seh’n uns nimmermehr. –
Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht,
ei, da hat er frohen Mut,
wenn die roten Fahnen vor uns weh’n,
ei, da geht’s noch mal so gut! –
Hundertzehn Patronen umgehängt,
scharf geladen das Gewehr,
und die Handgranaten in der Hand,
Bolschewist, nun komm mal her!
In der Praxis ging die Sache etwas anders aus, wie Vater erzählte. Im Wahlkampf 1932, da war er zwölf, tigerte er mit bierdeckelgroßen Hitler-Aufklebern durch Halberstadt und pappte sie den Thälmann-Plakaten aufs Auge. Auf einmal, sagte Vater, packte mich was am Kragen. Ich drehte mich um, da stand hinter mir ein riesiges Kommunistenmädchen. Sie klatschte mir links eine und rechts eine. Ich rannte weg und verlor meine ganzen Hitlerbildchen.
Dann fandest du einen Schulaufsatz. Schwarze Tinte, gestochenes Sütterlin. Unterstreichungen mit Lineal, so auch das Datum jenes Tages – 2. IX. 1937 –, da Vater, der Unterprimaner, sich der Frage auszusetzen hatte: »Inwiefern gilt für das Wirken Adolf Hitlers das Wort Moltkes: ›Um große Erfolge zu erreichen, muß etwas gewagt werden‹?« Was folgt, liest sich wie der Kleine Katechismus nationalsozialistischen Kinderglaubens. Man darf das nicht kürzen. Erst der gesamte Text entfaltet seine geradezu nordkoreanische Schönheit:
Halberstadt, 1940. Kühlingerstraße, Martinikirche.
Es gibt ein schlichtes deutsches Sprichwort, das überall bekannt, ja zum Teil schon abgegriffen ist und das doch eine große Wahrheit in sich birgt: »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!« Es hat sich hundertmal in der Geschichte bewahrheitet, sei es bei Ulrich von Hutten, der mit der Parole »Ich hab’s gewagt!« seinen Kampf führte, oder bei Friedrich dem Großen, der gegen eine Welt von Feinden zu kämpfen wagte und schließlich doch seine Herrschaft behaupten konnte. Und das Sprichwort gilt auch heute noch: Der ganze Kampf Adolf Hitlers war und ist ein Wagnis und ist trotzdem, oder gerade deswegen, schon von ungeheuren Erfolgen gekrönt. Schon der gewaltige Entschluß des Führers, einem ganzen System, einer Weltpest den Kampf anzusagen, obwohl er mittellos war und nur sieben Mitkämpfer hatte – ein völlig unbekannter Mann in einer unbekannten Partei – zeugt von seinem großen Wagemut, seiner großen Entschlußkraft. Diesen Geist drückte er später einmal sinngemäß etwa in folgenden Worten aus:
»Es ist nicht entscheidend für den Charakter eines Menschen, daß er in seinem Handeln Erfolg hat, entscheidend ist nur, daß überhaupt etwas getan wird. Soll der Bauer nicht zu säen wagen aus Furcht, ein Unwetter könnte die Ernte vernichten, oder nicht ernten, weil am Ende der Regen ihm das Korn verdürbe?«
Mit diesem Geiste begann der Führer seinen großen Kampf, den er nur durch diesen Geist mit Erfolg krönen konnte.
Nun sammelte Adolf Hitler immer mehr Anhänger, die teils beeindruckt und gewonnen wurden durch seine Persönlichkeit, teils einen Retter suchten, als die Not im Vaterland immer größer wurde. Endlich kam der Tag, da er losschlagen zu müssen glaubte, ja losschlagen mußte, weil die Zeit nach einer Explosion drängte. Es war der 9. November 1923. Es mußte eine bestimmte Tat gewagt werden, gleich, ob ein Hagelschlag die Arbeit verderben würde. Dieser Hagel von Geschossen der Reaktion vernichtete die geleistete Arbeit, verhinderte aber nicht den Erfolg. Denn der Erfolg wurde erst möglich durch die Blutopfer des 9. November, wie es Hitler am 8. November 1936 in seiner Gedenkrede zum Ausdruck brachte, und durch den Fehlschlag im Jahre 1923. – Der Führer wagte weiterhin den Kampf, er hatte den Glauben an seine Idee nicht verloren; er sprach in seiner denkwürdigen Rede vor dem Gerichtshof, der ihn zur Rechenschaft ziehen wollte, die Worte: »Das Urteil, das Sie über uns fällen werden, kennen wir. Jedoch die ewige Göttin der Geschichte wird lächelnd dieses Urteil zerreißen, denn sie spricht uns frei!«
Oh, das kennst du, das hast auch du vernommen – dieselbe heilsgeschichtliche Zukunftsanmaßung, wenngleich aus sehr anderem Mund. Und wenn sie uns in Bande werfen – wir sind frei! Leben wird unser Programm. Es wird die befreite Menschheit beherrschen, so sprach, nach meiner Erinnerung, Karl Liebknecht vor dem Leipziger Kammergericht und, dramatisch nachgeorgelt, auf einer blutroten Schallfolie, die 1968 dem Pioniermagazin »Fröhlich sein und singen« beigegeben war. Aber lesen wir weiter:
Adolf Hitler fing wieder von vorn an. Seine Bewegung wuchs von Tag zu Tag und mit ihr seine Feinde. Zuerst hatte man ihn verlacht, dann wurde man aufmerksam auf ihn; jetzt wurden die stärksten Gegner die Kommunisten, die seine Anhänger verfolgten, wo sie nur konnten und selbst vor dem Morde an Jungen nicht zurückschreckten. Trotzdem wagte Hitler den Kampf gegen die kommunistische Seuche; seine Anhänger gingen in die roten Industriestädte, ins Ruhrgebiet, nach Hamburg und Altona und Berlin, und ließen sich totschießen und totstechen, für die Idee – für Deutschland. Und für jeden Ausfallenden stellten sich hundert Neue in die Reihe.
Wieder war es ein Wagnis um Sein oder Nichtsein der Bewegung, wieder stand die Existenz Deutschlands auf dem Spiele, »denn«, so sagte der Führer, »wäre damals eine Mutter zu mir gekommen und hätte gesagt, Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen, so wäre der Kampf umsonst gewesen, aber, glauben Sie mir, es ist keine Mutter gekommen!« Er hatte den Kampf gewagt, nur so konnte er Erfolge haben, nur so kamen die Nationalsozialisten von noch nicht zehn Sitzen im Reichstage 1928 auf über hundert Sitze nach zwei Jahren. Ein neues Wagnis war die Aufstellung Hitlers zur Reichspräsidentenwahl – sie wurde ein großer Erfolg, ebenso wie die Reichstagswahl am 31. Juli 1932.
Mit die schwersten Zeiten im Kampfe um die Macht waren die Augusttage 1932. Viele selbst der treuesten Kämpfer des Führers drängten diesen, den angebotenen Vizekanzlertitel anzunehmen, jedoch er blieb unbeirrbar bei dem sich gesteckten Ziele, entweder alle Macht zu bekommen oder zu verzichten. Er setzte dabei alle bisherigen Erfolge aufs Spiel, wie es die Novemberwahlen zeigten, jedoch mußte es gewagt werden. Und der endgültige Erfolg, der 30. Januar 1933, gab ihm recht.
Eine neue Zeit, die nicht minder schwer und sorgenvoll war für den Führer, die Wagnisse von noch viel größerer Tragweite mit sich brachte, begann. Im Innern galt es, die drohende kommunistische Gefahr zu bannen, die Parteien zu beseitigen, ohne daß das Reich in Gefahr geriet. Deutlich kommt uns die Entschlußkraft des Führers zum Ausdruck, deutlich der Wagemut, als es galt, die »zweite Revolution«, die Röhmrevolte auszubrennen. Er selbst griff am 30. Juni 1934 ein, trat persönlich den Aufrührern gegenüber, ließ die Verräter, die doch immerhin großes Ansehen genossen, verhaften und an die Wand stellen, machte also selbst die zweite Revolution und rettete, unter Einsatz des eigenen Lebens, seine Idee und das Reich.
Am meisten wagte der Führer jedoch auf außenpolitischem Gebiet, nachdem er unter Gefahr eines Angriffes vieler Gegner und Verwüstung des Reichs am 14. Oktober 1933 aus dem Völkerbunde austrat, heimlich eine Wehrmacht schuf, die allgemeine Wehrpflicht am 12. März 1935 verkündete, eine neue Luftwaffe aufbaute, am 7. März 1936 das Rheinland durch deutsche Truppen besetzen ließ u.s.w. Und er siegte auf der ganzen Linie.
So sehen wir an dem Kampfe Adolf Hitlers, wie wahr Moltkes Wort ist. Ohne Wagemut auch keine Erfolge. Daß aber des Führers Wagemut auch Erfolge mit sich brachte, lag nicht allein in seiner Macht, denn Gott segnete das Werk des Kämpfers.
Es war vollbracht. Als nächstes würde der Führer die Heimholung Österreichs wagen, dann seine Hand aufs Sudetenland legen und in zwei Jahren minus einem Tag die Westerplatte beschießen. Und das Werk des Kämpfers hieß gesegnet, bis der Krieg dorthin zurückzukehren wünschte, von wo er ausgegangen war. Das will jetzt keiner ahnen. »Sehr gut«, steht unter dem Elaborat, »wohlüberlegter Inhalt in angemessener Form und glatter Darstellung«, dazu ein studienrätliches Kürzel, das »Kn.« bedeuten könnte.
Die Zuchtanstalt, da dies geschrieben wurde, war das Halberstädter Martineum. Wie jeder gewesene Pennäler hat auch Vater gern von seinen Paukern erzählt. Erinnerlich ist dir der Name eines Lehrers: Paule Knipfer. Der habe Schneid besessen. Die Familienkiste birgt auch ein paar brüchige Ausgaben des »Martineumsblatts«, der Postille für Ex-Gymnasiasten. Die vom Dezember 1939 bringt ein Photo des Lehrerkollegiums: zwei Reihen altvorderer Mannsbilder, durchweg im schwarzen Anzug, die Gesichter hart oder preußisch jovial. Der Jüngste sitzt in der Mitte, in SA-Uniform, mit blankgewichsten Knobelbechern. Das ist der Führer der Schule, der Oberstudiendirektor Paul Knipfer. Weiter hinten druckt das »Martineumsblatt« ein Gemälde des Zeichenlehrers Ernst Datan: Knipfer in Standartenführerpose, mit Eisblick und stählernem Scheitel, die Lippen brutal geschürzt, die nervige Faust in der Hüfte. Das Bild erscheint in memoriam, denn Knipfer lebt nicht mehr. Am 22. Dezember 1938 ist er gestorben, an Magenkrebs, mit 39 Jahren. Der Nachruf preist einen edlen Charakter mit ausgezeichnetem Kameradschaftssinn. »Einsatzbereitschaft im Kampfe des Führers um die Seele seines Volkes war ihm eine Selbstverständlichkeit. Es lag ihm im Blute, gefährlich zu leben.«
Erhebende Trauerfeier. Ehrenwache von Standartenführern der SA. Ernste Trauerklänge, gespielt von einem SA-Musikzug. Es spricht im Auftrag des Stabschefs der SA der Obergruppenführer Kob. »Sein Nachruf ließ alles Kleinliche des Lebens versinken und die Gedanken nur auf das Heldisch-Große richten. Die Fahnen senkten sich, als die wehmütige Weise vom guten Kameraden ertönte. Sie wurden wieder emporgerissen, und hell und klar klangen die Worte des Obergruppenführers: ›Standartenführer Knipfer ist eingegangen in die Standarte Horst Wessels.‹ Das Lied Horst Wessels beschloß die Trauerfeier.«
Aus keiner Silbe geht hervor, welches Lehrfach Knipfer unterrichtet hat.
Natürlich ist dieser gespreizte Jargon von brüllender Komik. Natürlich helfen Spott und Ekel wenig wider die prekäre Attraktion der Walhalla-Mystik. Da waltet ein Transrationales, ein joringelhafter Sog in die Ordensburgen der deutschen Romantik, deren Blaue Blume die Nazis zu Braunkohl gemacht haben. Du bist nichts, dein Volk ist alles – was uns als Vermassung graust, als Enteignung des persönlichen Gewissens, das wirkte Weihe, weil dem einzelnen die Bestimmung seines ganzen Herrenvolks verheißen war: zu glauben, zu wachsen, zu siegen – immer voran, voran. »Groß ist der Jubel, als der Führer erscheint«, schreibt der Martineer Heinz Franke über den Reichsparteitag 1936. »Unermeßliche Freude schwebt über dem ganzen Feld. Als er uns dann Worte sprach von seinem Vertrauen zu uns, von unserer Wacht gegen den Bolschewismus, und als er die Front abschritt, jedem einzelnen ins Auge sehend, da mag vielen der größte Augenblick ihres Lebens gekommen sein. Am anderen Tage fuhren wir gestärkt in unserem Glauben an Deutschland, Adolf Hitler und die Bewegung unserer Heimat zu.«
All diese Phrasen und Illuminationen umgriffen ja wirkliches Gefühl. Regelmäßig widmet sich das »Martineumsblatt« der völkischen Reisereportage und berichtet über Grenzlandmärsche