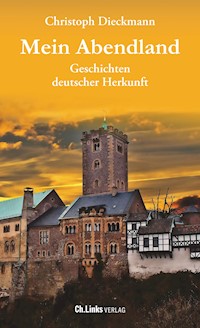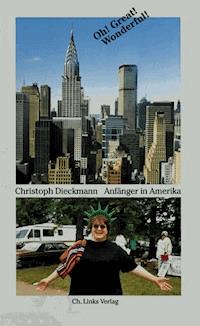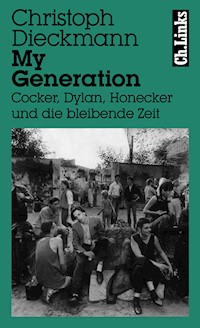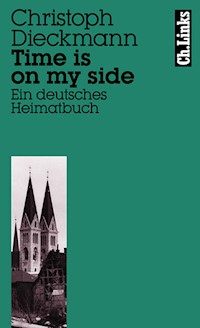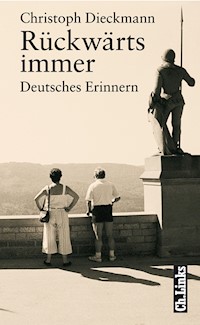9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christoph Dieckmann, der unermüdliche ZEIT-Chronist, sucht in seinem neuen Buch nach Wurzeln deutscher Identität. Er erzählt vom langen Untergang seiner DDR und von der Münchner Räterepublik, er reist zum »Schrein der Christenheit« nach Aachen, zur »Judensau« in Luthers Wittenberg, zur Walhalla und in Deutschlands einstige Kolonialmetropole Hamburg. Dieckmanns »Welt- und Heimreisen« führen weit: nach Chelmno, wo der Holocaust begann, durch die einstigen Ostblock-Diktaturen Russland, Georgien und Albanien bis zum 38. Breitengrad. An der Todesgrenze zwischen Süd- und Nordkorea bedenkt der Ost-West-Vermittler, was die Deutschen unterscheidet, doch
nicht trennen muss: Vergangenheit und Erinnerung. »Diese Grenze lässt sich überwinden. Unsere doppeldeutsche Geschichte ist ein gemeinsamer Schatz.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christoph DieckmannWoher sind wir geboren
Christoph Dieckmann
Woher sind wir geboren
Deutsche Welt- und Heimreisen
Meinem Verleger Christoph Links
mit Dank für drei Jahrzehnte Begleitung
zwischen Heimat und Welt
Auf Wunsch des Autors erscheint das Buchin nichtreformierter Rechtschreibung.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
1. Auflage, Februar 2021
entspricht der 1. Druckauflage vom Februar 2021
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: Nadja Caspar, unter Verwendung
eines Gemäldes von Caspar David Friedrich:
»Hügel und Bruchacker bei Dresden«, 1824
Satz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-96289-109-1
eISBN 978-3-86284-497-5
Inhalt
Woher sind wir geboren
Prägungen
Europas Geburtskirche
Aachen, das Neue Rom. In der Hauptstadt Karls des Großen
Die Luthersau
An der Wittenberger Stadtkirche prangt eine judenfeindliche Skulptur. Soll sie bleiben?
Gott mit keinem
Der Westfälische Frieden von 1648 festigte Deutschlands Glaubensspaltung und begründete Europas säkulare Politik
Im Himmelreich teutscher Nation
Eine Reise gen Walhalla
Preußens Totempfahl
Die Berliner Siegessäule, das erste Nationaldenkmal des deutschen Kaiserreichs
Heia Hamburg!
Auf Spurensuche in Deutschlands Kolonialhauptstadt
Da lag mal wer
Was blieb von der Münchner Räterepublik?
Die Marx-Engels-Kathedrale
MEGA: Ein Jahrhundertwerk nähert sich der Vollendung
Hier war es
In Chełmno begann die »Endlösung«. Eine Winterreise nach Polen
Endlich Moskau!
Nachsowjetische Impressionen zwischen Stalin, Gott und Vaterland
Utopie und Massengrab
Ein Jubiläumsbesuch der »Großen Sozialistischen Oktoberrevolution«
Mit Stalin in den Westen?
Georgische Erfahrungen
Europas Nordkorea
Eine Reise ins postkommunistische Albanien
Der Prediger von Fukushima
Mit Winfried Kretschmann in Japan und Korea
Die Seuche und ihr Arzt
1892 besiegt Robert Koch die Hamburger Cholera. Eine gegenwärtige Erinnerung
Anhang
Quellenverzeichnis
Photonachweis
Der Autor
Woher sind wir geboren?
Aus Lieb.
Wie wären wir verloren?
Ohn Lieb.
Was hilft uns überwinden?
Die Lieb.
Kann man auch Liebe finden?
Durch Lieb.
Was läßt nicht lange weinen?
Die Lieb.
Was soll uns stets vereinen?
Die Lieb.
Johann Wolfgang von Goethe
Woher sind wir geboren
Prägungen
1
Am 1. Mai 1989 erlebte ich die Liebe meines Volks zu seinem Führer. Das geschah in Berlin / Hauptstadt der DDR. Die Walpurgisnacht war lang gewesen. Ich wollte ausschlafen, doch die kleine Tochter rumorte und wünschte Unterhaltung.
Mach den Fernseher an.
Marschmusik erscholl, das Schnätteräng der Maiparade. Ein Jubelschrei: Mein liebster Erich Honecker!
Das Kind hatte auch den Ort erkannt. Wir wohnten nahe der Karl-Marx-Allee, durch die justament das Staatsvolk strömte, vorbei an der Tribüne mit den Granden des Regimes. Ich arbeitete und lebte im Berliner Missionshaus. Seit 1873 trutzte diese rote Klinkerburg am Volkspark Friedrichshain dem Wandel der Zeiten. Über dem Eingang prangte, flankiert von Petrus mit dem Himmelsschlüssel und Paulus mit dem Schwert, Christi Missionsbefehl: GEHET HIN UND LEHRET ALLE HEIDEN UND TAUFET SIE IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES UND DES HEILIG: GEISTES. Das war schwierig in der DDR. Nebenan ragten Plattenbauten. Darin wohnten Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Inmitten des Karrees befand sich ein Kindergarten. An dessen Spielzimmerwand erblickte die Tochter alltäglich ein gütiges Brillengesicht auf himmelblauem Grund. Jetzt forderte sie: Steh auf, Papa, ich will zu Erich Honecker! In echt!
Das war auch mir noch nicht vergönnt gewesen. Allerdings begegnete mir die Partei- und Staatsführung morgens beim Brötchenholen. Die Kreuzung am Königstor wurde gesperrt, wenn der Pulk der schwarzen Limousinen, aus dem Politbüro-Ghetto Wandlitz kommend, durch die Greifswalder Straße ins Berliner Zentrum jagte. An den roten Ampeln staute sich nörgelndes Volk. Ich fühlte mich erhaben. Den Ritualen der Diktatur blieb der Kirchenmensch fern, ideologische Lippenbekenntnisse wurden mir nicht abverlangt. Freilich umzäunte der Mauerstaat jeden Insassen.
Nun strebten Vater und Kind zum Strausberger Platz. Dort harrte das Volk seines Beitritts zur Demonstration. Es lehnte auf Schildern mit Parolen, es rauchte, schwatzte, vertat Zeit. Aus Lautsprechern schmetterte Zukunftsglück: Du hast ja ein Ziel vor den Augen / damit du in der Welt dich nicht irrst / damit du weißt, was du machen sollst / damit du einmal besser leben wirst … Endlich das Kommando: Formation Marschsäule!
Der Marsch war keiner. Formlos schlurfte die Masse in Richtung Alexanderplatz. Ich setzte das Kind auf eine Windmühlen-Attrappe des VEB Getreidewirtschaft Berlin. Rechts kam die Tribüne in Sicht. Die Latscher strafften sich und reckten ihre Schilder: Arbeite mit, plane mit, regiere mit! Wir sind Baumeister am Haus der friedlichen Zukunft! Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden! Mein Herz für die DDR! Vorwärts zum 40. Jahrestag unserer Republik – ich bin dabei!
Die Tribüne war treppig konstruiert, wie ein Siegespodest. Zunächst passierte man mindere Genossen, die, nur leicht erhöht, verhalten winkten und kaum Grüße empfingen. Dann aber droben die Parteiprominenz: Stoph, Mielke, Tisch, Axen, Sindermann, gruppiert um den Generalsekretär. Wie er lachte, wie er winkte, der kleine Mann im Sommeranzug mit der roten Nelke am Revers. Schlagartig war das Volk verwandelt. Es jauchzte: Hoch, hoch, hoch! Es wedelten bunte Tücher, Ballonbündel stiegen auf. Honecker rief Herzlichkeiten ins freudige Gelärm, er schüttelte Hände, er ergriff gar ein hinaufgereichtes Kind – nicht meines. Ich trug Sophie auf den Schultern. Das Volk drängte zur Macht. Fast wären wir gestürzt, Honecker zu Füßen. Die Folgenden schoben uns an der Tribüne vorbei.
Der Volkskörper erschlaffte in Sekunden. Die Genossen auf der Hinterstufe erfuhren nicht die geringste Beachtung. Die Schilder senkten sich, die Tücher verschwanden. Kein Ausklang, kein Blick zurück, nur noch mürrisches Getümmel. Es zerlief über den Alexanderplatz, zu Wurst und Bier, zu den Bahnen, nüscht wie weg. Das Volk schien wieder normal. Und doch wirkte der Jubel im Bannkreis der Macht unvergeßlich echt.
Abends schauten wir ausnahmsweise die Aktuelle Kamera. Vielleicht wären wir im Bild? Drei Viertel der halbstündigen Sendung galten dem Berliner Auflauf. Die dezent laszive Nachrichtensprecherin Angelika Unterlauf verkündete 700 000 Teilnehmer. Die Kamera fokussierte den Jubel vor der Tribüne, sie dehnte die Sekunden der Begeisterung zum Dauerzustand. Es folgten Kurzberichte von Maifeiern in aller Welt. In der Türkei war ein Demonstrant erschossen worden. In Moskau auf dem Lenin-Mausoleum erblickte man Michail Gorbatschow, der sich im Herbst als Honeckers Überwinder erweisen würde.
Youtube-Kommentare zum Berliner 1. Mai 1989: »30 Jahre. Wo ist die Zeit geblieben?«
»Kapitalistische Lügen können die Wahrheit nicht verbergen. Hier können Sie die Freude der Menschen auf dem Weg des Sozialismus sehen.«
»schauen alle so deprimiert, wahrscheinlich weil keiner freiwillig da war LOL«
»die sind alle freiwillig dort … niemand wurde gezwungen und gutgelaunt sind sie auch. Wir als lehrlinge damals meinten … das beste an der veranstaltung sind die bratwürste und der schnaps «
»meine güte war ich jung … habe an dem tag eine nette studentin mit nem Gipsbein bei der demo kennen gelernt … wollten vögeln … war aber später zu besoffen … was für ein jammer …«
»Die haetten uns nur reisen lassen sollen … 80 % mindestens, waeren in der DDR geblieben.«
»I like these people and their aims, maybe not the leadership.«
»Glaub ich, dass Erich ganz wuschig wurde, als die Damen anfingen, vor ihm zu turnen. Bei der nachträglichen Auswertung durch die Stasi wird er sich wohl einige zur Nachbereitung nach Wandlitz einbestellt haben.«
»Der vorletzte Tanz der alten Männer. Der letzte war dann am 7. Oktober.«
In den Annalen des Revolutionsjahrs 1989 hinterließ der 1. Mai keine Spur. Die Chronik der Wende beginnt am 7. Mai, mit der gefälschten DDR-Kommunalwahl, deren Auszählung von Oppositionsgruppen beobachtet wurde. Am 4. Juni massakrierte die Pekinger Regierung auf dem Tiananmen hunderte, vielleicht tausende protestierende Studenten. In Ungarn demontierte die kommunistische Regierung den Eisernen Vorhang. Ungezählte DDRler flohen im Sommer via Ungarn nach Westen. »Man sollte ihnen keine Träne nachweinen.« Das ließ Erich Honecker am 2. Oktober im »Neuen Deutschland« erklären.
Ihm wurde bald nachgeweint … Die Bevölkerung, sofern sie im Lande bleiben wollte, ging auf die Straße, zuerst in Plauen. In Leipzig entstand der Ruf WIR SIND DAS VOLK, das WIR betonend, als Replik auf die versammlungsfeindliche Lautsprecherdurchsage HIER SPRICHT DIE VOLKSPOLIZEI. Am 10. September veröffentlichte die Bürgerrechtsbewegung Neues Forum ihr Manifest »Die Zeit ist reif«, beginnend mit dem Satz: »In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört.« Mit letzter Kraft erreichte Honecker sein Nahziel, den 40. »Republikgeburtstag« am 7. Oktober, begleitet von den Prügeleien der Berliner Volkspolizei. Am 9. Oktober die Krisis: Wohl 70 000 demonstrierten in Leipzig; die befürchtete »chinesische Lösung« blieb aus. Am 18. Oktober wurde der Parteichef in der Politbüro-Sitzung von seinen Genossen zurückgetreten. Willi Stoph, angestiftet von Egon Krenz, sprach die Schicksalsworte: »Erich, es geht nicht mehr. Du mußt gehen.« Tags darauf holte ich Sophie vom Kindergarten ab. Sie stand in Tränen. Die geliebte Betreuerin hatte Honeckers Bild von der Wand genommen und erklärt: Kinder, ich muß euch etwas Schreckliches sagen. Onkel Erich war doch nicht gut.
Und das Volk? Jetzt erlebte ich seine Schönheit, hunderttausendfach, am 4. November beim Fest der Friedlichen Revolution auf dem Alexanderplatz. Die Demonstranten präsentierten nun sehr andere Parolen, die neuen Redner standen auf der Ladefläche eines LKW. Christa Wolf zitierte, was sie auf Transparenten gelesen hatte: Trittbrettfahrer zurücktreten! Rechtssicherheit spart Staatssicherheit! Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei. »Revolutionen gehen von unten aus«, so rief sie hinab. »Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei über die Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben und was wir uns jetzt laut zu rufen wagen: Demokratie jetzt oder nie! Und wir meinen Volksherrschaft, und wir erinnern uns der steckengebliebenen oder blutig niedergeschlagenen Ansätze in unserer Geschichte. Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen – der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk!«
Revolutionsredner Christoph Hein (Berlin, Alexanderplatz, 4. November 1989)
Waren das dieselben Menschen wie am 1. Mai? Oder gab es zwei Völker in der DDR – ein gefügiges, eines mit Charakter? Siebenundzwanzig Redner und Sänger traten auf, als fünftletzter Christoph Hein. Er erinnerte »an einen alten und wahrscheinlich jetzt sehr einsamen Mann. Ich spreche von Erich Honecker. Dieser Mann hatte einen Traum, und er war bereit, für diesen Traum ins Zuchthaus zu gehen. Dann bekam er die Chance, den Traum zu verwirklichen. Es war keine gute Chance, denn der besiegte Faschismus und der übermächtige Stalinismus waren dabei Geburtshelfer. Es entstand eine Gesellschaft, die wenig mit Sozialismus zu tun hatte. Von Bürokratie, Demagogie, Bespitzelung, Machtmißbrauch, Entmündigung und auch Verbrechen war und ist diese Gesellschaft gezeichnet.« Hein glaubte, auch für Honecker sei die DDR nicht die Erfüllung seiner Träume. »Selbst er, an der Spitze dieses Staates stehend und für ihn, für seine Erfolge, aber auch für seine Fehler, Versäumnisse und Verbrechen besonders verantwortlich, selbst er war den verkrusteten Strukturen gegenüber fast ohnmächtig. Ich erinnere an diesen alten Mann nur deshalb, um uns zu warnen, daß nicht auch wir jetzt Strukturen schaffen, denen wir eines Tages hilflos ausgeliefert sind.«
Honecker stürzte vergleichsweise glimpflich. Am 21. Dezember 1989 erhoben sich die Rumänen. Der Diktator Nicolae Ceausescu, am 7. Oktober noch Honeckers Gast, floh, wurde gefangen und am ersten Weihnachtstag samt Gattin Elena standgerichtlich abgeknallt. Ich saß im Berliner Operncafé. Am Nachbartisch besprachen zwei Damen die Bukarester Wende. Die Rumänen hätten es richtig gemacht. So müsse das hier auch laufen. Hinrichten, alle, das ganze Politbüro.
Um Gottes willen, wem nützt denn das?
Die Damen, spitzmündig: Junger Mann, unseren Gefüüühlen.
Honecker war nicht der Conducator Ceausescu. Wutvolk stürmte die Waldsiedlung Wandlitz und suchte in den Häuschen der geschaßten Herrschaft nach Märchenpomp. Was sich nicht finden ließ, erbitterte um so mehr. Nicht Titanen, nicht Dämonen – Kleinbürger hatten uns regiert. Das Ehepaar Honecker, von seiner Partei verstoßen, fand kirchliches Asyl im Pfarrhaus zu Lobetal. Daraufhin häuften sich Kirchaustritte. Als Honeckers in ein Regierungsheim nach Lindow umziehen sollten, wurden sie von einem Bürgermob fast gelyncht. Sie flohen zurück in Pastor Holmers Hut.
Einst hatte Margot Honeckers Volksbildungsministerium Holmers Kindern das Abitur verwehrt – wie mir, mangels Jugendweihe und Mitgliedschaft in der FDJ. Mit drei Holmer-Brüdern studierte ich am Theologischen Seminar Leipzig. Johannes stand im Tor unserer Fußballmannschaft, Markus spielte Stopper, Reinhard mit mir im Sturm. Jetzt verbargen sich Honeckers in Holmers Kinderzimmer. Welch Schwank der kichernden Weltgeschichte. Erich Honeckers Odyssee führte ihn am 3. April 1990 ins sowjetische Militärhospital Beelitz, am 13. März 1991 nach Moskau. Ende August überstand Gorbatschow knapp einen Putsch. Der neue starke Mann, Boris Jelzin, Präsident der Russischen Teilrepublik, verbot die KPdSU und forderte die Honeckers auf, das Land zu verlassen. Sie fanden Schutz in der chilenischen Vertretung, als letzte Botschaftsflüchtlinge der DDR.
Am 29. Juli 1992 wurde Erich Honecker auf Begehren der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin ausgeliefert. Ich heiratete an jenem Tag, hinter Honecker schloß sich das Gefängnistor von Berlin-Moabit. Dort hatte er bereits von 1935 bis 1937 eingesessen. Ich war mittlerweile politischer Redakteur der »Zeit« und wollte Honecker besuchen. Er war, wie sein Anwalt Nicolas Becker erfragte, einverstanden. Der Richter Hansgeorg Bräutigam verbot die Visite, weil ich, wie er mir am Telephon erklärte, die Wahrheitsfindung des Gerichts behindern könnte.
Kurz darauf wurde Bräutigam abgelöst. Er hatte sich vom Angeklagten Honecker einen Stadtplan signieren lassen. Der Wahrheitsfindung schien auch damit nicht gedient. Honecker, krebskrank, wurde am 13. Januar 1993 nach Chile entlassen und durfte dort am 29. Mai 1994 in Freiheit sterben. Die Wahrheit meiner Mauerjahre begleitet mich bis heute, wie das sogenannte Volk. Nach unserer Herkunft und Prägung frage ich immer. Davon handelt dieses Buch.
2
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, / Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. / Versuch’ ich wohl, euch diesmal festzuhalten? / Fühl’ ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? 2020, dreißig Jahre nach dem Untergang der DDR, dokumentierten die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Berliner Dietz-Verlag in Ton und Schrift ein »Faust«-dickes Drama: die Teufelsaustreibung der Linken, die Verstoßung des SED-Politbüros.
Das Drama spielt Anfang 1990. Der Herbststurm 1989 hat die Parteiherrschaft zerfetzt. Am 9. November ist die Mauer gefallen. Am 1. Dezember streicht die Volkskammer den SED-Führungsanspruch aus der Verfassung. Am 3. Dezember wird der Wirtschaftskommandant Günter Mittag verhaftet. Das Zentralkomitee der SED entzieht Erich Honecker, Willi Stoph, Staatssicherheitsminister Erich Mielke, Volkskammerpräsident Horst Sindermann, Gewerkschaftschef Harry Tisch, Werner Krolikowski, Günter Kleiber und Gerhard Müller die Parteimitgliedschaft. Sodann demissionieren ZK und Politbüro. Der öffentliche Ruf nach SED-Auflösung wird immer lauter. Dem widersetzt sich ein Außerordentlicher Parteitag, beschließt aber den »unwiderruflichen Bruch mit dem Stalinismus als System« und wählt zum neuen Führungsduo Gregor Gysi und Hans Modrow. Der Parteiname lautet fortan SED-PDS (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partei des Demokratischen Sozialismus), ab 4. Februar 1990 dann nur noch PDS.
Diese Partei will sich am 18. März zur ersten freien Wahl der DDR-Geschichte stellen. Die Zeit drängt, der Bruch mit der Vergangenheit muß bewiesen werden. Der Sonderparteitag hat eine Zentrale Schiedskommission gewählt, die am 20. und 21. Januar 1990 in Berlin die alte Führung einbestellt. Den Vorsitz des zwanzigköpfigen Gremiums übernimmt der Staatsanwalt Günther Wieland, Jahrgang 1931, spezialisiert auf NS-Verbrechen. Zunächst vernimmt die Kommission Margarete Müller, Landwirtschaftsexpertin, seit 26 Jahren Kandidatin des Politbüros. Sie hatte vorher, wie alle Anzuhörenden, eine Stellungnahme zu drei Fragen einzureichen: »Wie beurteilst Du Deinen persönlichen Anteil und Deine Verantwortung an der Politik der ehemaligen Parteiführung, die zur Krise in der Partei und in der Gesellschaft führte? Wie hast Du im Kollektiv der früheren Parteiführung gewirkt, um entsprechend dem Statut der SED gegen Subjektivismus, Mißachtung des Kollektivs, Egoismus und Schönfärberei aufzutreten und gegen jeden Versuch anzukämpfen, Kritik zu unterdrücken und diese durch Beschönigung und Lobhudelei zu ersetzen? Wie stehst Du zur Inanspruchnahme von Privilegien?«
Die Stellungnahme der Genossin Müller fehlt, sie bummelt wohl auf dem Postweg. Kommissionsmitglied N. N. (das Kürzel für nichtidentifizierte Beiträger) attackiert prinzipiell: »Wir haben fast keine Gesetze des Sozialismus bei uns zur Anwendung gebracht, weder das Leistungsprinzip (…) noch die Gesetze der Warenproduktion, der Investitionstätigkeit. (…) Wer hat der Arbeiterklasse Deutschlands die größte Niederlage ihrer Geschichte beigebracht? Ihr, ihr und kein anderer.«
Genossin Müller: »Sicher, man hat ja nun langsam Zeit, doch ein bißchen intensiver zu grübeln, aber irgendwie muß ich mal sagen, hat man doch immer gesagt, man hat ehrlich gearbeitet, man hat auch etwas geschaffen für die Menschen, die Menschen sind mitgegangen. So, und jetzt ist alles zusammengebrochen. (…) Und ich weiß, ich habe der Partei einen großen Schaden zugefügt.«
Ausschluß der Genossin, einstimmig. Die nunmehrige Frau Müller fügt sich, zum Wohle der Partei. Ihr folgt Werner Walde, Bezirksparteichef von Cottbus. Er gesteht zu große Abhängigkeit von Honecker. Vorteilsnahme? Sonderflugzeuge, Regierungssanatorien, Westimport-Erwerb – »Privilegien (…), die festgelegt waren, die unmoralisch waren, die ich bedaure, aber ich habe sie mit in Anspruch genommen.« N. N.: »Habt ihr gewußt, wie das Volk gelebt hat und habt ihr euch keine Sorgen darum gemacht, wenn ihr in Wandlitz eingekauft habt?« Walde: »Wir haben gewußt von der Versorgungssituation der Menschen.« Ausschluß, einstimmig.
Ebenso ergeht es dem verhaßten Joachim Herrmann, Honeckers Propaganda-General. Auch sprachästhetisch erweist sich Genosse Herrmann als Zumutung: »Ich bedaure zutiefst, daß ich nicht zu einer rechtzeitigen Veränderung in grundlegenden Fragen beigetragen habe. Aus damaliger Sicht habe ich im Kollektiv der früheren Parteiführung alle meine Kräfte eingesetzt, um die festgelegte Linie zu verwirklichen. Dabei galt als unverrückbarer Grundsatz, Parteidisziplin zu üben.« Kommissionsmitglied Joachim Lochmann: »Du hast das Schwert der Partei, die Medien, das ideologische Schwert, stumpf gemacht.« N. N.: »Und das Ergebnis kann man in wenigen Worten zusammenfassen: Ein Land zu Grabe getragen, eine Partei zu Grabe getragen und ein Ideal zu Grabe getragen.« Hinaus!
Siegfried Lorenz, SED-Bezirkschef von Karl-Marx-Stadt. Erst seit 1986 im Politbüro. Bei Honeckers Sturz Mitkonspirant von Krenz. Lorenz artikuliert in gescheitem Sächsisch Überzeugung und Selbstkritik. »Meine ablehnende Haltung zu Prunk, Protz und Repräsentationsgehabe ist den Genossen, die im Bezirk viele Jahre mit mir zusammenwirkten, gut bekannt. Seit meiner Mitgliedschaft im Politbüro habe ich von der Einkaufsmöglichkeit in Wandlitz bis September 1989 persönlich Gebrauch gemacht und mich dadurch dieser verurteilungswürdigen Gewohnheit von Politbüromitgliedern angeschlossen.« Lorenz beschreibt Honeckers Verweigerung gegenüber unliebsamen Realitäten und seine Konkurrenz zu Gorbatschow: Bis zu dessen Machtantritt konnte sich Honecker westwärts als der Entspannungspolitiker des Ostblocks profilieren, dann lief ihm der neue Mann im Kreml mit Glasnost & Perestroika den Rang ab.
Langes Gespräch. Überraschende Unterbrechung durch den Antrag der Genossin Ingrid Moritz, Siegfried Lorenz in der Partei zu belassen. Klare Mehrheit.
Es folgt Kurt Hager, der Chefideologe. Er doziert. Er beklagt die Unmöglichkeit theoretischer Auseinandersetzung mit Honecker und Genossen; unter Ulbricht habe man noch diskutiert. Indes: »Daß die Politik der ehemaligen Parteiführung zu einer tiefen Krise in der Partei und in der gesamten Gesellschaft führen würde, war nicht vorauszusehen.« Kommissionsmitglied Lochmann: »Wir haben heute eine Generation, (…) für die die Zeit vor 1848 und ihre Kultur eine Blackbox ist. Sie wissen mit dieser Geschichte nichts anzufangen. Ihr habt sie des geistigen Erlebnisreichtums beraubt und der Kultur.« Hager erklärt, in den sechzig Jahren seiner »Tätigkeit als Kommunist«, in Illegalität und Emigration habe er ein besonderes Verständnis von Parteidisziplin erworben. So erkenne er nun, daß seine Mitgliedschaft die Partei belaste. »Ich bitte darum, mich auszuschließen.«
Dem Manne kann geholfen werden. Ebenso ergeht es dem reisefreudigen Verteidigungsminister Heinz Keßler, dem proletarisch berlinernden Senior Alfred Neumann, dem Parteikontrolleur Horst Dohlus (parteiintern »der Friseur«) und dem einstigen Sozialdemokraten Erich Mückenberger. Sie mischen Einsicht mit Meriten und der Bezichtigung des fatalen Doppelgespanns Honecker /Mittag. Neumann bittet seine Kampfzeit zu bedenken, Keßler hielt Gorbatschows Reformen stets für richtig, Mückenberger vermißte gar die sozialdemokratische Parlamentskultur. Ein exquisites Hörspiel bietet die Frauenbeauftragte Inge Lange: »Ich selber komme aus dem Volke und bin an sich ein einfacher Mensch. (…) In der Fülle umfangreicher Vorlagen, die insbesondere zu ökonomischen Fragen behandelt wurden, vermochte ich mich jedoch kaum zurechtzufinden.« Bisweilen spürte sie, »das ist die Ecke, die am meisten klemmt«. Immerhin habe sie 1972 im dritten Anlauf das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch durchgebracht. Der sachlich-menschliche Kommissionsvorsitzende Wieland weiß, »wie schwer das auch jetzt wieder für jeden ist«. Dennoch muß auch Inge Lange ihr Parteidokument der Genossin Schönheit überreichen.
Zwei Wirtschaftler treten auf. Gerhard Schürer leitete die Staatliche Planungskommission und wurde nachmals im Westen bekannt als Autor des »Schürer-Papiers« zur DDR-Verschuldung. Honecker finanzierte seine »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« auf Pump, Schürer konfrontierte ihn und Mittag mit schonungslosen Bilanzen. Honecker deckelte den Realisten, der allerdings im Westimport-Shop Wandlitz besonders gierig zugriff. »Ursachen sehe ich darin, daß ich selbst in der Zeit überholter stalinistischer Denk-und Organisationsstrukturen erzogen worden bin. Besonders die privilegierte Lebensweise der Parteiführung förderte auch bei mir Eigenschaften, für die ich heute zu Recht verantwortlich gemacht werde.« Eindruck macht Werner Jarowinsky, geboren 1927 in Leningrad, promovierter Ökonom. Er ist schwer krank, neun Monate später wird er sterben. Wandlitz beschreibt er als »Ghetto der Eiseskälte«. Das Politbüro habe weder Kollektivgeist noch wirkliche Führung besessen. Das Wirtschaftsdesaster habe er früh erkannt. »Ich war kompetent.« Ihn lähmte die Angst, als Parteifeind dazustehen, als Zerstörer der Einheit. Ausschluß, ohne Gegenstimme. Enthaltungen? Bei Schürer eine, Jarowinsky erlangt vier.
Günter Schabowski schwafelt, recht salopp. Er sieht sich als Honecker-Stürzer und Wende-Pionier, ist allerdings in Wandlitz heftig »in den Sog solcher Privilegien geraten«. Überdies hing er »der Illusion an (…), daß die Wirtschaft der DDR relativ gut dasteht«. Honecker /Mittag hätten mit falschen Daten manipuliert, wonach Gorbatschows marode Sowjetunion, nicht jedoch die DDR der Perestroika bedurfte. Nun aber begreife er, »daß dieses System des administrativen Sozialismus auf eine verhängnisvolle Weise immer zur Selbstrechtfertigung tendiert. Je größer die Fehler werden, desto größer ist die Tendenz.« N. N. zum gewendeten G. S.: »Deshalb seid ihr drei – Egon Krenz, du und Siegfried Lorenz – eigentlich die ausführenden Vollstrecker dieser Notwendigkeit gewesen, weniger die Initiatoren.« Ausschluß, bei fünf Stimmenthaltungen.
Egon Krenz spricht klar: über die Wahlfälschung, über den Sommer der Agonie, über die Leipziger Krise, als er Waffengebrauch strikt untersagt habe. Auch über seine Hemmungen als Junior im Politbüro. »Gab’s hier jemand, der die Absetzung Erich Honeckers gefordert hat? Ich meine diese Frage ernst, weil alle Fragen aus heutiger Sicht gestellt werden. (…) Ich kämpfe um meine Mitgliedschaft.« Nach 102 Minuten Nacht-Kampf wird auch Krenz aus der Partei entfernt. Vier Gegenstimmen, drei Enthaltungen.
Dann ist’s vollbracht. Die Tonbänder dieses moralischen Marathons schlummerten drei Jahrzehnte im Karl-Liebknecht-Haus, der Berliner Linkspartei-Zentrale, in einer vergessenen Kiste. Der Ohrenzeuge teilt die Erschöpfung der Schiedskommission. Dieses Basis-Gremium wollte seine Partei desinfizieren; es putzte die eigene Geschichte. »Die Parteien der 1919 gegründeten Kommunistischen Internationale (Komintern) waren nach ihrer Bolschewisierung militarisierte, straff organisierte Bürgerkriegsparteien mit einer dementsprechenden missionarischen, quasi-religiösen sektenhaften Parteiideologie. Es entfaltete sich das Szenario von Parteireinigung, Denunziation, Ketzergericht, Exkommunizierung, Verdammung und Verbannung bis hin zum Massenmord an den eigenen Gefolgsleuten.« So schreibt Volkmar Schöneburg im Protokollband »Ausschluss. Das Politbüro vor dem Parteigericht«. »Auch als es längst keine politischen Richtungen mehr in den Komintern-Parteien gab, die sich hätten bekämpfen können, wurde auch in der SED weiter denunziert, ›entlarvt‹, ›ausgemerzt‹ und ›liquidiert‹ und so die Disziplinierung und Unterwerfung des Einzelnen im Selbstverständnis des Genossen tief verwurzelt.« Das Parteigericht vom Januar 1990 nennt Schöneburg einen notwendigen Anachronismus.
Bei der Wahl am 18. März 1990 gewann die PDS 16,4 Prozent der Stimmen. Im vereinigten Deutschland gerierte sie sich lange als Partei des Ostens – eine Anmaßung mit Gründen. Alle anderen Parteizentralen residierten im Westen, ohne Sinn für ostdeutsche Geschichte und Kultur. 1989 hatten von 16,4 Millionen DDR-Bürgern 2,3 Millionen der SED angehört, darunter fast die komplette Funktionselite eines Landes, dessen Prägungen nun bundesdeutsch untergebuttert wurden. Die heutige Linke ist im Kern sozialdemokratisch-bürgerlich. Ihr Wandel gelang durch Erkenntnis, Generationsablösung und (2007) die Vereinigung mit der westdeutschen Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit (WASG). Ihre Herkunft aus der Diktatur erließ der Linken kein Geschichtsgericht. Bereits am 20. Januar 1990 erklärte der Vorstand der SED-PDS: »Die Gegenüberstellung Erneuerer – Stalinist ist zu simpel. Die Erneuerung muß in jedem selbst stattfinden.« Klassisch sagt’s »Die Internationale«: Uns aus dem Elend zu erlösen / können wir nur selber tun.
3
Am 8. März 1996 erlebte ich Westberliner Führertreue. Der Fußballverein Hertha BSC war damals noch kein »Big City Club«, mangels Erleuchtung durch den Götterboten Jürgen Klinsmann. Er durfte jedoch in der zweiten Bundesliga dem FC Carl Zeiss Jena begegnen, dem Europapokal-Finalisten von 1981, dem unstürzbaren Spitzenreiter der ewigen DDR-Tabelle. Das Hinspiel in Jena hatte Hertha 3:0 gewonnen. Nun stieg die Rückpartie. Erregt eilte ich am Freitagabend mit Freund Adrian gen Olympiastadion. Zum Glück gab es noch Karten, etwa 66 000, doch 8099 Kenner ließen sich trotz Ekelwetters diesen Kracher nicht entgehen. Machtvoll hallten die Berliner Chöre im gähnenden Rund: HA HO HE, HERTHA BSC! und WIR WASCHEN UNSRE PANZER MIT DEM BLUT DER ANTIFA!
Wir Jenafans erlitten ein Trauerspiel. Ausschließlich Hertha stürmte. Das 5:0 nach einer halben Stunde wäre hochverdient gewesen, doch unser Torwart Mario Neumann flog schier unbezwingbar durch die Todeszone. Erst kurz vor der Pause traf Nico Kovac zur Berliner Führung. Die Herthaner schritten keck vom Feld. Japsend schlichen die Unsrigen in die Kabine. Dort ermunterte Trainer Matz Vogel, der DDR-Rekordlinksaußen, seine Thüringer Waldkinder zur Besichtigung der Westberliner Spielfeldhälfte. Zweite Halbzeit. Jena griff nun an, viermal. Beim ersten Versuch traf Heiko Weber, beim zweiten wieder, beim dritten Kovac ins eigene Tor, anschließend Mark Zimmermann. Herthas Volk fiel ins Koma. Klagend rief der Stadionsprecher: Hallo Fans, ich glaube, unsere Mannschaft braucht uns jetzt!
Super-Mario hielt noch einen Foulstrafstoß, Andreas Schmidt gelang noch Herthas zweiter Treffer, dann war Schluß und Jena im Paradies. Ich begoß mit Adrian das Wunder in einer stadionnahen Kneipe. Dort machten wir die Bekanntschaft eines rührenden Herthaners. Siebzehn war er, Hertha sei sein Leben, das ihn ansonsten mißhandle. Aufgewachsen sei er im Heim. Nun lebe er bei der Mutter, die er hasse. Keine Liebe, kein mütterliches Wort, nur Suff und Gekläff. Bei uns spüre er echte Sportskameradschaft, danke, Freunde. Wir seien so herzlich, sicher typisch Thüringen. Bei Hertha gehe es rauher zu. Künftig werde er Jena wärmstens bedenken.
Selbdritt liefen wir zur S-Bahn-Endstation. Zunächst saßen nur wir im Waggon. Dann rammte ein Hertha-Stoßtrupp herein. Unser neuer Freund erkannte seinen Sturmbannführer und machte Meldung: Das sind Jena-Fans! Die Bahn fuhr los, Adrian wurde der blaugelbweiße Schal vom Hals gerupft. Der Führer zückte ein Feuerzeug und steckte das feindliche Textil in Brand. Die Horde grölte, der Waggon verqualmte. Nun wies unser Freund auf mich: Der hat auch einen Schal, in der Tasche! Ich blieb unberaubt, denn die Herthaner mußten raus. Der Führer trat noch rasch ein stiefelgroßes Loch in die braune Wandverkleidung, dann entschwebte der Spuk, zuletzt der wackere Denunziant. Er präsentierte den Stinkefinger und krähte: Scheißjenawichser!
Zeitlebens hüte ich mich vor den Freuden der Kollektiv-Identität.
4
Mein Vater war Pfarrer in Dingelstedt am Huy. Wir hatten keinen Fernseher, doch im altwürdigen Pfarrhaus – Baujahr 1580 – wohnte auch die televisionär ausgestattete Familie Krems. Dort guckte ich »Rauchende Colts« oder »Spiel ohne Grenzen«, das Städtespiel mit Camillo Felgen, gern auch die Friedensfahrt. 1965 begann diese Tour de France des Ostens am 8. Mai mit der Etappe Rund um Berlin. Onkel Krems saß beizeiten vor der Flimmerkiste, denn zunächst lief das Fußball-Pokalfinale SC Aufbau Magdeburg gegen SC Motor Jena.
Magdeburg war unsere Bezirksstadt. Von Jena hatte ich nie gehört. Jena, das klang wie Harem oder Samarkand: nach Orient und Tausendundeiner Nacht. Und diese Märchenmannschaft stürmte und traf, durch einen Zauberschuß des weniger orientalisch benamten Helmut Müller. Das ist die Führung!, rief der Reporter. Es steht 1:0 für die bravourösen Männer aus dem Paradies! Auch dieser Herkunftsort betörte mich, als wären Jenas Spieler Engel, zumindest Pastorensöhne wie ich.
Das Märchen war kurz. Der Magdeburger Walter köpfte den Ausgleich. Onkel Krems brüllte lustvoll auf – und wenig später wieder, als Schiedsrichter Riedel Elfmeter pfiff, in letzter Minute, für Magdeburg. Hirschmann lief an, Jenas weißbehoster Torwart Fritzsche flog ins falsche Eck. Schluß! Onkel Krems orgelte vor Glück. Er griff in die Bierkiste, ließ die Bügelflasche ploppen, trank, rülpste und las, selig schnaufend, auf dem Harzbräu-Etikett den uralten Vers:
Es grüne die Tanne,
es wachse das Erz,
Gott schenke uns allen
ein fröhliches Herz.
Meins brach. Ich sah die traurigen Männer aus dem Paradies. Sie sanken hin. Die Magdeburger stemmten den FDGB-Pokal, ein bronzenes Ballarbeiter-Denkmal, jubelnd gen Himmel. Perfekt, rief Onkel Krems, jetzt kotzt Jena ab! Dieser grausame Siegersatz trieb mich zu den Opfern, für immer. Gewiß wäre es den Männern aus dem Paradies ein Trost, wenn sie mich auf ihrer Seite hätten. Dieser 8. Mai 1965 war der 20. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Für mich begann, im Alter von neun Jahren, eine lebenslange Liebeshaft.
Für’s erste belehrte mich der Schulatlas, wo Jena lag. Die Chance zur Revanche kam unerwartet rasch. In der Meisterschaft mußte Jena nach Magdeburg und erzwang ein 2:1, jedenfalls bis zur 86. Minute. Dann drosch Torwart Harald Fritzsche das Leder in den Rükken seines jungen Stoppers Hans Meyer. Von dort prallte die Kugel ins eigene Netz. Muß ich noch erwähnen, daß dem späten Ausgleich auch diesmal in letzter Minute das Magdeburger Siegtor folgte?
Wir lebten fern von allen Stadien dieser Welt. Traktor Dingelstedt spielte auf dem Sportplatz oben am Wald. Der große, der Jena-Fußball kam aus dem Radio. Am Samstagnachmittag legte Vater letzte Hand an seine Predigt und durfte nicht gestört werden. Ich saß bei Mutter in der Küche. Sie präparierte den Sonntagsbraten, ich schälte die Kartoffeln. Wir hörten Radio DDR: die Konferenzschaltung der sieben Oberliga-Spiele. Fußball interessierte Mutter nicht die Bohne, aber mein Seelenheil. Das hing vom Radio ab, vom – im Wortsinn – Röhren-Empfänger, von den schwellenden, brausenden Reporterstimmen und ihrer Kunde. Jeden Samstagmorgen fragte Mutter: Hat Jena heute Heimspiel? Heimspiele, wußte sie, wurden meistens gewonnen. Auswärts drohte Unheil, mithin ein verzweifeltes Kind. An einem fürchterlichen Samstag verlor Jena als Spitzenreiter beim Schlußlicht Erfurt, 0:1. Ich wagte mich mit diesem übergroßen Leid nun doch in Vaters Arbeitszimmer. Er hörte mich an. Sein Trostwort lautete: Nun ja, der Stern deiner Mannschaft ist im Sinken.
Vor einigen Jahren stöberte ich im Keller eines Abbruchhauses. Ich fand dort, unfaßbarer Zufall, das »Neue Deutschland« vom 9. Mai 1965: die Zeitung zu meinem ersten Fußballspiel. Sie ist acht Seiten dünn und kostete 15 Pfennige. Auf der Titelseite prangt die Zeile: »Mächtiges Bündnis zum Schutze des Friedens«. Daneben zeigen zwei Photos die »Deutsch-sowjetische Ehrenparade am 20. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus« – noch nicht in der Karl-Marx-Allee, sondern auf dem Marx-Engels-Platz, wo nachmals der Palast der Republik erwuchs. »Bevölkerung der Hauptstadt jubelte den Soldaten der verbündeten Armeen zu / Nachdrückliche Warnungen an revanchelüsterne Vorwärtsstrategen«.
Links unten, blau gerahmt, ein sportpolitischer Artikel. »Die XVIII. rollt«, so ist er betitelt. »Mit glanzvollem Zeremoniell nahm am 20. Jahrestag der Befreiung im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die XVIII. Internationale Radfernfahrt für den Frieden ihren Anfang. 25 000 begeisterte Berliner erlebten den Start der über 100 Giganten der Landstraße aus 19 Ländern zur ersten Etappe der insgesamt 2304 km langen, völkerverbindenden Fahrt.« Photo: Der polnische Botschafter Baranowski zerschneidet das Band zum Ehrenstart. »Während Schwärme von Tauben in den Himmel über dem Stadion fliegen, die Kunde von der Eröffnung in alle Teile der DDR zu tragen, verließ das bunte Feld das einem Meer winkender Fähnchen gleichende Rund, von donnernden ›Sport-frei‹-Chören der Berliner auf seiner ersten Etappe begleitet. (…) Auf der Ehrentribüne hatten Friedrich Ebert, Paul Fröhlich, Erich Mückenberger, Paul Verner, Günter Mittag, Horst Sindermann, Johannes Dieckmann und weitere Persönlichkeiten Platz genommen. Von den in der DDR weilenden ausländischen Gästen verfolgten Józef Cyrankiewicz, Shamsrangin Sambu, Frantisek Penc, Max Reimann und der erste Kosmonaut der Welt, Juri Gagarin, das großartige Volksfest.«
Der Ehrenstart wurde im Stadion vollzogen. Faktisch begann die erste Etappe außerhalb der Arena, in der Schönhauser Allee. Fünf Runden von je 22 Kilometern waren zu absolvieren, bevor nach 2 Stunden, 29 Minuten und 24 Sekunden der Russe Aleksej Petrow vor den DDR-Fahrern Axel Peschel und Dieter Mickein die Ziellinie überspurtete. »Neues Deutschland« widmet dem Ereignis fast die gesamte letzte Seite. Dem Fußball verbleibt ein unbebilderter Eck-Text von Joachim Pfitzner: »Magdeburg wieder Pokalsieger«.
Erstmals, rühmt Pfitzner, konnte eine Mannschaft den Pokal erfolgreich verteidigen. »Die Elbestädter hatten druckvoll begonnen, und Fritzsche mußte vor Walter und Stöcker retten. Aber es fiel kein Tor. So hatte der SC Motor Gelegenheit, die erste Phase heil zu überstehen. Da sich bei beiden Mannschaften die Nervosität nicht legte, wechselten die Szenen schnell vor beiden Toren. Und so mußte sich auch Magdeburgs Torwart Blochwitz einige Male vor Peter Ducke, der ansonsten nicht zu überzeugen wußte, Müller und Lange strecken.
Die Entscheidung in dem kampfbetonten, in spielerischer Hinsicht viele Wünsche offenlassenden Treffen, schien nach Müllers Scharfschuß gefallen, zumal die Magdeburger nachließen, aber: Als Fritzsche wieder einmal nicht entschlossen dem durchgebrochenen Magdeburger Klingbiel entgegenstürzte, köpfte Walter die Flanke zum Ausgleich ins Netz – zum Jubel der stimmgewaltigen, allerdings nicht immer ganz anständigen Magdeburger Anhänger. Kurz vor dem Schlußpfiff die tatsächliche Entscheidung: Foulspiel an Stöcker – Elfmeter! Einige Jenaer verloren die Nerven, und als Fritzsche den Magdeburger Walter wütend umstieß, hätte eigentlich der Feldverweis folgen müssen. Dann nahm Hirschmann Maß, und es stand 2:1. Etwas glücklich für die Magdeburger, tragisch für die Zeiss-Städter.«
Und so traten die Mannschaften an:
Jena spielte mit Fritzsche, Stricksner, Rock, Woitzat, Hergert (den das »Neue Deutschland« Hegert nennt), Marx, Knobloch, Müller, Peter Ducke, Lange, Roland Ducke.
Magdeburgs Aufstellung: Blochwitz, Wiedemann, Fronzeck, Zapf, Kubisch, Ruhloff, Stöcker, Hirschmann, Walter, Seguin, Klingbiel.
Auswechslungen waren damals noch nicht erlaubt. Die Statistik schließt mit der Torfolge. Demnach schoß Müller Jenas Führung in der 66. Minute, Walters Ausgleich fiel in der 82., Hirschmanns Siegtor in der 90. Minute. Das ist falsch. Und führte zum Skandal. Die Jenaer diskutierten erregt. Das 1:1 sei Abseits gewesen, der Elfmeter fragwürdig. Schiri Riedels ultimatives Bubenstück war jedoch sein letzter Pfiff. Er beendete das Spiel in Wahrheit bereits nach 82 Minuten. Das enthüllt der Zeiss-Chronist Udo Gräfe in »Jenas Fußball-Journal. Geschichte und Statistik« (2001). Das Endspiel war acht Minuten zu kurz. Warum?
Wegen der Friedensfahrt. Es drohte Verlängerung. Nach meiner Erinnerung füllte das Pokalfinale die Zeit zwischen Start und Zielankunft. In der »Neuen Fußballwoche« schrieb Günter Simon von einem »zeilich frühen Beginn vor Eröffnung der XVIII. Friedensfahrt«. Ob Juri Gagarin und die Ehrentribünlinge nicht länger auf die Eröffnung warten sollten, ob die Pedaleure zu rasch gen Jahn-Sportpark strebten – in jedem Fall mußte das Fußballspiel ohne Extrazeit enden. Ein einziger Jenaer erstritt eine persönliche Verlängerung. Die »FuWo« meldete: »Peter Ducke schädigte durch sein Verhalten in grober Weise das Ansehen der sozialistischen Sportbewegung. Obwohl in diesem Endspiel mehrfach dramatische Höhepunkte auftraten, kann dies in keiner Weise ein Verhalten rechtfertigen, das in grober Disziplinlosigkeit zu Beleidigungen und Unsportlichkeiten führte, wie dies nach diesem Endspiel durch den Sportfreund Ducke der Fall war.«
Peter Ducke hatte die Fußball-Funktionäre informiert, ihren Scheißpokal könnten sie sich in den Allerwertesten schieben. Für diesen unrealistischen Vorschlag wurde er zehn Wochen gesperrt.
All das liegt nun wirklich schon ein Weilchen zurück. Das Pokalfinale vom 8. Mai 1965 ist wohl nur wenigen erinnerlich, schon gar nicht als Schicksalsspiel der eigenen Fußball-Biographie. Und wäre ich im Fall eines Jenaer Sieges überhaupt Jena-Fan geworden? Insofern danke ich Schiedsrichter Wolfgang Riedel aus Falkensee.
Beruflich war Riedel Jurist und Chef der Finanzabteilung der Berliner Humboldt-Universität. In 1194 Spielen amtierte er als Schieds- und Linienrichter. 11 Länderspiele hat er gepfiffen, 1973 auch ein weiteres DDR-Pokalfinale (Magdeburg – Lok Leipzig 3:2). Nach der Wende amtierte Riedel als Schatzmeister und Schiedsrichter-Beobachter des Nordostdeutschen Fußballverbands. Einmal bin ich ihm begegnet, an einem Jenaer Glückstag.
Am 29. Mai 2005 fuhr ich mit meinem Sohn Cornelius nach Neuruppin. Nach vier Durstjahren in der 4. Liga Nordost war der FC Carl Zeiss Jena endlich Südstaffel-Sieger geworden: Nun trafen wir in zwei Aufstiegsspielen auf den Nordstaffel-Champion MSV Neuruppin. Dreitausend Zeiss-Beseelte reisten in die Fontane-Stadt. Conny war neun, wie ich bei meiner Jena-Premiere, allerdings längst stadionerfahren. Außerdem glänzte er als Mittelfeld-As beim VfB Einheit zu Pankow. Kurz vor dem Anpfiff flüsterte er mir ins Ohr: Papa, ich hab’ schon mal in Neuruppin gespielt und drei Tore geschossen. Welch Omen! Rasch führten wir, zur Halbzeit 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluß. Platzsturm! Auch im Rückspiel siegte Jena, 2:1. Wir stiegen in die dritte Liga auf, ein Jahr später in die zweite.
Im Siegesgewimmel von Neuruppin begegnete mir ein kleiner Mann im blütenweißen Hemd. Er kam mir bekannt vor, von alten »FuWo«-Bildern. Ich grübelte, dann fiel’s mir ein: Das ist Wolfgang Riedel! Ich sprach ihn an. Herr Riedel, sagte ich, Sie haben mich zum Jena-Fan gemacht, am 8. Mai 1965.
Er verstand nicht: Wie denn das?
Sie haben im Pokalendspiel Elfer für Magdeburg gepfiffen, wegen der Friedensfahrt. Und das Spiel abgekürzt, damit es keine Verlängerung gab.
Er lächelte, wohlwissend: Alles Volkssage!
Herr Riedel, sagte ich, weil’s nun schon ein bißchen her ist und weil wir gerade so herrlich gewonnen haben, könnte ich eine Begnadigung erwägen. Aber Sie müssen sich mit meinem Steppke photographieren lassen. Der ist heute genau so alt wie ich damals.
Komm her, Steppke, sagte Riedel und nahm Conny in den Arm. Er roch nach Flieder, wie der Mai. Conny dann auch.
Wolfgang Riedel und Cornelius Dieckmann (Neuruppin, 29. Mai 2005)
Wolfgang Riedel starb am 12. November 2007, mit 78 Jahren. Das Fußball-Leben ist fair. Was es an Zeit nimmt, ersetzt es durch Geschichten. In Samarkand erreichte mich am 12. April 2014 die Nachricht von Jenas 0:1-Heimniederlage gegen Auerbach. Das klang wie ein Märchen aus dem Okzident.
5
1912 erreichte Robert Scott den Südpol und verlor sein Leben. 1976 expedierte auch ich gen Süden und verlor meinen Photoapparat, sodann noch etliches mehr. Im selben Jahr erschien ein Meisterstück ostdeutscher Rockmusik: »Der Kampf um den Südpol« von der Stern-Combo Meißen:
Es ging ins 20. Jahrhundert,
jedes Land war entdeckt,
nur der kalte Pol im Süden
auf der Karte noch weiß gefleckt.
Da begann der große Wettlauf,
ihre Schiffe machten flott
zwei Kapitäne, namenlose,
später Amundsen und Scott.
Musikalisch war das Opus inspiriert von den Temptations, textlich von Stefan Zweig. Dessen »Sternstunden der Menschheit« liebte ich sehr: vierzehn historische Miniaturen von psychologistischer Dramatik. Immer wird der Geschichtslauf an jene Gabelung des Wegs geführt, wo ein Charakter alles entscheidet. Epochal geht’s los, bei Waterloo, am 18. Juni 1815. Napoleon, der Weltgeist zu Pferde, reitet ins letzte Gefecht, gegen die Alliierten unter Wellington. Fast triumphiert der Dämon abermals. Wellington barmt bereits: Either night or the Prussians will come, ich wollte, es wäre Nacht, oder die Preußen kämen! Der Kaiser indessen ersehnt seinen Marschall Grouchy und dessen 33 000 Mann. Der Vermißte verharrt bei Wavre, vierzehn Kilometer entfernt. Obwohl Grouchy hört, daß unweit eine Schlacht entbrennt, befolgt er Napoleons überholte Order, Blücher zu suchen. Der eilt nach Waterloo und siegt. Preußen rettet Europa, wenngleich nicht für immer.
Robert Scotts Expedition arbeitet sich mit Ponys und anfälligen Motorschlitten dem Südpol entgegen, im Bewußtsein eines Konkurrenten. Der Norweger Roald Amundsen ist gleichfalls unterwegs; er nutzt Schlittenhunde. Scott erreicht das Ziel am 18. Januar 1912 – zu spät. Stern-Combo-Sänger Reinhard Fißler berichtet mit schmerzlichem Tenor:
Doch als Scott an den Südpol kam,
da stand schon Amundsens Fahne fein.
Da brach der Frost von draußen her
ihm tief in das Herz hinein.
Kein Petroleum half mehr,
und kein Denken an Frau und Kind.
Und erfrorn mit ihm sind vier Mann
im ewigen Eis und Wind.
Der Rest ist Coda, umstürmt vom mörderischen Element:
Was bleibt nach dem Tode,
wenn nicht bleibt der Ruhm?
Was bleibt nach dem Tode?
Große Tat, großes Menschentum!
Zu diesem Pathos imaginiere man einen heldenmütigen Studenten der Theologie, der im Lenz des Jahres 1976 tatendurstig durch Leipzig schwebt, maximal verliebt in eine entzückende Heidin, deren Unglaube ihn überhaupt nicht stört. Sie beglücken einander, ist das denn kein Gebet? Mozarts »Zauberflöte« trillert: Mann und Weib, und Weib und Mann, reichen an die Gottheit an.
Natürlich will er sie heiraten. Sie hat ja nichts dagegen, doch zunächst möchte sie mit ihm bis ans Ende der Welt. Das liegt etwas näher als gewünscht. DDR-Bürgern steht der Erdball nur zonenweise zur Verfügung. Der sozialistische Planet ist eine fortschrittlich gezackte Scheibe. Am äußersten Rand liegt Bulgarien, dahinter das feindliche Nichts.
Wer erstmals richtig reist, empfindet auch den Balkan als globale Dimension. Vier fremde Länder werden sie im Sommer durchqueren. Sie nehmen den Zug über Prag nach Budapest. Sie stehen am Donaustrom, auf der Fischerbastei, in den römischen Resten von Aquincum. Sie wandern aus der großen Stadt und halten den Daumen in die Sonnenglut. Man nimmt sie mit, bis hinter Szeged, wo sie nahe der Grenze ihr Zelt aufbauen. Nachts überleben sie das Gewitter des Jahrhunderts, am nächsten Tag, schon in Rumänien, ein Pepperoni-Attentat gastfreundlich vespernder Bauern. Arad, Sibiu, Brasov – Rumänien ist noch nicht Ceausescus bettelarmes Ruinat. Anmutig schwingt es zwischen Berg und Tal und Fluß. Der Mais steht hoch, gemächliche Hirten treiben ihre Herden mit Schafs- und Rindsgeduld. Der türkische Trucker haut aufs Lenkrad und flucht. Aus seinem Cockpit erblickt das Glückspaar Siebenbürgen als endlosen Reigen bukolischer Herta-Müller-Bilder: Das Dorf steht wie eine Kiste in der Gegend. Ich ging zwischen den Hälsen der Gänse nach Hause. Die Dünnholzpappel wiegte sich und wiegte sich im Januar. Jetzt lodert der August. Sie sitzen neben Landvolk auf der Lade eines Lasters und atmen Stroh- und Straßenstaub. Er photographiert, so zeigen die Bilder nur sie: ein blondes Jeansgirl, braungebrannt, ihr Nicki und der Sommerhimmel leuchtendes Azur. Sie schäkert mit den Bauern. Sie winkt an der Chaussee, neben sich die Kraxe. Hier trägt sie die Wassermelone, ein Geschenk bulgarischer Soldaten. Denn schon ist das Zielland erreicht, hinter der mächtigen Donaubrücke, die Giurgiu mit Russe verbindet. Endlich das Schwarze Meer, blau wie die nichtsozialistische Adria. Nessebar: Pittoreske Treppengäßchen, weinumrankte Häuslein unter Feigenbäumen. Bratfisch gibt’s direkt vom Grill, dargereicht im bulgarischen Parteiorgan, den lächelnden Genossen Todor Schiwkow nahrhaft durchfettend. Hier endet der Liebesfilm.