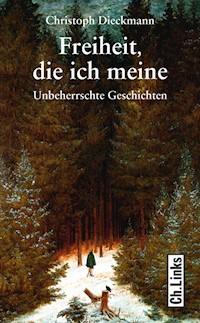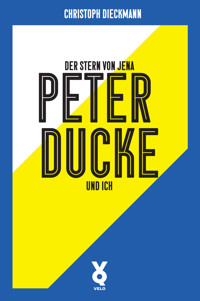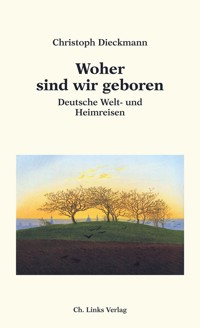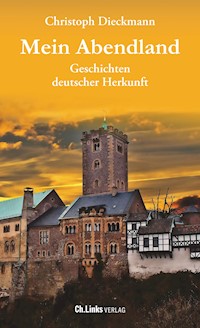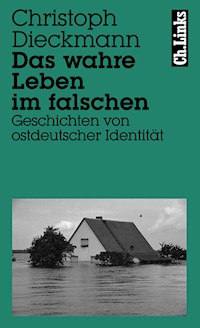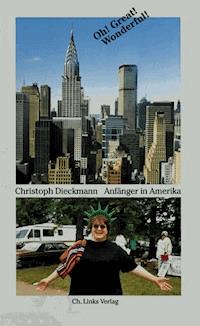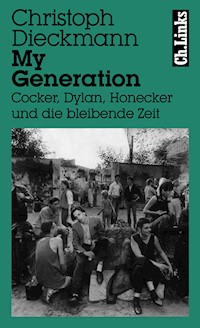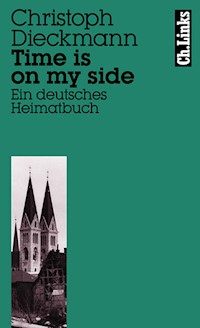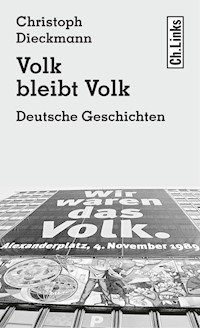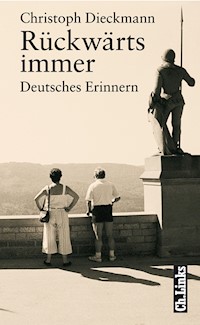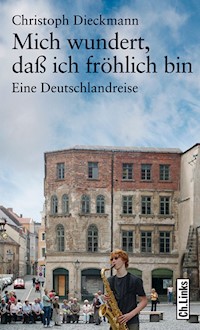4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
»Keiner schafft es, Woche für Woche die ganze ZEIT zu lesen, aber jeder liest Christoph Dieckmann. Da ist einer weder ost-fair noch west-fair, weder altklug noch jungklug – und hinzu kommt: er kann schreiben.«
Rudolf Walter Leonhardt
Juror beim Internationalen Publizistik-Preis in Klagenfurt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph Dieckmann
Die Zeit stand still, die Lebensuhren liefen
Christoph Dieckmann
Die Zeit stand still, die Lebensuhren liefen
Geschichten
aus der deutschen Murkelei
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2017
entspricht der 2. Druckauflage vom September 1999 (Erstveröffentlichung 1993)
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: KahaneDesign, Berlin
eISBN: 978-3-86284-384-8
Inhaltsverzeichnis
Paster
Eine Herkunft
Radio Taipei
Die Heimreise
Amboß oder Hammer sein
SUPER! Wie Peter Bartels den Osten liebgewann (und der Osten ihn)
Das Ende
Die Schafe im Wolfspelz
Dynamo Dresden spielt mit seiner Vergangenheit
Jena führt!
Liebesbrief an einen Fußballclub
»… die ganzen Neger in der Stadt«
Eberswalde bei Berlin sucht und deckt die Mörder des Angolaners Amadeu Antonio Kiowa
Mit Todesfolge
Ali Baba und die Mörder
Ein Tod in Ostberlin
Don Quichotte und die Windmüller
Honeckers Wiederkehr
Am Ende einer Posse
Honeckers Abgang
Münchhausen auf dem Karussell
Manfred Stolpes Aufklärung
Der Pyromane
Wolf Biermanns gewaltiges Schreiben für das Gute und gegen das Böse
Ich – kein Umstürzler?
Der Stasi-Akten-Neid
Niemandsland und seine Geister
Dichter in undichter Zeit
Väterchens Mondfahrt
Wie Mascha ihren Lenin wiederfand
Abendlicht
Eine Predigt für und wider den Mythos DDR
Lausitzer Passion oder Geil auf Horno
Ein deutsches Lehrstück
Springsteens Party
Das satte Herz
Bruce Springsteens bürgerliche Wiederkehr
Das brennende Licht
Bruce Cockburn, ein weiser Mann aus Kanada
Orpheus steigt herab
Townes Van Zandt, der berühmteste unbekannte Folk-Poet
Heute leben, morgen sterben
Guns N’ Roses, die »gefährlichste Rockband der Welt«
Die Überlebenden
Lynyrd Skynyrd, Ry Cooder und das Sentiment in der Rockmusik
Quellenverzeichnis
Über den Autor
Paster
Eine Herkunft
»Paster! Paster!« Einen Stein aufklauben, hinrennen, den Schreier packen und ihm über den Schädel schlagen, daß er stürzt und Blut strömt, bis der jähe Zorn versiegt. Der ruft dich nicht mehr Paster! Der kennt künftig deinen Namen!
Nichts wirst du tun. Sie sind zu viele. Fast alle im Dorf rufen sie’s, dann sogar Eberhard, der beste Freund. Im Streit fiel ihm deine wunde Stelle ein: »Du blöder Paster!« Halt an dich. Schlag ihn klüger. Der ist nicht du.
Du bist nicht die. Die kennen sich schon alle aus dem Kindergarten. Die lesen keine Bücher. Die haben Fernsehen. Die sind so praktisch, rasch und …, heute weißt du’s: weltgewandt. Du bist anders. Kein Triumph. Sehnsucht, zur Mehrheit zu gehören. Du hast nicht mitgehetzt, nicht mitgeprügelt, nicht Schmiere gestanden, als die bösen Buben der Klasse Peter Heerdt überfielen, weil Peter doof war und im Sport eine Flasche und immer alles versaute. Aber du kanntest den Plan und hießest ihn gut, aus Stolz, denn du warst eingeweiht, aus Glück, denn es traf einen anderen. Sie lauerten ihm auf zwischen Badergasse und Schmiede, auf dem Rückweg vom Sport. Sie droschen auf ihn ein, bis er bewußtlos liegenblieb. Ein Bauer fand ihn, sonst wäre er gestorben. Peter war schwer leberkrank.
Es ging auf Weihnachten. Fangfrage im Fach Heimatkunde: Warum feiern wir dieses Fest? Naaa, Christoph? Vorfreudiges Schweigen: Was macht der Paster jetzt? Dreiundzwanzig Kameraden, fünf aus christlichem Haus, gierten, ob Jesus oder Ulbricht siegte. »Weil wir stolz sind, daß wir im vergangenen Jahr soviel geschafft haben.« – »Richtig«, sprach die Lehrerin, ihres dummen Sieges nicht ganz froh. Ich schlich heim in Schande und Scham: Petrus nach der Judastat. Und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
Die Eltern taten ihr Mögliches, die Grenze zwischen uns und den Weltkindern offen zu halten. Was zuviel war, war zuviel. Zur Maidemonstration ging man eben nicht. Die Lampion- und Fackelzüge am Vorabend des internationalen Kampftages der Arbeiterklasse standen uns frei. Die Pionierorganisation Ernst Thälmann war tabu, obwohl ich heulte, als jeder das blaue Halstuch bekam, nur ich nicht. Frösi, das »Pioniermagazin für Jungen und Mädchen«, wurde abonniert, kindgemäß durchmischten Inhalts wegen, ebenso Atze und Mosaik, das einzige Comic-Heft der DDR. Vor den Pioniernachmittagen fragte der Vater, was geboten werde. Gab’s Schnitzeljagd, Sport oder Wandern, dann durfte ich hin. Partisanenfilme und Besuche bei den Grenzsoldaten fanden ohne mich statt.
»Christoph gehört nicht dem Pionierverband an«, vermerkt das Zeugnis der dritten Klasse. »Er fügte sich immer dem Kollektiv und stand nie abseits, wenn es ging, gemeinsam zu schaffen.« Ich danke meinen Eltern wie den meisten Lehrern, daß sie den Kampf der Ideologien nicht über ein Kind austrugen. Der Christenlehre-Unterricht war selbstredend streng getrennt vom staatlichen Schulsystem. In den fünfziger Jahren hatte die evangelische Kirche im Streit um die Konfirmation die Machtprobe mit dem Staat gewagt und verloren, weil die große Mehrheit der DDR-Gewohnheitschristen die atheistische Jugendweihe als Initiations-Ritual akzeptierte. Die Kirche gab sich dem landesüblichen Opportunismus geschlagen. Entweder – oder, das war nicht durchzuhalten. Fortan konnten auch Jugendgeweihte kirchlichen Segen erlangen, nach einem zusätzlichen Jahr Konfirmandenunterricht.
Den erteilte Vater. Die Kirche, das war er. Kraft und Größe gingen von ihm aus, wenn ich sah, wie die ärgsten Rowdies von Dingelstedt folgsam in den Gemeinderaum trabten, seiner Weisung zu lauschen. Erst später, selbst in seinem Unterricht, merkte ich, wie schwer ihm der Umgang mit diesen ländlichen Lümmeln fiel. Er brüllte (»Hörstejetztendlichmalzu!«), er schmiß auch mal raus – ganz im Gegensatz zu Fräulein Helma Bosse, die als Katechetin die kleineren Engel das Fliegen lehrte. Von Jona (wir malten ihm zu Ehren einen Wal) über Jesu Einzug in Jerusalem (seither kann ich Esel zeichnen) bis hin zu Luthers heldischem Walten (Blitz und Donnerwolken über Stotternheim) verdanke ich Fräulein Bosse unverwüstliche Gemütswerte, immun gegen Agnostik und Relativität, und überdies die lichte Erfahrung christlicher Sanftmut.
Fräulein Bosse taugte einfach nicht zum Zorn, was mancher weidlich nutzte. Freund Lindemann verhielt sich nicht, während des Vaterunsers krachend zu furzen wie der Leibhaftige und fragte nach dem Amen: »Fräulein Bosse, riechen Sie meine Marke?« Oh über ihn! »Eberhard!« rief Helma Bosse; in heiliger Erwallung erbebte ihr Dutt. »Wenn das noch einmal vorkommt, dann gebe ich dir eine Drei!« Dies war ihr Äußerstes. Ich hatte »Betragen Eins bis Zwei«. Mutter, die Fräulein Bosse kannte, befand, ich müsse mich wohl benommen haben wie die Axt im Walde.
Es nahte der jährliche Busausflug, den die Eltern mit der Kirchgemeinde unternahmen. Wir drei Jungs blieben zurück, Fräulein Bosses Obhut anvertraut. Michael, der älteste, war pflegeleicht, da ihn nur Bücher interessierten. Wolfgang, der jüngere, mußte parieren; die Katechetin war seine Patentante. Ich riß unverzüglich aus. Das Pfarrgrundstück war riesig, ein Kinderparadies: zwei Höfe, ein gewaltiger Garten mit reichlich Urwald. Teile des Geländes hatten wir in jahrelanger Wühlarbeit unterhöhlt, um Erdburgen zu bauen, wobei ich anfangs Sorge trug, eine U-Bahn-Linie anzustechen.
Es regnete in Strömen. Ich aber saß selig unter der Erde, trank Brause und las mit der Taschenlampe Rudolf Herzogs »Nibelungen«. Verzerrten Gesichtes starrte Königin Brunhild auf die Eifernde. »Und Ihr lügt dennoch!« kreischte sie. »Einen Stärkeren als Gunther trägt nicht die Erde, denn ich habe mit ihm um mein Bett gekämpft und furchtbar seine Manneskraft verspürt!« »Christoph!« rief es fern von oben irgendwo, »Chriiistoph!« Aha, sie suchte schon. Da konnte sie lange suchen, denn daß die Kinder Gottes sich in die Unterwelt begäben, lag jenseits von Fräulein Bosses Ahnen. Auch war die Erdburg gut getarnt. »Siegfriedes Manneskraft habt Ihr verspürt!« jauchzte die Königin Kriemhild ihr ins Gesicht. »Siegfried warf Euch aufs Bette, bis Ihr demütig wurdet und um Gnade betteltet!« »Lügnerin!« schrie die Königin Brunhild noch einmal. »Christoph!« schrie Fräulein Bosse noch einmal, nun allerdings bedrohlich nahe. Also still! Da reckte die Königin Kriemhild ihr die Hand unter die Augen, an der König Nibelungs Ring stak. »Kennt Ihr diesen Ring?« frohlockte sie. »Siegfried nahm ihn Euch, seinen Verlobungsreif holte er sich wieder in der Nacht, da er Euch gebändigt an König Gunther abtrat wie ein altes Gewand!« Da brach die Königin Kriemhild … Da brach Fräulein Bosse durchs Gebälk. Bretter, Steine, Erde stürzten herab. Ein Bein stieß durch die Decke, gefolgt von einem schaurigen Schrei. Nie zuvor und hernach nie wieder hat Helma Bosse so geschrien. »Jetztholstdumirerstmalsofortmeinenschuhdawiederrausunddannabmitdir!« Der Schuh stak wohlbehalten im Schlamm. Ein glücklicher Tag: Burg kaputt, Brille kaputt, mit frommen Traktaten verbannt ins Fremdenzimmer, und Fräulein Bosses Rapport an die Eltern tendierte gefährlich nach »Betragen Drei«.
Wir waren wild; mit Stolz sei es gestanden. Vetter Thomas, öfters zu Besuch aus Halberstadt, wurde auf der Heimfahrt von seiner Mutter stets ermahnt: So bitte nicht, wenn wir wieder zu Hause sind! Thomas, das Einzelkind, nickte und litt. Wie gern hätte auch er im Zimmer Fußball gespielt (zum Schaden der Lampen), die Apfelernte in Artillerie-Gefechten zu Mus gemacht, mit Lattenschwertern dreingehauen und chinesische Teeröschen abgeholzt, weil deren Stengel, mit einer Spitze aus Holunderzweig versehen, die besten Flitzbogen-Pfeile gaben. Krieg war immer. Die Gemeindeschwester empfing regelmäßig Notrufe aus dem Kampfgebiet. Vater: »Frau Eigenwillig, entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber wir brauchten mal wieder dringend Ihre Hilfe.« Frau Eigenwillig wunderte sich: Sie habe mir doch erst vorgestern die Schläfe geklammert. »Hält der Verband nicht?« – »Nein, nein, diesmal ist es unser Wolfgang.« Eine Kuhglocke mit der Aufschrift »Gruß aus Kühlungsborn« hatte ich an einen Strick gebunden und um mich geschwungen, wobei Wolfgang in die Umlaufbahn geriet. Ohr und Wange nahmen kräftig Schaden. Frau Eigenwillig eilte herbei und versah auch Wolfgang mit einem Turban. Für’s nächste ähnelten Pasters Söhne Kindern Mohammeds. Wolfgang war noch vital genug, zwei Tage später den Fußball durchs Doppelfenster in Vaters Arbeitszimmer zu bomben, wo leider justament eine alte Dame den Hinschied ihres Gatten anzeigte. Was folgte, war unvermeidlich: Dresche. Die ihm unbegreiflichste Tracht Prügel empfing Wolfgang, als ausgerechnet er mich »Paster!« rief – in Notwehr: Ich hatte ihm beim Versteckspiel auf den Kopf gepinkelt.
Die Eltern waren streng. Mutters impulsive Zornausbrüche verrauchten rasch. Es paßte, daß bei der einzigen mir erinnerlichen Züchtigung ihr die hölzerne Kochkelle auf meinem Hintern zerbrach. Aber Vaters Wut, falls wir nicht hörten, schien böse und roh. Er zerrte den Delinquenten ins Hinterzimmer und schlug mit dem Gummischlauch. Falls noch möglich, flohen wir aufs Klo und riegelten uns ein, am besten mit einem Buch, denn bis Mutter Entwarnung gab, konnten Stunden vergehen. Die Schläge wurden nachgeholt, fielen aber milder aus.
Heute sehe ich diese Exekutionen mit etwas anderen Augen. Vater neigte nicht zur Gewalt. Beschaulichkeit ging ihm über alles: Harz-Wanderungen, Radausflüge, Kaffeestunden im Garten stillten seinen Durst nach Harmonie. Ich sehe ihn mit Strohhut und Harke, Samstagabend zum Glockengeläut. Er hält bei der Gartenarbeit inne, legt die Harke hin, die Zinken zur Erde. Er nimmt den Hut ab und faltet die Hände. Aber sein Jähzorn setzte ihm zu. Pfarr-Herr sollte er sein, ständige Autorität. »Der Vati wußte sich manchmal keinen Rat mehr mit euch«, sagte Mutter später. »Er war hinterher immer selbst ganz verzweifelt. Er hatte euch doch so lieb. Und denk mal, wie wir erzogen wurden.«
Pasters Kinder, Müllers Vieh … Das seltsame Wesen vieler Pfarrerskinder ist ein Druckschaden, entstanden unter der Last, im Pfarrhaus jenes heile Leben vorzumachen, das die Welt nicht zustande bringt. Mutter war bereits »pfarrhausgeschädigt«, als Tochter eines Landpastors aus Stresow in Westpreußen (heute Strzeszow und polnisch), wo man sie übrigens »Preesters Anni!« rief, was beweist, daß »Paster!« kein Schmähruf des DDR-Atheismus gewesen ist. Bevor sie etwa bei Krämer Schumann ein Bonbon geschenkt bekam, war ein Gesang aufzuführen: Anneliese Lietzau wollte sich was kaufen, hatte sich verlaufen, setzte sich ins grüne Gras, pinkelt sich die Hosen naß.
Nach dem Kriege brachte es ihr Vater zum Superintendenten von Perleberg in der Prignitz, worauf er sich Großes zugute hielt. »Vox populi vox Rindvieh«, pflegte er zu sagen, »die Menschen sind Kühe«. Bruno Lietzau, erprobt als bekennender Hitler-Feind, war gewiß nicht ohne hagestolze Güte, aber eisern streng. Gnadenlos hieb er zu, als ihn mein Ballspiel im Mittagsschlaf störte. Warum fielen ihm die Eltern nicht in den Arm? Sie wagten es nicht. Mutter hatte, schon weit über Zwanzig, von ihm die ständige Drohung gehört: »Wenn du mir mit einem Kind nach Hause kommst, dann schmeiße ich dich raus!« Männliche Post prüfte er vor: »Du hast einen Brief von soundso, er schreibt dir dasunddas.« Ein harmloser Verehrer wurde heimlich abserviert, durch Einbehalt der Briefe.
Alle drei Lietzau-Töchter haben Pastoren geheiratet, wobei mein Vater, ein zaundünner Studiosus der Theologie, zunächst als ungenehm betrachtet wurde. Er machte nichts her. Seine Familie war gewöhnlich, ein schlimmes Verdikt, zumal auch die kirchliche Tönung des Hauses Dieckmann zu Halberstadt bedenkliche Flekken zeigte. Nicht bei Mutter Marie-Luise; die war Johanniterschwester gewesen und eine fromme Seele von Mensch. Aber Wilhelm Dieckmann, ihr Gatte, ging bestenfalls für gottgläubig durch. Als Flieger war er gegen Ende des ersten Weltkriegs ganz in der Nähe des Cottbuser Krankenhauses abgestürzt, in dem Großmutter Dienst tat. Man trug den ramponierten Helden herein. Marie-Luise Nagel wußte sofort: Der oder keiner!
Sie hatte manchmal hart zu ringen mit dem nationalromantischen Mann, der im Garten Bunker und Burgruinen baute und sich bei häuslichem Krach mit der Klampfe in seine SA-Kneipe verzog. Sie hielt das Haus in Schuß, er besang deutsches Fühlen und Trachten: In des Huywalds finstren Gründen / auf naturverschlungnem Pfad / hauste einst der Räuber Heising / der allhier grassieret hat. Pietistisch wurde Vater also nicht erzogen. 1920 geboren, wollte er eigentlich Chemie studieren. Mit zwanzig mußte er in den Krieg, als Funker nach Frankreich und Italien. Vor der Ostfront bewahrte ihn ein alter Ohrenarzt, der, als die Vater eigentlich bestimmte Kompanie abrückte, ihm noch rasch die Mandeln herausnahm.
Der erste tote Mensch, den Vater sah, war Jahre nach dem Krieg in Stuttgart ein kleines Mädchen, das überfahren worden war. Abends, beim Ausziehen und Waschen, mußte Vater oft vom Krieg erzählen, von fernen, wundersamen Stätten, die Amboise und Verona hießen, Arcachon, Nevers an der Loire, Marostica, Genzano bei Rom. Krieg machte keine Angst. Vater war ja rein geblieben, unbefleckt von Blut, woran mir unendlich lag. Er selbst nannte sich behütet. Er zählt zu jener Nachkriegs-Theologengeneration Barthscher und Barmer Prägung, der sich im Christ-Sein ein Rettungsanker bot. Weit mehr als Akademiker waren sie Gläubige. Man findet Parallelen zur anderen großen Religion, die das Nazi-Reich im Martyrium überstand. In Bonn besuchte ich Hans Modrow, wo er ziemlich einsam, ziemlich bitter in seinem Abgeordneten-Büro saß, Bonn-Center, achter Stock; auf dem Dach kreiste der Mercedes-Stern. Modrows Geschichte vom jungen Wehrmachts-Soldaten, von Irrtum, Bewahrung und Heimkehr klang der meines Vaters sehr verwandt. Das fand auch Vater, als ich ihm das Band vorspielte. »Vor Hans Modrow habe ich Respekt«, sagte er, »der hat den friedlichen Übergang möglich gemacht.«
Anders als Modrow schwor er den Ideologien in toto und auf immer ab. Christlicher Glaube ist ja nach Barth das Gegenteil von Ideologie, sofern er sich nicht in menschliche Macht verkehrt. Daß Macht obszön sei, war vielen christlichen Oppositionellen in der DDR von Kindheit an vertraut. Das innere Nein zum weltlichen Regnum bewahrte die Seele – und stärkte das System? Die Kirche forderte nie. Sie bat. Der zeitig eingetrichterte Respekt vor staatlicher Obrigkeit blieb Vater erhalten. »Ich rede dein Zeugnis vor Königen und schäme mich nicht« – dieses Psalm- und Leitwort der Confessio Augustana taugte ihm nicht als Panier. Er war kein Luther in Worms, aber fest auf scheue Art. Er traute auf Gottes Führung durch Menschen guten Willens. Zu Sozialismus-Phrasen hätte er sich nie hergegeben. Im Dorf galt er als scharf, das heißt: staatskritisch.
Am Nachmittag des 6. April 1968, dem Tag des Referendums über die neue DDR-Verfassung, unterbrach Besuch das sonntägliche Kaffeetrinken unter der großen Eiche. Die fliegende Wahlurne segelte herbei, flankiert von zwei sichtlich verschüchterten Damen aus der Bürgermeisterei. Guten Tach, Herr Paster! Herr Paster bot Kaffee an, doch darum ging es nicht. Das ganze Dorf habe schon vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, nur von Herrn und Frau Paster fehlten noch die Stimmen. Man wolle schließen; es sei doch schon halb vier. Auf stand Vater. »Sie haben bis achtzehn Uhr geöffnet«, sprach er, die Würde des Rechts, »so stand es in der Volksstimme.« Sie zogen ab. Zwei Stunden darauf begaben sich die Eltern ins Wahllokal und stimmten mit Nein, weil die neue Verfassung kirchliche Rechte beschnitt.
Vater Ethos war sein Amt. Selbstredend wurde auch Mutter das Glück des Dienens auferlegt. Gewerbe-Lehrerin, wie studiert, konnte sie nicht bleiben. Sie fügte sich, nicht klaglos zwar, und hielt meinem Vater den Rücken frei; er lehnte sich öfters auf ihren. Sie machte und tat und wirbelte von früh bis spät durch das riesige Haus (im Winter ein Eispalast); sie kochte, putzte, wusch und weckte ein und hungerte nach etwas, das sie Anerkennung nannte. »Ich bin kaputt«, ihr stehender Satz am Abend, wenn sie beim Bügeln oder Strümpfestopfen wieder eingeschlafen war.
Wie viele Pfarrfrauen sind so ohne Lohn und Dank verschlissen worden. Selbstverwirklichung, diese hedonistische Tugend, war nicht das Gebaren der fünfziger, sechziger Jahre. Man sah, wie man zurande kam mit vier Kindern und dem bißchen Geld. Selbstverständlich wurden die paar hundert Westmark Bruderhilfe, die es seit etwa 1965 gab, für »was Praktisches« ausgegeben, Wolldecken beispielsweise. Welcher Stolz über das erste UKW-Radio, ein mächtiges hölzernes Trumm. Und dann begann das Raumfahrt-Zeitalter: Beim Eisenwarenhändler Eberhard Bröse erwarben die Eltern den Plattenspieler »Soletta«, Edelmarke im Koffer, grauweinrot mit Kunstleder bespannt. Bröse gab noch gratis eine Platte drein: Udo Jürgens, »Siebzehn Jahr, blondes Haar«.
Fernsehen? Hatten wir nicht. Aber Tante Schniefler hatte. Unvergeßliches wie »Spiel ohne Grenzen« und »Rauchende Colts« erlebten wir bei der alten Dame, die oben im Pfarrhaus eine muffige Kemenate bewohnte. Schüsse peitschten durchs ganze Haus, wenn Matt Dillon zum Hüfteisen griff, denn Frieda Schniefler war so gut wie taub. Dank dieser Disposition ließ sich auch die Fußballweltmeisterschaft 1966 verfolgen: barfuß im Nachthemd vor Tante Schnieflers Tür. Der Himmel weiß, was die alte Dame am Fußball fand, aber ich war neuerdings verrückt danach.
An einem Sonntag des Jahres 1965 – die Eltern hielten Mittagsschlaf – zerriß die dörfliche Stille ein außerirdisches Geschrei. Ich lief ihm nach, landete am Sportplatz und sah das erste Fußballspiel meines Lebens. Titanisch! Die Offenbarung! Traktor Dingelstedt spielte gegen Traktor Ausleben, von Hunderten Bauern nach vorn gebrüllt, weshalb ich instinktiv Partei für Ausleben ergriff, als stritten dort elf einsame Pastorensöhne wie ich gegen die böse Majorität. Ausleben gewann 2:1, was mir die Illusion eingab, Fußball sei eine Liebe, die glücklich macht. Ich rannte heim und gründete zur selbigen Stunde das Wochenblatt Der Fußballer, das es immerhin auf über siebzig Ausgaben brachte und auf elf Abonnenten, darunter Frieda Schniefler. Auch um ihre Augen stand es nicht zum besten.
Die Eltern waren vom Donner gerührt und hielten mich für aus der Art geschlagen, zumal ich unverzüglich selbst zu spielen begann, und zwar Torwart. Fortan waren Knie und Ellenbogen bandagiert mit großen, eiterdurchsuppten Pflastern, denn ich schmiß mich auf den Schlackeplatz, als gelte es das Leben. Fußball: der Schlüssel zur profanen Welt. Die Jungs des Dorfes kamen auf unseren Hof. Fortan war’s vorbei mit Vaters Ruhe bei der Predigtmeditation. Wumm! Wumm! Wumm! krachte das Leder ans Scheunentor. Dann sollte der Traum sich erfüllen. Die Schülermannschaft wollte mich als Keeper. Vater sagte Nein. »Wann spielen die? Sonntagvormittag? Da ist Kindergottesdienst.«
Scheiß-Kirche, das sagten wir nie. Aber oft schien uns, wir kämen zu kurz – auch, weil Pfarrhaus in der DDR stand für: wenig Geld. Manchmal tat das weh; Kinder vergleichen ja. »Die Kinder leider sehr undankbar und anspruchsvoll«, schrieb Vater nach einer Weihnachtsbescherung in sein Tagebuch. Wir wurden eben anders entgolten als »die Kinder, die nicht zur Kirche gehören«, wie Mutter überlegen sagte. »Andere müssen sich am Sonntagnachmittag auf der Straße herumtreiben.« Da spielten die Eltern mit uns, wanderten und fuhren Rad. Abends im Bett wurden Geschichten erzählt, aus der Bibel, von »Peterchens Mondfahrt« oder – besonders beliebt – von früher, der minder behüteten Zeit. Gebet, Gesang und Gute Nacht. Breit aus die Flügel beide, o Jesu meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so laß die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet sein. Vom Kirchturm schlug die Glocke neun.
Dann stürzte alles ein. Eines Abends im Frühsommer 1968, wir löffelten fröhlich Erdbeeren mit Milch, erklärten die Eltern, im Herbst zögen wir um. Waaas? Warum? Wohin? Was wird aus Muck, meinem Kater? »Der kommt natürlich mit.« Von Stund an war Abschied – von Haus und Hof, Akazie, Steinbank und Regenbassin, von allen Kameraden, von Plätzen, Wegen, Kirschplantagen, von Windmühlen und Leiterwagen, vom Friedhof, den ich oft durchstreifte, um das Alter der Toten zu errechnen, seit eine rätselhafte Selbstmordwelle durchs Dorf gegangen war. Ein Tod auch dies. Nie mehr zur Dingelstedter Schule, lautlosen Schritts im Neuschnee, und am Platz der Freundschaft glänzte der Weihnachtsbaum. Nie mehr die Klingel hören und wie die Flurtür ins Schloß fällt, die Kellertür, die Bodentür. Nur der Essensgong kam mit, ein transportabler Klang. Und Muck, der Streuner. Kurz bevor der Möbelwagen fuhr, tauchte er endlich auf. Ich griff ihn und sperrte ihn in die Kiste. Er fauchte, ich heulte vor Erleichterung.
Und vor Trauer, noch Monate nach der Vertreibung aus dem Paradies. Mutter war ganz fertig und sagte: »Hätten wir gewußt, daß es euch so mitnimmt …« Heimat ist Selbstvergessenheit. Man kann sich an Fremde gewöhnen, erst schutzbefohlen wie auf See, dann unmerklich Land ergreifend. Doch der zweiten Liebe traut man keine erste zu.
Was mir als erstes auffiel in Sangerhausen: Die Stadtbengels waren wesentlich frühreifer als die der Dingelstedter Klasse 7, wo es noch als memmenhaft galt, sich mit Mädchen abzugeben. Nie hätte ich Angelika Reps mein zartes Träumen gestanden. Hier aber wurde beknuddelt, begrapscht und gezotet, daß man von einem Ohr auf’s andere fiel. Und – täuschte das? – den Mädchen war’s ein juchzendes Vergnügen. O Hannelore Gretzki, o Hanna Bützner, o Heidrun Wäldchen mit den Rundstrickhosen! Monika Reinsch tat ein übriges und kriegte mit vierzehn ein Kind. Um die geliebten Mosaik-Hefte einzutauschen, galten Matchbox-Autos hier als keine Währung mehr. Beatgruppen-Fotos mußten es sein oder, besser, Porno-Bilder.
Ich beschaffte sie. Als Mutter die außerordentlichen Motive erspähte, mitten auf dem Rauchtischchen neben der Frohen Botschaft, da blieb sie unerwartet zahm, empfahl allerdings zügigen Weiterhandel. Wie die meisten Pfarrhäuser brannte auch unseres nicht vor Eros. Undenkbar für die Eltern, mit den Kindern nackt zu baden. Immerhin, aufgeklärt wurden wir zeitig, nachdem Michael auf Klassenfahrt zum Weihnachtsmärchen in Halberstadt gewesen war. Er kam heim, weniger erglüht von Humperdincks »Hänsel und Gretel« als von einem Libretto, das er im Volkstheater auf dem Klo gelesen hatte: Ficken, ficken, Geldverdienen, dann gibt’s wieder Appelsinen.
Appelsinen waren bekannt. »Was ist ficken?« fragte er beim Mittagessen. Oh! Vater, Mutter blickten stumm auf dem ganzen Tisch herum. Vater ergriff die Flucht nach vorn und schob uns ins Fremdenzimmer – erst Micha, dann Wolfgang und mich. Erstens: Hahn und Henne. Zweitens: Wenn ein Mann und eine Frau sich seeehr liebhaben. Nie, wußte ich, tust du DAS!
Im Anfang war das Wort. Alles in Sprache zu verwandeln: ein Mysterium, das die Weltkinder nicht kannten, sowenig wie die Lebensangst dahinter. In sexualibus flog dieser Zauber auf. Jedenfalls war klar, daß man, bevor DAS passieren könnte, die elterliche Welt verlassen müßte.
Bis zum Ende der zehnten Klasse wuchs sich das Brodeln und Gären zu einem gewaltigen Haarschopf aus, dem längsten der Schule. »Mit solcher Mähne keine Abschlußprüfung«, diese Drohung war kein leerer Spruch in der DDR des Jahres 1972. Ich hielt durch, wie Black Sabath und Deep Purple; ich siegte, wie Crosby, Stills & Nash in »Almost Cut My Hair«. Seit zwei Jahren war ich Rockfan und hing mit dem Recorder am West-Radio: ein bürgerlicher Freak mit Hecke und Benimm. Zeugnis neunte Klasse: »Lehrern und Erziehern gegenüber ist er höflich.« Mehr als die Mähne erschreckte die Eltern das Tosen der Gitarrengötter Johnny Winter, Jimmy Hendrix, Leslie West. Leiser! rief Vater von nebenan, leiser!! nochleiserkannstenichtendlichmal!!! Brief an die PGH Elektronik Markranstädt: »Ich möchte sehr darum bitten, mir die beiliegenden Kopfhörer bald zu reparieren, da wir eine sechsköpfige Familie in einer kleinen Wohnung sind und aufeinander Rücksicht nehmen müssen.« Pubertäre Nöte wurden zu Melancholie gemacht, nicht zur Aggression.
Dann war die Schule aus. Ich wäre gern geblieben. Nichts drängte ins Leben. Die Oberschule, das Abitur kam nicht in Betracht, »aus Kapazitätsgründen«, wie die Kreisschulrätin Richter, passionierte Christenverfolgerin, von oben wissen ließ, obwohl ich leistungsmäßig vorgeschlagen war. Der Magdeburger Bischof Werner Krusche schickte einen Trostbrief: Es gehe jetzt vielen so um ihres Glaubens willen.
Ich wußte mir keinen Beruf – außer Sportreporter; das war außer Reiche. Auf der Berufsberatungsstelle liefen die Eltern Herrn Helbig in die Arme, dem Kinochef des Kreises Sangerhausen, der ihnen die Segnungen der Filmvorführerei ausmalte. »Und wenn der Junge sich macht, ist es nur ein Schritt zum Regisseur nach Potsdam-Babelsberg.«
Von wegen. Anfang September 1972 begann die Lehre im sächsischen Langenau. Das Nest lag am Ende der Welt und die Filmschule noch einen Kilometer weiter. Filmvorführer sind ein sehr, sehr sonderbares Volk, schlechtbezahlte Kino-Träumer, Egomanen, neurotisch, hochbegabt, und hier kamen siebenunddreißig Knaben aus der ganzen DDR auf acht Mädchen. Filmwürdige Dramen spielten sich ab, Trunksucht, Intrige, tiefe schlimme Liebe. Einer schmiß sich ums Haar wegen einer Elke vor den Zug. Einen hinderte ich des Nachts im Waschraum, sich für eine Marika aufzuhängen. Hermann Hesse wäre unters Rad gekommen. Ich aber explodierte.
Die Chronik meiner beiden Lehrjahre nimmt mir jedes Bedenken, ich könnte ein jugendlicher Anpasser gewesen sein. Verweise sind in schöner Regelmäßigkeit dokumentiert – wegen Disziplinlosigkeit, mangelnder Arbeitsmoral, nächtlichen Eindringens ins Mädchenzimmer und ähnlichen Manifestationen frohen Jugendlebens. Nach einem strengen Verweis drohte Direktor Hillmann zum letzten Mal. »Am 10. Mai 1973«, schrieb er den Eltern, »wurde mit dem Lehrling Christoph Dieckmann nochmals eine Aussprache geführt. Seine Antwort nach einer einstündigen Aussprache war: Meine ganze persönliche Einstellung zum Leben zwingt mich zu diesem Verhalten, ich kann nicht anders und fühle mich dabei auch nicht wohl.«
Ja! Ja! Gar nicht ungern war ich mißverstanden in dieser anti-musischen Welt praktischer Zwecke, darbte tagsüber zwischen Lötkolben und Verstärkern, las nachts Puschkin, »Henri Quatre« und Goebbels’ Tagebuch, war tragisch verliebt und – ganz Rock’n’Roll-Outlaw – zur Verzweiflung fest entschlossen. Freedom is just another word for nothing left to lose. Verbot tut not. Wie soll man schreien, wenn man darf?
Die Eltern kämpften für mich. »Christoph hat da seine eigenen Vorstellungen, die noch nicht mit den Erfordernissen eines Gemeinschaftslebens in Einklang zu bringen sind«, so schrieb mein Vater »hochachtungsvoll« und bat um gut Wetter. »Er hat uns allerdings beteuert, seine Einschätzung durch die Lehrkräfte, daß er vorsätzlich Schrott verursache oder die Apparaturen falsch bediene, sei nicht richtig. Wir als Eltern möchten ihm an diesem Punkte glauben. Auch meinte er uns gegenüber, wenn er den Kopf auf den Tisch lege im Unterricht, so täte er dies nicht aus Desinteresse und weil er schlafe, sondern er höre dabei genau zu.«
Zwei Wochen vor der Abschlußprüfung flog ich raus. Der Grund war der letzte Tropfen. Wortwörtlich. Um Heimleiter Ekkehard Cords die nächtlichen Kontrollbesuche zu versüßen, hatten wir gemeinschaftlich ein Kondom der Marke »Mondos« über die Türklinke unseres Sechserzimmers gezogen und es mit Flüssig-Bohnerwachs der Marke »Egü-farblos« gefeuchtet. Cords griff hinein, schrie auf, überlebte trotz Angina pectoris, hob die Tür aus und ächzte sie zur Mitternacht ins Lehrerzimmer. Am nächsten Morgen Verhör und Skandal. Besonders der alte Kinotechniker Fritz Zinner, einst Filmvorführer in Rommels Afrika-Korps, konnte sich »nicht entsinnen, jemals eine solche Sauerei gesehen zu haben«. Nach Luft japsend, trat er ans Fenster, riß es auf und sah – mich. Unten auf der Straße marschierte ich auf und ab, im Schlepp ein großes rotes Plaste-Auto ohne Räder. »Was tun Sie dort?« brüllte Zinner.
»Fahren und denken.« Das war’s. Diese Documenta ’74 gab mir den Rest.
Direktor Hillmann sandte das Telegramm, wobei ihm der Zorn in die Grammatik fuhr. »werter herr dieckmann wegen ihrem sohn christoph wurde ein disziplinarverfahren eingeleitet die disziplinarverhandlung findet am 6. mai 1974 in der zentralen betriebsschule des lichtspielwesens statt dazu laden wir sie ein christoph wird bis zu diesem zeitpunkt beurlaubt und tritt heute am 25. 4. 74 die heimreise an« Vater, viel gefaßter als Mutter, fuhr am 6. Mai mit mir zurück nach Langenau. Das Urteil war schon vorgefaßt. Formal lag genug vor, aber die Torheit, die eifernde Überzeugung, mit der hier ein schwieriger, harmloser Junge entfernt wurde, empört mich noch heute – wie auch die schleimscheißende Kleinheit einiger Kameraden. FDJ-Sekretär Dreyer profilierte sich beim Tribunal als Kronzeuge meiner Asozialität: »Ich möchte anmerken, daß Christoph als Diskjockey oft Titel gespielt hat, nach denen man nicht tanzen konnte.« Direktor Hillmann war mit Strafmaßnahmen wohlvertraut. Ihn selbst hatten seine Oberen in die Wüste nach Langenau geschickt, weil er als Filmeinkäufer der DDR aus dem Westen mit den »Glorreichen Sieben« zurückgekommen war. Nach kurzer Laufzeit befanden die Kulturbestimmer der Republik, der Streifen verherrliche imperialistische Gewalt.
Dann saß ich auf dem Bett im Internat und wollte nicht mit. »Bitte«, sagte Vater, »bitte komm mit.« – »Ich bleibe hier.« – »Hier kannst du nicht bleiben.« – »Mir egal.« Sein Blick fiel auf mein Wandbild, eine selbstgefertigte Collage aus Farben, Blättern, einem aufgeklebten Stift, einem Pfennig, einem Fußabdruck und einer Scheibe Bierschinken, um deren grünliche Wölbung geschrieben stand: ALLES HAT SINN. »Ja, Junge«, sagte Vater, »da hast du recht, das wirst du noch erfahren.« Ich fuhr mit. Am nächsten Morgen war ich Kohlenschipper in der Kreisfilmstelle Sangerhausen.
Der Sturz war brutal. Theologie hatte ich ab Herbst studieren wollen, mit Menschen arbeiten, und den Platz am Theologischen Seminar Leipzig schon in der Tasche. Dazu brauchte es den Facharbeiterbrief. Ein Jahr lang reservierte mir Leipzig den Studienplatz. Der Lichtspielbetrieb machte ein Hintertürchen auf: Erwachsenen-Qualifikation