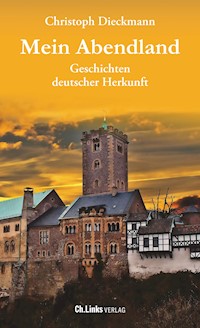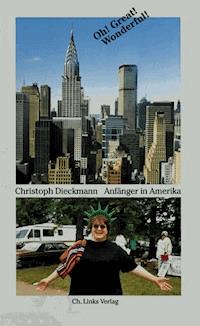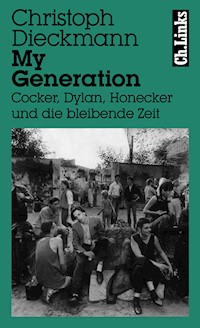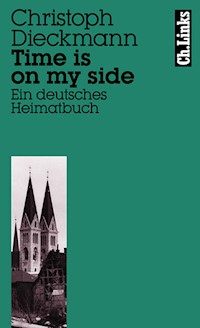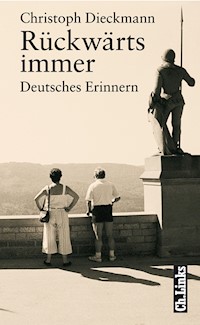4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
Mit "Volk bleibt Volk" schreibt der vielfach preisgekrönte Zeit-Reporter Christoph Dieckmann seine Chronik deutscher Lebenswelten fort: Geschichte in Geschichten. Dieckmann erklärt Deutschland, indem er es erzählt - von oben und unten, aus der Kanzler-Perspektive, aus Stefan Heyms Schreibstube, aus dem Keller des Hundezüchters Kümmel. Wir lesen von Guben, Buchenwald und der "lustigen Witwe" Bonn, von Ost-West-Scharmützeln im Hauptstadtgürtel, vom Heldengedenken an die Mörder Walther Rathenaus. Und natürlich gibt es wieder bodenständige Musik und haarsträubende Fußballdramen.
"Volk bleibt Volk" überbrückt die Kluft zwischen Kollektiv-Historie und persönlicher Erfahrung. Dieckmann schaut, gut lutherisch, dem Volk aufs Maul. Dem Globalisierungs-Wahn begegnet er mit einem "Glücksverlangen": Heimat. Die Parolen der großen Politik erprobt er in den Provinzen, wo "das Volk" lebt, dem wir alle angehören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph Dieckmann
Volk bleibt Volk
Christoph Dieckmann
Volk bleibt Volk
Deutsche Geschichten
Dem Volk des FC Carl Zeiss Jena,in welcher Liga auch immer
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2017
entspricht der 1. Druckauflage vom September 2001
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: Eugen Lempp unter Verwendung eines Fotos vom Ost-Berliner Haus des Lehrers am Alexanderplatz im Herbst 1999 (Aufnahme von Christoph Dieckmann)
eISBN 978-3-86284-388-6
Inhaltsverzeichnis
Mein Volk
Wir waren das Volk
Am 9. November 1989 scheiterte die ostdeutsche Revolution
Volk bleibt Volk
18. März 1990: Deutliche Erinnerungen an die ersten freien Wahlen in der DDR
In der Niemandszeit
Drei Kapitelchen über die ostwestdeutsche Ungleichzeitigkeit
Gezeitenwechsel
27. September 1998: Ein Wahlsonntag zwischen Hoffen und Bangen
Bomben auf Ankara?
Ostdeutschlands Nein zum Jugoslawien-Krieg
In der Eisenzeit
Eine üble Nachrede auf den Nato-Sieg im Kosovo
Schaden, Freude
Die CDU-Spendenaffäre: glückliche Tage der Demokratie
Bitte nicht aussteigen!
Zehn Jahre Deutschland. Eine kleine Festrede aus dem Beitrittsgebiet
Die grüne Grenze
Krieg und Frieden im Speckgürtel von Berlin
Die lustige Witwe
Bonn überlebt den Regierungsumzug
Erniedrigte und Beleidigte
Rathenow. Ein Bericht aus der Brandenburger Normalität
Die unsichtbare Stadt
Nazihochburg Guben? Ein Besuch im östlichsten Deutschland
In Kümmels Keller
Kulturstadt Weimar: Eine Reise in das Universum der Provinz
Der deutsche Berg
Eine winterliche Fahrt nach Buchenwald
Der Mörderstein
Wie die deutsche Geschichte nach Saaleck kam und wie sie wieder ging
Pankow erwache!
Ein Berliner Stadtbezirk wehrt sich gegen die Republikaner
Unser starker Mann
Ein Glückwunsch an den Nobelpreisträger Günter Grass
Der Erwählte
Ein Besuch bei Stefan Heym
Daheim ist daheim
Ein stolzer ostdeutscher Brief an Edmund Stoiber
Der Reinbeißpreis
Abenteuer zwischen BSE-Angst und Appetit
Der sterbende Schwan
Der Berliner Palast der Republik wird 25 Jahre alt
Der Fluch des Ostens
Abriß, Aufbau, Menschenflucht in Halle
Das Gelobte Land
The Bottle Rockets spielen die Ewigkeit des Rock ’n’ Roll
Der Schand-Elfmeter von Leipzig
Wie Schiedsrichter Stumpf die DDR bereits am 22. März 1986 fast zum Einsturz brachte
Im Auf und Ab zur Weltmacht
Wie jetzt auch Deutschlands Jugend dem FC Carl Zeiss Jena verfällt
Quellenverzeichnis
Bildnachweis
Über den Autor
Mein Volk
1
Du nennst es Sage, ich Erinnerung. Du suchst die Daten, ich den Wald. Der Wald steht schwarz und schweiget, hinter dem Friedhof, dem Hünengrab, den Kirschplantagen, immer den Berg hinauf, bis zum Forsthaus Butz. Da blafft der Hund, und da beginnt der Wald. Das Mädchen trat ein. Der Weg war hier noch breit, Licht brach durch die Kronen der Buchen, doch die Vögel gaben keinen Laut. Waldeinwärts schwand das Licht, der Pfad verjüngte sich und wurde steil. Das Mädchen stieg, stolperte, erhob sich, da trat aus dem Dickicht ein Mann. Er lächelte, dann fiel er über sie her.
Daneil hieß er; jeder kannte den Namen. Er beraubte die Bauern und Händler, die auf dem Weg zum Halberstädter Markt den Huywald passierten. Durchs Unterholz hatte er Schnüre gespannt. Stieß Beute an, klingelte ein Glöckchen in seiner Höhle. Dorthin verschleppte er die junge Frau und zwang sie, mit ihm zu leben. Sie gebar ihm Kinder, die erschlug er, damit das Geschrei ihn nicht verriete. Ihr preßte er einen Eid ab: bei Todes Strafe keinem Menschen zu verraten, wo sie sich verbargen. Denn manchmal ließ er sie zum Markt. Er wußte, sie käme zurück.
Dann konnte sie’s nicht länger tragen. Da sie ja zu keinem Menschen sprechen durfte, klagte sie ihr Los dem steinernen Roland an der Rathausmauer: wie sie so entsetzlich lebe in Daneils Höhle bei der Huysburg und dem Röderhöfer Teich. Dies hörte oben durchs offene Fenster ein Ratsherr, der eilte herab, zog die Zitternde ins Haus und beruhigte sie: Ihr Eid sei unverletzt. Dann rüsteten die Halberstädter zum Zug gegen Daneil. Sie fanden und umstellten den Unterschlupf. Der Räuber hatte sich verschanzt. In riesigen Kesseln kochten sie Wasser und gossen es von oben in die Höhle. Unten lief es wieder heraus, und von drinnen lachte Daneil Hohn. Jetzt kochten die Halberstädter Brei. Das Lachen wurde Schreien, dann erstarb’s.
Drei Räume hat die Höhle: das Zimmer, den Pferdestall und, etwas höher, Daneils Küche. Darunter soll sein Schatz vergraben sein. Stampf auf: Der Boden klingt hohl. Einmal haben die großen Jungen aus unserem Dorf in der Küche gegraben, doch vergeblich. Je tiefer sie gruben, desto weiter zog sich der Klang, der Schatz ins Erdinnere zurück. So handelt meine Erinnerung.
2
Daß ich zum Volk gehöre, habe ich spät erfahren. Ich wuchs hinter Mauern auf. Sie bargen das mächtige Pfarrhaus, zwei Höfe, ein Wäldchen, den weiten Garten. Draußen um die Mauern lagerte das Dorf, das Volk, die Welt. Über diesen Gegensatz haben etliche Pfarrerskinder geschrieben, auch ich in »Time is on my side« und »Die Zeit stand still, die Lebensuhren liefen«. Unser Ur-Text stammt von Thomas Mann: »Tonio Kröger«, Archetypus der abseitigen Existenz, das Volk belächelnd und doch gepeinigt von Sehnsucht nach Gemeinschaft mit der lachenden Welt des Hans Hansen und der unvergrübelten Mädchen.
Von Fremdheit erzählte ich also, als Pasterjunge, Brillenschlange, Bücherwurm, aber wurde das dem Dorf gerecht? Ist denn das Volk ein Monolith? Seit die Ostdeutschen in summa unter Rassismusverdacht gerieten, sieht man sie wieder eingeschachtelt in jene Kollektiv-Identität, die nach einem West-Klischee den Ossis das Ich-Sein erspare. Das sei ja kein Wunder nach einem halben Jahrhundert Diktatur. Du bist nichts, dein Volk ist alles, hatten die Nazis eingehämmert, und die SED plakatierte: Alles für das Volk, alles durch das Volk, alles mit dem Volk!
Tatsächlich, dem Kind war das Volk naturgegeben, Fleischer Grützmacher wie Gärtner Mingerzahn, Bäcker Gutjahr wie Kaufmann Kassebaum, Schlosser Rosenblatt wie Förster Butz. Ihr Wesen schien Dienst am Dorf, dem sie gaben, wie sie von ihm nahmen. Unterschiede fielen auf zwischen Schuster Wesarg und Frau Doktor Banse, die nicht Volk war, sondern eine Dame. Banses hatten sogar einen Swimmingpool. Wer zum Schuster wollte, mußte über einen schmalen Hof, in dessen Mitte der Misthaufen prangte. Gänse zischten heran. Ein Spurt, ein Sprung auf die Brettertreppe, und man stand in Wesargs Kemenate, in Stube und Werkstatt zugleich. Umstellt von Botten und Pantinen, thronte der Alte auf seinem Schemel, drosch Absätze fest, bequallte lappende Sohlen mit köstlich müffelndem Leim. Er sog an der kalten Zigarre, prüfte sein Werk mit rissigem Daumen und nuschelte den lächerlichen Preis. Genauso verschmolzen mit dörflicher Pflicht schien Tischler Bärecke an seiner Hobelbank und Schmiedemeister Stache, wenn er – Glut zischte, Horn stank – die ergebenen Harzer Gäule beschlug. Gutjahr walkte seinen Teig, Rosenblatt schweißte, wortreich bedienten die alten Kassebaums im Laden, mit Tocher und Schwiegersohn, und einst würde Hans-Heinrich, der Enkel, das Geschäft übernehmen. Und alle taten und ließen geschehen, was von jeher war, auf daß es immer sei. Die Führer kamen und gingen, das Volk aber blieb. Und ewig zischten die Gänse.
Brauch und Homogenität empfand ich als Wesen des Volks. Die Zeit im Dorf lief nicht voran, sie ging im Jahreskreis. Im Märzen der Bauer sein Rößlein einspannt. Sommerfeld, uns auch meld, wieviel zählst du Ähren? Bunt sind schon die Wälder, kahl die Stoppelfelder, kühler pfeift der Wind. Und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Bald kam ein neuer März, doch ehe der Schnee ging, mußten die Schweine sterben, in jedem Bauernhof eins. War der Schlachter Christenmensch, dann schickte er, Gott zum Gruß, eine Kanne Wurstsuppe brühwarm ins Pfarrhaus. Mutter hob den Deckel und prüfte, ob dem fettigen Sud ein paar Scheiben Wellfleisch beigegeben wären. Danach taxierte sie des Spenders Kirchentreue.
So schien das Dorf sich selbst genug, von keiner Sehnsucht gepeinigt, von Träumen ungestört. Aber hast du vergessen, wie viele Frauen schwarze Kleider trugen jahrein, jahraus? Weißt du nicht mehr, was geschah, wenn Vater Christvesper hielt? Beim Gesang von Stille Nacht löschte die Küsterin das Licht, und ein Schluchzen und Weinen erfüllte das Kirchenschiff, als habe das Leid des ganzen Jahres auf diese drei Minuten gewartet, auf dieses süßliche Lied, das Vater nicht liebte. Singen müssen wir es, sagte er. Für die Vertriebenen ist es ein Stück Heimat.
Am nächsten Morgen sammelten sich die Christenkinder im Pfarrgarten. Wir stapften durchs verschneite Dorf, zum Weihnachtssingen. Vater hatte eine Liste von Einsamen, Gebrechlichen, Bettlägerigen erstellt, fast alles alte Frauen, die besuchten wir nun in ihren muffigen Stübchen. Wir sangen Vom Himmel hoch und Ihr Kinderlein kommet, Brigitte Biewendt spielte Blockflöte, Vater las die uralte Geschichte vor: Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde (…) Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Wieder weinten die alten Frauen und schenkten uns Printen und Makronen, manchmal eine ganze Tafel Westschokolade mit der Mahnung, sie gerecht zu teilen. Danke, Kinder, danke, ach wie gut, daß ihr noch nichts vom Leben wißt! – Erleichtert liefen wir heim zu unseren Geschenken unter der Lichterfichte, im Pfarrhaus geborgen wie im Herzen der Welt.
In einem Winter ging der Selbstmord durchs Dorf. Ich fürchtete mich vor den Häusern, wo das geschehen war, wie mich auch das Schweineschlachten grauste und der große Nachbarsjunge, der das Zicklein abgestochen hatte. Wer tötet, fühlte ich, fällt aus der Welt. Wie arglos, wieviel weniger befleckt dachte ich mir die Städter. Es war keineswegs denkbar, daß zwei Stadtbewohner bei Friseur Heinecke ihren Kahlschlag empfingen, und die Beerdigungsglocke läutete, und die balbierten Bauern – kundig, wer da in die Grube fuhr – zoteten von der ollen Soundso, die sich uffjebammelt habe.
Daß alte Frauen derart starben, ließ sich fast noch irgendwie ertragen. Sie hatten, wie es hieß, ihr Leben gelebt. Dann brachte sich Jutta um, am 1. April 1966, mit Gas, in der Halberstädter Wohnung ihrer Tante. Achtzehn war sie, eine Konfirmandin meines Vaters. Sein Tagebuch – reich an Fakten, karg mit Emotion – läßt spüren, wie ihn dieser Tod erschüttert hat. »Ich muß Herrn (…) die Kunde bringen«, schreibt er, und: »Ich habe Jutta noch einmal gesehen. Sie lag in der Küche auf dem Boden. Mit Herrn (…) zum Volkspolizeikreisamt, wo er in die 3 Briefe Einblick nehmen konnte, die Jutta für die Eltern, Marlene und ihren Freund hinterlassen hat. Allgem. Angst vor der Bewältig. des Lebens.«
Da muß etwas zu groß gewesen sein für das Dorf. Ich erinnere mich an Jutta: eine Dunkle, Stille, freundlich, immer ernst. Am 2. April unterstrich Vater den Bibeltext in seinem Pfarrerkalender: Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. (Psalm 116,9) – Das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat: das ewige Leben. (1. Johannes 2,25) »Eine tröstliche Losung«, schrieb er dazu und hat am 6. April bei Juttas Beerdigung darüber gepredigt. Am Nachmittag davor kamen Juttas Eltern ins Pfarrhaus. Ich saß auf der Mauer und sah, wie das gebeugte Paar den Kirchweg heraufschritt und versteckte mich wie vor dem Tod. In Vaters Kalender steht: »Noch lange über Jutta gesprochen.«
Es starb auch der große Sohn des Lehrers. Er kauerte im Wald, in der Höhle, und hatte Gift genommen. Und dann war Agnes tot. Um welchen Gottes Willen erhängt sich ein dreizehnjähriges Mädchen? Und welcher Teufel läßt zwölfjährige Bengels darüber Witze machen? Ein Hänsel-Mädchen war Agnes gewesen, eine Sitzenbleiberin, immerzu bemüht, sich lieb Kind zu machen. Das nervte. Dann trotteten wir, die ganze Klasse, inmitten eines langen Zugs den Friedhofsweg hinauf. Vor uns schwankte der Sarg. Ein trüber Tag war. Ich weiß, ich trug den braunen Anorak und versuchte zu fassen, wie entsetzlich nahe ich der toten Agnes sei. Vater predigte nicht, denn Agnes’ Familie war katholisch. Der Priester sprach so leise, daß ich ihn nicht verstand. Die Mutter weinte und rief immer wieder den Namen ihres Kinds: Agnes, warum hast du das getan! Agnes, mein Mädchen, warum hast du das getan!
Abends setzte sich der Vater an mein Bett. Ich fragte: Kann Agnes in den Himmel kommen?
Ja, Junge, sagte er.
Aber sie ist katholisch.
Alle Christen gehören zum Volk Gottes.
Was unterscheidet uns von den Katholiken? fragte ich. Der Volksmund wußte: Sie sind falsch, und die Priester treiben’s alle mit ihrer Haushälterin. Vater sprach vom Papst und dem Abendmahl ohne Wein für alle. Der größte Unterschied sei aber der Beichtzwang. Alle Sünden beichten, begangen in Gedanken, Worten und Werken, das schaffe keiner, das mache den Menschen verrückt. Dann sangen wir, auch für Agnes, mein und Vaters Lieblingslied: Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Mein sehnlich Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Tale, weit über blaches Feld schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt.
Werden irgendwann alle Menschen zu Gottes Volk gehören? fragte ich.
Irgendwann ja, versprach Vater.
Und wer vorher stirbt und nicht an Gott geglaubt hat? Kann der in den Himmel?
Nach menschlichem Ermessen nicht, sagte Vater. Aber wenn Gott will, dann geht auch das. – Letzteres mißfiel mir, und ich unterschlug es, als mich der freche Grundmann wieder Paster! rief. Du kommst nicht in den Himmel, zischte ich, kalt vor Wut. Grundmann kreischte vor Vergnügen.
Drei Viertel der Klassenkameraden standen der Kirche fern, besuchten weder Gottesdienst noch Christenlehre, gehörten nicht zu Gottes Volk, wurden nicht schulfrei gestellt zu Vaters Reformationsgottesdienst – natürlich auch nicht die wenigen Katholiken. Der Küsterjunge Ulli wußte: Die feiern morgen Allerheiligen, da stehen nachts die Totengeister auf. Spätabends stahl ich mich aus dem Pfarrhaus und pirschte zum Friedhof. Das eiserne Tor winselte im Scharnier, in den Weiden knarrte ein harter nasser Wind. Die Finsternis stand wie eine Wand. Ich tappte am Regenbassin vorbei in Richtung Leichenhalle, da sah ich den Flammentanz auf den Gräbern. Wie Seelen hüpften die Lichter in ihren gläsernen Gehäusen. Ich wagte mich näher und war berückt von meinem Mut. Plötzlich ritt mich der Luther. Ich griff ein Windlicht und hastete in Richtung Friedhofstor. Fast war ich draußen, da schlug die Glocke vom Turm. Ich erschrak und trug die flackernde Seele zurück an ihr Grab.
Es stand auf dem Friedhof ein Stein, der wurde der Muna-Stein genannt. Das Wort kam von Munitionsfabrik. Die hatte zur Nazizeit oben im Wald gelegen, bei der Soldatensiedlung Mönchhai. Am 21. September 1944 war dort etwas in die Luft geflogen, mit sieben deutschen Menschen, deren Namen auf dem Muna-Stein zu lesen standen. Eine spätere Zeit hatte nicht vergessen mögen, daß auch 59 Zwangsarbeiter in den Tod gerissen worden waren, und eine Ergänzungsplatte angefügt. Ansonsten schien die Hitlerei ein anderer Planet gewesen. Die Schuldigen säßen in Westdeutschland, lehrte die Schule und warnte vor diesen Ewiggestrigen. Uns dagegen, den Siegern der Geschichte, war die Zukunft versprochen. Doch auch die Lehrer, die Ideologie verkündeten, schlossen das Pfarrerskind, den Nichtpionier, in die Klassengemeinschaft ein. Fast glaubt die Erinnerung, es habe im Dorf keine Kommunisten gegeben, obwohl sie Maiumzüge meldet, Pioniermanöver, Fahnenappelle sonder Zahl und einen Schulfreund im Zentralrat der FDJ. Und mußte nicht jedes Kind sich mit Beginn des Russischunterrichts einen Namen aus dem Lande Lenins wählen? Waleri, komm an die Tafel!, und du kamst. Larissa, lies vor!, und Christine Groeger las. Die Erinnerung schätzt den Schaden gering. Ihr ist, als sei das Dorf für alles Auswärtige immun gewesen. Was vermochten die SED-Parolen und die Zeitung der Partei gegen das Gesetz von Saat und Ernte und die Symbiose von Mensch und Tier? So wenig wie die Zeit gegen den Ort.
»Volksstimme« hieß die Zeitung; sie heißt noch heute so. Doch Volkes Stimme wurde nicht gedruckt. Alles Wirkliche war mündlich. Alltags sprach Volkes Stimme nur das Nötigste. Sonntags schwoll sie zum Chor, aber nicht in Vaters Kirche, sondern an einem Ort, den Vater nie verstand: auf dem Fußballplatz oben am Wald. Es rüstete die Stadt gegen das Dorf, der Halberstädter Spitzenreiter gegen die Tabellenkellerkinder. Was taten sich die Gäste schon beim Warmspielen arrogant hervor. Los ging’s, und zack, lag ihnen ein Ei im Nest. Fünfhundert Bauern brüllten Spott. Doch dann kamen die Halberstädter und rannten und schrien sich nach vorn und legten unser Tor unter schwerstes Feuer. Es stand aber darin der König von Dingelstedt: Boxer Koennecke. Boxer flog, fing, faustete wie mit zehn Händen. Er lenkte ums Holz, er kratzte von der Linie, er riß den Feinden das glitschige Leder vom Fuß. Nach der Halbzeitpause wurde aus Regen Hagel und aus dem Halberstädter Sturm ein Orkan. Ich stand dicht hinter Koenneckes Tor und sah durch die Maschen, was Mut der Verzweiflung bedeutet. Boxer schrie nicht herum, er zeigte keine Show. In stummer Erbitterung tat er die Arbeit seines Lebens wie einer, der gegen sein Orakel kämpft oder einen Pakt geschlossen hat. Der Harz ist ja voll von Teufelssagen.
Längst drängte das ganze Volk hinter Koenneckes Gehäuse. Er und unsere Ballwegdrescher hielten das 1 : 0 bis vier Minuten vor Schluß. Dann trat im stampfenden Gewühl ein Halberstädter Koennecke ins Kreuz. Etwas zerbrach. Da lag der Unbezwingliche im Morast und warf schluchzend den Kopf hin und her. Aber seine Arme bargen den Ball.
Auszuwechseln war damals noch nicht erlaubt. Sie richteten Koennecke auf und lehnten ihn behutsam an den Pfosten. Sie riefen ihr Letztes wach und trieben die Halberstädter ins Feld zurück. Dann brachen die doch noch durch. In der 90. Minute drosch ihr Mittelstürmer die Kugel völlig frei in Koenneckes Gesicht. Kopfüber kippte Boxer in den Abpfiff hinein.
Der Jubel war grenzenlos. Ein laufendes Spalier, so eskortierte das Volk seine Helden ins Dorf. Die Fußballstollen schnalzten auf dem Kopfsteinpflaster wie alltags die Hufe der Pferde. Zwei schleppten Koennecke, der nieste Blut und spuckte Schlamm und leuchtete vor Heldenschmerz und Glück. Der hat das wahre Leben, dachte ich erregt und rannte nebenher. Könnte mich Angelika so sehen, sie käme nie wieder los.
Dann waren die Männer am Ziel. Sie betraten ihr Geheimnis: Schmagolds Ratskeller. Als ich heimkam, schimpfte Mutter: Mußtest du bei Regen raus? Im ganzen Dorf, bei Bäcker, Fleischer, Kassebaum, sprachen die Leute von Boxer Koennecke, und als mich Vater zwecks Fassonschnitt zu Heinecke befahl, wurde der Titan im Sessel neben mir geschoren. Boxer, das war was am Sonntag, sagte der Friseur. Koennecke sagte, was er immer sagte: nichts. Und so blieb es, bis die Dingelstedter in die Fremde mußten, hoch in den Harz, nach Benneckenstein. Dort waren sie Helden ohne Volk und verloren 1 : 8.
3
Eines Tages entdeckte ich im Bücherzimmer ein Gemälde-Album. Auf dem Umschlag schwang sich ein kantiger Adler ins Licht. Gotisch prunkte der Titel: »Im Auf und Ab zur Weltmacht«. Vom Inneneinband war zu erfahren: Ein Volk ohne Vergangenheit verdient auch keine Zukunft. An Vergangenheit litt unser Volk nicht Mangel. Sie hub an im Jahre 9, natürlich im Wald. Ein Kolossalbild bezeugte, wie Volksgenossen – fragwürdig gekleidet, doch germanisch resolut – Varus’ Römer zerfleischerten. Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder! jammerte der Kaiser in Rom – umsonst. Sein Feldherr hatte sich ins Schwert gestürzt.
»Im Auf und Ab zur Weltmacht« triumphierte die Tat über den zaudernden Geist. Geschichte schien ein Defiliermarsch großer Stunden, Krieg der Vater aller deutschen Dinge. Herrlich, wie das Deutschtum sich zeiteinwärts hackte, blutete und siegte. Dann ein Idyll: Heinrich der Finkler träumt am Vogelherd, da nahen die deutschen Fürsten und tragen ihm die Königskrone an. 1077 muß Heinrich IV. durch Eis und Schnee nach Canossa wanken, um vor Papst Clemens VII. Buße zu tun. Schon wieder Gehacktes: die kaiserlose, schreckliche Zeit. 1521: Luther in Worms, die Hand aufs Herz, das Auge himmelwärts, zum deutschen Gott, der fortan als nationaler Protestant zu denken ist. 1632 meucheln die Katholiken in der Schlacht bei Lützen den edlen Schwedenführer Gustav Adolf. Preußen erscheint; der Soldatenkönig inspiziert seine Langen Kerls. Und endlich wird dem Deutschtum der Heiland geboren: der Alte Fritz.
Der Alte Fritz als Fahnenträger in der Schlacht von Zorndorf. Der Alte Fritz beim Feldgebet nach der Schlacht von Leuthen (Nun danket alle Gott!). Der Alte Fritz als Flötenspieler (Sanssouci). Und als der Große Friederich 1786 zum himmlischen Wachregiment versammelt wurde, war Preußen bald im Eimer. Auftritt Bonaparte: Preußenvernichtung bei Jena und Auerstedt 1806. Erschießung der Schillschen Offiziere in Stralsund 1809. Und so fort mit deutscher Not, bis Napoleon der Wahnsinn schlug und er Rußland überfiel. Borodino 1812: Dumpf brütet nach unentschiedener Schlacht das Ungeheuer über seinem Kartentisch: Vor oder zurück? Ritt durch das brennende Moskau. Fluchtkalesche nach Paris, gefolgt von den letzten Trümmern der Großen Armee. Mit Mann und Roß und Wagen, so hat sie Gott geschlagen, aber noch nicht ganz. Völkerschlacht bei Leipzig, endlich Waterloo. Wellington, verzweifelnd rufend: Ich wollt, es wäre Nacht oder die Preußen kämen! Heißa, da bricht Papa Blücher aus dem Busch und jagt dem welschen Monster seine deutsche Klinge ins Gemächt. Der entkaiserte Korse verdämmert auf einem Felseiland im Atlantik, und Freddy singt im Deutschlandfunk: Sankt Helena um Mitternacht, der Kaiser ist vom Schlaf erwacht und denkt daran, wie schnell sich alles ändern kann.
Der Rest sei übersprungen, all die Düppeler Schanzen, Königgrätze und Sedans. Kaiserkrönung in Versailles, Dreikaiserjahr, herrlicher Wilhelm Zwo. Nährstand ist Wehrstand, schimmernde Wehr zu Lande und zur See, Kolonien, lauf Neger lauf, Sarajevo, Verdun. Und dann war alles zu Ende, obschon Deutschland im Felde unbesiegt. Verräter, Novemberverbrecher hatten unserem kämpfenden Volk den Dolch in den Rücken gestoßen. »Im Auf und Ab zur Weltmacht«, erschienen zur Weimarer Zeit, harrte der nationalen Erweckung und eines Neuen Fritzen, der dann Adolf hieß.
Es schlummerten noch mehr solcher Bücher ganz unten im Regal, und alle erzählten Geschichte als Kampf und Volkestreu. »Der Löwe von Flandern« reinigte das Land der Flamen von Franzosenbrut. In »Ohm Krüger« rangen die Buren, das Heldenvolk des Großen Trecks, gegen die perfiden Engländer. »An der Pacificbahn« verteidigten weiße Siedler die christliche Zivilisation gegen tückische Indsmen vom Stamme der Upsaroka. »Zwischen den beiden Rassen wird es einen ewigen Kampf geben, bis der rote Mann der Übermacht weichen muß und von der Erde verschwindet.« Immer kitzelt es Mister Hoffmanns gute alte Gun, den verdammten Rothäuten eins aufzubrennen, und Mister Weiß weiß, »daß der indianische Rachedurst teuflische Martern erfindet, an die ein Weißer gar nicht denkt«.
Ja, hatte er denn nie »Die Nibelungen« gelesen? Rudolf Herzogs Version, 1929 erschienen, erwies sich als Lehrbuch für Fleischer Grützmacher. Lustig ritten die Recken vom Rhein nach Hunnenland. Ihr ritterlicher Spielmann, Herr Volker von Alzey, sang ihnen das Lied vom Tod, der süßer schmecke als ein Mädchenkuß, rauche nur kräftig das Schwert vom Blute der Feinde. Am Donaustrand fand Hagen von Tronje den Fährmann frech. »Da holte er den Balmung aus der Scheide und tat von unten herauf einen Hieb, der dem Riesen Brust und Schädel spaltete. Wie eine Springflut schoß das rote Blut ins Boot.« Sie erreichten König Etzels Hof. Große Tafel. Kecke Reden des Etzelbruders Blödel. »Kein Wort sprach er mehr. Wie ein zündender Blitz war ihm Dankwarts Schwert durch den Hals gefahren und hatte ihm das Haupt vor die Füße geworfen.« Und so endete Jung-Ortlieb, das Etzelsöhnchen: Hagen »hob die Hand, die am Griffe Balmungs lag. Und es ging ein leises Zischen durch die Luft. Da stand der Knabe Ortlieb hauptlos im Saal, griff mit den Händen umher und sank in sich zusammen.« Da mochte Herr Volker nicht untätig bleiben und mähte dem ersten Hunnenritter »den Kopf herunter, daß er augenrollend unter die Menge im Hofe flog«. Gottlob schwächte diese Bemühung nicht Herrn Volkers Muse. »›Immer heran,‹ sang er, ›immer heran! Hier ist zu sehen, was kein Mensch mehr sieht, der es einmal sah! Volkers Schwert! Heidi! Mitten in eurer Gurgel!‹«
Abertausende sterben, ein Nibelung auf hundert Hunnen. Blut schäumt im Schlachtsaal wie das arische Weltenmeer. Am Ende des rassigen Ringens sind alle tot, bis auf den Oberhunnen, dessen Kehle nun ein schauriges Lachen entkeucht. »Durch die Lande aber zogen die Heersäulen heran, die die Boten gerufen hatten, und gelbe schwarzhaarige Menschen kamen zu Tausenden und Hunderttausenden geritten aus Ungarn und der Walachei, aus dem Reußenlande und den Steppen Asiens. Wie ein Heuschreckenschwarm, der die Sonne verdunkelt, kamen sie heran, und blaß und finster setzte sich Etzel an ihre Spitze und warf sich sengend und mordend auf die deutschen Lande bis über den Rhein hinaus. Da ward aus Etzel vom Hunnenland Attila, die Geißel Gottes. Und wohin er kam, kam die Nacht. So furchtbar ward heimgesucht an den Menschen der Tod Siegfrieds, des Sonnenhelden.«
Nicht Feuchtwanger, Tucholsky, die Gebrüder Mann – Bücher wie dieses schufen den soundtrack der Weimarer Republik und präparierten das Kommende. Und zwei Jahrzehnte nach der Nibelungen neuerlicher Höllenfahrt besoff ich mich am gurgelnden Wahn. Heute weiß ich: Rassismus, Volksverhetzung, sadistisches Gewichse, Germanenquark. Und doch klingt nach, was mir »Die Nibelungen« damals waren: Blaubarts Zimmer, mein verbotenes Gelaß, eine Gegenwelt zu Ulbricht, dem Roten Oktober, den blauen Wimpeln im Sommerwind und der Zeitungsprosa über Bonner Ultras und die Ernteschlachten. Unser wahres Vaterland ist die Sowjetunion, wußte die Lehrerin. Von den Burgen und Schluchten nationalromantischer Knabenträume wußte sie nichts. Dann brachte der Landfilm »Die Kreuzritter« ins Dorf. Ich kannte die Geschichte aus Werner Jansens »Geier um Marienburg« (1925, 1. –100. Tausend): das gewaltige Stapfen der Ordensritter nach Osten, wo sie das deutsche Kreuz aufrichteten und es mit gläubigem Schwert beschirmten gegen Jagiello, den sabbernden Polenkönig, und seine Heere aus Slawenquark und Heidenhefe. »›Christ ist erstanden!‹ donnerte das Siegeslied des Ordens aus jedem Munde des deutschen Heeres.« Auch wie der sonnenblonde Hochmeister Ulrich von Jungingen fiel, war mir aufs Wort bekannt: »Rings um ihn sanken die Freunde, er aber focht mit leuchtenden Augen, und mit jedem Schlage dünkte ihn seine Seele heller. Mit einem Male fuhr eine feurige Lohe mitten in seine Brust, er fühlte sich pfeilschnell emporgehoben, und lächelnd trat er vor Gott.«
Vor Gott? Wohl kaum. Jetzt erlebte ich die Gegengeschichte. Ich sah die Tücke der Recken mit dem Christuszeichen auf den weißen Mänteln. Ich verstand den gerechten Kampf der geschundenen Polen, nur daß ihre Waffenbrüderschaft mit den Völkern des Ostens die Sowjetunion beschmusen sollte, ahnte ich sowenig wie die sonstigen Pflichten, denen ein 1960 gedrehter polnischer Monumentalfilm unterlag. 1410 war, die Grunwald-Schlacht eben vorüber. Tot lagen alle Kreuzmäntel, in ihrer Mitte Jungingen, das Vieh, und der edle Jagiello sprach über die Walstatt und in die Geschichte hinein: »Das ist der, der noch heute meinte, über alle Herrscher der Welt erhaben zu sein.« Natürlich ging das auf Hitler. Die Bauernjungs begeisterte der Film; jegliche Schlacht und jeder Sieger schien ihnen recht. Ich aber lief wie betäubt aus dem kleinen Saal über der Kneipe »Zum Huywald«. Ich tappte die Treppe hinunter. Ich stand, der letzte Kreuzritter, auf dem Dorfplatz und wußte nicht wohin. Sie hatten die Meinen erschlagen.
Aber der Zweifel war gesät. Die polnische Perspektive wirkte nach. Und wie konnte ich Einzelgeschöpf mich einem Orden, einem Volk unterstellen, und sei es in der Phantasie? Jetzt geriet ich an ein Buch, das mich empörte, obwohl sein Blutdurst dem der Nibelungen nicht gewachsen war: »Taras Bulba« von Nikolai Gogol. Stolze Kosaken fochten gegen Polengeschmeiß und Juden, die man, nun ja, im Dnjepr ersäufte. Hetman Bulba galoppierte immer vorneweg mit Mir nach! und Hoho! und allzeit blanker Klinge. Zwei Söhne hatte er, Ostap und Andry. Der Jüngere verliebte sich in eine Polin, was hieß, daß er sein Volk verriet.
Im Gefecht fing ihn der Vater. »›So, was wollen wir denn nun tun?‹ fragte Taras und sah dem Sohn fest ins Auge. Andry antwortete nicht. Er saß regungslos mit niedergeschlagenen Augen auf seinem Pferd. ›Nun, mein Sohn, welchen Gewinn hattest du davon, daß du zu den Polen übergingst?‹ Andry schwieg. ›Verraten und verkauft hast du deinen Glauben und die Deinigen! Steig hier vom Pferde!‹ Gehorsam wie ein gescholtenes Kind stieg Andry ab und stand halb bewußtlos vor seinem Vater. ›Bleibe so stehen und rühre dich nicht und höre, was ich dir noch zu sagen habe. Ich gab dir das Leben, ich werde es dir auch nehmen.‹ Taras trat einen Schritt zurück und nahm die Muskete von der Schulter. Andry war blaß wie ein Toter; seine Lippen bewegten sich und flüsterten einen Namen, aber es war nicht der Name des Vaterlandes, auch nicht der Name seiner Mutter, es war der Name der schönen Polin. Taras drückte ab, und wie ein von der Sense getroffener Kornhalm neigte Andry das Haupt und stürzte reglos nieder.«
In diesem erzieherischen Buche stand eine Widmung: »Meinem lieben Hans-Joachim Dieckmann zum Weihnachtsfest 1927«. Da war mein Vater sieben. Diese Jugend mußte ja marschieren, bis alles in Scherben fiel. Was die Massaker der Kreuzritter und Nibelungen nicht vermochten, das schaffte Taras Bulbas Sohnesmord: mich vom Völkischen zu kurieren. Obwohl meinem Vater keinerlei Ähnlichkeit mit dem Kosakenhauptmann vorzuwerfen war, wünschte ich Andry Ostap zu rächen. Eine Fremde würde ich heiraten. Angelika, das blonde Heidenmädchen aus dem Ortsteil Röderhof, war meine erste Wahl. Für den Fall, daß sie nicht wollte (Grund zur Sorge bestand), ersehnte ich die Mandelaugenprinzessin, die ein kirgisischer Märchenfilm mir in die Träume geflimmert hatte. Hoffnung auf mich machen durfte sich auch die französische Schlagersängerin France Gall, die im Westradio gurrte: Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte, so soll er aussehn, der Mann, auf den ich warte. Die Bibel bestärkte mich: Das Buch Ruth pries die Liebe einer Gottesvölkischen zu Boas, dem gütigen Fremden. Liebe überwand alles – Glaube, Rasse, Klasse. Das wurde mein neuer Trotz gegen die Ideologie.
Die Burgen blieben mir, das Waldgefühl, die unabweisliche Ahnung, was Volksseele sei: ein Urstrom zwischen Weisheit und Barbarei. Die DDR-Ideologie entseelte Burgen und Wälder und nannte das Volk Arbeiterklasse. Die Schule lehrte Geschichte als Abfolge von Klassenkämpfen: Spartakus und Müntzer, Marx, Karl & Rosa. Thälmann war niemals gefallen und Soja Kosmodemjanskaja die Madonna der Partisanen. Geschichte, das hieß Bauernkrieg und preußisches Rekrutenschinden. Geschichte war der dreifache Fluch der schlesischen Weber und die Lage der arbeitenden Klasse in England, wie sie Vilmos und Ilse Korn so kindanrührend wie ideologiegerecht erzählten in der Pflichtlektüre »Mohr und die Raben von London«. Es mochte ja stimmen, daß nicht Könige, sondern ihre Proletarier das siebentorige Theben erbaut hatten, das goldstrahlende Lima, die Triumphbögen von Rom. Aber niemals konnte, wie behauptet, diese Brechtsche Mahnung von einem lesenden Arbeiter stammen. Arbeiter lasen sowenig wie Bauern, das erfuhr ich in der Stadt.
4
Die Stadt war groß, die Stadt war ungeheuer. In ihr lebten 30 000 Menschen, recht andere als auf dem Dorf. Sie ritten nicht, sie trieben keine Schafe durch die Straßen, sie hegten und töteten kein Vieh. Sie pflügten keinen Acker und mähten kein Korn. Das lehmige Schweigen des Landes war ihnen unvertraut. Sie redeten rasch in einem rauhen, schmutzigen Idiom, das sie durch ihr Gelächter unterbrachen. Ihre Fenster schauten keinen Wald. Ihre Dächer überragten ihre Bäume. Sogar einen Wolkenkratzer hatten sie errichtet, zehn Stockwerke hoch, wie in Amerika.
Ein riesiger Kegel, so thronte die Halde über dem Tal. Stahltrossen verbanden ihren Gipfel mit dem Förderturm, dessen eilendes Rad die Männer 900 Meter tief ins Gebirge seilte und die Kupferschiefer, die sie dort unten brachen, herauf. Jahr um Jahr spulte das Rad. Tag und Nacht schwebten die Loren voll tauben Gesteins zur Kegelspitze, schlugen dort um, entleerten sich und schaukelten wieder zum Turm, frei geworden für die nächste Last, die ihnen von den Männern im Berg schon immer bereitet war.
Die Menschen brachen den Berg, der Berg brach die Menschen, auf daß sie einander ähnlich würden. Dem Dorf- und Waldkind schien das schaurig, ein Fronkreis ohne Sonne, Saat und Ernte, Jahreszeiten und worin sonst der Ländler Sinn und Weitergang empfindet. Hier aber fuhren die Männer seit alters in den Berg, und daß die Söhne es den Vätern gleichtun würden, war beider Stolz. Schon die Schüler der siebenten Klasse wanderten am Montagmorgen durch wehende Kälte zum Müntzer-Schacht empor, um Unterricht in der sozialistischen Produktion zu erhalten. Der Schneefall raschelte auf der Anorakkapuze. Alle fünfzig Schritte fror unter einer Peitschenleuchte ein Kegel blaues Licht. Goldäugige Busse kamen lautlos entgegen und frachteten müde Männer in die Dörfer ringsum, wo sie schlafen mußten, am Nachmittag erwachen, essen, rauchen und ein wenig reden, ihren Hund spazierenführen und sich pünktlich auf dem Dorfplatz sammeln, wo derselbe Bus sie wieder holen würde zur nächsten Nacht im Berg. So lebte dieses Volk.
Am Wochenende blieben die Bergleute oben auf der Welt. Trainingshose, Unterhemd, das war ihre Samstagsuniform. Sie saßen vor Siedlungsblocks – Dreigeschossern, nach dem Kriege gebaut; die Straßen hießen Einheit, Freiheit, Frieden. Bei den Häusern standen kleine Autos. Die Männer gossen sie aus bunten Eimern oder duschten sie mit Wasserbürsten, deren grüne Schläuche in die Kellerfenster krochen. Mopedjugend kurvte ums Karree. Auf dem Rasen sang im Kofferradio ein mondäner Alt: Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee und die ganze Zeit im Herzen nur Amor, das ist wundervoll, Señor.
Der 2. Juli hieß Tag des Bergmanns. Hierzu fand eine zentrale Festveranstaltung statt, immer in einem anderen DDR-Revier. 1972 war Sangerhausen an der Reihe. Der Markt wurde aufgehübscht, die Ratskeller-Ruine wieder Restaurant, und dann strömten 30 000 zum Kampfmeeting mit Horst Sindermann. Der war damals SED-Bezirkschef von Halle. Als wir gestern herfuhren, rief er, da hingen schwere Regenwolken über dem Mansfelder Land, und ich war in Sorge, daß unsere festliche Massenveranstaltung vielleicht ins Wasser fällt gewissermaßen. Aber der Genosse Bergbauminister sagte zu mir: Genosse Sindermann, wissen Sie denn nicht, am Tag des Bergmanns der Deutschen Demokratischen Republik regnet es nie.
Dies schien mir beifallswert. Ich klatschte. 30 000 fielen ein. Horst Sindermann riß kämpferisch die Arme hoch. Jawohl! rief er. Jawohl!
Ich drängte zur Tribüne, um ein Bild zu schießen. Da, war das nicht Adolf Hennecke, der Ur-Aktivist, der Ahnvater der Arbeitsproduktivität, der am 13. Oktober 1948 im Karl-Liebknecht-Schacht von Oelsnitz seine Norm mit 387 Prozent erfüllt hatte? Auf meinem Film war nur noch eine Aufnahme. Sind Sie Herr Hennecke? rief ich hinauf. Er neigte sich über die Brüstung. Seine Orden zogen ihn erdwärts. Herr? fragte er. Den Herrn habch im Kleiderschrank gelassen 1945, wie unser Volk die Herren davongejagt hat. Ich bin der Genosse Hennecke.
Ich drückte ab. Er starb nicht viel später, doch am Tag des Bergmanns 1972 war er froh, wie mein Photo beweist. Ich wollte statt Bergmann oder Aktivist Fußballreporter werden, also studieren. Die Sangerhäuser Volksbildung unterstand der Kreisschulrätin Richter, einer Hilde Benjamin auf Rayonsniveau. Die ließ kein Pastorenkind zur Oberschule und zum Abitur, und hätte es den Notendurchschnitt 1,0 gehabt. Wer nicht in der FDJ sei, wer sich weigere, die Kampfreserve der Partei zu verstärken, der beziehe Stellung gegen das Volk. Logischerweise tue da die Volksmacht auch nichts für ihn. – Da mußte ich dem Volke dienen und wurde Filmvorführer.
5
Und dann kam die Theologie. In den »Lebensuhren« ist davon erzählt und auch, warum ich nach sechs Jahren Studium bei Kirchens doch kein Pfarrer wurde: aus Scheu, immerzu und von Amts wegen vom Höchsten und Tiefsten zu sprechen. Das war freilich nur ein Teil des Problems. Hinzu kam Volksflucht, Angst vor der Sorgepflicht für übliche Menschen. Die Kirchbehörde hatte mich ins Vikariat nach Berlin-Buch entsandt, in eine intellektuell gehobene Gemeinde. Deren Pfarrer war Konrad Hüttel von Heidenfeld, ein Literat und seinem Rufe nach der gewaltigste Prediger von Berlin-Brandenburg. Ich fürchte, sagte er, die einfache Omi wird bei mir im Gottesdienst nicht satt.
Doch selbst diesem Chef war ich zu volksfern, zu kühl im Umgang mit Menschen. Er hielt meine Schwäche für Arroganz. Mahnendes Gespräch im Bucher Pfarramtszimmer. Plötzlich schossen mir die Tränen auf, und ich erklärte schniefend: Ich kann’s nicht, ich gehe einfach nicht auf Leute zu, ich will allein sein und nicht in deren Leben. Heidenfeld war amtsbrüderlich angeschockt und erteilte mir diversen Rat – wohl nicht nur mir. Als leichteste Menschenübung sollte ich zunächst die Gemeindeältesten besuchen. Gleich der erste traktierte mich ermutigend mit Stullen und Bier. Der Abend gedieh. Zum Abschied geleitete mich die Gattin an die Tür und sagte mütterlich: Na sehen Sie, Herr Vikar, war’s denn so schlimm?
Als Unterhaltungsmedium hingegen schätzte ich das Volk schon immer. Beim Fußball, in der Kneipe, in der Bahn: Voyeursvergnügen ohne Ende. Völkische Erbauung gewährte auch das Christliche Hospiz in der Berliner Auguststraße, wo ich zwecks Zuverdienst öfters als Nachtportier aushalf. Markante Gäste gab es zuhauf, mein Liebling war jedoch Herr Schindler, ein kleiner, rechtwinklig agierender Leipziger, der jedes zweite Wochenende in Berlin verbrachte, um seinem Lebensziel näherzukommen: der lückenlosen Kenntnis des Berliner Straßennetzes. Die Menschen interessierten ihn nicht. Seine Spezialität brachte Herrn Schindler immerhin in die Kuriositätensendung »Außenseiter – Spitzenreiter«. Nach dem Fall der Mauer dachte ich an ihn und sein Unglück. Wie katastrophal mußte die Vereinigung beider Berlin sein Wissen relativiert haben. Aber dann trat Herr Schindler auch im Westfernsehen auf. Jetzt beherrschte er ganz Berlin. Unlängst sah ich ihn wieder. Alt geworden, saß er in der Straßenbahn und sang leise: Ein Mädel ging zum Tanze mit güldenem Haar …
Eines Nachts um halb drei klingelte es an der Hospiztür. Die Gäste waren doch alle im Haus? Ich öffnete. Herein stampfte ein untersetzter Mensch: Mittvierziger, wühliges Blondhaar, Humphrey-Bogart-Kippe. Das klaffende Hemd unterm Bummelsakko entbarg eine goldene Kette auf reich gelockter Brust. Morjen! posaunte der Spätling und zwang meine Hand in seine Pranke. Ick sehe, du bist neu. Ick bin alt, ick bin der Fotzen-Günther. – So hatte sich im Christlichen Hospiz bislang noch niemand vorgestellt. Günther war kein Christ, aber als Kellner von Clärchens Ballhaus, der Anbahnungs-Lokalität in der Chausseestraße, zutiefst befaßt mit den Dingen des Lebens. Er sah immerzu Menschen, die sich sehnten. Nach Schichtschluß mußte er abtrinken, sonst konnte er nicht schlafen.
Günther liebte mich, weil ich so unverdorben sei. Wennde betest, mach mal für mich mit, sagte er, und: In fünf Jahren mach ick Himmelfahrt. Beruhigenderweise verringerte sich seine selbstgesetzte Lebensspanne nicht, solange ich ihn kannte. Ich liebte Günther auch. Er war mein Idealvolk. Er hatte Seele, er gab üppig Trinkgeld und lud ein, und während wir tranken, schwadronierte er mit hochmusikalischer Kodderschnauze Geschichten, die allesamt dasselbe Thema variierten: die tragische Komödie der menschlichen Existenz. Besonders gern hörte ich, wie ihm der Großadmiral der Baltischen Rotbannerflotte im Interhotel von Rostock-Warnemünde Sektgläser gestohlen hatte. Ick hab ihm amnestiert, sagte Günther. Wenn der Russe nich wär, jäbs keene Russen mehr. Das Leben is Kampf, aber ick hol mein Heu rin. Drushba! – Pssst, sagte ich, die Gäste.
Unbeschadet seines Beinamens war Günther sehr moralisch. Er hatte eine Ehefrau (wejen die Treue) und einen Schatz (wejen die Liebe). An meinem Tresen entschied er, wem in dieser schwindenden Nacht seine Heimkunft zustand. Beim ersten Frühlicht verließ er das Hospiz und schritt mit dem Ruf Der liebe Jott straft euch alle! ins tätige Leben zurück. Einmal rammte er an der Tür eine zierliche Diakonisse aus dem Vogtland. Er hob die Entsetzte hoch, küßte sie und sagte: Juten Morjen, meene süße kleene Sau.
Mittlerweile war ich fast ein passabler Vikar geworden. Pfarrer Hüttel von Heidenfeld erklärte, ich sei nun reif, meine erste Beerdigung zu halten. Nächsten Dienstag, eine alte Dame. Am Abend dieser Nachricht wachte ich wieder im Hospiz. Günther kam und wünschte Sekt zu trinken. Der Rotkäppchen-Korken klemmte. Ich äugte, wo er denn bliebe, da, bautz! saß er mir halb im Hirn. Das linke Auge schien Püree mit Brillensplit. Günther erklärte seine Sektlaune für beendet und rief den Krankenwagen. Der brachte mich in die Charité. Der Notarzt tupfte, reinigte und applizierte eine Augenklappe. Ich hätte einen Sehnervschock. Das Auge werde wieder – hoffentlich.
Dann stand ich auf der nächtlichen Straße, blind wie ein Lurch. Wo war ich? Sehr nahe der Mauer. Ich kletterte einen Mast empor, um das Straßenschild zu lesen. Hierbei verhafteten mich die diensthabenden Organe des Grenzsicherungsregiments Feliks Edmundowitsch Dzierżyński. Meine Erklärungen wurden als unorthodox empfunden, aber schließlich wiesen mir die Genossen den Weg zurück in unsere Republik. Endlich daheim, klingelte ich wild. Eva öffnete, völlig verschlafen. Wach auf! rief ich. Ich habe mir ein Auge ausgeschossen und mußte in die Charité. – Das ist ja furchtbar, sagte sie. Auf welcher Station liegst du denn?
Anderntags rief ich Pfarrer Hüttel von Heidenfeld an und schilderte mein Ungemach. Ob er die Beerdigung halten könne? Es sei doch ungünstig, am Grabe aufzutreten wie John Silver, der Piratenkoch aus Stevensons »Schatzinsel«. Heidenfeld, wie immer ihm dies Bild gefiel, pflichtete mir bei. Ich möge ihn über mein Auge auf dem laufenden halten (dies fand ich nun wieder keine schöne Formulierung). Am nächsten Tag, nach der Charité-Visite, besuchte ich die Brecht-Buchhandlung. Abends Telephonat Heidenfeld. Er klang eisig: Wie geht es Ihnen?
Oh, situationsbedingt.
Ist Ihr Augenschaden eigentlich objektiver Natur?
Äh. Wie meinen Sie?
Ich meine, daß ich gern wüßte, ob sich auch ein Außenstehender von Ihrer Unpäßlichkeit überzeugen kann.
Schon, aber ich soll die Augenklappe noch zehn Tage drauflassen.
Ich war heute in der Brecht-Buchhandlung, sagte Heidenfeld scharf. Ich habe Sie gesehen. Sie trugen keine Augenklappe.
Ich trage sie seit vorgestern Tag und Nacht.
Da stünde denn also meine Wahrnehmung gegen Ihre Behauptung, sagte Heidenfeld gemessen. – Ich fragte: Haben Sie mich vorn vorn gesehen?
Seitlich. Und überaus deutlich.
Von rechts oder von links?
Von rechts.
Meine Augenklappe ist links, sagte ich. Wenn ich zwei Augenklappen trage, gehe ich nicht in die Brecht-Buchhandlung.
Morgen um zehn sind Sie in meinem Arbeitszimmer, gebot Heidenfeld. Mit Krankenschein!