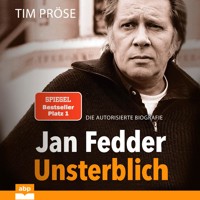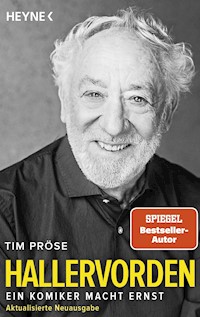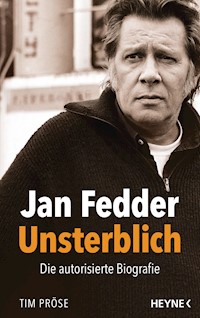14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Plötzlich steht die Welt still. Manchmal ist es ein Schicksalsschlag, manchmal ein Krieg oder eine Verzweiflungstat, die unser Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellt. Wie gehen Menschen damit um, wenn sie hinfallen, alles verlieren – und wie finden sie aus tiefster Krise zu sich selber? Nr.-1-Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse begleitete solche Menschen lange und erzählt nun in 15 berührenden Porträts von ihnen. Und von dem Wunder ihrer seelischen Widerstandskraft, ihrer Resilienz. Inspirierende Geschichten aus der Mitte der Gesellschaft, die Hoffnung und Mut machen, dem Leben immer positiv gegenüber zu treten und neue Wege zu gehen.
»Tim Pröse befasst sich in seinem Buch mit Schicksalsschlägen. Das enorm Bewegende dabei ist, dass er empathisch mit diesen Schicksalen umgeht. Er hört einfühlsam zu, bringt sich selbst ein, gibt das Essenzielle der Begegnungen weiter und hilft uns damit, aus all diesen Schicksalen für uns das zu entdecken, woraus wir für unser Leben lernen können.« Konstantin Wecker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Plötzlich steht die Welt still. Manchmal ist es ein Schicksalsschlag, manchmal ein Krieg oder eine Verzweiflungstat, die unser Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellt. Wie gehen Menschen damit um, wenn sie hinfallen, alles verlieren – und wie finden sie aus tiefster Krise zu sich selber? Nr.-1-Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse begleitete solche Menschen lange, prominente und unbekannte. Nun erzählt er in 15 berührenden Porträts von ihnen. Und von dem Wunder ihrer seelischen Widerstandskraft, ihrer Resilienz. Inspirierende Geschichten, die Hoffnung und Mut machen, neue Wege zu gehen.
»Tim Pröse befasst sich in seinem Buch mit Schicksalsschlägen. Das enorm Bewegende dabei ist, dass er empathisch mit diesen Schicksalen umgeht. Er hört einfühlsam zu, bringt sich selbst ein, gibt das Essenzielle der Begegnungen weiter und hilft uns damit, aus all diesen Schicksalen für uns das zu entdecken, woraus wir für unser Leben lernen können.« Konstantin Wecker
TIM PRÖSE
DER TAG, DER
MEIN LEBEN
VERÄNDERTE
Von Menschen, die aus
tiefster Krise
zu sich selbst fanden
15 Begegnungen, die Mut machen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag hat sich bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund des Zeitablaufs und der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Originalausgabe 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Heike Wolter
Bildredaktion: Tanja Zielezniak
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch,
unter Verwendung eines Fotos
von matsiukpavel/Shutterstock.com
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27961-5V001
www.heyne.de
»Ich setzte den Fuß in die Luft,
und sie trug«
Hilde Domin
Für meinen Freund
Jurek Rotenberg,
der mein Leben veränderte
INHALT
Unterwegs mit dem Seelenretter
Hermann überbringt Todesnachrichten und richtet wieder auf. Eine Reise durch die dunklen Nächte
Der Tod und das Mädchen
Lea sprang mit 17 von einer Brücke. Nun kämpft sie sich zurück ins Leben. Heinz Rudolf Kunze hilft ihr dabei
»Hitler ist tot! Ich lebe!«
Jurek Rotenberg überlebte den Holocaust. Und machte die Menschen glücklich
Die Seele des Seelsorgers
Pfarrer Gruber konnte nicht mehr – und wird nun wieder zusammengesetzt. Zu Gast in einem Kloster für ausgebrannte Priester
»Hans-Dietrich, du wirst kämpfen«
Zu Gast bei Genscher. Kurz vor seinem Tod erinnert sich der Staatsmann an sein Glück, überlebt zu haben
Die Überlebenskünstler
Wie Mario Adorf, Udo Lindenberg, Konstantin Wecker und Jan Fedder aus dem Nichts wieder aufstiegen
Einmal Sternenhimmel und zurück
Hubert Kah war ganz oben und ganz unten. Eine Achterbahnfahrt
Die Geisel
Ines saß mit Silke Bischoff im Auto der Gladbecker Gangster. Sie überlebte, die Freundin nicht
Fritz fliegt fort
Wie sich Deutschlands ungewöhnlichster Bestatter auf sein Sterben vorbereitete
Paulas Krieg
Die Soldatin wird bei einem Angriff schwer traumatisiert und kämpft nun ihren größten Kampf. Zu Besuch in der Psychiatrie der Bundeswehr
Jennys blaue Blumen
Wie sich die ehemalige Zwangsprostituierte Jenny befreite und ihr Glück fand
Willkommen in der Heimat
Hamoudi floh übers Meer nach Deutschland. Jetzt will er etwas zurückgeben
Der echte Rain Man
Der Autist Daniel rang lange mit sich und dem Leben. Nun siegte er. Ein Einblick in eine andere Welt
Der letzte Kumpel
Wie der Bergmann Peter erst alles verlor und dann alles gewann
»Eine wie sie gibt es selten hier«
Linda wollte ihren gewalttätigen Vater töten. Zu Besuch im Frauengefängnis
»Weil das Leid da ist«
Die Nacht ist schon der Anfang eines neuen Tages. Noch einmal unterwegs mit dem Kriseninterventionshelfer Hermann
Dank
Bildnachweis
Quellen
Unterwegs mit dem Seelenretter
Hermann überbringt Todesnachrichten und richtet wieder auf. Eine Reise durch die dunklen Nächte
Das Leben danach beginnt um fünf nach zehn.
Was von diesem Leben übrig blieb, halte ich in meiner Hand. Eine kleine Tüte bloß. In ihr liegt die letzte Habe der Toten von Gleis 5. Ihr Portemonnaie, ihre Zigaretten, ihr Feuerzeug. Der Ausweis im Geldbeutel offenbart, dass die Tote vor ein paar Tagen erst 30 Jahre alt wurde. Dann ihre Uhr. Das Glas über dem Zifferblatt ist zerborsten, die Zeiger sind stehen geblieben, als der Zug über die Frau fuhr. Fünf Minuten nach zehn. Der Zeitpunkt, als ihr Leben endete.
Die Tote von Gleis 5 ist ein »Personenschaden«, so sagt die Deutsche Bahn dazu, weil sich das Entsetzliche so einfacher aussprechen lässt. Die Zugführer teilen diesen »Schaden« beinahe täglich mit. Eine Durchsage wie so viele für die Fahrgäste. Dabei ist es doch eine Todesnachricht.
Ich sitze fast jede Woche in irgendeinem Zug, der irgendwo in Deutschland stehen bleibt. Meist fährt er bald weiter. Doch leider höre ich viel zu oft diese Nachricht durch die Lautsprecher meines Waggons. Ich habe mir angewöhnt, in diesem Moment zu beobachten, wie meine Mitreisenden weiterleben nach dieser »Störung«. Nach diesem Halt auf freier Strecke. Dieser Katastrophe, die uns erreicht, wenn wir uns in den Polstern der ICE-Sessel zurücklehnen.
Während ein Mensch vor Sekunden zerschellte.
Viele im Waggon, denen ich zusehe und zuhöre, seufzen. Andere neben mir stöhnen jäh auf, ein paar sogar, weiter hinten, schimpfen, »wer sich denn da um Himmels Willen wieder umbringen musste?!« Und andere fragen: »Schlimm, das alles … aber hätte der nicht auch mal an seine Mitmenschen denken und sich erschießen können?« Und wieder ein anderer raunte vor Kurzem bei einem anderen Vorfall: »Na toll! Wegen dem werd’ ich meinen Termin nicht schaffen!«
So in etwa klingt das Echo auf das Ende eines Menschenlebens in einem ICE. Es könnte aber auch eine S-Bahn sein oder ein Vorortzug, in dem wir mal wieder zu spät zur Arbeit kommen.
Deswegen, auch deswegen, stehe ich jetzt, ein paar Monate später, mit dieser Tüte in der Hand vor einer fremden Tür, irgendwo in München. Weil ich in diesem Buch von Schlägen des Schicksals erzählen möchte und von Tagen, nach denen nichts mehr ist, wie es einmal war. Aber auch von neuer Hoffnung. Neuer Stärke. Neuem Leben nach dem Tod.
Ich begleite dafür Menschen, die mitten in dem, was wir das normale Leben nennen, ganz plötzlich hinabfallen in das, was wir als »ganz unten« bezeichnen.
Ich werde als Reporter aber auch dabei sein, wenn diese Menschen wieder Anlauf nehmen, um ihr Leben neu zu beginnen, sich zu erheben nach dem großen Sturz. Oder wenn sie sich an diese Zeit des Aufbruchs erinnern.
Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen »Resilienz«. Gemeint ist die Widerstandskraft der Seele.
Beginnen möchte ich mit jenen »Personenschäden«, die nicht nur ein Leben beenden, sondern auch die Leben der Hinterbliebenen eines solchen »Schadens« für immer verändern. Von einem Augenblick auf den anderen ist alles anders. Ein privater Weltuntergang hat sich ereignet für ein paar Menschen, die diesen Toten kannten oder liebten. Diese untergegangene Welt bleibt uns verborgen, und wir wollen das auch so. Wir haben uns an vieles gewöhnt.
Seit aber die Mutter eines meiner besten Freunde vor drei Jahrzehnten auf einem Bahngleis aus dem Leben ging, gelingt mir das nicht mehr.
Auch dieser Beutel in meiner Hand bricht mit vielem, an das ich mich versucht hatte zu gewöhnen. Er birgt letzte Dinge. Neben mir steht Hermann Saur. Sein Leben lang schon steht er vor fremden Türen. Steht durch. Steht bei. Hält stand. Er ist von der Kriseninterventionshilfe.
Das Glück steht vor der Tür… so heißt es zumindest. Aber das stimmt nicht. Nicht, wenn Hermann Saur klingelt. Dann steht das Unglück davor.
80 Prozent der Deutschen sterben als relativ alte Menschen oder weil eine Krankheit den Tod zuvor angekündigt hat, sagt Hermann. Doch 20 Prozent aller Tode in Deutschland kommen plötzlich und unerwartet. An irgendeinem viel zu frühen oder bis dahin so harmlosen Tag. Für diese Tode und Tage ist Hermann Saur zuständig. Wenn er irgendwo hineilt, geraten Leben aus den Fugen. Von jetzt auf gleich. In nur einem Moment.
Es gibt die Erste Hilfe. Und es gibt die Letzte Hilfe. Die leistet Hermann Saur. Er soll der starke und feste Rahmen sein für den Kern dieses Buches. Alles, was ich mit ihm erlebe, führt schließlich zu den Menschen, die ich porträtiere und deren Geschichte ich in diesem Buch nachzeichne.
Diesmal ist es ein Tag im Hochsommer. Wir haben uns gerade auf den Weg zur Mutter der jungen Frau gemacht, die sich vor den Zug geworfen hat. Zwei Polizisten warten schon. Sie haben noch nicht geklingelt. Sie nehmen Hermann und mich am Hauseingang in Empfang. Hermann wird die Sache jetzt übernehmen. Einer der Beamten hält ihm den Plastikbeutel hin. Er nimmt ihn und reicht ihn an mich weiter. Ich soll ihn der Hinterbliebenen gleich übergeben, denn ich will und ich darf Hermann für dieses Buch begleiten. Dann muss ich das jetzt tun und nicht nur erstarren in der Wucht dieses Moments.
Hermann überbringt Todesnachrichten. Bei etwa einem Drittel seiner Einsätze ist er der Erste, der das Unsagbare ausspricht. In den anderen zwei Dritteln ist der Tod schon seit ein paar Minuten bekannt und das Beben, das er mit sich bringt, schon losgebrochen. Wenn Hermann jetzt an dieser Tür klingelt, wird eine Mutter öffnen, die gerade ihre Tochter verloren hat. Sein Blick fällt auf die Klingelknöpfe. Jetzt nur nicht den Falschen wecken.
Hermann Saur ist ein Erstretter für die Seele. Hauptberuflich war er bis 2020 Leiter der Münchner Notfallseelsorge und katholischer Diakon. Ein Diakon ist ein von der Kirche geweihter, aber nicht zölibatär lebender Mann, der in »besonderer Weise denen verpflichtet ist, die auf Hilfe angewiesen sind«. Das Vorbild der Diakone ist der Samariter.
Wenn Hermann die Nachricht vom Tod überbringt und den Hinterbliebenen beisteht, kommt er den Menschen aber meistens nicht mit dem lieben Gott. Stattdessen ist er ganz weltlich im Auftrag des »Krisen-Interventions-Team München« (KIT) unterwegs. Das KIT in dieser Stadt besteht aus 50 Männern und Frauen, die verschiedenen Not- und Rettungsdiensten angehören. Hermann arbeitet ehrenamtlich wie alle KIT-Leute. Meist dauert seine Bereitschaft 24 Stunden lang. Gern aber auch ein ganzes Wochenende.
Diesmal ist Hermanns Dienstplan anders. Weil ich ihn begleite, sind wir zwei Wochen am Stück im Einsatz. Und nun, vor dieser Tür der Mutter, wartet unser erster gemeinsamer »Fall«.
Ich wollte unbedingt mit Hermann losfahren. Weil ich irgendwann auf meinen vielen Reisen gespürt habe, dass ich selber auf einen »Personenschaden« mit einigem Unmut reagierte. Beim letzten Mal stand mein ICE stundenlang im Nirgendwo. Und dann erschienen Männer vor meinem Zugfenster. Erst Polizisten, dann Sanitäter, dann die Bestatter. Und mittendrin Frauen und Männer in roten Uniformen mit dem KIT-Aufnäher an ihren Jacken.
Vögel kreisten über der Szenerie. Krähen. Auf der Suche nach dem, was übrig geblieben war.
In diesen Stunden auf freier Strecke merkte ich, dass es mal wieder an der Zeit für mich war, ein anderer zu werden. Oder wenigstens etwas an mir zu ändern. Ich wollte nicht länger taub und kühl, vielleicht sogar verärgert sein, wenn mich der nächste »Personenschaden« aufhalten würde. Ich wollte meine Empfindsamkeit für diese scheinbar so fernen und namenlosen Toten wiederbeleben.
Ich wollte wieder fühlen wie das Mädchen im Grundschulalter in meinem stillstehenden Waggon, das aus dem Fenster auf die Szenerie starrte und das seine Eltern solange fragte und fragte, bis sie ihm endlich sagten, was geschehen war. Und das dann, als es langsam begriff, erschüttert war und durch den Waggon irrlichterte. Das suchend durch die Fenster ins Freie schaute. Helfen wollte. Und seine Mutter fragte: »Mama, was können wir jetzt tun?«
Ich suchte in diesem Moment in meinem Handy nach ersten Infos zur Kriseninterventionshilfe. Und als ich das Mädchen beobachtete, fühlte auch ich mich tatsächlich schon ein ganz kleines bisschen wieder wie ein Kind. Ein Junge, in dem sich damals schon dieser merkwürdige Wunsch ausbreitete, Journalist zu werden. Weil man in diesem Beruf so fragen darf, ja, so fragen muss, wie dieses Mädchen. Auch nach dem, was gern verschwiegen wird. Und weil man in einem Reporterleben mit etwas Glück viele Leben in diesem einen leben kann.
Am liebsten traf ich dafür in den vergangenen drei Jahrzehnten Menschen, deren Leben sich jäh verändert hatte. Und die das oft ganz wundersam durchstanden. Resiliente Menschen eben. Vielleicht interessierte mich in meinem Journalistenleben auch deswegen das Schicksal von Holocaust-Überlebenden so sehr. Oder das von Menschen, die sich dem Schicksal und den Gesetzen des Kriegs widersetzten.
Ich wollte diese anderen Leben mitfühlen, am liebsten ein paar Tage lang mitleben. Und dieses Gefühl dann aufschreiben und es verbreiten. Diesem Empfinden zu etwas mehr Macht verhelfen.
Es sollte aber nicht irgendeine Geschichte sein. Sondern eine, in der es um Leben und Tod geht. Nicht, weil ich eine Sensation erleben wollte. Bitte auch keinen Krimi, denn ich mag die meisten Krimis nicht. Sondern weil die wichtigsten Geschichten, jene, die wir im Gedächtnis behalten und die uns umtreiben, immer um Leben und Tod gehen.
Auch deswegen habe ich mich vor ein paar Jahren beim KIT München in aller Form beworben, einen ihrer Helfer begleiten zu dürfen. Und mit ihm loszufahren. Hinein in die Straßen, die ich noch nie zuvor befahren hatte. Um vor Türen zu stehen, durch die ich noch nie gegangen war. Und so begegnete ich Hermann. Er wurde ausgewählt dafür, weil der Chef vom KIT meinte, wir würden vielleicht gut zusammenpassen. Das stimmte. Ich bin seitdem befreundet mit Hermann.
Die zwei Wochen mit ihm versetzten mich in eine andere Welt. In eine, in der es nicht nur diesen einen Tag gibt, der ein Leben für immer verändert. Nein, in Hermanns Leben ist jeder Tag ein solcher Tag. Zumindest wenn er an diesem Tag Dienst hat. Wo er auftaucht, zerteilt sich die Zeit der Menschen, die ihm begegnen, in zwei Hälften: in die eine, bevor sie ihn kennenlernten. Und in jene, nachdem sie ihn trafen. Nur eines ist dabei sicher: Dass nichts bleibt, wie es war, wenn er da war.
Deswegen beginnt dieses Buch mit Hermann und führt in seine Wirklichkeit, die so anders ist als unsere. Die aber real ist, weil sie sich immer und andauernd um uns herum ereignet. Auch wenn wir sie noch so scheuen. Diese Welt kommt nicht in den Schlagzeilen vor. Wohl aber in diesem Kapitel. Ich finde, es wird Zeit dafür. Denn irgendwann in unseren Leben werden wir einen Ausschnitt aus Hermanns Welt womöglich selbst erleben, eine Rolle in ihr übernehmen. Meist gegen unseren Willen.
Gleich wird es so weit sein. Dann werden wir eintreten ins Wohnzimmer der Mutter, die ihre Tochter verloren hat. Noch stehen wir vor dem Mietshaus und schauen hinauf in die kleine, vermeintlich heile Welt hinter gerüschten Gardinen. Gleich müssen wir den Schrecken in dieses Idyll von München bringen.
Hermann tut das nicht zaghaft, nicht schleichend, sondern mit festem Schritt und noch festerer Stimme. Er bleibt standfest, wenn er auch noch so gütig und gutmütig aussieht und gleich wie ein alter Freund im Türrahmen stehen wird. Von seiner kantigen und wuchtigen Gestalt ist er eine Art Gegengewicht zu all dem Grauen, dem er sich stellt.
Dieser Mann wirkt nicht so, schon gar nicht mit seinem lieben Blick aus blauen Augen, seiner Meckifrisur und seinem weißen Bart. Aber wenn er irgendwo erscheint, setzt die Zeit aus. Sie liegt dann zerbrochen, zerstört oder zumindest angeknackst und verformt vor einem. Und man denkt an eine dieser Uhren, die Salvador Dalí sein Leben lang gemalt hat. Die so aussehen, als fielen die Zeiger aus ihren Zifferblättern, als zerfließe ihr Metall. Bis es auf den Boden seiner Bilder tropft wie Tränen.
Wenn Hermann irgendwo ankommt und wieder mal vor einer dieser Türen steht, hört hinter ihnen eine Zeit auf zu sein. Und mit ihr meist ein ganzes bisher schön und gut, vielleicht aber auch bloß recht und schlecht gelebtes Leben.
Genau dorthin nimmt mich Hermann mit. Ich steige zu ihm in sein Kriseninterventions-Mobil. Eine Art Krankenwagen, nur dass in seinem Inneren niemand verbunden, geschient oder reanimiert wird. Trotzdem hat dieses Mobil Blaulichter auf seinem Dach. Jene der neuesten Generation. Stroboskopartig stechen sie ins Dunkel. Wenn Hermann sie einschaltet mitten in der Nacht, tauchen sie ganze Häuserreihen in einen kalten Schein. Eine Art Dauerblitzlicht durchzuckt dann jeden Meter, den er zu seinem nächsten Einsatzort eilt, und schlägt taghelle Schneisen in das Schwarz.
Mit diesem Licht auf dem Dach seines Mobils fuhr ich mit ihm durch die Nächte. Ich tauschte mein geregeltes Dasein noch einmal gegen eine Praktikantenstelle. Ich hospitierte als sein Assistent. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), in dessen Namen Hermann unterwegs ist und der das KIT, das ausschließlich von Spenden lebt, organisiert, prüfte mich dafür wie bei einem Vorstellungsgespräch. Die Frauen und Männer vom ASB ließen mich schließlich auch deswegen mitfahren, weil ich vor meinem Studium als Rettungssanitäter im Einsatz war. Die meisten KITler üben einen ganz normalen Vollzeitjob aus, haben aber ursprünglich eine Ausbildung zum Sanitäter, zur Ärztin oder zum Feuerwehrmann gemacht oder waren beim Technischen Hilfswerk.
Und dann staffierte mich Hermann mit der gleichen Uniform aus, die er trug. Blaue feuerfeste Hose, weißes Poloshirt und eine signalrote und ebenfalls flammenabweisende Jacke mit dem Emblem des ASB und der Aufschrift »Krisen-Interventions-Team«. Die Lettern auf Brust und Rücken reflektieren und blinken schon im Halbdunkel hell.
Ein Anzug, der jeden KIT-Helfer schützen soll, wenn er dorthin geht, wo es wehtut. Er soll ihn gegen das Blut, den Rauch und die Flammen wappnen, wenn er als einer der Ersten hilft, oft nach einem schrecklichen Unfall.
Wenn ich mich in diese Uniform zwang, fühlte es sich an, als hätte ich eine Rüstung angelegt. »Die brauchst du auch für das, was wir erleben werden«, sagte Hermann und schickte seinen Worten ein väterliches Lächeln hinterher.
Mit diesen Sachen im Gepäck verließ ich meine Wohnung in München und zog bei Hermann und seiner Frau Eveline ein. Ich schlief im alten Kinderzimmer ihrer Tochter, in dem Hermann jetzt lauter Feuerwehr-Miniaturautos geparkt hat, stolz und ordentlich in den Regalen und auf dem Fenstersims.
Denn Hermann ist das, was wir Knirpse damals alle werden wollten, bevor unsere Träume bald schon nicht mehr so sehr brannten. Er ist ausgebildeter Feuerwehrmann und bis heute stolz darauf. Sein Handy steckt er in eine Schutzhülle, die aus einem Feuerwehrschlauch gemacht ist.
Der Mann ist aber schon lange kein Brandbekämpfer mehr im direkten Sinne. Aber bis heute löscht Hermann Feuer, zumindest versucht er es. Die vielen, die losbrennen in den Seelen, wenn das Schicksal nicht gütig ist, sondern wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Als hätte jemand Unsichtbares einen Molotowcocktail in unser Innerstes geschleudert. Wenn die Not also am größten ist, dann kommt Hermann.
Wir tun im Leben gerne so, als geschähen solche Katastrophen nur in den Krimis und Dokus im Fernsehen, in den schlechten Nachrichten oder weit entfernt auf der Welt. Besonders häufig erleben wir sie durch Hörensagen. Doch dann ereignen sie sich irgendwann in unserer Nähe. Vielleicht sogar in unserem Stadtteil, in unserem Viertel, selten, aber mit einiger Sicherheit dann in unserer Straße oder gar nebenan … Und doch, so hoffen wir noch immer, nie bei uns. Was für ein Irrtum.
Hermann stellt sich dem Schmerz. Wenn er jetzt an dieser Tür klingelt, wird es kein Zurück geben. Er pendelt vor und zurück und schiebt das Schicksal noch für ein paar Sekunden auf. Es kostet Überwindung, auch nach all den Jahren.
Unsere Blicke fallen auf die Klingelknöpfe. Ich knipse meine Handy-Taschenlampe an. Der Lichtschein tastet die Namen ab. Dann läutet Hermann. Einmal, zweimal, dreimal. Im ersten Stock geht das Licht an. Es wirft einen Schein ins Dunkel vor der Tür. Hinter den Gardinen taucht der Schattenriss einer Frau auf. Nur ein paar Sekunden noch lebt sie in ihrem alten Leben.
Vor dem Haus der Mutter reckt Hermann seinen Brustkorb. Er will gefasst wirken. Und doch nimmt es auch ihm nun den Atem.
Er wird gleich das Unsagbare sagen müssen. Er wird der Mutter gegenüberstehen. Sie wird ihn anschauen aus großen Augen. Und mitten in ihre Ahnungslosigkeit hinein wird er der Mutter sagen: »Es tut uns sehr leid, aber Ihre Tochter lebt nicht mehr.«
Der Türöffner summt. Hermann muss das Grauen in den ersten Stock tragen, ich darf mich als Praktikant an seiner breitschultrigen Seite wenigstens ein wenig wegducken. Noch. Wir stapfen die Stufen hoch.
Die Wohnungstür öffnet sich, im Türspalt erscheint das Gesicht der Mutter. Hermann und ich gehen auf sie zu. Hermann wirkt auf mich erstaunlich leicht, fast hat er nun etwas Schwebendes an sich, während mir jeder meiner Schritte tonnenschwer erscheint. Die Dame bewegt sich zaghaft, sie hat etwas Durchscheinendes. »Ja, was ist denn?«, fragt sie leise.
Eigentlich hat Hermann eine freundliche Brummbärstimme, doch im Einsatz legt er sich eine professionelle Tonlage zu. Wie es ein Arzt bei einer schlimmen Diagnose tut. Noch im Flur sagt Saur den Satz, den man schon so oft in Fernsehkrimis gehört hat. Er spricht ihn bedächtig, aber auch erstaunlich unumwunden aus: »Es tut mir sehr leid, aber Ihre Tochter lebt nicht mehr.« Die Frau im Türrahmen erstarrt. Hermann setzt nach und fragt: »Dürfen wir reinkommen?«
Die Mutter bleibt in ihrer Starre. Sie steht da im Flur, ihr Mund will sich zu einem Schrei öffnen, doch der Ruf erstirbt. Sie öffnet ihn ein zweites, ein drittes Mal, bis ein fast lautloses »Nein« hervorbricht. Das gilt nicht Hermanns letzter Frage, sondern es ist ein ungläubiges »Nein«. Immer wieder ein »Nein«, ein in zwei Silben erstickendes »Nei-ein«.
Die kleine Wohnung der 68-jährigen Frau zeugt von Armut, im Wohnzimmer stehen abgewetzte Möbel, der Teppichboden ist zerschlissen. Im Flur hängt ein Bild von Dürers »Betenden Händen«. Die Frau blickt erst auf die Hände an der Wand, dann auf ihre eigenen, zitternden und versucht, sie zu falten.
Hermann Saur nimmt ihre rechte Hand und hält sie. Der Blick der Mutter fleht ihn an: »Was soll ich denn nun machen? Wo ist denn jetzt mein Mädchen?« In Hermann Saurs Gesicht stehen Mitgefühl und eine Spur des Schreckens. Er wendet sich mit seiner ganzen Statur der Frau zu. Er behütet mit seiner Gestalt.
Sein Blick weicht nicht aus. Er wird der Dame nicht alles erzählen, was er von den Polizisten weiß. Dass ihre Tochter vor wenigen Stunden aus der Psychiatrie rannte, dass sie zum U-Bahnhof Marienplatz hetzte, dass sie dort am Bahnsteig wartete, bis sie das Licht im Tunnel sah. Dass sie dann auf das Gleis sprang.
Hermann sieht dem Schmerz in seine Augen. Und das niemals nur im übertragenen Sinn. Sondern immer real, immer hautnah: wenn er den Menschen gegenübersteht. Er hält ihren Blicken stand, wenn er das Unaussprechliche ausspricht. Er sieht in Augen, die sich vor ihm voller Unglaube und Entsetzen weiten und in denen dann etwas bricht.
Ganz wichtig, so erklärt er mir nach dem Einsatz, sei es, den einen schlimmen Satz der Todesnachricht möglichst schlicht und schnell auszusprechen, ohne ihn zu verzögern oder zu verschleiern. »Denn ich versetze meinem Gegenüber ja in diesem Moment einen Schlag.« Je zielgerichteter und zügiger dieser Schlag kommt, je deutlicher er also die Katastrophe mitteilt, desto eher erspart er dem Empfänger, weiter in diesem Nebel auszuharren.
Hermann hat schon Polizisten neben sich erlebt, denen genau das schwerfiel. Die den Hinterbliebenen schützen wollten. Die mit »Sie müssen jetzt ganz stark sein!« anfingen, dann mit »Wollen Sie sich nicht erst einmal setzen?« und dann mit »Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?« weitermachten. Genau dieses gut gemeinte Hinauszögern der Nachricht sei es, das das Leid verlängere und sogar Aggressionen auslöse oder verstärke. Hermann muss direkt aussprechen, was passiert ist. Wenn er auf Umwegen davon erzählen würde, wäre das noch viel quälender.
»Denn der Mensch will wissen, was passiert ist. Oft hofft er doch schon seit Stunden auf eine erlösende Nachricht seines Partners oder Kindes, vergeblich. Er schreit nach der Wahrheit«, erklärt Hermann. Allein schon, dass Hermann mitten am Tag oder in der Nacht irgendwo in einem Treppenhaus erscheint in seiner Uniform, ist ja ein Teil der Schreckensnachricht.
Viele Menschen werden diesen Moment vielleicht einmal, vielleicht sogar mehrmals im Leben erleiden: den Schmerz, der zusticht, der einen umhaut, der einen fast erwürgt oder der einen benommen zurücklässt, wenn man einen lieben Menschen plötzlich verliert. Saur kennt ihn in all seinen Schattierungen. Wie ein Polarmensch, der in seiner Sprache mit den vielfältigsten Namen für Schnee-Arten vertraut ist, weiß Saur um die Bandbreite der Ausdrucksweisen für Schmerz: »Sie geht von einer brutal emotionalen Reaktion, also von Menschen, die laut weinend aufschreien, bis zum anderen Ende der Möglichkeiten. Dann steht ein total erstarrter Mensch vor mir. Das ist jener Typus, der glaubt, dass mit dem Leben des soeben gestorbenen Menschen auch seines zu Ende geht«, sagt Saur.
Und oft liege in den Sekundenbruchteilen zwischen dem Öffnen der Tür und seinem Satz die kurze Hoffnung, dieser Fremde da in Uniform möge jetzt bitte nur eines sagen: dass der Mann, die Frau oder das Kind bloß schwer verletzt sind. Und nicht tot.
Die Mutter im Flur fragt Saur nun immer wieder: »Wo ist denn mein Madel jetzt? Kommt sie denn nun nicht mehr heim zu mir?«
Hermann Saur schüttelt den Kopf. »Ihre Tochter ist nun in der Rechtsmedizin«, sagt er und legt Wärme in den Satz, der kalt, der aber die Wahrheit ist. »Ich darf nichts beschönigen«, erklärt Saur später. In den Augen der Mutter sammeln sich Tränen. »Warum muss ich das noch erleben?«, fragt sie. Saur erwidert: »Es gibt keine Antwort. Vielleicht, weil Ihre Tochter unter Depressionen litt, und es keinen Ausweg für sie gab.« Während Hermann mit der Mutter nun bespricht, wie es weitergehen soll, koche ich einen Kakao in der Küche, den hat sie sich gerade gewünscht, als ich sie fragte, ob sie etwas trinken möchte.
Dann sitzen wir am Wohnzimmertisch und hören der Mutter zu. Sie spricht viel von ihrer Tochter, als diese ein Kind war. Dann deutet sie auf die silbergerahmten Erinnerungen auf ihrer Kommode. »Sie war doch ein fröhliches Kind«, sagt sie, »aber nach der Pubertät veränderte sie sich immer mehr. Da war diese Traurigkeit in ihr. Die hab ich versucht zu trösten, wie man das nun mal so macht als Mutter.« Bis dieser Trost die Tochter irgendwann nicht mehr erreichte. Und sie tiefer und tiefer im Schwarz ihrer Depression verschwand. Unerreichbar selbst für die Mutter.
Ich überwinde mich jetzt und überreiche der Mutter die Tüte mit der letzten Habe ihrer Tochter. Hermann hatte mich dazu vorher ermutigt. Die Mutter sieht die Sachen und fällt in sich zusammen. Erst jetzt scheint die Nachricht bei ihr mit aller Macht angekommen zu sein. Hermann Saur nimmt die rechte Hand der Mutter und hält sie. Einer mit weniger Erfahrung würde jetzt vielleicht auf die Mutter einreden. Bloß nicht diese Stille ertragen wollen, in die das Weinen der Mutter dringt. Aber Saur schweigt. Er sitzt neben der Fremden wie ein Freund, der nichts zu sagen braucht.
»Die meisten stürzen in einen Zustand der Dissoziation«, wird mir Hermann später erläutern, »mental reißt es sie auseinander. In Menschen, die mit einer plötzlichen Todesnachricht konfrontiert werden, laufen Überlebensprogramme ab: Kämpfen, fliehen oder erstarren.« Wenn das passiert, versucht Saur, dieses Notprogramm der Psyche zu stoppen. Deshalb ermutigt er jetzt die Mutter, die noch zögert, ihren Sohn anzurufen, aus ihrer Ohnmacht herauszutreten und zu handeln: »Ja, rufen Sie jetzt Ihren Sohn an und erzählen Sie ihm, dass seine Schwester tot ist!«
Später erklärt mir Hermann, was in der dissoziativen Frau in diesen Momenten vorging: »Was normalerweise zusammengehört, nämlich das Gefühl und der Verstand, spaltet sich auf. Ganz tief in sich spürt der Empfänger einer Todesnachricht: ›Jetzt ist alles aus!‹ Doch solange er mit seinem Verstand auswandert, ist es noch zu ertragen.« Ein psychologischer Fluchtreflex vor der Realität befalle die Hinterbliebenen.
Das Angstzentrum im menschlichen Gehirn, die Amygdala, beherrscht nun unser Tun. Ein Naturreflex. »Der Puls beschleunigt sich, die Muskeln aktivieren sich wie unter Lebensgefahr.« Einigen Angehörigen fällt in diesem Zustand oft nicht einmal mehr die Nummer des Notrufs ein. In genau diesen Minuten versucht Hermann, ein Setting zu schaffen, damit dieses Notprogramm in den Menschen stoppt. Weil man so nicht leben kann. In der ersten Stunde, nachdem er die Todesnachricht übermittelt hat, hilft er, dass wieder der Verstand einsetzt und die Angehörigen verstehen können, was geschehen ist.
»Beim nächsten Schritt ist es dann ganz wichtig, die Klappe zu halten«, sagt Hermann. »Und stattdessen nur abzuwarten und zu hören und zu fühlen, was der Hinterbliebene jetzt genau braucht.« Und wenn er in diesem Moment voll ohnmächtiger Wut mit seinen Fäusten auf Hermanns Brust schlagen will, dann erlaubt ihm Hermann auch das. Oder er hört ihm zu, wie er immer und immer wieder laut schreit.
Hermann lässt den anderen sein. Eine Kunst, den anderen so sein zu lassen und seinen ganz eigenen Umgang mit der Realität auszuhalten. Psychotherapeuten sprechen hier vom Konzept der radikalen Akzeptanz der Umstände. Hermann schafft es, sich abzugrenzen von den vielen Arten und Eigenarten, wie Menschen mit ihrem Leid umgehen. Stattdessen bleibt er bei sich und bietet Halt.
Ich frage ihn, ob sich sein Glaube in all den Jahren verändert hat durch seine Einsätze. Er antwortet: »Je länger ich unterwegs bin in der Intervention, desto abstrahierter glaube ich. Ich stelle mir den lieben Gott nicht mehr im Himmel vor. Aber für mich bleibt es dabei: Jesus hat uns vorgelebt, das Leid auszuhalten.«
Einen Sinn im Leid aber erkennt auch der Christ Hermann nicht: »In meinem Glauben gibt es keine Erklärung dafür. Ich weiß bloß, dass das Schicksal oft falschspielt.«
Da weiß ein Experte keine Antwort und gibt es offen zu. Wie selten ist das geworden in unserer Zeit. Ausnehmend anders, so wie es die gesamte Zeit mit Hermann ist. Sie setzte von Beginn an aus und ging jäher tief als jede andere zuvor in meinem Reporter- und Autorenleben. Schulter an Schulter begaben wir uns auf eine Reise und glitten sofort in lauter Menschenschicksale. Bei einer normalen Recherche dauert das naturgemäß immer Tage, meist sogar Wochen. Bis es so weit ist, bis der andere einen einlässt in sein Leben.
Die trauernde Mutter am Wohnzimmertisch sagt uns jetzt, dass sie ihre Tochter noch einmal sehen will. »Ja, gerne«, antwortet Saur, »es ist wichtig, dass Sie ihren Tod begreifen, auch ganz direkt. Dass Sie Ihre tote Tochter noch einmal berühren.« Und so fahren wir mit der Mutter ins Krankenhaus. Inzwischen ist es drei Uhr morgens. Hermann bringt die Lebenden mit den Toten zusammen, denn das tröstet.
Er befürchtet jetzt, dass die Leiche der Tochter entstellt ist. Deshalb bittet er die Mutter, kurz vor der Tür zum Kühlraum zu warten. Er vergewissert sich, dass nur eine Hand der Tochter, die rechte, die unversehrte, unter dem Tuch hervorschaut. Dann bittet er die Mutter herein. Jedes Mal, wenn sich die Tür zum Kühlraum öffnet, springt die Klimaanlage an und weht einen Eiswind in den gekachelten Raum.
Wieso entscheiden sich Krankenhausbetreiber für ein kaltes Neonlicht in solchen Räumen? Eines, das den Abschied noch kälter macht. Und wieso ist der Raum so gebaut, dass jedes Wort in ihm nachhallt? Und mit ihm jedes Schluchzen wie ein Echo.
Hermann deutet auf die Hand der Tochter. Die Mutter ergreift und streichelt sie. Wir schweigen. Fast eine Stunde lang hält die Mutter die Hand.
Dann lässt sie ihre Tochter los.
Später deutet Hermann, was in diesen Momenten geschah: Das »Fernziel« seiner KIT-Betreuung sei bereits erfolgreich angegangen worden: dass die Mutter in eine »Handlungsfähigkeit zurückkehrt«. Als Hermann in einem Wartezimmer des Krankenhauses ganz leise mit ihr besprach, welche Möglichkeiten der Beisetzung es gibt und welche Arten der psychologischen Betreuung, dann noch, welche Behörden morgen informiert werden müssen, wurde der Mutter vielleicht nicht leichter. Aber ein wenig klarer. Sie begann schon in dieser Nacht, ihre neue Rolle zu begreifen und anzunehmen – dass sie nämlich lebenslänglich mit dem, was geschah, umgehen muss. Dadurch wird sie aus der Passivität und Machtlosigkeit geholt und erhält ein Stück weit mehr »Kontrolle« über die neue Situation zurück.
Es sei ein großer Irrtum, anzunehmen, dass die Mutter nun getröstet sei, sagt Hermann jetzt mit all seiner typischen Selbstdistanz und Reflexion. Ich versuche noch, ihm zu widersprechen. Denn ich war doch gerade dabei und glaubte, dass die Mutter mitten im Leid wieder etwas Land zu sehen schien. Wenigstens eine kleine Insel … »Nein«, hält Hermann dagegen, »wenn ich von solch einer Hinterbliebenen gehe, weiß ich, wie dreckig es ihr weiterhin gehen wird. Aber ich weiß auch, dass sie zumindest ahnt, was die nächsten Schritte sein werden.«
Folgt man Hermanns professionellen Gedanken, gibt es streng genommen also keinen Trost. Aber dank seines Besuchs hoffentlich auch keinen noch tieferen Fall ins Nichts.
Als wir die Mutter wieder nach Hause gefahren haben und allein sind, sagt Hermann zu mir: »Im Angesicht eines solchen Todes muss man nur eines: Aushalten.«
Wenn Hermann Saur von »aushalten« spricht, klingt es eher nach einem »Halten« als nach »aus«. Er besitzt eine große innere Stabilität und die Fähigkeit, sich abzugrenzen, dadurch kann er eine so gute Stütze sein. Und im Anschluss das Geschehene loslassen.
Er umfasst die Menschen, ohne sie zu berühren. Er umarmt sie meistens nicht, aber er hält sie in den haltlosesten Stunden ihres Lebens. Fast unmerklich. Oft, so sagt er, erinnern sich die Hinterbliebenen am Tag danach nicht mehr an ihn, selbst wenn er Stunden mit ihnen verbracht hatte. Weil sie im Schock waren. Weil dieser gestandene Mann etwas wunderbar Leichtes an sich hat. Er erscheint und verschwindet wieder.
Vorher aber taucht er in Schicksale ein wie Turmspringer ins Wasserbecken. Aus dem Stand heraus, kopfüber, im freien Fall. Mit dem einen Unterschied, dass er von dort aus dann nicht nur ein paar Meter, sondern gleich in jene Gefilde menschlicher Abgründe sinkt, die Tiefseetauchern vorbehalten sind.
Dieser Vergleich kommt mir in den Sinn, als wir wieder allein im Bus sitzen, und so erzähle ich Hermann davon. Er hebt seine Brauen, freut sich und antwortet: »Da fällt mir ein Witz ein, kennst du den? Treffen sich zwei Apnoe-Taucher. Sagt der eine zum anderen: ›Jetzt halt mal die Luft an.‹«
Wie gut tut es, jetzt ganz kurz zu lachen. Man atmet anders weiter. Dann bleiben uns wieder nur zehn oder fünfzehn Minuten Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn. Wo wird das Schicksal diesmal zuschlagen? Tausende Male am Tag kriecht, dringt oder platzt dieser Schmerz irgendwo in ein deutsches Leben. Sei es der Ehemann, den beim Zähneputzen der Herzinfarkt traf. Sei es das Kind, das unter eine Straßenbahn geriet.
Hermann Saur und seine Münchner Kolleginnen und Kollegen sind eine Pioniertruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes. Sie war schon dabei, als die Türme in New York fielen. Damals rief sie das Auswärtige Amt. Durch die vielen internationalen Einsätze hat sich das KIT seit seiner Gründung im Jahr 1994 zum Vorbild für viele ähnliche Teams in ganz Europa entwickelt. Es war dabei, als ein Schüler im April 2002 in Erfurt Amok lief, als der Tsunami im Dezember 2004 fast einer Viertelmillion Menschen den Tod brachte. Hermann war dabei, als die Costa Concordia sank. Als in Paris die ISIS-Attentäter gewütet hatten. Als ein suizidialer Pilot die Germanwings-Maschine an eine Felswand steuerte. Hermann fällt es schwer, von Schlagzeilen-Katastrophen zu erzählen, bei denen er meist dabei war. Weil er einfach nur helfen und nicht Zeuge einer Sensation sein will.
Das KIT München ist pro Jahr fast 1000 Mal im Einsatz und hilft dabei mehr als 2700 Angehörigen. Die Ursachen für die Einsätze lesen sich in der Statistik so: Natürlicher Tod 42 %. Unfälle 27 %. Suizide 14 %. Gewalttaten 5 %. Sonstige 12 %.
Wir sind unterwegs in diesem München, das an guten Tagen so verschont von Unglück und beinahe heil erscheint. Wären da nicht die vielen Türen, vor denen Saur zu stehen kommt und hinter denen nichts mehr heil ist, wenn sie sich öffnen.
Die Notrufzentrale holt ihn herbei. In jeder seiner 24-Stunden-Schichten lernt er drei bis vier Wohnzimmer von innen kennen. Meist ist er mit seinem Kriseninterventions-Transporter wenige Minuten nach einem plötzlichen Tod am Ort der Trauer. Denn die Notärztinnen, Polizisten und Bestatterinnen folgen ihm erst später und haben dafür keine Zeit. Hermann Saur aber hat sie. Dazu ein großes Mitgefühl. Weil der Schmerz so groß ist.
Im letzten Kapitel dieses Buchs wird es ein Wiedersehen mit Hermann geben, und wir werden noch einmal unterwegs sein.
Bis dahin wird Hermann auf sich achtgeben. Alle drei Monate muss er zur Supervision, damit seine eigene Seele nicht taub wird. Und nach jedem Einsatz erstattet er dem Leiter des KIT offiziell Bericht und schätzt dabei auch den Belastungsgrad des Einsatzes ein. Die Helfer wollen so verhindern, dass einer von ihnen selbst zum Hilfsbedürftigen wird. Jenen bei der Mutter wird Saur am nächsten Tag als relativ einfach einstufen. Er sagt mir: »Der Begegnung mit dem Schmerz muss immer ein Moment folgen, in dem ich ihn wieder abgebe. Das geht aber nur, weil es nicht mein eigener ist.«
Genau einen solchen aber trägt er in sich, seitdem er als junger Mann erleben musste, wie seine Mutter über viele Jahre immer weniger wurde, bis sie starb. Und auch, als er sich vor vier Jahren von seinem geliebten Bruder verabschieden musste. »Ich habe mich aber nicht alleine gefühlt in meinem Leid«, sagt er.
Wie Sisyphos kämpft er immer wieder aufs Neue gegen den Schmerz an. Ein Ende ist nicht abzusehn, würde Heinz Rudolf Kunze singen. Uferlos ist das alles. Aber vielleicht muss man sich Sisyphos, der der Sage nach einen schweren Felsbrocken auf einen Berg wälzt, bis der, kaum oben angekommen, immer wieder herunterrollt, als einen glücklichen Mann vorstellen, so wie das der Politiker Franz Müntefering einmal sagte. Die meisten Menschen fürchten sich davor, immer wieder von vorne zu beginnen. Hermann tut es gern, jeden Tag aufs Neue.
Und so ist er genau in dieser scheinbaren Vergeblichkeit ein Vorbild in der modernen Trauerkultur. Sie hat sich sehr verändert.
Bis vor nicht allzu langer Zeit war es eine gängige Annahme in der Psychologie und Traumaforschung, dass ein Mensch nach dem plötzlichen Verlust eines sehr nahen Menschen nur gründlich und tief genug trauern müsse, um dann irgendwann mit dieser Trauer »durch« zu sein, sie quasi bewältigt, mit ihr abgeschlossen zu haben. Um dann wieder offen und frei für neue Beziehungen zu sein. Es galt der schöne Spruch, das man nun darüber hinweg sei.