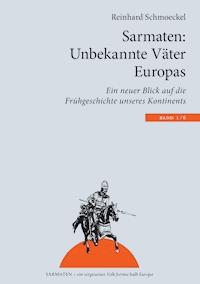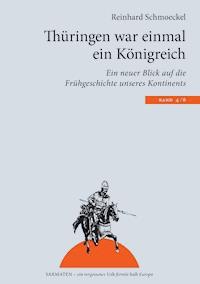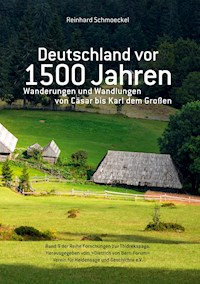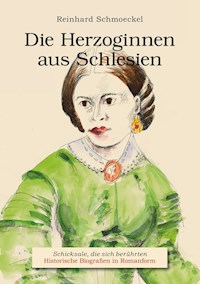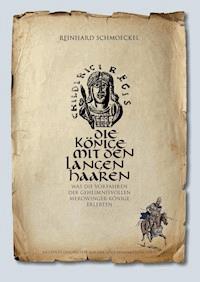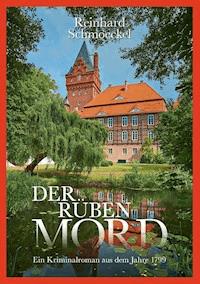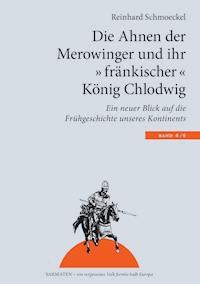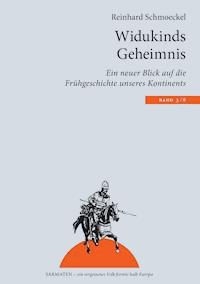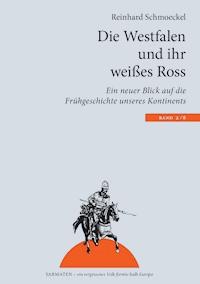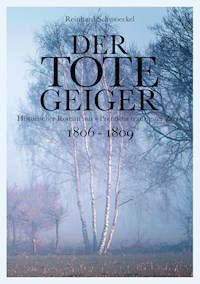
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Krimi, in dem der darin vorkommende Mord nicht aufgeklärt wird (vielleicht versucht sich einmal der Leser selbst daran?), und eine Liebesgeschichte ohne Happyend - was ist das für ein merkwürdiges Buch? Spannend ist es auf jeden Fall und (wie bei Schmoeckel üblich) "zu 90 Prozent Geschichte und nur zu 10 Prozent Phantasie". Preußen nach dem "schrecklichen" Frieden von Tilsit 1807: Verzweiflung, Ärger, Auflehnung gegen die französische Besatzung, Anteilnahme an den Aufständen in benachbarten, direkt unter französischer Herrschaft stehenden, Staaten, aber auch zarte Annäherung zwischen Menschen der verschiedenen Nationen. Der einst gefeierte, später vergessene Zug der Soldaten des Majors von Schill wird verwoben mit einer tragisch endenden Liebesgeschichte und der anschaulichen Schilderung des Lebens auf einem Adelshof in der einstigen preußischen Provinz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1:
„Was ist bloß mit diesem Preußen los?“
(Dezember 1806 – Juni 1807)
Weihnachten - wunderschön und traurig
Schill macht es den Franzosen heiß
Französische Einquartierung
Schlechte Nachrichten aus Ostpreußen, und eine gute aus Magdeburg
Kapitel 2:
Preußen in seiner tiefsten Erniedrigung
(Juli – November 1807)
Frieden - aber die fremde Besatzung bleibt
Ungewisse Zukunft
„Eine überflüssige, ja schädliche Reform“
Neue Besatzer, alte Lasten
Kapitel 3:
Ein Frühjahr mit freudigen Überraschungen
(Februar bis Mai 1808)
Die glückliche Heimkehr der jungen Putlitzens
Ein musikalisches Frühjahr
Ein wunderschöner Maien-Tag
Kapitel 4:
Sommer auf dem Land
(Juni – Oktober 1808)
Im Krug von Pankow
Der Geiger aus Baruth
Heimliche Vorgänge
Im Salon musiziert man, im Stall macht man sich Sorgen
Verdacht
Kapitel 5:
Kann man was gegen die Besatzer tun?
(September – Oktober 1808)
Anzeichen für Risse im „Empire française“
Was klimpernde Münzen alles bewirken können
Vertrauliche Gespräche
Mozart an der Panke
Der Missmut wächst - und zugleich das Misstrauen
Kapitel 6:
Kein Vertrauen mehr auf dem Gut
(November – Dezember 1808
Lauschen und Belauschtwerden
Gefährliche Pläne
Verräter werden gemacht, nicht geboren
Schills triumphalste Stunde
Geheime Informationen, belauscht und wieder belauscht
Kapitel 7:
Ein Mord auf Schloss Pankow
(Ende Dezember 1808 – Januar 1809)
Der Tote an der Doppelbirke
Eine kriminalistische Untersuchung, leider ergebnislos
Ein Weihnachten ohne Musik
Zwei hochgeborene Studenten
Kapitel 8:
Begehren die Völker gegen die Zwangsherrschaft auf?
(März – April 1809)
Die Besatzung zieht ab
Sorgen und Hoffnungen alter Männer
Die verhängnisvollen Briefe
Kapitel 9:
Waren alle Hoffnungen vergeblich?
(April- Mai 1809)
„Die Altmark muss frei werden!“
„Es lebe das Kurfürstentum Hessen-Kassel!“ und was daraus wurde
Ausmarsch wie zum Manöver
Fünf Tage im Jubel-Gefühl
Ein schicksalsträchtiger Kriegsrat
Kapitel 10:
Bis zum bitteren Ende
(Mai 1809)
Schills Zug durch die Altmark
An der Ostseeküste dem Ziel entgegen
Sechs Tage Herr von Stralsund
Der letzte Kampf
Kapitel 11:
Opfer eines grausamen Feindes
(Juni – Oktober 1809)
Das schreckliche Los der Gefangenen
Ein Gewitter
Die letzten Opfer Schills
Eine Witwe, die eigentlich keine war
Vorwort
Die traurigste Zeit Preußens, jenes inzwischen schon fast legendären Königreichs im Norden Deutschlands, das waren wohl die Jahre zwischen 1806 und 1810.
Unter einem König, der wenig von der Staatskunst und dem Charisma seines Großonkels Friedrich dem Großen geerbt hatte, war Preußen im Jahr 1806 in einen Krieg mit dem inzwischen übermächtigen Frankreich hineingestolpert, das unter dem „selbst gebackenen“ Kaiser Napoleon sich anschickte, die Geschicke ganz Europas zu bestimmen.
Diesen Krieg verlor Preußen im Grunde schon wenige Wochen nach dem offiziellen Ausbruch, in zwei Schlachten in Thüringen (bei Jena und Auerstedt, Oktober 1806), obwohl sich der Krieg danach noch einige Monate fortschleppte. Nicht nur der König und seine Familie mussten Hals über Kopf aus der Residenz Berlin flüchten, sondern das taten auch die meisten seiner Truppen, die nach den beiden Schlachten übrig geblieben waren. Preußische Festungen ergaben sich reihenweise selbst kleinen französischen Patrouillen, die vor den Toren auftauchten.
Mit dem Friedensschluss in Tilsit, der nördlichsten Stadt Preußens (im damaligen Ostpreußen), wohin der König schließlich geflüchtet war, verlor das einst so mächtige Königreich im Juli 1807 alle seine Besitzungen westlich der Elbe sowie alle Teile des ehemaligen Polen, die es sich in den Jahren zuvor in Allianz mit Österreich und Russland gesichert hatte. Dazu kam eine für damalige Zeiten kaum vorstellbar hohe Kriegsentschädigung, die es an Frankreich zahlen sollte. Französische Besatzungstruppen überall im Land sollten dafür sorgen, dass diese Gelder auch tatsächlich schnell gezahlt wurden.
Genau in diese Zeit führt der historische Krimi „Der tote Geiger“. Schriftsteller – hier im Gegensatz zu „Historikern“ gemeint – aus Preußen oder allgemein aus Deutschland haben sich wohl selten bemüht, das Geschehen in jenen Jahren genauer aufzuklären und zu beschreiben, im Gegensatz zu der Zeit unmittelbar danach (1810 – 1815), die als „Epoche der preußischen Reformen“ und als „Befreiungskriege“ überschwänglich gelobt wurden, und über die es eine zahlreiche Literatur gibt, auch „schöngeistiger“ Art. Daher existieren heute, 200 Jahre später, nur wenige Quellen für den Geschichtsforscher und für den Autor, der einen historischen Krimi aus der Zeit zwischen 1806 und 1809 schreiben möchte.
„Historischer Krimi“ – das ist eine auf dem deutschen Buchmarkt nicht häufige Bezeichnung, obwohl es viele davon aus den verschiedensten Zeiten gibt. Für den Autor dieses Buches bedeutet sie, dass in ihm mindestens 90 Prozent reale Geschichte und höchstens 10 Prozent Roman enthalten sind. Im Grunde ist das Buch eher ein „historischer Sachroman“, eine lebendige Beschreibung von Zuständen und Vorgängen in unserem Land vor längerer Zeit, eine Art Geschichtsbuch unterhaltsamer Art. Es gibt darin nicht einmal ein „happy end“, sondern entsprechend den tatsächlichen Vorgängen damals ein sehr tragisches Ende.
Historisch ist zum Beispiel die Existenz des uralten brandenburgischen Adelsgeschlechts der Herren Gans Edle zu Putlitz. Sitz eines der verschiedenen Zweige dieses Geschlechts war damals und noch bis 1945 das Schloss (oder der Gutshof) Pankow in der Prignitz (Land Brandenburg). Heute beherbergt das Gebäude eine weithin berühmte Augenklinik. Historisch waren auch die im Buch vorkommenden Angehörigen dieses Adelsgeschlechts, einschließlich ihrer Namen, ihres Alters und ihrer Lebensumstände. Der Autor hat sich nur erlaubt, die Tochter vom ältesten zum jüngsten Kind der Familie zu machen – und ihr eine Liebesbeziehung zu einem jungen preußischen Offizier anzudichten.
Nicht historisch ist allerdings die Verteilung französischer Truppen auf verschiedene große Adelsgüter, etwa in der Prignitz, wie im Buch beschrieben. Die zahlreichen nach dem Krieg 1806/07 in Preußen zurückgebliebenen oder dort neu stationierten französischen Einheiten blieben in Wahrheit lange in preußischen Festungen kaserniert, von Schlesien bis Pommern. Aber das Verhältnis der französischen Soldaten zu den Einwohnern des besetzten Landes, den „Prussiens“, in diesen Jahren hatte wohl viele Seiten, böse und auch sehr persönliche, und um die zu beschreiben, bedurfte es einer „dichterischen Freiheit“.
Jedenfalls wird das in diesem „historischen Roman“ beschriebene Leben der Menschen im Innersten Preußens wahrscheinlich sehr viel realistischer geschildert, als man sich das etwa hundert Jahre später vorstellen wollte, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges und in einer Zeit, als man das „Preußentum“ rund um die „Befreiungskriege“ geradezu in den Himmel hob.
Historisch, und zwar bis in die Einzelheiten, ist dann jedoch wieder der Schluss des Buches, das tragische Ende der Soldaten des „ungestümen Schill“, nur die Verlobung eines der Schill’schen Offiziere mit der Tochter vom Adelssitz der Edlen zu Putlitz ist wieder „dichterische Freiheit“. Auch der Krimi innerhalb des „Sachromans“ ist eine Erfindung des Autors; schließlich sollte das Buch ja auch richtig spannend sein! Aber unwahrscheinlich war eine solche „Spionagegeschichte“ damals keineswegs, wie der Leser erkennen wird.
Wie die Menschen auf dem flachen Land, in der brandenburgischen Prignitz, hundert Kilometer von der Hauptstadt Berlin entfernt, die für den Staat so aufregenden Ereignisse des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit mitbekamen - das hat sowieso nie ein Historiker und vermutlich wohl auch kein „Literat“ beschrieben.
Dies heutigen Lesern verständlich zu erzählen, blieb der Vorstellungskraft des Autors überlassen. Doch die wurde gefördert durch das Wissen über Empfindungen und Verhalten einfacher Menschen in unserem Land vor 500 oder 200 Jahren, das sich durch Forschungen für etliche „historische Sachromane“ aus dem Deutschland zwischen Mittelalter und Neuzeit, gerade auch in der brandenburgischen Prignitz, beim Verfasser angesammelt hat.
Dortmund, im Frühjahr 2020 Reinhard Schmoeckel
Kapitel 1
„Was ist bloß mit diesem Preußen los?“
Dezember 1806 – Juni 1807
Weihnachten – wunderschön und tieftraurig
Schloss Pankow (Prignitz), Weihnachten 1806
Im Salon des Schlosses Pankow hatte man für dieses Weihnachtsfest alles so hergerichtet wie in den früheren Jahren. Der Esstisch war in eine Ecke gerückt, damit für den Tannenbaum Platz wurde. Diese neumodische Erscheinung gab es im Schloss der Edlen zu Putlitz schon seit einigen Jahren; irgendwie war diese Mode aus dem Süden des Reiches 1 bis in den Norden eingewandert. Allerdings konnten sich nur reiche Gutsherren es leisten, eine der seltenen und daher teuren Tannen für diesen sentimentalen Schmuck fällen und in das Haus schleppen zu lassen. Doch nun war der Baum mit Ketten aus buntem Papier und mit an den Zweigen befestigten roten Äpfeln geschmückt. Er zog damit die Blicke jedes Menschen auf sich, der den Raum betrat.
Traditionsgemäß sammelten sich die Herrschaften am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, gegen 6 Uhr abends in diesem Salon, um gemeinsam das höchste Fest der Christenheit zu feiern. Die anderen Feste, Ostern oder Pfingsten, gingen wenigstens den nüchternen Lutheranern hier in der Prignitz nicht so tief in die Seele.
An diesem Weihnachtsabend des Jahre 1806 war allerdings die Familie des Schlossherren stark zusammengeschrumpft. Nur vier Personen konnten an dieser Bescherung teilnehmen. Das waren die Eltern: der Vater Gebhard Gans Edler zu Putlitz, mit seinen 64 Jahren noch immer ein lebhafter und keineswegs seniler Mann, aus dessen Gesicht die Klugheit eines Gelehrten und die Weisheit eines Philosophen leuchtete. Beides war er sein Leben lang gewesen, kein Soldat, wie sonst so viele Adlige im preußischen Königreich. Seine grauen Haare waren nach inzwischen reichlich altmodisch gewordener Sitte zu einem Zopf geflochten.
Neben ihm stand seine Gattin Juliane, zwölf Jahre jünger als ihr Mann und auch als würdige Matrone noch immer ein Abbild der Schönheit, für die sie in ihrer Jugend weithin berühmt gewesen war. Nach der Mode der Zeit trug sie einen weiten Rock, der infolge der darunter getragenen vielen Unterröcke weit vom Leib abstand.
Juliane hieß auch ihre Tochter, die mit ihren 17 Jahren offensichtlich die einstige Schönheit der Mutter geerbt hatte, so reizend sah sie aus mit ihren modischen Ringellocken.
Die beiden älteren Brüder Julianes fehlten an diesem Weihnachtsabend, denn beide waren als junge preußische Offiziere mit ihren Regimentern im Feld. Aber niemand auf Schloss Pankow wusste, ob sie noch lebten und wo sie eventuell steckten.
Einem alten Brauch folgend hatte der Schlossherr von Pankow auch den alten General Wichard von Moellendorf zum Weihnachtsessen eingeladen. Er war als Gutsherr von Gramzow gewissermaßen Nachbar, unverheiratet und alleinstehend, außerdem der Pate der beiden Söhne der Familie zu Putlitz; Mit seinen 82 Jahren benutzte er zwar einen Krückstock zum Gehen, machte aber nicht den Eindruck, dass er schon bald ins Gras beißen würde. Weihnachten gehörte er zur Familie Die junge Juliane nannte ihn „Onkel Wichard“.
Vor dem Beginn des Diners 2 war es am Weihnachtstag bei den Herren zu Putlitz üblich, die gegenseitigen Geschenke zu öffnen, die in kleinen Leinwandbeuteln versteckt unter dem Weihnachtsbaum lagen. Da gab es ein aus Wolle gestricktes buntes Etui für die Brille des Vaters, ein mit Spitzenstickerei verziertes Taschentuch für die Mama und einen mit den Initialen des Eigentümers geschmückten neuen Geldbeutel für Onkel Wichard. Diese Geschenke hatte die Tochter in wochenlanger Arbeit heimlich angefertigt.
Doch das größte Geschenk dieses Weihnachtsfestes stand schon seit einigen Wochen im Salon, bisher dezent unter einem großen Leintuch versteckt. Theoretisch sollte es eine Überraschung für die Tochter Juliane sein, doch wusste diese natürlich längst, was da vor einigen Wochen von einem stabilen Transportwagen mit vier Pferden davor abgeladen und in den Salon getragen worden war. Aber der Brauch der Überraschung musste eingehalten werden.
Als der Vater das Leintuch wegzog, kam ein keineswegs eingeübtes „Oh“ aus dem Munde des jungen Mädchens, und dann eine ehrfürchtige Stille, bis Juliane in ihrer Begeisterung erst dem Vater, dann der Mutter um den Hals fiel. Denn dort stand ein leibhaftiges Pianoforte, wie man neuerdings die Musikinstrumente nannte, die moderne Weiterentwicklung des Cembalo. Es war eines der Instrumente, für die in den letzten Jahrzehnten die berühmten Komponisten Bach und Mozart, Haydn und Beethoven so wunderbare Musik geschrieben hatten.
Musik, erdacht und aufgeschrieben von mehr oder weniger berühmten Komponisten und wiedergegeben von einem kleinen oder sogar größeren Orchester, war seit gut einem Jahrhundert ein unerlässlicher Bestandteil des Zeitvertreibs der guten Gesellschaft an den Höfen der Könige, der Herzöge und Fürsten in ganz Europa. Zahlreiche begüterte Adlige, ja sogar wohlhabende Bürgerliche taten es ihnen nach. Mit dem Pianoforte von dem bekannten Instrumentenbauer Ibach aus dem Bergischen Land 3 hatten nun auch in Schloss Pankow mitten in der angeblich so kulturfernen Mark Brandenburg die schönen Künste Einzug gehalten.
Schuld daran war die junge Juliane zu Putlitz, die sich von Kindheit an für Musik begeisterte und auf einer Querflöte – dem einzigen leicht transportablen und einigermaßen preiswerten Musikinstrument – die an sich für ganz andere Instrumente aufgeschriebenen Noten nachspielte, die sie in den Druckausgaben der berühmten Komponisten fand, soweit sie die in ihrer abgelegenen Gegend bei einer Buchhandlung in Neuruppin bestellen konnte. Schon seit einem Jahr hatte sie ihrem Vater in den Ohren gelegen, ob er nicht auch für Schloss Pankow ein solches neumodisches Instrument anschaffen könne.
Nun stand es da, als Ausdruck der Güte - und auch ein wenig der Wohlhabenheit - des Vaters. Sofort setzte sich die junge Juliane auf einen Hocker vor das Gerät und versuchte zaghaft, ihm die ersten Töne zu entlocken. Wie die weißen und schwarzen Tasten angeschlagen werden mussten, wusste sie aus ihren theoretischen Studien recht gut, aber sie hatte natürlich nicht die geringste Übung. Das würde sich sicher in den nächsten Wochen ändern.
Schließlich aber fiel Juliane ein, dass ja der Bescherung das festliche Diner folgen musste. Seufzend stand sie auf, zog ihre Eltern zur großen Tafel und führte sie zu den angestammten Sitzplätzen. „Was ist das für ein schönes Weihnachten, liebe Eltern“, rief sie aus, „mit diesem wunderbaren Geschenk!“
Doch als Juliane auch ihren üblichen Platz einnahm und dabei die Stühle frei ließ, wo nach dem Familien-Herkommen ihre Brüder zu sitzen hatten, entfuhr ihr der Seufzer: „und was ist das zugleich für ein trauriger Tag, ohne meine Brüder!“
Diese Erwähnung lenkte die Erinnerung aller Festgäste auf die Ereignisse der jüngsten Zeit in der großen weiten Welt, so weit weg vom abgelegenen Schloss Pankow in der brandenburgischen Prignitz - - und dennoch mit so unmittelbaren Einfluss auf das Leben dort.
Insgeheim dachte Juliane von Putlitz nicht nur an ihre Brüder, sondern vor allem an einen jungen Sekondeleutnant Albert von Wedell, den sie im Frühjahr bei einem Fest auf Schloss Wolfshagen bei den Schwerins kennen gelernt hatte. Er war irgendwie mit dieser in ganz Brandenburg verbreiteten Adelsfamilie entfernt verwandt, sie selbst auch.
Das hatte ihr im Frühjahr dieses Jahres die Einladung zu einer der berühmten „Wolfshagener Soirées“ eingetragen, einem Wochenende mit musikalischen Vorführungen, einem in der Mark Brandenburg außerordentlich seltenen Ereignis. Von daher stammte die Begeisterung Julianes für die Musik, aber auch für den hübschen jungen Wedell, in den sich der Backfisch 4 prompt verliebt hatte – und umgekehrt auch. Beide hatten sich damals in einer zärtlichen Stunde versprochen, sich offiziell zu verloben, wenn Albert im kommenden Jahr sich auf Schloss Pankow einfinden werde, um, wie es sich gehörte, die Einwilligung der Eltern einzuholen. Aber zu diesem versprochenen Besuch war es in diesem Jahr nicht gekommen, und daran waren die politischen Ereignisse schuld.
Als die Suppe aufgetragen war und alle die köstliche Rinderbouillon löffelten, nahm Vater Gebhard das Wort, wie es ihm als Familienoberhaupt zustand. „Was ist nur mit diesem Preußen los? Bereits die ersten Schlachten, die es in diesem Krieg geführt hat, waren vernichtende Niederlagen 5 . Inzwischen ist der König und seine Familie aus Berlin geflüchtet, bis nach Ostpreußen, wie man hört, und die Franzosen sind ihm dicht auf den Fersen, haben Berlin besetzt und rücken nach Pommern vor. Und von unsern Söhnen, die ihrem König als junge Offiziere dienen, haben wir seit Monaten nichts gehört.“
Das Verhältnis der uralten brandenburgischen Adelsfamilie der Gans Edle zu Putlitz zu den Kurfürsten von Brandenburg und späteren preußischen Königen war von jeher etwas kompliziert. Einst, vor 600 Jahren, war ein Adliger mit dem seltsamen Familiennamen „Gans“ an der Spitze einer größeren Gruppe von Bauern aus dem südlichen Holstein in die Gegend der Wenden östlich der Elbe gezogen, als es darum ging, die dortigen Heiden zu Christen zu machen - - und natürlich den deutschen Bauern und ihren adligen Anführern neues fruchtbares Land zu verschaffen.
Im Örtchen Putlitz im nördlichen Brandenburg hatten die Nachkommen dieses Gründervaters eine erste Burg gebaut und nannten sich danach „Gans Edle zu Putlitz“. Aber anders als vielen einflussreichen Adelsfamilien im Westen des „Heiligen Römischen Reiches“, wie etwa den Edelherrn zur Lippe oder Waldeck, gelang es den Edelherren zu Putlitz in Brandenburg nie, vom Kaiser verliehene Titel wie „Graf“ oder „Fürst“ zu erhalten; die später aus ihnen souveräne Landesherren machten.
Stattdessen setzte ihnen Anno 1415 der Kaiser einen landfremden Günstling, einen Grafen Friedrich von Hohenzollern und Burggrafen von Nürnberg, als Kurfürst vor die Nase, der sofort auch die faktische Oberhoheit über die vielen Adligen in Brandenburg beanspruchte. Zu dem und zu den meisten seiner Nachkommen behielten die Edlen zu Putlitz fast immer kritische Distanz, wenn auch offene Feindschaft nur in den ersten Jahren des neuen Kurfürsten zutage trat.
Selten oder nie hatten Angehörige der Familie derer Gans Edle zu Putlitz Dienste unmittelbar am Hof der Kurfürsten und später der preußischen Könige verrichtet, wie es ihrem hohen Rang zugestanden hätte. Aber immerhin hatten junge Leute aus der inzwischen in viele Zweige verbreiteten Familie als Offiziere in der preußischen Armee gedient, so auch die beiden Söhne Gebhards.
Der pensionierte General Wichard von Moellendorf zeigte sich trotz seines hohen Alters erstaunlich gut über die Ereignisse des letzten Jahres informiert, er bestritt daher mit Gebhard die Unterhaltung an diesem Weihnachts-Diner auf Schloss Pankow, während die beiden Damen schweigend, aber interessiert zuhörten.
Es war nicht leicht, aus den vielen Gerüchten – oder zutreffenden Berichten? – der letzten Monate den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse in Europa zusammenzusetzen, hier in der abgelegenen Prignitz in Nordwesten der Mark Brandenburg, weitab von der Hauptstadt Berlin und ohne jede wirklich verlässliche Information. Doch das war ja auch in allen früheren Jahrhunderten nicht anders gewesen, also nichts Ungewöhnliches.
Der alte Moellendorf liebte es, mit seinem großen Wissen über die Weltgeschichte zu protzen, wenn er, der Junggeselle, einmal Zuhörer fand. Das war auf jeden Fall zu Weihnachten gegeben, wenn er bei den Putlitzens eingeladen war. Die Familie des Schlossherrn auf Pankow hörte ihm auch gerne zu, denn auch wenn die Vorträge des Gastes meist ziemlich lang waren, so waren sie doch nicht langweilig.
„Anno 1792 hat Preußen schon einmal einen Krieg gegen Frankreich geführt 6 , Sie erinnern sich, liebe Freunde? Damals hatten die Sanscoulotten 7 in Frankreich ihren von Gott gegebenen König erst entmachtet und dann hingerichtet, sogar die Königin! Leider hat der Kampf der Preußen, der Österreicher und der Reichstruppen gegen das aufständische Gesindel nicht viel erbracht. In den Jahren darauf haben die Franzosen sogar alles Reichsgebiet links des Rheins besetzt und annektiert. Auch wir Preußen haben damals schon einige kleinere Gebiete verloren, die jenseits des Rheins lagen. Aber wir bekamen Ersatz im Osten, weil die Polen große Gebiete an uns und an Russland abtreten mussten. Seitdem hat Preußen einen direkten Zugang nach Ostpreußen, das man vorher nur über polnisches Gebiet erreichen konnte.“ 8.
Der alte General legte den Löffel beiseite, als er seine Suppe aufgegessen hatte und zwirbelte gewohnheitsmäßig die langen Spitzen seines Schnurrbartes. Die Unterbrechung seines Vortrags war auch sinnvoll, denn nun trug der Leibdiener Georg, genannt Gurgen, mit würdevoller Miene die große Platte mit einer gut gebratenen Gans auf, dem traditionellen Weihnachtsessen auf Schloss Pankow. Zur Tradition gehörte es auch, dass die Familie mit Rufen wie „Was für eine schöne Gans“ das Festessen begrüßte. Während sich der Hausherr wie üblich daran machte, den großen Vogel kunstgerecht zu tranchieren 9 , schien dem alten Moellendorf eine Fortsetzung seines Vortrages über die gegenwärtigen schlimmen Zeitläufte angemessen.
„Wissen Sie, liebe Putlitzens, was um uns herum in den letzten Jahren in Europa passiert ist? Ich muss zugeben, dass ich da auch den Überblick verloren habe. Immer war da eigentlich Krieg, aber wir Preußen waren daran bisher nie beteiligt. In Frankreich muss irgendwann ein Mann namens Bonaparte an die Macht gekommen sein, erst als General, dann als sogenannter ‚erster Konsul’ und schließlich seit zwei Jahren, glaube ich, als Kaiser. Denken Sie, liebe Putlitzens, er hat sich selbst die Kaiserkrone aufgesetzt!“
„Das hat der Hohenzollern-Kurfürst Friedrich I. auch getan, lieber Moellendorf, als er sich Anno 1701 in Königsberg die Königskrone auf den Kopf hob!“ unterbrach Gebhard von Putlitz den Monolog des Generals, vielleicht mit einem etwas despektierlichen Ton in der Stimme. Die Ehrfurcht der Familie zu Putlitz vor den Hohenzollern-Königen hielt sich noch immer in Grenzen.
„Na ja, wie dem auch sei,“ setzte General von Moellendorf seinen Vortrag fort, „jedenfalls hat fast ständig Österreich gegen Frankreich Krieg geführt, meist irgendwo in Süddeutschland, denn dem Franzosen war es gelungen, die Herrschaften in Bayern und Baden und in Württemberg auf seine Seite zu ziehen. Zum Schluss stand zwar Russland auf Österreichs Seite, da haben Russen in der Schweiz und in Oberitalien gegen Franzosen gekämpft. Wie sie da hin gekommen sind, weiß ich auch nicht. Und im vorigen Jahr haben die drei Kaiser irgendwo in Böhmen gegeneinander gekämpft. Bei Austerlitz gab es eine Schlacht 10, die die Kaiser von Österreich und Russland trotz ihrer Allianz gegen den Kaiser Napoleon verloren haben, so lässt dieser Kerl sich jetzt nennen. Österreich musste danach Frieden mit Frankreich schließen.“
„Ach, lieber Onkel Wichard,“ meldete sich die Tochter Juliane zu Wort, „wissen Sie denn auch, wie nun unser Königreich Preußen in den Krieg gegen Frankreich kam?“ Ihr Interesse an Dingen, die nach seiner Meinung Frauen nichts angingen, war dem alten General fast ein wenig unheimlich, aber er antwortete sachlich: „Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ich weiß da selbst viel zu wenig darüber. Was da an Demarchen 11 zwischen Berlin und Paris hin und her gegangen sind, ist ja sowieso geheim, und das Wenige, was man veröffentlicht hat, habe ich ja auch nur durch Gerüchte und durch Zufall erfahren.“
Für ein paar Minuten beschäftigten sich alle schweigend mit den Gänsekeulen und -brüsten auf ihren Tellern, dann fuhr der alte Soldat fort. „Ich meine, irgendwie hat der Kriegsaubruch gegen Frankreich etwas mit dem Kurfürstentum Hannover zu tun, das ja, wie Sie sicher wissen, vom englischen König in London regiert wird, der zugleich Kurfürst von Hannover ist. Frankreich hatte das Gebiet schon seit mehr als einem Jahr besetzt, aber ich glaube, es hat dieses Land Hannover dem preußischen König angeboten, sicher um das bisherige Bündnis Preußens mit England zu hintertreiben. Was da zwischen den Höfen in Berlin, London und Paris hin und her gespielt worden ist, davon weiß ich nichts, am Ende aber hat Preußen den Franzosen den Krieg erklärt und war auf einmal wieder mit den Engländern verbündet.“
„Wann ist der Krieg denn eigentlich ausge-brochen?“ fragte die neugierige junge Juliane. „Das muss Ende August diesen Jahres passiert sein“, gab der alte Moellendorf Auskunft, „aber wie immer dauerte es lange, bis die gegnerischen Armeen so weit marschiert waren, dass sie sich zur Schacht gegenüberstellen konnten. Die Franzosen hatten viele Truppen bereits in Bayern stehen, denn der neugebackene König in München ist eng mit Napoleon verbündet. Von Bayern aus sind die Franzosen wohl nach Norden marschiert. So kam es wohl, dass im Oktober im nördlichen Thüringen zwei Schlachten am gleichen Tage ausgetragen wurden.“
General von Moellendorf legte Messer und Gabel beiseite und stützte mit einer Geste der Verzweiflung sein Gesicht in beide Hände. „Leider Gottes muss ich Ihnen berichten, dass beide von den Preußen und ihren Verbündeten, den Sachsen, verloren wurden 12. Seitdem scheint die einst so ruhmreiche preußische Armee auf der Flucht vor den Franzosen zu sein, immer nach Norden, bis nach Pommern und Ostpreußen. Bereits Ende Oktober ist der Kaiser Napoleon an der Spitze seiner Truppen in Berlin eingezogen. Unser König und seine Familie sind gerade noch rechtzeitig geflohen, wahrscheinlich halten sie sich jetzt in Ostpreußen auf.“
„Haben Sie eine Ahnung, lieber Moellendorf, wo der General von Ruechel gekämpft hat?“ fragte Gebhard zu Putlitz. „Unsere beiden Söhne stehen bei Regimentern, die meines Wissens diesem Befehlshaber unterstellt waren.“
„Das weiß ich leider nicht,“ musste der sonst so gut informierte alte Soldat gestehen. „Aber wer als Soldat die Schlachten überlebt hat und nicht getötet, verwundet oder gefangen genommen wurde, der ist jetzt auf der Flucht in die nördlichsten Teile Preußens. Wenn ich den Gerüchten glauben soll, dann muss ich mich für meine Offizierskameraden schämen. Denn reihenweise haben preußische Festungen vor zum Teil nur kleinen französischen Streifscharen kapituliert, die vor deren Toren erschienen sind.“
„Wie ist das möglich, Moellendorf „ fragte Gebhard von Putlitz erregt, „was ist aus der ruhmreichen preußischen Armee geworden?“
„Zu einem kleinen Teil kann ich das beantworten“, gab der alte General zu. „Unter anderem liegt das an der preußischen Pensionskasse für Offiziere. Es gibt im preußischen Etat 13 eine solche Kasse, aus der wegen ihres Alters aus dem Dienst entlassene Offiziere ihre Pension erhalten. Ich selbst bin Anno 1791 noch ganz normal mit 67 Jahren in die Pension geschickt worden und erhalte regelmäßig von dort meine Bezüge. Doch seitdem sind mehrere Dutzend hohe Offiziere in das Pensionsalter vorgerückt, aber das Geld dort reicht nicht, ihnen Pensionen zu zahlen. Also müssen sie im aktiven Dienst bleiben, auch wenn sie inzwischen noch so alt geworden sind. Dafür reicht das Geld, denn das kommt aus einem anderen Etat-Posten im preußischen Staatshaushalt. Ich würde mir allerdings in meinem Alter nicht mehr zutrauen, eine belagerte Festung zu kommandieren, doch meine bedauernswerten Kollegen mussten es tun, zum Teil sind sie noch älter als ich – mit dem Ergebnis, das wir jetzt vor uns sehen!“ 14
Nach einer kurzen Pause fuhr Herr von Moellendorf fort: „Im Übrigen habe ich meine Zweifel, ob die Soldaten in Reih und Glied heutzutage noch so gut gedrillt sind wie zu des großen Friedrichs Zeiten. Schon als ich in Pension ging, war an der Disziplin nach meinem Dafürhalten Manches auszusetzen, und besser geworden ist es damit wohl in den letzten fünfzehn Jahren auch nicht.“
Nach einer langen Gesprächspause, in der alle vier Festgäste schweigend mit dem Genuss der gebratenen und mit Äpfeln gefüllten Gans und dem leckeren Rotkohl beschäftigt waren, ließ sich zum erstenmal auch die Hausfrau hören: „Wo mögen nur meine Söhne sein, Karl und Eduard? Es ist so schrecklich für eine Mutter, nichts über das Schicksal der eigenen Kinder zu wissen!“ Sie zog ein großes Taschentuch aus ihrem Pompadour 15 und putzte sich damit die Nase. „Liebe Frau Juliane,“ versuchte Herr von Moellendorf, für einen alten Soldaten ungewöhnlich mitfühlend, die Gastgeberin zu trösten, „das ist nun aber einmal seit Menschengedenken so, wenn Soldaten für ihren König oder Landesherrn in den Krieg ziehen. Wir müssen uns damit abfinden. Erst wenn Waffenstillstand oder noch besser Frieden geschlossen worden ist, gibt es eine Chance, dass die Söhne zurückkehren oder man wenigstens die Hoffnung haben kann, etwas über ihr Schicksal zu erfahren. Daran kann niemand etwas ändern.“
Die Stimmung im Salon des Schlosses Pankow wurde an diesem Weihnachtsabend nicht besser. Trübe Gedanken beherrschten die alten Herrschaften. Sie wurden nur zeitweise aufgeheitert durch den Versuch der jungen Juliane, auf ihrem neuen Pianoforte die Töne des Weihnachtsliedes von Martin Luther „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ zu spielen. Die Fehler, die sie bei jedem zweiten Ton machte, brachten sie zur Verzweiflung und ihre Eltern und den Gast eher zu einem leichten Lachen. Jeder wusste ja, dass die junge Musikantin auf diesem Instrument noch keinerlei Erfahrung hatte.
Schill macht es den Franzosen heiß
Im westlichen Hinterpommern, Februar 1807
Nur etwa fünfhundert Schritt vom Camminer Tor des pommerschen Kleinstädtchens Naugard entfernt lag ein kleines Dorf. Der Schnee des Winters war schon weitgehend geschmolzen und lag nur noch auf den unberührten Ackerflächen.
Zwischen den wenigen Bauernhäusern herrschte ein lebhaftes Treiben. Zahlreiche Soldaten, manche in der dunkelblauen Uniform mit dem typischen weißen Leder-Bande-lier 16 der Dragoner, wimmelten herum, sattelten ihre Pferde oder packten Fässer, Körbe und andere Behälter auf einige Bauernwagen. Mehrere der Soldaten hatten dicke weiße Verbände um Arme, Kopf oder Beine. Viele der Soldaten trugen allerdings auch andere Uniformen, wie sie in der preußischen Armee üblich waren. Hier stand offensichtlich eine militärische Einheit kurz vor ihrem Aufbruch, eine Einheit, die sich aus verschiedenen Truppenteilen zusammensetzte. Gar nicht so wenige der Männer, die da herumwimmelten, waren offensichtlich auch Zivilisten, junge Bauern-burschen, denen man noch keine Uniform hatte geben können. Der befehligende Offizier hatte sich einen Hocker vor die Tür eines der Bauernhäuser gestellt und überblickte mit wachen Augen das nur scheinbar ungeordnete Treiben.
Gelegentlich ertönte ein Schuss, den eine Kette von etwa sechs Dragonern mit ihren Karabinern 17 in Richtung auf das Camminer Tor in Naugard abgab. Das sollte das französische Infanterie-Regiment, das sich in dem Städtchen festgesetzt hatte und schon seit Tagen die preußischen Soldaten verfolgte, abschrecken und an einem Ausbruch aus der schützenden Stadtmauer hindern. Mit dieser Taktik hatten die preußischen Dragoner schon seit 14 Tagen den Vormarsch der Franzosen hier in Hinterpommern ganz erheblich verzögert.
Ein schnauzbärtiger Sergeant 18 baute sich vor dem Offizier auf seinem Hocker auf, salutierte vorschriftsmäßig und meldete: „Halten zu Gnaden, Herr Leutnant, soeben sind vier preußische Soldaten hier eingetroffen. Dabei ist auch ein Offizier, der Herrn Leutnant sprechen möchte.“ Der Angesprochene winkte: „Bitte Er ihn zu mir, Sergeant!“
Damit erhob er sich und blickte dem Ankömmling neugierig entgegen. Der war ein junger Leutnant in der Uniform eines preußischen Artillerie-Regiments. Er stellte sich in „Hab-acht-Stellung“ 19 vor den Dragoner-Offizier, salutierte und stellte sich vor: „Sekonde-Leutnant Leopold Jahn vom 4. preußischen Fuß-Artillerie-Regiment von Natzmer, aus Stettin. Melde mich gehorsamst zum Dienst unter Herrn Premierleutnant20 von Schill!“
Erstaunt sah der Dragoneroffizier den Besucher an, winkte dann einer bereitstehenden Ordonnanz 21 , der sofort eine andere Sitzgelegenheit aus dem Bauernhaus holte, auf der der Besucher Platz nehmen konnte. „Albert von Wedell“, stellte er sich seinerseits vor, „Sekondeleutnant, einst im 3. preußischen Dragoner-Regiment von Treskow, jetzt im Freikorps des Hauptmanns Ferdinand von Schill. Was verschafft mir die Ehre Ihrer Anwesenheit, Herr Kamerad?“
„Ich komme aus Stettin, Herr Kamerad“, gab der Ankömmling Auskunft. „Diese preußische Festung hat doch aber schon, so weit ich weiß, Ende Oktober vorigen Jahres vor den Franzosen kapituliert“, entgegnete Leutnant von Wedell. „Wie wollen Sie da jetzt, mehr als ein Vierteljahr später, aus Stettin kommen? Das macht mich, um es ehrlich zu sagen, etwas misstrauisch!“
„Das ist eine lange und eigentlich auch wieder kurze Geschichte, Herr Kamerad“, antwortete der fremde Leutnant. „Darf ich sie Ihnen erzählen?“ – „Ich bitte darum!“
„Als der Herr General von Romberg, der Befehlshaber der preußischen Festung Stettin, damals, am 29. Oktober 1806, vor zwei Schwadronen französischer Husaren kapitulierte, haben das viele meiner Kameraden in unserer Garnison in Stettin als eine Schmach empfunden; schließlich waren wir mehr als 2000 Soldaten des Königs von Preußen in dieser Stadt. Aber der alte Herr – er zählt schon 79 Jahre – war nach den Gerüchten über die Niederlagen des preußischen Heeres Anfang Oktober in Thüringen so verzweifelt, dass er wohl keine Nerven für eine lange Belagerung unserer Stadt und Festung hatte. Wie auch zahlreiche andere meiner Kameraden habe ich in den Tagen danach versucht, über die Oder nach Hinterpommern zu entkommen. Sie mögen es Befehlsverweigerung nennen, Herr Kamerad, aber ich war nicht bereit, mich mit der Kapitulation in französische Gefangenschaft zu begeben.“
Der junge Offizier stockte, schluckte und fuhr dann aber in seinem Bericht fort. „Zwei volle Taler musste ich einem pommerschen Fischer bezahlen, damit er mich, mein Pferd, meinen Burschen und zwei andere Soldaten aus meiner Batterie 22 , die zu diesem Abenteuer bereit waren, über die Oder fuhr. Doch beim Einschiffen hat eine französische Patrouille uns erwischt. Beim Kampf mit Säbeln bekam ich einen stark blutenden Hieb auf die Schläfe, aber mein treuer Bursche 23 hat mich in das Boot gerettet und dann zusammen mit den beiden anderen Soldaten mich in ein Bauernhaus bei Greifenhagen 24 schaffen können, wo man mich und meine Begleiter versteckt, rührend gepflegt und verpflegt hat. Ich bin diesen pommerschen Bauern zu tiefem Dank verpflichtet.“
Er machte eine Pause, wie, um sich an diese für ihn so wichtige Zeit noch einmal zu erinnern. „Jetzt bin ich aber wieder voll einsatzfähig und habe mich mit meinen Leuten abseits von den französischen Truppen durchs Land geschlagen, um mich dem Freikorps von Schill anzuschließen. Das ganze Land ist voll des Lobes über diese mutigen preußischen Soldaten, die dem französischen Eroberer noch Widerstand entgegensetzen. Mit Ihren Leuten hier habe ich dieses Korps ja nun wohl erreicht, Herr Kamerad! Darf ich mich Ihnen anschließen?“
„Ich habe nichts dagegen, Herr Kamerad, möchte aber doch die endgültige Entscheidung meinem Befehlshaber überlassen, dem Herrn Hauptmann von Schill“, antwortete der Sekonde-Leutnant von Wedell.
„Mein Chef, Herr Ferdinand von Schill, ist übrigens seit kurzem schon Hauptmann“ fuhr er fort, „erst vor wenigen Tagen hat Seine Majestät, der König von Preußen, geruht, meinen Chef zum Hauptmann zu ernennen und ihm den Orden Pour le Mérite 25 zu verleihen. In seinem augenblicklichen Hauptquartier in Königsberg hat der König davon erfahren, dass die von ihm gesammelten und geführten Soldaten offenbar die einzigen sind, die hier östlich von Stettin noch den Vormarsch der Franzosen aufhalten.
Leutnant von Wedell machte eine kurze Pause, um seine Gedanken zu sammeln, dann fuhr er fort: „Herr von Schill sieht es als seine Aufgabe an, den Vormarsch der französischen Truppen von Westen her so gut wie möglich zu verzögern. Es sollen mehrere Divisionen sein, wie man sagt. Schließlich ist der Krieg zwischen Seiner Majestät dem König von Preußen, und dem französische Kaiser Napoleon ja noch längst nicht zu Ende, obwohl unser einst so ruhmreiches Heer eine schreckliche Niederlage erlebt hat. Und die Wochen danach mit der Kapitulation so vieler preußíscher Festungen ist auch kein Ruhmesblatt. Der Franzose hat ja Berlin besetzt, kurz nachdem die Familie unseres Königs von dort mit ein paar Angehörigen des Hofstaats geflüchtet war. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt geworden ist, wo Sie in dieser Zeit ja auf einem pommerschen Bauernhof versteckt waren und Ihre Blessur 26 auskurierten. Der König und seine Frau und seine Kinder flohen gleich nach Ostpreußen, um von dort her die Verteidigung Preußens zu organisieren.“
„Danke, Herr Kamerad, für diese Informationen, die mir tatsächlich bisher unbekannt waren“, bedankte sich Sekondeleutnant Jahn. „In der Abgeschiedenheit dort im pommerschen Bauernhaus habe ich ja nichts mitbekommen, was in der Welt passiert ist. Könnten Sie mich nicht ins Bild setzen, wie es eigentlich überhaupt jetzt mit dem Krieg zwischen Preußen und Frankreich steht?“
„Gerne will ich das versuchen, Herr Kamerad“. Leutnant von Wedell nahm die Finger zu Hilfe, um aufzuzählen, was ihm einfiel. „Ich weiß das alles natürlich nur aus Gerüchten, und ich bin nicht sicher, ob man alles glauben soll. Schon unmittelbar nach den Schlachten bei Jena und Auerstedt hat unser stets ‚treuer’ Verbündeter, der Kurfürst von Sachsen, die Seiten gewechselt. Jetzt ist er mit Napoleon verbündet und darf sich neuerdings als König bezeichnen. Nur der russische Zar hält noch zu Preußen, und er hat einige Truppen nach Ostpreußen geschickt. Aber so viel ich weiß, hat dort im Februar eine schreckliche Schlacht stattgefunden, bei der viele Russen und fast ebenso viele Franzosen gefallen sein sollen 27. Sie ging wohl unentschieden aus. Seitdem sind die Kämpfe erst mal abgeflaut, auch wenn es keinen Waffenstillstand gab, so viel ich weiß.“
„Waren da auch preußische Truppen beteiligt?“ fragte Leutnant Jahn. „Ich habe nichts davon gehört,“ gab sein Gesprächspartner Auskunft. „Es gibt ja kaum noch intakte Einheiten der preußischen Armee. Das ist ja das Furchtbare an unserer Lage. Nur die Festungen Colberg und Danzig sind noch in der Hand preußischer Truppen, und noch sind die Franzosen auch nicht so nahe an sie herangekommen, um sie belagern zu können. Und unser Hauptmann von Schill ist der Einzige mit seinen von überall her aufgelesenen Leuten, der noch sich Mühe gibt, dem Feind im freien Feld Widerstand zu leisten.“
„Sie brechen offenbar bald auf, Herr Kamerad,“ stellte Sekondeleutnant Jahn nach einem Blick in die Runde sachverständig fest. „Aber hätten Sie vielleicht trotzdem Zeit, mir kurz zu erzählen, wie es zu diesem ‚Freikorps Schill’ gekommen ist?“
„Wir sollen erst am frühen Nachmittag aufbrechen, da ist noch etwas Zeit, Herr Kamerad“, antwortete Herr von Wedell freundlich. Sein anfängliches Misstrauen gegenüber dem Neuankömmling war vollständig verschwunden. „Unser Hauptmann von Schill ist ein wunderbarer Mensch, er hat uns Offiziere und auch die Mannschaften , die sich ihm angeschlossen haben, vollkommen verzaubert.“