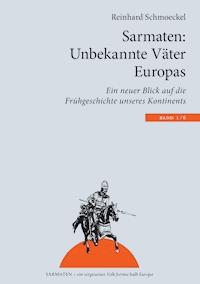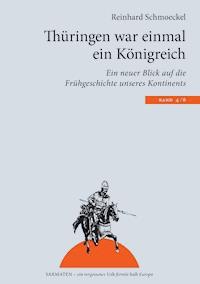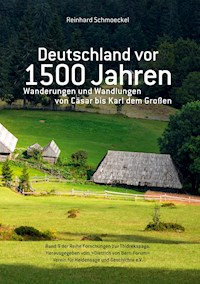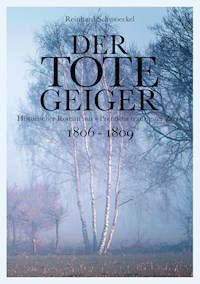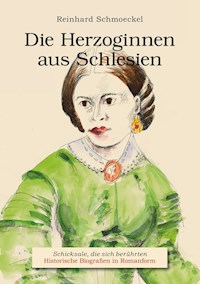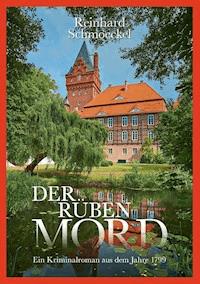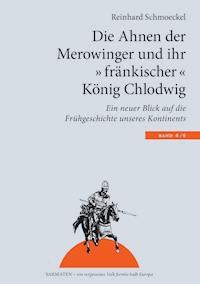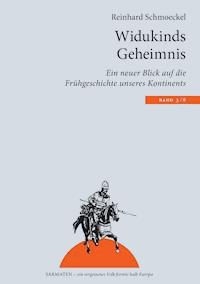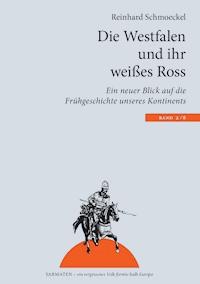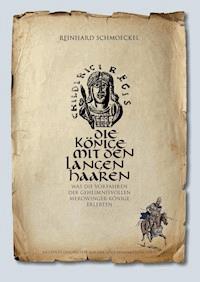
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch liest sich wie ein historischer Roman. Doch es ist keiner. Es ist die Beschreibung echter historischer Vorgänge, allerdings so, dass man sie sich vorstellen kann. Sie liegen mehr als 1500 Jahre zurück. Kein Vertreter der Geschichtswissenschaft an europäischen Universitäten wird sie allerdings glauben, weil es dafür angeblich keine schriftlichen Beweise gibt. Und doch sind seit damals Quellen vorhanden, im Untergrund gewissermaßen oder von den Geschichtswissenschaftlern als unseriös eingeschätzt und missachtet. Diese Quellen hat der Autor seit vielen Jahren genau untersucht und konnte daraus höchst überraschende Schlussfolgerungen ziehen (näher dargestellt im Buch "Die Ahnen der Merowinger und ihr "fränkischer" König Chlodwig"). Eine Geschichtsfälschung mit bis heute wirkenden Folgen wurde vom "fränkischen" König Chlodwig mit Hilfe christlicher Bischöfe vor 1500 Jahren vorgenommen. Er ließ seine sarmatische Abstammung und die Ehe eines Vorfahren mit einer Frau verschleiern, die für eine Nachkommin Jesu gehalten wurde, damit er als (katholischer) Christ getauft werden konnte. Stattdessen ließ er sich nunmehr "König der Franken" nennen. So glaubt die Geschichtswissenschaft bis heute fest an die germanische Abstammung dieses Königs und seiner Familie, der M e r o w i n g e r , die das "Reich der Franken" schufen. Dieses löste in Mitteleuropa die Römer als Herrschafts- und Ordnungsmacht ab und leitete die Entstehung Europas ein, wie wir es heute kennen. Dank Chlodwigs Geschichtsfälschung wissen herkömmliche Historiker allerdings bis heute praktisch nichts über seine Vorfahren und die beiden Jahrhunderte, die seiner Reichsgründung vorangingen, die für das Schicksal Europas so entscheidende Völkerwanderungszeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Der lange Weg immer nach Sonnenuntergang
(376 – 415 n. Chr.)
1. Auf der Flucht
(im Jahr 376)
Der Spruch der Schicksalsstäbe
… zu beider Seiten Nutzen
Das „Feuer, das die Geister der Väter beschwört“
2. In fremder Nachbarschaft
(389 – 396)
Die Römer im Sumpf
Fürstliche Hochzeit
Die Braut mit dem heiligen Blut
Die Geister der Ahnen reiten aus den Grabhügeln
Ein Grab, würdig für einen Fürsten
3. Um das Überleben der Menschen des Draco
(407 – 415)
Gespannt wie eine Bogensehne
Wieder auf der Flucht
„Ein Schiff, ein Schiff!“
Aus Nachbarn werden Verwandte
In eine neue Welt, aber eine bessere?
Der Aufstieg
(415 – 447 n. Chr.)
4. Die Fischerkönige
(415/416)
Chlogio am Ziel seiner Suche
Die Desposynoi
Die Prozession zum Geburtstag Christi
Eine Zweckehe aus Liebe
Das Siegel des Herrn
5. Im Umgang mit den Römern
(421 – 430)
Lager-Alltag
Die Zivilisierten und die Barbaren
Fränkische Gastfreundschaft
Für 3000 Soldaten Wurfbeile
König der Salier
6. Der Bagauden-Aufstand
(432 – 437)
„Desunt monetae“
Ein Blutsauger sucht neue Opfer
Ein Aufwiegler
„Die Dämonen sind aus der Unterwelt entwichen“
Vorbereitungen zur Schlacht
„Rom gewährt gnädig einen Frieden“
Erschütternde Nachrichten
7. Chlogio und seine Söhne
(440 – 448)
Schwieriges Winterfeuer
Eine neue Schutzmacht
Geteilte Einheit
Auf dem Weg zur eigenen Herrschaft
Colonia „voll der Barbaren“
Das Römerreich am Ende
(447 – 481)
8. Merowech, der Vater seiner Schutzbefohlenen
(449)
Ein Fürst voll Würde und Heil
Veränderungen auf dem Land
9. Unheil bahnt sich an
(Erstes Halbjahr 451)
Eine dringende Botschaft
Attila will die Kaiserschwester und das halbe Reich
Wann kommen Attila und die Goten?
10. Die „Geissel Gottes“ über Gallien
(Zweites Halbjahr 451)
Das Wunder von Aurelianum
Reiten, reiten, reiten
Die Schlacht, die Galliens Schicksal entschied
Erkundungsritt in ein unbekanntes Land
11. Der Schwur ist gelöst, das Bündnis nicht
(455 – 460)
König Merowech
Ein verlockendes Angebot
Leicht errungener Sieg
Ruf an den Rhein
Umkämpfte Colonia
12. Im Bunde mit einem Rebellen
(461 – 465)
„König Childerich, ich brauche deine Hilfe!“
Bluternte
Tod eines Freundes
13. Macht unter Mächten
(465 – 481)
Eine Ehe auf Wunsch des Volkes
Ödes Marschieren, wechselnde Gegner
Ein Sieg, aber für wen?
Vertreibung neuer Störenfriede
Eine Niederlage, die man am besten schnell vergisst
Eine verdiente Ehrung
Ein Grabhügel, würdig der Ahnen
König der Franken
(481 – 511)
14. Sieg aus eigener Kraft
(481 – 487)
Pilgerfahrt an die Quelle des Heils , und noch etwas mehr
Ein Bündnis zerbricht
Keine Gnade für den Besiegten
König für wen?
15. Allen Königen ebenbürtig
(487 – 498)
Das Thüringerreich findet seinen Erben
Die burgundische Prinzessin Chrodechilde
Um den stärkeren Gott
16. Ein Ereignis; das beide Seiten wollten – und zwanzig Jahre darüber verhandelten
(503 – 507)
Die Schlacht bei Tulbiacum
Eine Einigung, die geheim bleiben muss
„Beuge demütig dein Haupt, Sygambrer“
Der „Ahnherr Francus“
17. Von Erfolg zu Erfolg, auch auf dem harten Weg
(507 – 511)
Ein schwelendes Feuer, kurz vor dem Aufflammen
König Alarich verliert sein Leben und sein Land
Die Einen müssen weichen, die Anderen übernehmen ihr Land
Fast wie ein Kaiser
Die Sammlung von Chlogios Erbe
Das Ende eines Mächtigen
Ein Nachwort für skeptische Leser
Gallien im 5. Jahrhundert (Karte)
Stammtafeln: Die mutmaßlichen Vorgänger König Chlodwigs
Vorwort
„Erzählte Geschichte“ - - was ist das denn? Ein anderes Wort für „historischer Roman“? Eben nicht! Ein „Roman“ ist etwas Erfundenes, eingebettet in eine historische Situation.
Doch dieses Buch will vermutliche oder sogar sehr wahrscheinliche reale Geschichte so anschaulich beschreiben, wie es eben auch ein guter Roman kann. Es ist der Versuch, historische Personen, Zustände und Denkweisen zu erklären, und zwar in einer Form, bei der jeder Leser auch ohne Universitätsstudium verstehen kann, was passierte – und warum.
Es muss nicht alles genauso gewesen sein, wie es in diesem Buch beschrieben wird, aber es ist wahrscheinlich. Denn der Autor konnte dabei auf fundierte Vermutungen über Zustände und das Denken von Menschen vor 1500 Jahren zurückgreifen, das sich durch Arbeit an einem halben Dutzend Büchern über die europäische Frühgeschichte im Lauf von vier Jahrzehnten angesammelt haben. Er konnte Indizien aus verschiedensten wissenschaftlichen Fächern nutzen - - und zusammen sehen!- , etwas, was „gelernte“ Historiker nur selten tun.
Und Kritiker sollten beweisen, dass es so nicht gewesen sein kann. Doch das dürfte ihnen schwer fallen.
Eine Geschichtsfälschung mit bis heute wirkenden Folgen wurde vom „fränkischen“ König Chlodwig mit Hilfe christlicher Bischöfe vor 1500 Jahren vorgenommen: Er ließ seine sarmatische Abstammung und die Ehe eines Vorfahren mit einer Frau verschleiern, die für eine Nachkommin Jesu gehalten wurde, um als (katholischer) Christ getauft werden zu können. Stattdessen ließ er sich nunmehr „König der Franken“ nennen.
So glaubt die Geschichtswissenschaft bis heute fest an die germanische Herkunft dieses Königs und seiner Familie, der Merowinger, die das „Reich der Franken“ schufen. Dieses löste in Mitteleuropa die Römer als Herrschafts- und Ordnungsmacht ab und leitete die Entstehung Europas ein, wie wir es heute kennen. Dank Chlodwigs Geschichtsfälschung wissen herkömmliche Historiker allerdings bis heute praktisch auch nichts über seine Vorfahren und die beiden Jahrhunderte, die seiner Reichsgründung vorhergingen, die für Europas Schicksal so entscheidende Völkerwanderungszeit.
Und doch sind seit damals Quellen vorhanden, im Untergrund gewissermaßen oder von der Geschichtswissenschaft als „unseriös“ eingeschätzt und missachtet. Diese Quellen hat der Autor seit vielen Jahren genau untersucht und konnte daraus höchst überraschende Schlussfolgerungen ziehen.
In den letzten 15 Jahren hat sich der Autor dieses Buches als privater Geschichtsforscher – nicht an einer Universität – sehr intensiv mit der „Vorgeschichte“ der Merowingerkönige befasst und mehrere wissenschaftliche Bücher dazu veröffentlicht. Neue Bücher im Abstand von einigen Jahren wurden nicht etwa deswegen nötig, weil sich der Inhalt der alten Veröffentlichungen ganz oder teilweise als falsch herausgestellt hatte. Sondern im Gegenteil ergab sich die Notwendigkeit zu neuen erweiterten Auflagen, weil durch zahlreiche Informationen von Lesern und weitere Forschungen neue aufschlussreiche Mosaiksteinchen hinzugekommen waren, die das eine oder andere Rätsel klären halfen.
Das letzte wissenschaftliche Buch („Sachbuch“) in dieser Reihe trägt den Titel Die Ahnen der Merowinger und ihr „fränkischer“ König Chlodwig. Es ist im Jahr 2016 erschienen (242 S., Preis € 12,90. ISBN 978-3837050110. )
Bereits einige Jahre zuvor hatte der Autor aber auch zum gleichen Thema einen umfangreichen Text verfasst, den man oberflächlich gesehen als „historischen Roman“ bezeichnen könnte. Aber er ist eben kein Roman, denn er erzählt Geschichte!
Das ursprüngliche Manuskript dieses Buches entstand bereits im Jahr 2008, doch kein Buchverlag hätte es damals gedruckt, aber es wurde aufbewahrt. Für die jetzige Veröffentlichung musste es nur unwesentlich verändert werden, entsprechend den fortgeschrittenen Erkenntnissen des Autors als Geschichtsforscher. Wen die so entscheidende Zeit vor 1500 Jahren interessiert, dem ist zu empfehlen, dieses Buch vor oder nach dem eben erwähnten Sachbuch zu lesen. Denn beide ergänzen sich.
Beide Bücher hebeln zahlreiche angeblich unumstößliche „Glaubensvorstellungen“ der europäischen Geschichtswissenschaft, ja sogar der christliche Theologie aus. Gerade Geschichtskundige werden das spannend finden – aber natürlich auch angreifbar.
Für Leser, die hinsichtlich der historischen Realität des hier Erzählten misstrauisch sind, die es gerne seriös belegt wüssten, was sich hier „wie ein Roman“ liest, enthält das Buch zweierlei Hinweise. Im Text werden häufig Jahreszahlen, Übersetzungen von Ortsnamen und andere Hinweise in kursiver Schrift gegeben, die den Leser mit modernem Wissen versorgen können. Außerdem aber enthält das Buch ein „Nachwort für skeptische Leser“. Auch das ist kein hochwissenschaftlicher Traktat, soll aber einem Publikum Auskunft geben, das von einem populärwissenschaftlichen Werk mehr verlangt als bloße Behauptungen. Hier werden einige der Quellen wenigstens kurz erwähnt, die im „wissenschaftlichen“ Buch Die Ahnen der Merowinger … genau betrachtet und gewertet werden.
Dormund, im Frühjahr 2017 Reinhard Schmoeckel
I.
Der lange Weg immer nach Sonnenuntergang
(376 – 415 n. Chr.)
Kapitel 1
Auf der Flucht
An der Saale beim heutigen Naumburg, Herbst 376 n. Chr.
Der Spruch der Schicksalsstäbe
Es war unglaublich. Die Bewohner des kleinen Dorfes der Thüringer in der Nähe des Ufers des Sala-Flusses, kaum mehr als zwei Hände voll zählend, konnten vor Staunen kaum ein Wort herausbringen. Auf der weiten Talaue neben dem Dorf hatte sich ein Wurm zusammengeringelt, ein Wurm von unzähligen hölzernen Wagen, die aussahen wie Flöße auf Rädern, oben aber ein rundes Dach aus wasserdichtem Filz hatten, das oft bunt bemalt war. Bespannt waren die Wagen mit Pferden oder Ochsen und begleitet von einer großen Menge von Männern, Frauen und Kindern. Dem Wurm folgten zahlreiche Pferde und eine noch größere Herde von Kühen, einigen Zuchtbullen und ein paar Schafen, beaufsichtigt und vorwärts getrieben von etlichen halbwüchsigen Jungen und Mädchen auf Pferden. Am meisten beeindruckt aber waren die Dorfbewohner von den Kriegern, die vor, neben und hinter den Wagen auf edlen Pferden sorgsam Wache hielten, mit metallschimmernden Brustpanzern und Helmen, bewaffnet mit einer langen Lanze, einem langen Schwert, einem Bogen, einer Wurfaxt und einem Schild.
Schon vor Tagen waren Gerüchte zu den Dorfbewohnern gedrungen, dass dieser Wurm sich langsam nach Sonnenuntergang zu bewege und bald die Sala erreicht haben werde, so hatten Leute aus den Dörfern berichtet, bei denen der Wurm schon vorbei gekrochen war. Hier auf der weiten baumlosen Ebene nahe dem Fluss war der Wurm, so schien es, zur Ruhe gekommen und richtete sich zum Schlafen ein. In sieben Kreisen ineinander, einer immer kleiner als der andere, hatten die Wagen in größter Ordnung Halt gemacht, die Pferde oder Ochsen waren abgespannt und nach draußen geführt worden, um weiden zu können, und aus den Wagen reichten nun die Frauen und Kinder, die zuvor darin gesessen hatten, allerlei Geräte heraus, um zu kochen. Offensichtlich wollten die Fremden hier einige Zeit verweilen.
*
Der Draco der stolzen Sicambrier aus dem Volk des Sarmaten war seit knapp vier Monden auf dem Marsch nach Norden und Westen. Hier, bei den Thüringern, sollte er sich, wenn es denn möglich wäre, friedlich niederlassen, um Tieren und Menschen Zeit zu geben, sich von dem anstrengenden Marsch zu erholen und wieder Normalität in das Leben aller einkehren zu lassen. Schon in weiter Entfernung von diesem Land, seit man am Fluss Albis (Elbe) entlang gezogen war, im Lande der Sueben (das böhmische Becken), da hatten die Sicambrier gehört, dass es dort bei den Thüringern große, fruchtbare Weidegegenden gebe, die nicht allzu dicht bevölkert seien.
Der Vortrupp, der stets im Abstand von einigen Tagereisen die Gegend erkundete, hatte mit dem Fürsten der Thüringer in seiner Burg am Fluss Onestrudis (Unstrut, Nebenfluss der Saale) Kontakt aufgenommen und ihn zu einem friedlichen Treffen mit dem Fürsten des Sicambrier-Draco hier am Ufer der Sala gebeten. Ein berittener Bote dieses Vortrupps hatte gerade gestern die Nachricht überbracht, dass der Thüringer-Fürst diesem Vorschlag zugestimmt habe und zum Treffen kommen werde. Doch noch war Attahari, der Thüringerfürst, nicht an der Sala eingetroffen, und die Befehlshaber der Sicambrier wollten die Gelegenheit nützen, unter sich eine Frage zu klären, die schon seit Wochen unter ihnen schwelte und die das ganze Volk zu entzweien drohte.
Als daher der Abend anbrach, die Krieger mit ihren Familien neben ihren Wagen saßen und das einfache Essen von gedörrten Rindfleischstreifen verzehrten, als keine Befehle mehr von Schwadronskommandeuren, ihren Unterführern oder gar vom Fürsten erwartet wurden, da trafen sich diese Anführer am großen Beratungsfeuer. Nach der Tradition der Sicambrier wurde es nur zu besonderen Gelegenheiten in der Mitte des innersten Kreises entzündet, wenn die hölzernen Wagen ihren abendlichen siebenfachen Ring um die Wagen und Wohnstätten des Fürsten, seiner Söhne und deren Familien gebildet hatten.
Schweigend, wie es der Brauch gebot, saßen die etwa zwanzig obersten Adligen der Sicambrier mit untergeschlagenen Beinen rund um das Feuer. Ihre Panzer und Helme hatten sie abgelegt und sich stattdessen gegen die Abendkühle in warme dunkelblaue Wollmäntel gehüllt. Diese Mäntel und ihre Farbe waren das äußere Abzeichen der Azantanen, der sicambrischen Adligen; einfache Krieger oder gar Handwerker und Frauen trugen andere Mäntel. Nur der Mantel des Fürsten und obersten Anführers des Draco – auch er bestand natürlich ebenfalls aus dunkelblauer Wolle – war mit zahlreichen kleinen goldenen Bienen geschmückt, zum Zeichen, dass er den Göttern näher war als die anderen.
Ihre Schwerter und Dolche hatten die Anführer griffbereit am Gürtel. Kein sarmatischer Krieger trennte sich freiwillig von seinen Waffen, selbst bei dieser Gelegenheit nicht, bei der Gott Marha seit uralten Zeiten den Kriegern auferlegt hatte, unbedingt Frieden zu halten, selbst wenn am Beratungsfeuer unversöhnliche Gegensätze zutage treten und Beleidigungen gefallen sein sollten.
Meodaris, der greise Oberpriester der Sicambrier und Onkel des Fürsten Marcomir, führte am Zaum einen jungen Hengst an das Feuer heran. Mit geübtem Schwung hob er seine Wurfaxt und spaltete dem Pferd mit einem Schlag den Schädel. Das Opfer eines für die Reiterkrieger der Sarmaten so kostbaren Streitrosses musste unabänderlich ein Beratungsfeuer einleiten. Das Blut des Tieres rann in Ledereimer und wurde dann ins heilige Feuer gegossen, wo es zischend dunklen Rauch und helle Funken verursachte und als Botschaft und Bitte des Volkes um Hilfe zu den Göttern emporstieg. Das Fleisch wurde danach von Gehilfen des Priesters in handliche Stücke geschnitten und an die einzelnen Krieger und ihre Familien verteilt, sie nahmen auf diese Weise an der Opferhandlung teil und kamen zudem in den seltenen Genuss frischen gebratenen Pferdefleisches. Für Sarmaten war das ein Leckerbissen und Opfermahl zugleich.
Endlich eröffnete Fürst Marcomir die Aussprache. Er war schon etwas alt, über vierzig Jahre, aber immer noch im Vollbesitz seiner Kräfte und von allen Sicambriern als ihr oberster Befehlsgeber anerkannt. Er trug wie alle seine Männer Hosen aus Leder . Auf seinem Wollmantel waren etliche Skalpe, die Haarschöpfe getöteter Feinde, festgenäht.
„Meine Söhne und Verwandten, werte Azantane! Ihr wisst alle, warum wir heute hier um das Beratungsfeuer sitzen. Wir, die Anführer des stolzen Draco der Sicambrier, stehen vor schwerwiegenden Entscheidungen. Schon lange weiß ich, dass es unter euch verschiedene Meinungen gibt darüber, ob wir hier bleiben sollen, wenn wir das im Einvernehmen mit dem hiesigen Leuten, den Thüringern, tun können, oder ob wir weiter nach Westen ziehen sollen, bis zum Strom Rhein, der hier die Grenze zum Reich der Römer ist. Ich weiß, dass einige von euch die Hoffnung haben, sich dort an den Römern rächen zu können für die Schmach, die sie uns in diesem Frühjahr angetan haben. Ich habe meine Meinung in dieser Frage, aber ich will hier, wo es um das Schicksal unseres ganzen Draco geht, euch, ihr Edlen, um eure Meinung befragen, und wir wollen dann die Losstäbe werfen, um zu sehen, was die Götter dazu sagen. Darum rede, wer meint, etwas zu unserer Entscheidung beitragen zu können!“
Es dauerte lange, bis sich einer der sicambrischen Adligen traute, das Wort zu nehmen. Schließlich war es Genobauud, der älteste, aber noch recht junge Sohn des Fürsten Marcomir, der die Diskussion eröffnete. „Ich weiß, mein Vater und mein Fürst, dass du hier im Land der Thüringer auf ein friedliches Niederlassen unseres Draco hoffst. Das ist aller Ehren wert. Aber hast du auch bedacht, bei wie vielen unserer Krieger die Wunden noch schmerzen? Sie trugen sie im Frühjahr im Kampf mit den Römern davon, in einem Kampf, den wir nicht gewinnen konnten, weil die Gegner gar zu viele waren. Dabei waren wir doch so lange – ich weiß gar nicht, wie viele Jahre! – die treuesten Verbündeten der Römer, von ihnen als Zierde ihres Heeres angesehen! Was haben wir verbrochen, dass sie uns plötzlich mit solcher Heeresmacht verfolgten, so dass uns nichts als die schmähliche Flucht blieb? Der Wunsch nach Rache dafür liegt auf der Seele vieler unserer Krieger.“
Zustimmendes Murmeln erklang bei einigen der umsitzenden sarmatischen Adligen. Dadurch ermutigt, schlug Genobauud nachdrücklich vor, weiter nach Westen zu ziehen und die dortigen Anwohner – „Franken nennen die Römer sie, wie ich gehört habe“ – zu Verbündeten zu machen. Dann seien die Sicambrier viel stärker als am Danubius, denn überall auf ihrem bisherigen Wanderweg habe er erzählen hören, dass dort am Rhenus viele Grenznachbarn der Römer reich und ruhmvoll geworden seien, weil sie Kriegszüge zu den Römern hinüber unternommen hätten.
Sunno, ein gut dreißigjähriger kräftiger Krieger, Sohn des Fürstenonkels Antenor und damit Vetter des regierenden Fürsten Marcomir, war es, der als nächster das Wort ergriff. „Marcomir, mein Fürst und mein verehrungswürdiger Verwandter,“ sagte er laut und ruhig, aber man hörte seiner Stimme die innere Spannung an, „ich weiß, du hast damals am Danuvius befohlen, dass wir Sicambrier den Fluss schleunigst überqueren und uns ins Gebiet der Sueben retten sollten, als mehrere Heere der Römer uns bedrohten und unsere Krieger schon in verschiedenen Gefechten Verwundete und Tote zu beklagen hatten. Dein Wunsch, das kostbare Blut der Sicambrier zu schützen, wenn man eine Schlacht nicht gewinnen kann, war sicher richtig. Für die Masse unseres Volkes, unseres Draco der Sicambrier, für die Frauen und Kinder, musste das wohl gelten. Doch hast du auch bedacht, mein Fürst, wie dein Befehl auf uns junge Krieger wirkte, denen man stets gesagt hat, für uns seien Kampf und Sieg – und wenn kein Sieg , dann Kampf und Tod – das Wichtigste im Leben? Lass wenigstens einige von uns jungen Kriegern noch weiter nach Westen ziehen und versuchen, dort im Kampf mit den Römern das zu tun, was wir Sarmaten am besten können: kämpfen und siegen!“
In ruhigem Ton, aber dennoch mit nur mühsam gedämpfter Leidenschaft wogte das Gespräch um das heilige Beratungsfeuer hin und her. Von älteren erfahrenen Adligen gab es auch Stimmen, die für die Idee des Fürsten eintraten, sich hier im Lande der Thüringer niederzulassen, wenn denn ein friedliches Übereinkommen mit diesem Volke möglich sei. Doch andererseits zeigte sich immer deutlicher, dass eine kleine Minderheit von sicambrischen Anführern bereit und entschlossen war, sich vom Draco der Sicambrier zu trennen, an den Strom Rhenus und damit die Grenze der Römischen Reiches zu ziehen , die dortigen Nachbarn als Verbündete im Kampf gegen die Römer zu gewinnen, Reichtum und Ruhm bei Plünderungseinfällen über den Strom hinüber und auf diese Weise die Art der Ehre zu gewinnen, die als die erstrebenswerteste für sarmatische Krieger galt.
Es waren vor allem Marcomir, der Sohn des Fürsten-Onkels Priamos, und sein Vetter Sunno, die sich von ihrem Entschluss nicht abbringen lassen wollten. Genobaud, des Fürsten Marcomirs Sohn, gehörte ebenfalls zu dieser Gruppe, war aber auf die Bitte seines Vaters bereit zu der Zusage, zum Draco der Sicambrier zurückzukehren, falls der Tod des jetzigen Fürsten die Übernahme des Amtes des regierenden Fürsten nötig machen sollte.
Es blieb in später Nacht dem Fürsten Marcomir nichts anderes übrig, als dieses Ergebnis des Beratungsfeuers als Beschluss bekannt zu geben. Feierlich traten die zwanzig sarmatischen Adligen rund um den brennenden Holzstoß, hielten die rechte Hand über die Flammen, stießen mit der linken Hand ihre Schwerter in den Boden und schworen auf das Feuer und zu ihrem Gott Marha, nicht im Unfrieden von einander zu scheiden, die alten Sitten und den alten Glauben der Sarmaten nicht zu vergessen und sich, wenn es möglich und nötig sei, auch in Zukunft gegenseitig zu helfen.
„Lasst uns, meine Verwandten und edle Azantane, die Schicksalsstäbe befragen, wie es nach dieser so einschneidenden Entscheidung den Menschen unseres Draco und ihren Nachkommen in der Zukunft ergehen mag“, verkündete Fürst Marcomir am Ende feierlich. Jeder in der Runde hatte dies erwartet. Die Götter wussten es, und mit etwas Glück war es dem Oberpriester und Weissager des Draco, Meodaris, möglich, aus dem Fallen der Weissagungsstäbe die künftigen Schicksale abzulesen.
Gehilfen des Priesters holten aus dessen Wagen das Bündel von Holzstäben, die in ein kostbares rotes Tuch gehüllt waren. Ein Teil davon war mit Holzkohle schwarz gefärbt, das waren die Stäbe des Unheils, ein anderer Teil hatte mit Kalk eine weiße Farbe erhalten, das waren die Stäbe des Glücks. Meodaris stellte sich auf einen Wagen, um einen erhöhten Standpunkt zu haben, erhob das Stabbündel hoch in die Luft und ließ sie dann auf das rote Tuch fallen. Atemlos vor Spannung wartete die Runde der vornehmen Krieger ab, was der alte Mann verkünden würde, der sich nun auf den Boden gehockt hatte und lange die genaue Lage der kreuz und quer durcheinander liegenden Stäbe betrachtet hatte.
„Das ist der Spruch der Götter zuerst für den Teil, der unter Führung von Genobauud, Marcomir und Sunno sich vom Draco der Sicambrier trennen und nach Westen an den Rhenus ziehen wird“, ließ sich Meodaris endlich vernehmen. „Diesem verheißen die Götter Ruhm und Sieg, reiche Beute. Auch harte Kämpfe mit den Römern kann ich hier sehen, Kämpfe mit Sieg, aber auch Kämpfe und Ruhm und Tod!“ „Der Tod ist jedem von uns gewiss“, kommentierte Marcomir gelassen den Spruch, „wenn es der Tod mit Ruhm sein soll, will ich ihn gerne annehmen!“
Noch einmal sammelte der Weissager die Stäbe auf, mischte sie im Bündel gründlich und ließ sie erneut von der Wagendeichsel aus fallen. „Das sagen die Götter für den Teil unseres Draco, der bei Marcomir, unserem Fürsten, bleiben wird. Ich sehe friedliches Leben, aber ich sehe auch Flucht, ich sehe einen weiten Weg immer nach Sonnenuntergang. Hier sehe ich eine Heirat – nein, es sind sogar zwei Heiraten. Ruhm, Zwietracht, Sieg über die Römer – und hier – ob ihr es glaubt oder nicht - sehe ich Stäbe, die sagen: einer der Nachfahren unseres Fürsten Marcomir wird ein Reich beherrschen, das ebenso mächtig sein wird wie das der Römer!“
…zu beider Seiten Nutzen
Drei Tage nach dem Beratungsfeuer versuchte der Draco der Sicambrier, irgendwie mit den tiefgreifenden Veränderungen fertig zu werden, die mit dem ertrotzten Abzug der „jungen Heißsporne“ eingetreten waren. „Junge Heißsporne“, so nannten manche alt – und wie sie glaubten, weiser - gewordenen Männer die Gruppe, die am Tag zuvor unter Führung der Prinzen Genobaud, Marcomir und Sunno das Lager verlassen hatten. Das bedeutete nicht nur einen Verlust an Menschen, sondern hatte auch Umstellungen in der Ordnung der Beziehungen zwischen den Kriegern, ihren Familien und den von ihnen Abhängigen, den Herden von Pferden, Rindern und Schafen und der Zahl der im Draco verfügbaren Wohnwagen zur Folge.
Jeder der drei jungen Angehörigen der Fürstenfamilie hatte zuvor eine Schwadron der schweren sicambrischen Reiterei kommandiert, je etwa vierzig Reiter. Von diesen waren zwar nur je fünf Männer mit ihren Anführern mitgezogen, die Angehörigen der jeweiligen Leibwache, die durch ganz besondere Schwüre der Treue mit ihren Herren auf Leben und Tod verbunden waren. Doch darüber hinaus hatten sich etwa weitere dreißig Krieger aus fast allen der zehn Schwadronen freiwillig zum Mitziehen gemeldet, das war Teil der Beschlüsse am Beratungsfeuer gewesen. Sie mussten sich allerdings zunächst von dem Treuegelöbnis entbinden lassen, das sie mit ihren Schwadronskommandeuren verband. Doch angesichts des so deutlichen Wunsches der jungen Leute war das nur eine Formsache.
Von den jungen Männern waren viele noch nicht verheiratet, daher begleiteten nur etwa dreißig Frauen und Kinder mit zusammen drei Dutzend Wagen den Zug. Doch nahmen die Krieger auch ihr Eigentum an Tieren mit, acht Dutzend Pferde und fünf Dutzend Kühe und einen Zuchtbullen. Das alles riss Lücken in die Schwadronen, die Familien und die Herden und den ganzen Ablauf von Aufgaben, die bisher nach erprobter Tradition auf viele Schultern verteilt waren und für Menschen und Tiere des ganzen Draco von lebenswichtiger Bedeutung waren.
*
Die Sonne hatte schon drei Viertel ihres Tagesbogens zurückgelegt, als ein Reiter der sicambrischen Vorausabteilung auf dampfendem Ross dem Fürsten Marcomir meldete, der thüringische Fürst Attahari mit Begleitung sei schon an der Furt über den Sala-Fluss. Kaum hatten Marcomir und seine zehn Leibwächter Zeit, sich gehörig in ihre Panzer zu werfen und ihre Waffen anzulegen, um den Gast gebührend zu empfangen.
Prüfend betrachteten sich die beiden Fürsten, als sie, jeder mit seiner Leibwache hinter sich, aufeinander zu ritten. Eigentlich sieht dieser Sarmate gut aus, dachte Fürst Attahari bei sich, kräftige Gestalt, schwarze Haare, nur der Bart ist anders gestutzt als bei uns. Was hat er da für merkwürdige Haarbüschel auf seinem Mantel?
„Ich grüße Euch, edler Fürst der Thüringer, auf Eurem eigenen Boden, aber zugleich im Kreise des sicambrischen Draco des sarmatischen Volkes!“ Fürst Marcomir benutzte recht passabel die Sprache der Thüringer, er wusste, dass er sich ihnen verständlich machen konnte, wenn er so sprach, wie er es von den Sueben im Norden der Donau (in Mähren und Böhmen) gelernt hatte. Mit diesen Nachbarn hatte einst der Kommandeur der 3. sarmatischen Ala des römischen Heeres häufiger Kontakt gehabt. Auch die Goten, die an sich östlich des Donau-Stroms in den großen pannonischen Steppen lebten, zusammen mit anderen Teilgruppen der Sarmaten, benutzten seltsamerweise eine ganz ähnliche Sprache.
Höflich geleitete Marcomir seinen Gast und dessen Begleitung in den Ring der Wagenburg, dorthin, wo nahe dem Platz für das Beratungsfeuer der Wohnwagen der Fürstenfamilie stand. Bei dem langsamen Ritt in das Innerste der Wagen-Spirale wurde dem Thüringerfürsten flau im Magen; diese Zuschaustellung exakter Disziplin und Ordnung des sicambrischen Draco war auch durchaus beabsichtigt. Allerdings beruhigte sich Attahari bei dem Gedanken an seine Geiseln. Prinz Dagobert, Marcomirs jüngerer Bruder und Kommandeur des Erkundungstrupps, der ihm die Einladung zu dem Treffen überbracht hatte, hatte zwei seiner wichtigsten Unterführer und entfernte Vettern als Geiseln in der thüringischen Hauptburg zurückgelassen. Sie würden erst wieder freigelassen werden, wenn Fürst Attahari und alle seine Begleiter heil wieder in der Heimat eingetroffen waren.
Einen Festschmaus würde es erst am späteren Abend geben, zum obligatorischen feierlichen Beratungsfeuer. Jetzt erhielten die Gäste erst einmal jeder einen Becher Kumys, jene gegorene Stutenmilch, die für alle Steppenhirten ein begehrter Rauschtrank war. Misstrauisch und mit großer Überwindung genossen die Gäste den Ehrentrunk.
In dem zwanglosen Vorgespräch vor dem abendlichen Beratungsfeuer legten die beiden Fürsten schon einmal fest, was sie in einem friedlichen Übereinkommen erreichen wollten. Wesentlich zurückhaltender waren sie dabei, was ihre jeweiligen Beweggründe für dieses Abkommen betraf. Fürst Marcomir legte dar, dass der Draco der Sicambrier , der so lange als Foederaten Wachtdienste im römischen Heer am Donau-Limes gehalten hatte, nun gerne wieder zur eigentlichen Beschäftigung der Sarmaten zurückehren wolle, nämlich friedlich Pferde und Rinder zu züchten, ohne noch auf Befehle der treubrüchigen Römer hören zu müssen. Das aber sei nur möglich außerhalb des Römischen Reiches, in einer Gegend, die ihren vielen Pferden, Rindern und Schafen genügend Weideflächen bot.
Er wisse, versicherte Fürst Marcomir, dass es im Land der Thüringer solche Weiden gebe, die noch keineswegs alle von den einheimischen Leuten in Anspruch genommen worden seien. Hier, so bitte er den Fürsten Attahari, würden sich die Sarmaten aus Sicambria gerne niederlassen und böten gute Nachbarschaft an. Die berühmte Pferdezucht der Sarmaten würde in Kürze zahlreichen und wertvollen Pferdenachwuchs hervorbringen, davon einen angemessenen Teil den gastgebenden Thüringern zur Verfügung zu stellen, würde eine Ehre für den Draco der Sicambrier sein.
Den Thüringerfürst Attahari führten ganz andere Überlegungen zu einer Zustimmung zu diesen Vorschlägen. Auch wenn die Sarmaten viele hundert Meilen von den Thüringern entfernt gelebt hatten, war doch ihr Ruhm als äußerst tapfere, im Ernstfall blutdürstige und eigentlich immer erfolgreiche Soldaten bekannt. Einem der berühmten Angriffsritte von mehreren hundert schwer gepanzerten sarmatischen Kriegern mit ihren langen Lanzen hätten die normalerweise zu Fuß kämpfenden Thüringer nichts entgegenzusetzen gehabt. Die Versorgung mit guten Pferden und Rindern, die Marcomir versprach, war für die Thüringer umgekehrt durchaus von Vorteil.
„Ich glaube auch, Fürst Marcomir“, fasste Attahari zusammen, „dass ein Übereinkommen, wie Ihr es vorschlagt, zu beider Seiten Nutzen sein könnte. Allerdings hätte ich da noch zwei Bitten, deren Berechtigung Ihr gewiss einsehen werdet. Einmal bitte ich Euch, dass nicht alle eure Leute sich an einer Stelle ansiedeln, das würde die Leistungsfähigkeit unserer Weidegebiete überfordern. Sondern sucht euch verteilt über das große Land der Thüringer die Plätze, wo ihr in kleineren Gruppen und mit kleineren Herden siedeln möchtet.“ Dem stimmte Fürst Marcomir bereitwillig zu, nur knüpfte er daran die Bedingung, dass der Zusammenhalt der Sicambrier als Volk dadurch nicht zerstört werden solle. „Und was ist Eure zweite Bitte, Fürst Attahari?“
Der Thüringer zögert erst ein wenig, ehe er mit seiner zweiten, noch viel wichtigeren Bedingung herausrückte: „Damit unsere beiden Völker auf Dauer in gutem Einvernehmen bleiben mögen, wäre es von Nutzen, wenn eure jungen Leute, Knaben wie Mädchen, für einige Jahre bei uns Thüringern lebten. Die Älteren braucht ihr ja als Hirten für eure Tiere, aber die Kinder vom zehnten bis zum fünfzehnten Lebensjahr, die solltet ihr jeweils zu uns Thüringern schicken, damit sie bei uns unsere Sprache und unsere Sitten lernen.“
Dieser kaum verhüllten Forderung nach der Gestellung von Geiseln, und zwar von Geiseln, die sich nicht selbst wehren konnten und formbar waren, hatte Fürst Marcomir derzeit nichts entgegen zu setzen. Er wusste, dass er im gegenwärtigen Augenblick der Schwächere war. So konnte er seinem künftigen Vertragspartner nur resigniert zugestehen, dass er auch mit dieser Forderung einverstanden war. „Wir werden das, was wir jetzt besprochen haben, gleich nachher am feierlichen Beratungsfeuer im Kreise Eurer Begleitung und unserer hervorragenden Azantanen bestätigen und über dem heiligen Feuer beschwören, Fürst Attahari“, schlug er vor.
Der Thüringerfürst war erleichtert, dass sein Gegenüber die beiden Bedingungen so überraschend widerspruchslos geschluckt hatte. „Ja, ich bin gerne damit einverstanden. Aber bitte, Fürst Marcomir, sagt mir doch zuvor noch, was der Draco eigentlich ist, von dem Ihr immer redet.“
„Der Drache, lateinisch Draco genannt, ist seit eh und je das Feldzeichen der sarmatischen Krieger“, erklärte Marcomir. „Er ist ein aus Kupfer geschmiedeter und vergoldeter Drachenkopf mit offenem Maul. Beim Reiterangriff könnt Ihr ihn sehen, auf einer Stange, getragen vom Standartenträger neben mir als Anführer, mit einem langen Schlauch aus Stoff, der sich im Sturm windet und knattert und allen Gegnern Furcht einflößt.“
Der sicambrische Fürst verhielt einen Augenblick, ihm ging in der Erinnerung das überwältigende Bild dieser langen Reiterfront durch den Kopf. Dann fuhr er mit geheimem Stolz fort in seiner Erläuterung. Draco, so heiße aber auch ein Regiment der sarmatischen Reiter. Immer zehn Schwadronen aus etwa 40 Reitern gehörten zusammen, und ein solcher Draco würde von einem Angehörigen des sarmatischen Königshauses befehligt. Auch er, Marcomir, sei der Nachkomme eines sarmatischen Königs.
„Die Schwadronen und ihre Unterteilungen stehen unter dem Befehl unserer Adligen, und die Krieger aus der unteren Kaste kommen alle aus Familien, die oft schon vor Generationen einem Vorfahren ihres adligen Herren einen Schwur der Treue und des Gehorsams geleistet haben. Das bindet die Krieger und ihre Befehlshaber ganz eng an einander, denn der adlige Herr ist auch seinerseits zu lebenslanger Treue und Fürsorge für seine Schwurgenossen verpflichtet. Allerdings darf ein Adliger niemals eine Frau aus der unteren Kaste heiraten, das ist bei uns Sarmaten seit undenklichen Zeit ein unverbrüchliches Gesetz.“
„Doch wir haben ja noch mehr als nur diese Krieger auf unseren Pferden und in unseren Wagen“, fuhr Fürst Marcormir in seiner Erklärung fort. „Dazu kommen die Frauen und Kinder unserer Krieger, und auch eine Reihe von Handwerkern und anderen Personen, die von uns Adligen abhängig sind. Diese Männer bilden im Kriegsfall zwei Schwadronen berittener Bogenschützen, und sie können gut mit ihren Bogen treffen, sage ich Euch! Alles in allem zählen wir Sicambrier etwa zweimal zehn mal zehn mal zehn Hände (2000)“, erläuterte der Sarmate und nahm seine Hände zu Hilfe, um die große Zahl zu verdeutlichen. Stolz fügte er hinzu: „Aber die Zahl unserer Pferde und Rinder ist viel größer, das kann ich Euch sagen!“
Der aufmerksam zuhörende Thüringerfürst gestattete sich einen Einwurf. „Ich danke Euch, Fürst Marcomir, dass Ihr meine Neugier so gut befriedigt habt. Aber sagt mir doch bitte auch noch, warum Euer Draco der sicambrische heißt.“
„Das ist einfach zu erklären“, meinte Marcomir. „Als wir ein Bündnis mit den Römern geschlossen haben – das war vor sieben Generationen zu Zeiten meines Vorfahren und Königs der Sarmaten Clogio, da hat der Sohn dieses Königs mit seinem Draco auf Bitten der Römer die Festung Sicambria bei Aquincum (Budapest) am Danubius bezogen . Seitdem haben wir sie bewacht. Für die Römer galt unser Draco als die 3. sarmatische Ala (Reiterregiment) und als die besten schweren Kavalleristen ihrer ganzen Armee. Es war eine sehr tapfere und sehr berühmte Ala, kann ich versichern!“
Nach einem Augenblick des Zögerns war Marcomir bereit, seinem Gast auch von einigen Gedanken zu erzählen, die ihm Sorge machten. „Leider sind wir nun schon lange entfernt vom Rest unseres Volkes, und wir sind nur eine ziemlich kleine Gruppe. Ich mache mir Sorgen darüber, was aus uns in Zukunft werden soll. Immerhin leben wir aber noch fast genauso wie unsere Verwandten weiter nach Sonnenaufgang zu, weil wir unsere Herden, unsere Frauen und die Familien der von unseren Adligen Abhängigen bei uns haben.“
Bedächtig nickte Attahari und schwieg eine Weile. Dann aber meinte er in etwas anzüglichem Ton: „Das war sehr eindrucksvoll, was Ihr mir da erzählt habt. Aber ich frage mich, warum sich dieser Draco jetzt hier in unserem Lande ansiedeln will, fernab von den Römern, für die ihr so viele Siege errungen habt.“
Ein wenig verlegen schwieg nun Marcomir einen Moment. „Das, lieber Fürst, ist eine ziemlich lange Geschichte. Darf ich Euch vorschlagen, dass unser Draco morgen zur Feier unseres Bündnisses und Euch zu Ehren ein ‚Feuer der Geister unserer Väter’ anzündet. Das ist ein Fest, das wir in größeren Abständen abhalten. Dann wird mein greiser Oheim Meodaris, der Oberpriester und Hotar unseres Volksteils ist, von den großen Taten unseres Volks der Sarmaten singen. Dann sollt Ihr auch erfahren, warum wir uns von den Römern getrennt haben.“
Das „Feuer, das die Geister der Väter beschwört“
Fürst Attahari und seine Leibwache hatten erstaunlich gut geschlafen in den für sie frei geräumten sarmatischen Wagen. Die reichlich vorhandenen Teppiche, Pelze und Kissen und die wasserdichten Filzdächer der hölzernen Karren hatten ihnen eine angenehme Nachtruhe in den ungewohnten Schlafstätten beschert. Eine Familie konnte durchaus gut leben in diesen fahrbaren Wohnungen, stellten die Thüringer erstaunt fest.
Während des Tages machten sich die thüringischen Krieger allmählich mit den Lebensgewohnheiten ihrer künftigen Nachbarn vertraut. Zwar kannte sich außer Fürst Marcomir niemand von den Sicambriern mit der Sprache der Thüringer aus, aber da alle wussten, dass man in der vergangenen Nacht am Beratungsfeuer sich gegenseitig gute Nachbarschaft und Freundschaft zugeschworen hatte, wurden Attahari und seine Begleiter überall freundlich begrüßt, wo auch immer sie sich bei den Wagen oder den Herden des sicambrischen Draco umsahen.
Als der Abend herannahte, sammelten sich alle Männer und Frauen des Wanderzuges auf einem Feld neben dem Wagenring. In der Mitte des Feldes stand ein Holzstoß, der mit einigen geheimnisvollen Zeremonien feierlich entzündet wurde. Nur die Kleinkinder durften in ihren Wagen schlafen, und einige Wachen mussten auch in der Nacht auf die Herden aufpassen. Für die thüringischen Ehrengäste hatte man aus Heu, Teppichen und Kissen eine Art Podest errichtet, dort nahmen auch Fürst Marcomir, sein Bruder Dagobert und einige ältere Schwadronskommandeure Platz.
Ein Schwertertanz von zehn sarmatischen Kriegern, wild und unheimlich zu den Klängen der Pauken, die sonst die Kommandos für die Manöver der Reiterkrieger gaben, und zweier primitiver Fiedeln, bildete den Auftakt für den feierlichen Abend. Dann suchte sich Meodaris einen erhöhten Sitzplatz auf einem der Wagen und begann seiner Leier melodische Töne zu entlocken.
Meodaris war der Oberpriester des Draco, so erläuterte Fürst Marcomir seinem Gast mit leiser Stimme. Er sei der einzige Mensch in diesem Kreis, der die Kunst des Lesens und Schreibens beherrschte, und zwar in griechischer Sprache. Diese Kunst, vor Jahrhunderten erlernt, als die Sarmaten noch in der Nachbarschaft der griechischen Städte am Pontus Euxeinos (dem Schwarzen Meer) lebten, wurde stets vom Oberpriester an seinen ausersehenen Nachfolger weitergegeben.
Außerdem war Meodaris der Hotar des Draco, der Sänger, der die uralten Lieder über die Taten der Vorväter in seinem Kopf bewahrte. Auch dieses Wissen wurde jeweils in langen Jahren dem Nachfolger eingeprägt. Denn diese Texte waren es, die zusammen mit dem feierlich entzündeten Feuer für das ganze Volk die Geister der Väter beschworen, die heroischen Vorfahren der sarmatischen Krieger. Nur alle paar Jahre veranstaltete man diese Zeremonie im Kreise des Draco der Sicambrier, umso aufregender war sie für alle Teilnehmer.
Meodaris hatte zwei große Lederhäute außen an seinen Wagen hängen lassen. Im ungewissen Licht des Feuerstoßes konnte man erkennen, dass sie uralt zu sein schienen, schon voller Löcher und Flicken und mit fast verblassten Schriftzeichen darauf. „Das ist die Liste meiner königlichen Vorfahren“, erklärte Marcomir seinem Gast mit Ehrfurcht in der Stimme, „es müssen etwa acht Hände voll davon auf diesem Leder stehen.“ Ununterbrochen über so viele Generationen zurück legten diese Lederstücke Zeugnis ab von der uralten Heldengeschichte der sarmatischen Könige und ihrer Nachkommen. „Ich bin stolz, dass meine Familie die ursprünglichen Lederhäute bewahren darf, mit den Namen darauf von meinem Vorfahren Antenor angefangen. Immer wenn ein neuer König oder jetzt Fürst die Herrschaft antritt, wird sein Name hier eingetragen. Einige meiner entfernten Vettern, die Fürsten anderer Dracones, müssen sich mit einer Abschrift von diesem Leder begnügen. Aber lesen und beschreiben kann sie nur unser Priester.“
Meodaris hatte nun die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gefunden, tiefes Schweigen lag über den vielen hundert Menschen. In altertümlicher sarmatischer Sprache begann er zu singen:
„Singe, Hotar, von der Zeit, als die Väter, die Helden noch lebten, bring uns im Feuer herbei ihren Mut, ihren Ruhm und ihr Wesen!“
Leise übersetzte Chlodio seinem thüringischen Gast den wesentlichen Inhalt der Worte des Priesters. Er hatte Zeit dazu, denn Meodaris pflegte immer nach ein paar Sätzen eine längere Pause zu machen, die er durch Töne aus seiner Leier ausfüllte.
Für Attahari mochten die etwas unzulänglichen Übersetzungsversuche Marcomirs nicht viel von den Stürmen der Gefühle wiedergeben, die die Strophen des Sängers bei den sarmatischen Zuhörern auslösten. Die Heldenzeit wurde hier wieder heraufbeschworen, als vor vielen hundert Jahren die Sarmaten aus den unendlichen Weiten der Steppen Asiens langsam nach Westen zogen, immer der Gegend zu, wo die Sonne unterging. Schon damals war das Volk geteilt in zwei Kasten, deren Angehörige sich niemals mit einander vermischen durften, die aber gleichzeitig durch gegenseitige Schwüre der Treue und des Zusammenhalts ganz eng und auf Dauer mit einander verbunden waren.
Das Gewoge der großen Rinderherden, die sie dabei mit ihren Pferden trieben, die Kämpfe mit Bären, Wölfen und Adlern waren plötzlich in der Vorstellung der Zuhörer wieder da, auch die Heldenzeit, als die Sarmaten auf die stammverwandten Skythen trafen und sich in zahlreichen Gefechten zu deren Herren machten.
Meodaris erinnerte an das Plündern der Schätze der Griechenstädte nördlich des Pontos Euxeinos (Schwarzes Meer), das aber allmählich in friedlichen und für beide Seiten nützlichen Handel mit den Erzeugnissen der Tierzucht oder des Handwerks überging. Begeisterte Rufe vor allen von den Frauen in der Zuhörerschaft mischten sich in das Lied des Hotar, als er die heldischen jungen Frauen der Sarmaten beschrieb, die einst auf dem Pferderücken an der Seite ihrer Brüder die Feinde verfolgten und sie mit ihren Pfeilen töteten. Damals war es Brauch, dass eine sarmatische Frau erst heiraten durfte, wenn sie mindestens einen Feind getötet und ihm die Kopfhaut als Zeichen ihres Sieges genommen hatte. Jetzt war das nicht mehr Sitte, und der Hotar ließ es offen, ob er das richtig fand oder nicht.
Doch dann kam eine Zeit, da die jungen sarmatischen Adligen eine neue Kampfart erfanden: Mit schweren, aus vielen Metallplättchen gefertigten Panzern und Helmen geschützt, jeder mit einer langen Lanze bewaffnet, traten mehrere hundert Reiter nebeneinander zum Sturm auf die Feinde an, eine Formation, der kaum ein Gegner gewachsen war. Das war auch die Zeit, in der die Frauen aufhören mussten mitzukämpfen, denn die Panzerrüstung und die schwere Lanze überstiegen doch die körperliche Leistungsfähigkeit der gewandten Frauen.
Später waren es nicht mehr die Griechen, sondern die Römer, deren reiche Gutshöfe und Städte die Begehrlichkeit der Sarmaten weckte. In derselben Zeit, als dieses Volk auf seiner Wanderung nach Westen in den weiten Steppen Pannoniens angekommen war, versuchten auch die Römer, sich über den Danuvius-Strom hinweg zu Herren eben dieser Steppen zu machen. Das hatte mehrere erbitterte Kriege zwischen Sarmaten und Römern zur Folge, aber auch Niederlagen der Sarmaten, die damit endeten, dass als Friedensbedingung mehrere Dracones der berühmten sarmatischen Reiterei unter römischen Befehl gestellt und in irgendwelche fernen Teile des Imperiums zur Kriegführung mit aufständischen Völkern dort geschickt wurden.
Doch danach kamen noch einmal friedlichere Zeiten, und da war es, während der Regierung des göttlichen Kaisers Diokletian, dass ein Draco der Sarmaten sich freiwillig zum Kriegsdienst bei den Römern meldete, angelockt von den Versprechungen reichen Soldes und der Möglichkeit, auch unter römischer Herrschaft so leben zu können, wie es für Sarmaten richtig schien. Das war der Anfang des Draco der Sicambrier. Denn bald nach diesem Schritt schickte der römische Befehlshaber diese Militäreinheit – die Römer nannten sie die „Dritte Ala der Sarmaten“ – nach Aquincum, der Hauptstadt der römischen Provinz Pannonia am Danuvius und ließ sie das Kastell Sicambria besetzen, das einige Zeit leer gestanden hatte (heute der Berg mit der ungarischen Königsburg im westlich der Donau gelegenen Teil Buda der Stadt Budapest). Dort am römischen Limes entlang der Donau brauchten die Römer stets tapfere Soldaten.
Dieses Kastell war nun für mehrere Generationen der Lebensmittelpunkt des Draco geworden, er bezeichnete sich danach als „der sicambrische“. Chlodio, Sohn des Theodomir und Vater des jetzigen Fürsten war schon seinem Vater als Oberkommandierender des Draco, nachgefolgt, als der römische Kaiser Valentinian (der Erste, 364 – 375) den Sicambriern einen ehrenvollen Befehl erteilte. Plündernde Alanen hatten von Dacia aus (heute Banat, Rumänien) die römischen Städte Sirmium und Singidunum (an der unteren Donau in der Nähe des heutigen Belgrad) angegriffen; vor den Gegenschlägen römischer Heere hatten sie sich in die unzugänglichen Sümpfe an der Donau (südlich von Budapest) zurückgezogen. Dort sollte sie nun die 3. sarmatische Ala aufstöbern und vernichten.
Nichts konnte den Sicambriern größere Freude bereiten, als die ihnen in Sprache und Lebensweise so ähnlichen, aber seit alters her verhassten Alanen bekämpfen zu dürfen. Der Draco erledigte diesen kaiserlichen Befehl in vorbildlicher Weise, und Kaiser Valentinian war so angetan davon, dass er den Sicambriern für zehn Jahre Steuerbefreiung versprach und sie die besten Kataphrakten (griechisch: Panzerreiter) in seinem Heer nannte. Elf Jahre war das jetzt erst her.
Doch was danach kam, war Unheil für die Krieger aus Sicambria. Da war doch im Herbst des vorigen Jahres ein römischer Steuereintreiber – Primarius ließ er sich nennen – mit einer kräftigen Leibwache im Kastell von Aquincum erschienen und hatte in höchst arrogantem Ton die Zahlung der üblichen Kopfsteuern von den sarmatischen Soldaten verlangt, Steuer statt Sold! Dabei hatte ihnen der Kaiser doch Steuerfreiheit versprochen! Ein Wort gab das andere, und das Ende der Geschichte war, dass eine Schwadron sicambrischer Reiter den Steuereinnehmer und seine Leibwache erschlugen.
Das hätten sie nicht tun sollen. Denn auf die Nachricht davon ließ der römische Dux, der Militärbefehlshaber der Provinz Pannonia, verschiedene, natürlich nicht sarmatische Truppenteile aus Nachbarprovinzen kommen und griff mit ihnen plötzlich die sarmatische Ala in Sicambria an. Diese wehrte sich kräftig und konnte auch vorübergehend die einstigen römischen Waffenkameraden abwehren; die Verluste bei diesen Scharmützeln waren auf beiden Seiten beträchtlich.
Aber Marcomir, der wenige Jahre zuvor seinem Vater als Fürst gefolgt war, erkannte schnell, dass seine Leute auf die Dauer für einen Erfolg gegen die vereinigten Streitkräfte des ganzen römischen Heeres in den Provinzen an der Donau zu schwach sein würden. Hier galt es nicht mehr „Ruhm und Sieg – oder Ruhm und Tod“, wie es sich für einen einzelnen sarmatischen Krieger ziemte. Sondern hier stand die Zukunft aller Menschen des ganzen Draco auf dem Spiel.
Daher hatte im Frühjahr dieses Jahres Fürst Marcomir befohlen, alle Herden, alle Wagen und alle Menschen so schnell wir möglich über die Donau zu bringen. Die sarmatischen Wohnwagen waren wie Flöße mit Bordwänden konstruiert, weil auf ihren Wanderungen immer wieder Flüsse zu überqueren waren. Daher gestaltete sich dieser geplante Rückzug als nicht allzu schwierig, angesichts der strikten Ordnung und Disziplin, die seit alters her bei den sarmatischen Kriegern und ihren Familien herrschten.
Seit dem Frühsommer dieses Jahres war nun der Draco der Sicambrier auf dem Marsch. Durch die Wohngebiete der im Norden benachbarten Sueben entlang der Flüsse Morawa (March) und Albis (Elbe, im mährisch-böhmischen Becken) zog man so rasch wie möglich durch, gegen eine angemessene Entschädigung in Form einiger Rinder an die Herren dieser Regionen. Nachdem man in einem Geschwindmarsch die Felsenenge durchquert hatte, in der die Albis das Gebirge durchbrach (Elbsandsteingebirge), war man auf der Suche nach einer geeigneten Gegend, wo man sich auf Dauer niederlassen konnte. Schon in weiter Entfernung hatte Marcomir vom Land der Thüringer gehört, wo die Weiden fruchtbar und die Menschen nicht allzu zahlreich sein sollten.
Erschöpft und heiser von dem stundenlangen Vortrag seines Liedes schwieg Meodaris, der Hotar, endlich. Beifälliges Gemurmel wurde im Kreis seiner Zuhörer laut. Auch Marcomir war froh, dass seine Arbeit als Übersetzer vorerst beendet war. Aber leise fügte er zu seinem Sitznachbarn Attahari hinzu: „Nun wisst Ihr, edler Fürst der Thüringer, warum unser Draco auf dem Marsch ist und warum wir uns so sehr wünschen, in Frieden hier bei euch Thüringern leben und unsere Tiere züchten zu dürfen!“
Kapitel 2
In fremder Nachbarschaft
389 – 396 n. Chr.
Die Römer im Sumpf
An der Ruhr beim heutigen Essen, Wintersonnenwende 389 n. Chr.
Von hier oben hatte man eine wunderbare Aussicht über die Sümpfe und Wälder, in denen sich noch kurz zuvor die Krieger der Brukterer und der Sicambrier tagelang mit den Römern herumgeschlagen hatten. Es war geradezu lächerlich gewesen, wie diese armen, mit eiserner Rüstung und Waffen schwer behängten römischen Soldaten, die man auf Schwertkämpfe in Reih und Glied auf freier Ebene trainiert hatte, in diesen dunklen Wäldern hoffnungslos unterlegen waren, wo jeder Schritt auf den schmalen Pfaden in Sümpfe führen konnte. Immer wieder waren die römischen Fußtruppen auf ihrem Vormarsch auf Verhaue aus Baumstämmen und Gebüsch getroffen, und plötzlich prasselten von allen Seiten Pfeile auf sie ein, die nur allzu oft trafen, und sie hörten laute Schreie, die ihnen das Blut in den Adern erstarren ließen. Aber fränkische Krieger bekamen sie selten zu sehen. Kein Wunder, dass die Römer nach einigen Tagen verzweifelt umgekehrt waren und zusahen, dass sie wieder offenes Land gewannen.
Dort hatten sie in aller Eile mit einem Erdwall ein provisorisches Lager errichtet, in dem sie sich sicher fühlten. Durch Parlamentäre luden die römischen Anführer die militärischen Befehlshaber der Franken zu Friedensverhandlungen, die dann auch stattfanden und mit dem üblichen Austausch von Eiden abgeschlossen wurden, man wolle sich in Zukunft nicht mehr gegenseitig überfallen. Danach zogen die römischen Truppen sich schleunigst in ihre Winterquartiere in den warmen Kasernen in Augusta Treverorum (Trier) zurück. Außer einigen niedergebrannten fränkischen Dörfern hatten die Römer keine „Siege“ zu verzeichnen.
Es war dieser Ausgang des Feldzuges der römischen Befehlshaber Carietto und Syrus, den die Anführer der vereinigten fränkischen und sicambrischen Krieger feiern wollten, jetzt, da der Tag der Wintersonnenwende unmittelbar bevorstand. Von der Burg des Brukterer-Häuptlings Arbito hoch oben über dem Fluss Rura (etwa bei der heutigen „Villa Hügel“ in Essen) hatte man diesen Blick auf Wald und Sümpfe. Dicht hinter der Holzpalisade der Burg ging es steil hinunter zum Fluss Rura, und auf der anderen Seite des Stromes , nach Mittag zu, lagen die Hügel und sumpfigen Bachtäler, die so dicht bewaldet waren und somit die natürliche Falle für die römischen Truppen bildeten, selbst jetzt im Winter, da die Bäume ohne Laub standen.
Die von den Römern zusammenfassend Franken genannten Stämme am Ostufer des Rheins lebten mit dem mächtigen Reich auf der anderen Stromseite in einem häufig wechselnden Verhältnis. Etliche Jahre lang gab es friedlichen Handel und geradezu freundschaftliche Beziehungen. Viele junge Leute ließen sich von den Römern als Soldaten anwerben, manche davon brachten es bei den Römern zu hohen Stellungen. Der entfernte Oheim des Brukterer-Häuptlings, er hieß Arbogast, war in der Kaiserresidenz Augusta Treverorum, wie es hieß, sogar der Oberbefehlshaber aller römischen Truppen. Aber dann wieder packte manchen Krieger der Franken der Übermut, und sie schlossen sich zu Banden zusammen, um wieder einmal die reichen Gefilde am Westufer des Rheins zu plündern. Das zog dann häufig Einfälle römischer Soldaten in das freie Gebiet der Franken nach sich.
Vor ein paar Jahren waren drei sarmatische Adlige, begleitet von etlichen Kriegern, deren Familien und einer Herde Pferde und Rinder hier bei den Franken aufgetaucht. Sie besetzten einige nicht benutzte Weideplätze, und die fränkischen Bauern in der Nachbarschaft unternahmen nichts dagegen. Die Fremden pflegten in der Folgezeit gute Nachbarschaft, machten sich bei den Franken nützlich und waren voll Hass und Rachegefühlen gegen die Römer. So hatten sie anfangs verschiedene kleinere Einfälle von Gefolgschaften über den Rhein hinüber geführt und dabei immer mehr fränkische Krieger daran beteiligt. Sie waren sehr einträglich für die Teilnehmer verlaufen.
Als nun vor zwei Wintern die Römer zu einem größeren Gegenangriff ansetzten, wählten die Vertreter der Dörfer der Brukterer den einen dieser sarmatischen Adligen, Marcomir, zu ihrem Herizogo (Heeres-Anführer), weil man ihn als den Erfahrensten im Kampf gegen die Römer schätzte. Auch das war gut für die Brukterer verlaufen, wie man bereits im vorigen Jahr und auch dieses Jahr wieder mit dem schmählichen Abzug der Römer gesehen hatte. Die Nachbarn der Brukterer, die Chattuarier, die nördlich der Lupia wohnten, waren mit etlichen Kriegern zu Hilfe gekommen; sie standen ebenfalls unter Führung eines sarmatischen Adligen, der Sunno hieß. Das alles hatte das Ansehen der fremden Krieger unter den Franken erheblich wachsen lassen.
Aber Häuptling der Brukterer war deshalb Marcomir noch keineswegs. Bei aller erfolgreichen Waffenbrüderschaft wäre es diesem Stamm nicht eingefallen, sich auch im Frieden von einem Fremden regieren zu lassen. Das tat noch immer Arbito, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er ein Verwandter des römischen Militärbefehlshabers Arbogast war, der die Franken mit dem Hass des Abtrünnigen zu verfolgen schien. In den Augen der Römer galten allerdings die Fremden Marcomir, Sunno und Genobauud als die „Regales“ (Kleinkönige) der Brukterer und Chattuarier, das wusste man von aus den Kämpfen in Gefangenschaft geratenen römischen Soldaten. Mit diesen Anführern hatten auch die römischen Befehlshaber Charietto und Syrus über den Waffenstillstand verhandelt.
Arbito, der Bruktererhäuptling, wusste, was er dem stolzen Sicambrer schuldig war. Er hatte ihm gerne die drei Häuser in seiner Burg hoch über dem Tal der Rura zur Verfügung gestellt, um hier das Fest des Winterfeuers zu feiern. So fremd die Sicambrier immer noch den Brukterern erschienen, so hatten die Einheimischen doch mit Erstaunen festgestellt, dass die Bräuche für dieses höchste Jahresfest bei beiden Völkern gar nicht zu verschieden waren. „Winterfeuer“ nannten die Sicambrier das Fest, aber die Art, wie sie es feierten, waren der der Brukterer durchaus ähnlich. Man opferte den Göttern, man tanzte und sang, man schmauste Leckerbissen, die es sonst das ganze Jahr nicht gab, und Familienangehörige, die sich vielleicht lange nicht gesehen hatten, bemühten sich, das Fest gemeinsam zu feiern. Bei den Brukterern und den anderen Stämmen in der Umgebung dauerte allerdings das Julfest länger, man beging es zwölf Nächte lang.
So war auch verabredet, dass Marcomirs Vetter Sunno dazu kommen würde, der bei dem Volk der Chattuarier nördlich der Lupia eine ähnliche Stellung errungen hatte wie Marcomir bei den Brukterern. Jetzt noch vor knapp einem Mond hatten sie gemeinsam mit ihren fränkischen Kriegern und der sarmatischen Begleitung der beiden Kriegsanführer die Römer zum Rückzug gezwungen. Sunno war danach mit seinen Leuten zurück in deren Heimat gezogen, aber er hatte versprochen, zur Feier des Winterfeuers wiederzukommen. Es hatte es ja nicht so weit.
Den jungen Neffen Genobaud hatte Marcomir schon seit drei Wintern nicht mehr gesehen. Anfangs, als die drei sicambrischen Prinzen mit ihrer kleinen berittenen Begleitung versuchten, unter den fränkischen Nachbarn der Römer östlich des Rheins Fuß zu fassen, da hielten sie noch eng zusammen. Gemeinsam hatten sie kleinere Einfälle in das Römerreich angeführt und römische Gutshöfe links des Rheins geplündert.
Doch später hatte sich Genobaud unter den Stämmen am rechten Rheinufer umgesehen, ob auch für ihn eine eigenständige Rolle als Herizogo zu finden sei. Tatsächlich gelang es ihm, Gast der Königsfamilie eines Volkes zu werden, das seltsamerweise einen ganz ähnlichen Namen führte wie der Draco der Sicambrier. Cugerner oder auch Sigambrer nannte sich dieses Volk. Es lebte nördlich der Mündung der Lupia (Lippe) in den Rhein, zum größten Teil allerdings westlich des Stromes im Gebiet der Römer. Nur die Königsfamilie mit einer Reihe von Gefolgsleuten hatte in einem unzugänglichen, von Sümpfen und Wasserläufen geschützten Gebiet östlich des Rheins Zuflucht gefunden, und bei ihr hielt sich Genobaud seitdem auf. Es hieß, diese sigambrische Königsfamilie sei in einer ganz besonderen Weise heilig und stamme von Göttern ab. Genobaud hatte durch Boten immer wieder einmal Kontakt mit seinen Verwandten Marcomir und Sunno gehalten und jetzt versprechen lassen, er werde sie zur Feier des Winterfeuers bei den Brukterern besuchen.
Pünktlich einen Tag vor dem Fest trafen Genobaud und Sunno auch tatsächlich in der Burg des Arbito hoch über der Rura ein. Das bisschen Schnee, das inzwischen gefallen war, hatte ihre Fahrt mit den sarmatischen Wagen nicht aufgehalten. Genobaud hatte nur drei und Sunno nur zwei Tage für den Weg gebraucht, jeweils mit drei ihrer vertrautesten Leibwächtern. Sie hatten dabei die uralten Herwege benutzen können, die die Stammesgebiete der Franken rechts des Rheins miteinander verbanden und zielgenau jeweils zu den Furten führten, wo man die Nebenflüsse des großen Stromes ungefährdet überqueren konnte. Diese Wege waren allerdings nur Ortsansässigen bekannt. Nun freuten sich die Verwandten, sich nach langer Zeit wiedersehen und ausführlich sprechen zu können.
Mit einem Krug gallischen Weines, den einer der Prinzen im letzten Sommer bei einem Überfall auf ein römisches Landgut nördlich der Colonia Agrippina (Köln) erbeutet hatte, saßen die drei Adligen am Abend des Winterfeuers behaglich zusammen. Auf dem Herd des kleinen Fachwerkhauses, das sonst der Wohnsitz des Häuptlings Arbito war, wenn er sich auf seiner Burg aufhielt, brannte ein wärmendes Feuer. „Seltsam“, sprach Marcomir die Gedanken der beiden anderen laut aus, „seltsam, wie wir Sarmaten jetzt in einem Haus sitzen, das uns früher wie ein Grab vorgekommen wäre, statt um ein großes Lagerfeuer im Freien im Innersten unseres Wagen-Ringes!“
„Ja“, stimmte Genobaud zu, „ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, in einem Haus zu leben, wo nicht nur ein halbes Dutzend Menschen herumwimmeln, sondern auch noch Kühe, Schafe und sogar Pferde stehen und ihr Futter mampfen, wenigstens im Winter. Tiere gehören doch auf die Weide!“
Sunno nahm das Stichwort auf. „Das weite Land, auf dem unserer Herden einst an der Donau ihr Futter suchten, das fehlt mir hier schon. Hier gibt es überall nur kleine Felder, auf denen die Bauern arbeiten, und kleine Stücke freier Wiesen zwischen den Wäldern, und sonst immer nur Wald und Sumpf, Sumpf und Wald.“
„Ja, wir haben lernen müssen, auch anders zu kämpfen als wir es einst in Sicambria geübt und auch ausgeführt haben“, warf Marcomir ein. „Hier nützen uns unsere gepanzerten Pferde und unsere langen Lanzen nichts, weil wir keinen Platz zum Reiten in breiter Front haben, selbst wenn wir viele hundert Reiter hinter uns hätten und nicht gerade ein Dutzend, wenn es hoch kommt.“
Sunno sah aber auch die vorteilhaften Seiten ihres jetzigen Lebens. „Ihr müsst aber doch zugeben, dass wir uns erfolgreich umgestellt haben. Wir haben Ruhm und Sieg errungen, Jahr um Jahr, gegen die Römer, und wir konnten große Beute machen. Allerdings, ich muss zugeben, dass ich es mir abgewöhnt habe, den von mir getöteten Feinden die Kopfhaut mit den Haaren abzuziehen, denn meine fränkischen Krieger und Freunde verabscheuen diesen Brauch allzu sehr. Jedenfalls, es ist eingetreten, was uns die Stäbe der Weissagung einst am Beratungsfeuer im Kreis unseres Draco an der Sala – erinnert ihr euch? – vorausgesagt haben: Ruhm und Sieg haben wir errungen!“
Genobauud war der jüngste der drei, aber dennoch vielleicht der, der in der Lage war, am weitesten voraus zu denken. Nachdenklich meinte er: „Die Stäbe haben uns aber auch Ruhm und Tod vorausgesagt, vergesst das nicht! Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Unser Feuergott Marha möge uns dann beistehen und dafür sorgen, dass wir einen Tod finden, der einem Azantanen aus dem Volk der Sarmaten würdig ist. Lasst uns darauf mit römischem Wein anstoßen!“
Fürstliche Hochzeit
Bei Hamminkeln/ Niederrhein (Krs. Wesel) Juni 394
Der junge Mann trat vor die Tür und schaute nach dem hoch stehenden Mond am Nachthimmel. Zwei Tage konnten es nur noch bis zum Vollmond dauern, dem letzten Vollmond vor der Sommersonnenwende dieses Jahres. Übermorgen würden er, seine Braut und die beiderseitigen Familien das Fest des Brautlaufs begehen. Das war schon ein Anlass, um die Gedanken schweifen zu lassen.
Faramund blickte sich im bleichen Mondlicht um und atmete tief ein. Leise rauschte der Wald, der in einiger Entfernung seines Hauses stand. Ihm war der nahe Wald seit seiner Kindheit vertraut. Aber war dieses Haus auch seine Heimat? Aus den Erzählungen seiner Eltern wusste er, dass er vor knapp 17 Wintern in einer völlig anderen Gegend geboren worden war, im römischen Kastell Sicambria am Fluss Donau in Pannonien. Doch bald danach war er als kleines Wickelkind mit den Eltern und dem ganzen Draco der Sicambrier auf eine lange Fahrt gegangen, wohl behütet im sarmatischen Ochsenwagen seiner Eltern. Später hatte er dann ein paar Jahre bei den Brukterern nach Mittag zu gelebt, doch dann war der Vater Genobaud hierher zu den Cugernern gezogen und hatte Frau und Kind mitgenommen. Seit neun Wintern lebte die Familie nun hier. An die Zeit davor hatte Faramund praktisch keine Erinnerung mehr.
Hier stand das Bauernhaus aus Fachwerk, in dem seine Familie wohnte, umgeben von den Katen für die Gefolgschaft seines Vaters Genobaud, das Dutzend Krieger und ihrer Familien, die ihren Herren seit der Trennung vom Draco der Sicambrier stets begleitet hatten. Das väterliche Haus nannte man den „Stallmannshof“. Von den anderen Höfen in der Umgebung unterschied es sich nur, dass es einen Anbau hatte, unter dem der alte sarmatische Wohnwagen gegen den häufigen Regen geschützt stehen konnte. Doch der wurde nur noch sehr selten gebraucht.
In einer Viertelstunde Entfernung stand das etwas größere Haus, der Fronhof des Thiud-rix (eine Art Priester-König), dem sein Vater Genobauud vor Jahren Treue und Gefolgschaft geschworen hatte. Als Folge davon hatte der sarmatische Fürstensohn dieses Haus hier beziehen dürfen, ganz in der Nähe seines neuen Gefolgschaftsherrn. Genobaud hatte an dessen Hof eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe: er musste mit Unterstützung einiger Männer aus seiner Gefolgschaft den Pferdestall dort betreuen, weil er als gebürtiger Sarmate sich am besten mit Pferden auskannte. Er selbst trug in der kleinen Hofhaltung seines Herrn den Titel Mare-skalk (wörtlich „Pferde-Knecht“, Marschall, viel später als fränkisches Hofamt Befehlshaber der Kavallerie).
Zum edlen Gefolge dieses Stammesfürsten gehörte noch ein halbes Dutzend anderer Adliger aus der Stamm der Cugerner, sie lebten auf Höfen ähnlich wie dem ihren in einem großen Kreis rund um die Hofhaltung des Thiudrix . Alle diese Familien, jeweils unterstützt von wenigen Schalken und Mägden (abhängige Knechte, aber keine Sklaven), hatten besondere Ämter am Fronhof ihres Herrn. Im Übrigen ernährten sie sich von den Erträgen ihrer kleinen Äcker und von der Zucht von Rindern, Schafen und Schweinen - und bei Genobaud zusätzlich auch von guten Pferden. Milch, Fleisch, Häute und andere Erzeugnisse der Tierzucht konnten die Leute hier teilweise an die Römer verkaufen, die eine Tagereise weiter nach Sonnenuntergang und jenseits des Rhein-Stromes in steinernen Häusern wohnten..
Einst, so hatten die Nachbarn dem jungen Faramund erzählt, gab es dort eine schimmernde Stadt mit einer hohen Mauer rund herum und Gebäuden aus Steinen, unzähligen Menschen, mit einem Kastell voller römischer Soldaten. Doch seit mehreren Generationen lagen dort die meisten Häuser in Schutt und Asche, seit fränkische Krieger sie überfallen, ausgeplündert und angezündet hatten. Heute lebten nur noch wenige Römer in der Stadt. (gemeint ist die große römische Stadt Colonia Ulpia Traiana, CUT, und das römische Militärlager Vetera, dicht beim heutigen Xanten, am westlichen Rheinufer).
Auch die Cugerner, bei denen Faramund jetzt wohnte, hatten einst der römischen Herrschaft unterstanden, die meisten Menschen dieses Stammes siedelten auch heute auf der westlichen Seite des Rheins in den großen Wäldern, schon seit vielen, vielen Generationen. Nur ihr Oberhaupt, den man Thiudrix nannte, hatte es verstanden, sich im unzugänglichen Gelände zwischen Wasserläufen, Sümpfen und Wäldern östlich des Stromes einen Hof zu bauen und seine engsten Gefolgsleute dort um sich zu scharen. Auch dies war schon vor sehr langer Zeit geschehen, seit die Cugerner hier überhaupt ansässig waren. Dort hatten Römer nie viel zu sagen gehabt, und seit mindestens zwei Menschenaltern hatte sich an diesem Platz auch niemand von diesem Volk mehr sehen lassen, kein Soldat und kein Händler.