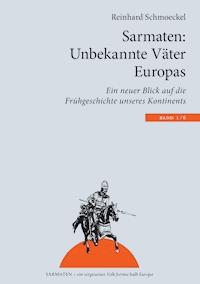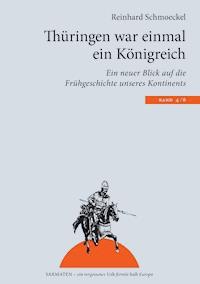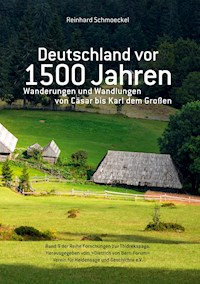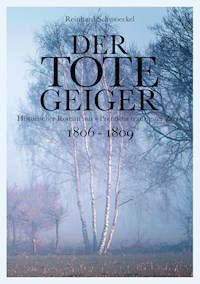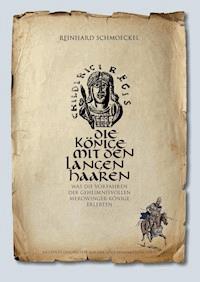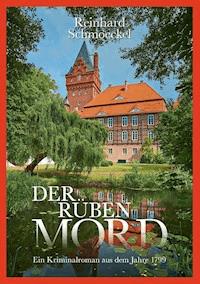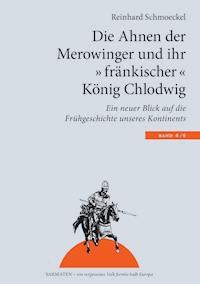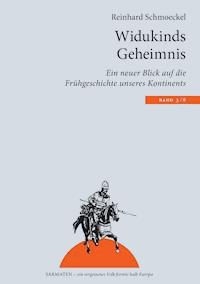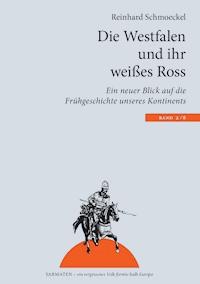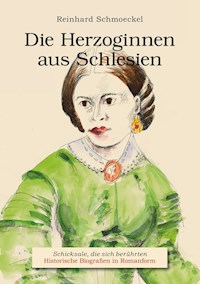
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kein Roman, sondern echte Geschichte, kein langweiliges Sachbuch, sondern spannende Schilderung des Lebens einiger Mtglieder des ehemaligen württembergischen Königshauses, die allerdings im fernen Schlesien aufwuchsen, sowie eines evangelischen Pfarrers, deren Schicksale sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf merkwürdige Art beührten. Ein Blick in das Jahrhundert unserer Urgroßeltern, wie man es nicht kennt. Wie gingen damals Mitglieder der höchsten Gesellschaftsschicht mit Abkömmlingen von Bauernknechten um ? Und wie konnten sich intelligete Mitglieder der unteren Schichten empor entwickeln ? Das Schicksal von manchen dieser Adligen war so aufregend, dass es einfach beschrieben werden musste. Das Buch hat den Vorzug, in allen EInzelheiten auf tatsächlich "geschehener" Geschichte zu beruhen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Teil I: Ein fleißiger junger Mann in Westfalen, ein verdienter General im Ruhestand in Schlesien
Eine neue Generation auf dem Hof
(1829)
Ankunft im Altersruhesitz
(1829)
Fast ein Zarensohn
(1830)
Ein kleiner Schlaukopf
(1834)
In der Schule
(1837)
Eine Oper, komponiert von Herzog Eugen
(1840)
Gelernt, was möglich war
(1843)
Im Herforder Gymnasium
(1847 – 1852)
Studentenleben
(1852 – 1856)
Der General und seine Schlachten
(1857)
Eine Privatschule als vorübergehender Broterwerb
(1858)
Teil II Fünf Jahre am Sitz der Herzöge von Württemberg im Schloss Carlsruhe in Schlesien
„Hier ist alles anders als sonst!“
(1858)
„Jetzt wird’s ernst!“
(1858)
Pädagogische Fortschritte
(1858 – 59)
Standesherren und freie Bauern
(1859)
Probleme bei der Erziehung von Prinzen
(1859)
Unbotmäßigkeit oder Heldenmut?
(1860)
Das „Jahrhundertfest“ (
1861)
Ein pädagogisches Gutachten
(1861)
Westfalen, Schlesier, Württemberger
(1861)
Die Reise ins Reich des Rübezahl
(1863)
Träumereien zwischen Kopf und Herz
(1863)
Der Wohltätigkeitsball
(1863)
Flucht vor der Liebe – aus Liebe
(1863)
Den wahren Grund verschleiern
(1863)
Liebeskummer
(1863)
„Wer sündigt, muss bestraft werden“
(1863)
Das Ende der Prinzen-Schule
(1863)
Teil III: Vier Herzogskinder und ein Pfarrer – Was für ganz verschiedene Schicksale!
Eine Hilfspredigerstelle muss für die Heirat reichen (
1863 – 1870)
Eine Verlobte muss auf ihre Ehe warten
(1863)
Mit den Preußen, gegen die Preußen, Hauptsache, noch nicht verheiratet
(1863 – 1868)
Die Annäherung des Herzogs Wilhelm an den Königshof zu Stuttgart
(1864
–
1870)
Verheiratet und doch einsam
(1868 – 1875)
Eine Pfarrstelle mitten im Ravensberger Land
(1870-80)
Ein junger Offizier wird Schwiegersohn des Königs
(1870 – 1874)
Das kurze Eheglück der Herzogin Wera
(1874 – 1876)
Reise zu den Verwandten
(1875)
Herzog Wilhelms plötzlicher Tod
(1876)
Die Reise ans Schwäbische Meer
(1876)
Nach Krakau versetzt
(1877)
Schicksalsträchtiger Besuch in Breslau
(1878)
Ein Verzicht, der eine Erlösung war
(1880)
Zwischen Slowaken und Ungarn
(1882)
PaulinesWeg zur „roten Prinzessin“
(1885 – 1890)
Die Silberhochzeit
(1889)
Altersjahre und Abschiede
(1890 – 1915)
Nachwort
Vorwort
Die bekannte Autorin historischer Romane, Petra Durst-Benning, hat in ihrem Buch „Die russische Herzogin“ (Ullstein Verlag 2010, Taschenbuch 2012) einen Herzog Wilhelm Eugen von Württemberg beschrieben und auch seinen Charakter gut angedeutet. Er war um das Jahr 1875 für wenige Jahre Ehemann der Heldin ihres Buches, der „russischen Herzogin“ Wera. Die darin geschilderten historischen Ereignisse spielten sich in der höchsten in Deutschland vor 160 Jahren denkbaren Gesellschaftsschicht ab, der Familie eines leibhaftigen Königs, und zwar der des Königs von Württemberg in Stuttgart.
Die Schwester dieses Herzogs Wilhelm hatte jedoch für kurze Zeit eine romantische Beziehung zu einem Mann aus der damals „untersten Klasse“, dem Sohn eines Bauernknechts. Sie hieß Prinzessin Wilhelmine von Württemberg (im Buch von Frau Durst-Benning kommt sie nicht vor). Diese Romanze zwischen zwei jungen Menschen aus so verschiedenen Gesellschaftsschichten war jedoch alles andere als die phantasiereiche Erfindung eines Romanschriftstellers.
Es ist eine merkwürdige Schicksalsfügung, dass in der Familie der Frau des Autors dieses Buches handgeschriebene Briefe (richtiger: nur Entwürfe dazu) aus dieser Zeit aufbewahrt worden sind. Zum Teil haben sie mit dieser Prinzessin zu tun. Sie waren verfasst worden von einem gewissen Christoph Becker, und dieser war der Großvater der Frau des Autors. Erst im Jahr 2018 gerieten die Briefe genauer in das Blickfeld des Autors dieses Buches, wurden mühsam entziffert und bestätigten plötzlich die historische Realität der seit langem in der Familie umgehenden Legende, der Ahne habe als Hauslehrer in einem Fürstenschloss eine Romanze mit einer jungen Frau aus dem Hochadel gehabt.
Zugleich boten diese alten Dokumente einen überraschenden Einblick in die charakterliche Entwicklung des Prinzen Wilhelm Eugen (zeitweise fast Anwärter auf den württembergischen Königsthron), denn Christoph Becker war mehr als zehn Jahre vor dessen Heirat der Lehrer der Prinzen-Geschwister im kleinen Schloss Karlsruhe (damals Carlsruhe geschrieben) in Oberschlesien. Dabei lernte er auch die Schwester Pauline der beiden Prinzen kennen, die er unterrichtete; doch die war damals noch ein kleines Kind. Viel später erlebte diese kleine Schwester ein für Mitglieder des deutschen Hochadels eigentlich undenkbares und höchst außergewöhnliches Schicksal
Diese Entdeckung war der Anlass für den Autor, einen weiteren Teil der Geschichte seiner Vorfahren und der seiner Kinder als „historische Biographien in Romanform“ niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Eigentlich sind es sechs Biografien: nämlich von drei Herzögen und zwei Herzoginnen von Württemberg („Schlesische Linie“) und einem evangelischen Pfarrer aus Westfalen, vereint durch kurze, aber zum Teil intensive Berührungen während ihres Lebens. Weitere Recherchen während der Arbeit an diesem Buch brachten nämlich ans Licht, welch hochinteressanten und zugleich völlig verschiedenen Schicksale gerade auch die hohen Adligen hatten, die damals zeitweise im schlesischen Schloss Carlsruhe gelebt hatten und zusammen genommen mehr als ein Jahrhundert überdecken. Es schien sich zu lohnen, ihr Leben der Vergessenheit zu entreißen, weil sie aufschlussreiche Einblicke in historische Vorgänge und Zustände in Deutschland vor mehr als 150 Jahren bieten.
Den Lesern im 21. Jahrhundert sind die meisten davon mit großer Wahrscheinlichkeit völlig unbekannt. Insofern stellt dieses Buch einen Beitrag zur verständlichen Beschreibung der Geschichte unseres Landes in einem Jahrhundert dar, das noch gar nicht so lange vergangen ist. Daher sind sie vielleicht bei vielen Deutschen als Lesestoff willkommen, auch dann, wenn sie die Bücher nicht als Geschichte der eigenen Familie lesen. Nur wenig an der „Verpackung“ ist schriftstellerisches Erzeugnis, der große sachliche Kern ist jedoch reale Geschichte – genau wie bei den Büchern von Petra Durst-Benning.
Anders als in historischen Romanen sind in diesem Band sogar zahlreiche Illustrationen möglich: er ist ja auch kein Roman!
Dortmund, Frühjahr 2019 Reinhard Schmoeckel
Teil I
Ein fleißiger junger Mann in Westfalen und ein verdienter General im Ruhesitz in Schlesien
Eine neue Generation auf dem Hof
Holtkamp b. Isselhorst (Westfalen), Juni 1829
Zur Geburt seines Neffen kam der Hofbauer selbst in den Kotten 1 seines Bruders Caspar, um zu gratulieren. Normal war das nicht, dass der Bauer persönlich zu seinem Heuerling 2 ging, doch heute war immerhin eine neue Generation in das Leben der Familie Hermbecker getreten, da musste man doch wohl mal eine Ausnahme von dem Brauch machen, der ohne viele Worte bei den Bauern eingehalten wurde, dass nämlich der Heuerling zum Bauern zu kommen hatte, und nicht umgekehrt.
Immerhin war der Vater des neuen Kindes, der Heuerling Caspar Hermbecker, der ältere Bruder des Hofinhabers Heinrich. Nur das im Ravensberger Land 3 seit Urzeiten gültige Jüngsten-Erbrecht hatte dazu geführt, dass Heinrich als der jüngste Sohn und nicht Caspar als der älteste Sohn ihres gemeinsamen Vaters Heinrich zum Erben des Hofs wurde. Dieses Erbrecht sorgte dafür, dass die Bauernhöfe und ihr Landbesitz über viele Generationen zusammenblieben. In manchen anderen Teilen Westfalen galt das Ältesten-Erbrecht, und das hätte Caspar und nicht Heinrich zum Erben des Hofes gemacht. Dieses Bewusstsein sorgte dafür, dass zwischen dem Bruder als Hofinhaber und dem Bruder als Knecht auf dem Hof kein Standesdünkel herrschte, sondern ein normales brüderliches Verhältnis, wenn auch klar war, dass der eine dem anderen Anweisungen für die Arbeit zu geben hatte.
Immerhin war das westfälische Erbrecht – egal ob es den ältesten oder den jüngsten Sohn des Bauern zum Erben machte – der Grund dafür, dass die Höfe nicht im Laufe weniger Erbfälle in winzige, nicht mehr sinnvoll zu bewirtschaftende Landsplitter zerteilt werden mussten. Man wusste selbst auf dem Land im Ravensbergischen, dass in manchen anderen Teilen des alten Reiches 4 andere Erbregeln herrschten, die eine ständige weitere Aufteilung des bäuerlichen Landbesitzes und damit eine ungewollte Verarmung der Menschen erzwangen. Die ravensbergischen Bauern waren froh, dass das bei ihnen nicht der Fall war.
Der neugeborene Säugling – Christoph sollte er heißen, hatte dessen Vater seinem Bruder anvertraut – war offensichtlich gesund und brüllte munter in die Welt, im Arm seiner Mutter Johanna, als der Onkel zum Gratulieren kam. Die Mutter Johanna lag im Bettkasten des Kottens, in der linken hinteren Ecke des kleinen Raums, gegenüber dem Kochherd. Ihre Zudecke bestand aus weißem Linnen 5 und war gefüllt mit wärmenden Gänsedaunen 6. Johanna war stolz gewesen, einst ein gut ausreichendes Hochzeitsgut 7 mit in die Ehe gebracht zu haben, auch wenn es nur für einen Kotten bestimmt war.
Die Geburt war wohl normal verlaufen, wobei Emma, die erfahrene Hebamme für die Bauerschaft Holtkamp in der Gemeinde Isselhorst aus dem Bauernhof der Kruphölters, wie üblich die junge Mutter betreut und für eine normale, reibungslose Geburt gesorgt hatte. Sie war zugleich die Tante Johannas, die ja ebenfalls vom Hof Kruphölter stammte.
Ein Storch hätte hier in der Landschaft rund um Isselhorst weit zu fliegen gehabt, wenn er einen Besuch beim Nachbarnest auf dem Dach eines anderen Bauernhofes hätte machen wollen. Doch daran dachte ein Storch gewiss nicht, er hatte jetzt im Sommer genug damit zu tun, seinen Nachwuchs im eigenen Nest auf dem Giebelkreuz des Hermbeckerschen Hofes mit Nahrung zu versehen. Bei einem dieser vielen Flüge hatte er in der Nacht der Frau im Kotten einen kleinen Säugling mitgebracht, so erzählten es seit vielen Generationen die Mütter ihren kleinen Kindern, die normalerweise auf den Höfen herumwuselten, wenn in dem einen oder dem anderen Haus mal wieder ein Säugling angekommen war.
Die Höfe hier im Ravensberger Land hielten einen erstaunlich großen Abstand vom nächsten; mindestens 1000 Schritte musste man gehen, um zum Nachbarn zu kommen. Das war eine Eigenart hierzulande, allerdings auch weit darüber hinaus. Rund um die jeweiligen Höfe lag deren Feldflur, so dass die Bauern für Aussaat, Bearbeitung und Ernte keine langen Wege hatten.
Dörfer gab es hier nicht, höchstens im Abstand von zwei bis drei Meilen 8 ein Kleinstädtchen, in dem die Handwerker und Kaufleute ansässig waren, die zur Versorgung der vielen Bauern benötigt wurden. Isselhorst war das den Bauern in Holtkamp am nächsten liegende Kleinstädtchen mit Kirche und Schule. Die Bauern waren auf die Gewerbetreibenden dort angewiesen, aber heimlich verachteten sie die meisten Menschen in der Stadt, waren sie doch in nur zu häufigen Fällen keine Nachkommen freier Bauern, sondern erst irgendwann von irgendwoher zugezogen.
Der Blick über die brettflache Ebene ging unbeschränkt bis zum Horizont, nur im Norden war die gewellte Linie der Berge des Teutoburger Waldes zu erkennen, jenes fast schnurgeraden Bergzuges, der das nördliche Westfalen vom Westen bis zum Osten durchzieht. Die Ebene südlich dieses Bergzuges war nicht besonders fruchtbar, aber immerhin ernährte sie ausreichend die vielen hundert kleinen Bauernwirtschaften, die sich seit Urzeiten auf ihr festgesetzt hatten. Einige kleine Bäche schlängelten sich darin.
Ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl auch noch bemerkt, dass es hier keinen Wald gab, nur gelegentliche Büsche an den Wegrainen zwischen den Feldern. Und doch gab es viele Bäume hier in der Ebene. Fast neben jedem Bauernhaus ragte ein kleines Wäldchen aus jungen Eichenstämmen in die Höhe. Schon vor unendlichen Generationen war den Bauern hierzulande klar geworden, dass ihre aus Holz gebauten Höfe nach einigen Generationen zusammenzufallen drohten; man musste sie neu errichten und tat das auch, wenn es so weit war. Irgendwann vor langer, langer Zeit waren die Bauern auf die gute Idee gekommen, dass es nützlich sein konnte, zeitgleich mit dem Bau eines neuen Bauernhauses auch in der Nähe junge Eichen einzupflanzen. Sie würden wachsen und nach einigen Generationen gerade die richtige Größe haben, um als Balken und Bretter für den Bau eines neuen Bauernhauses verwendet zu werden.
Im Kotten des Heuerlings Caspar Hermbecker nahm dessen Bruder das neugeborene Söhnchen aus dem Arm der Mutter, um es nach altem Brauch in die Höhe zu halten und damit der Welt zu zeigen und ihm den Segen Gottes herabzuflehen. Das hatte zwar schon der Vater getan, aber die Verstärkung dieser guten Wünsche durch den Onkel und Hofbauern konnte ja nicht schaden.
Sorgfältig schaute der Onkel seinem kleinen Neffen in die Augen, wenn er diese einmal öffnete. Er selbst, Heinrich, hatte noch keine Kinder, schließlich war sein Bruder Caspar ja einige Jahre älter und eher mit dem Heiraten dran gewesen. So wurde hier mit dem kleinen Christoph eine neue Generation in der langen Geschichte der Familie Becker in Holtkamp eröffnet. Vor einigen Generationen hatte sie sich in zwei Linien getrennt, und um die zu unterscheiden, nannte sich die eine Linie „Hermbecker“, also eigentlich Hermann Becker, die andere Wilmbecker (Wilhelm Becker). Der Bauer Heinrich und seine Sippe gehörte zu den Hermbeckers, aber natürlich wusste jeder in den Höfen Holtfelds, wer wohin zu zählen war.
In einem Anfall von Sentimentalität streichelte der Onkel dem Säugling über das spärliche blonde Haar. „Ich wünsche dir ein ganz besonderes Leben, kleiner Christoph, ich glaube, du wirst es einmal ganz weit bringen!“
1 Kleinbauernhaus
2 Bauernknecht
3 die alte Grafschaft Ravensberg in Ost-Westfalen, heute Stadt und Kreis Bielefeld, Herford und der nördliche Teil des Kreises Gütersloh, nördlich und südlich des Mittelteils des Teutoburger Waldes.
4 Gemeint ist das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“, der theoretische Überbau aller souveränen Staaten in Deutschland, wie dem Königreich Preußen, dem Erzherzogtum Österreich, dem Kurfürstentum Bayern, dem Herzogtum Württemberg und zahlreichen kleineren Staaten bis hin zu Reichsstädten, in den letzten Jahrzehnten seines Bestehens kaum noch von politischem Einfluss, aber immer noch von einer Art mystischen Aura umgeben. Im Jahr 1806 legte der österreichische Kaiser und Erzherzog Franz, zugleich Kaiser dieses Reiches, die Reichskrone nieder und beendete damit die vielhundertjährige Existenz dieses Reiches. Bei vielen Deutschen stand es dennoch in guter Erinnerung.
5 Leinwand
6 kleine Federn junger Gänse
7 von der Braut vor der Hochzeit anzufertigende Ausstattung von Haushaltswäsche, der Beitrag der Braut zum künftigen Haushalt.
Ankunft im Altersruhesitz
Carlsruhe / Schlesien, Dezember 1829
Einige Tage vor dem Weihnachtsfest rollte eine Schlange von Pferdeschlitten vor dem kleinen Schloss Carlsruhe vor. Die jahrelange Stille in dem bisher fast menschenleeren Schloss war wohl vorüber. Endlich war der lange erwartete Schlossherr eingetroffen.
Knapp einen Monat war die Schlittenkarawane unterwegs gewesen. Sie war in St. Petersburg, der Hauptstadt des russischen Zaren, aufgebrochen, als dort der erste Schnee gefallen war und die Straßen nunmehr für Pferdeschlitten passierbar geworden waren. Im Herbst und im Frühjahr konnte, wenigstens in Russland, kein Gefährt, weder Wagen noch Schlitten, die Straßen passieren, weil sie dann nur aus tiefem Schlamm bestanden. Der Winter war für Russen eine beliebte Reisezeit, man musste in den Schlitten sich nur warm in Pelze und Decken hüllen. Eine andere Reisemöglichkeit gab es nun einmal nicht. Übernachten konnte man in den kleinen oder größeren Städtchen, die man unterwegs berührte, und wo man auch frische Pferde für die Schlitten mieten konnte.
Herzog Eugen Friedrich Carl von Württemberg war mit seinem Gefolge in seiner Besitzung, dem Schloss Carlsruhe in Schlesien, knapp 7 Meilen 9 südöstlich von Breslau, eingetroffen, um hier nach seiner ehrenvollen Verabschiedung als kaiserlich-russischer General endlich seinen Ruhestand zu genießen. Fast die ganze, gut 160 Meilen 10 lange Strecke war er auf russischem Gebiet gereist, über Riga und Warschau, fast ganz Polen gehörte ja seit dem Wiener Frieden 11 zu Russland. Nur die letzten vier Meilen 12 gingen durch die preußische Provinz Schlesien.
Carlsruhe war schon seit fast einem Dreiviertel-Jahrhundert der Sitz der so genannten „schlesischen Linie“ des württembergischen Königshauses, seit ein Großonkel die Wälder rundum billig erworben hatte und dort ein Jagdschlösschen bauen ließ. Es ging die Legende, der Vorfahr habe während einer Jagd geschlafen und dabei von einem Schloss geträumt, das er danach auch prompt errichten ließ und nach seinem ersten Vornamen „Carlsruhe“ nannte. Dabei sei der Bauplan der damals ganz neuen Hauptstadt des Großherzogtums Baden, ebenfalls Karlsruhe genannt, hier im Wald Oberschlesiens nachgeahmt worden, mit einem Stern von acht Alleen durch den Wald, in deren Kreuzungspunkt das Schlösschen gebaut worden war. Schräg rechts und links vor dem Schloss, auf der Linie von zwei dieser Alleen, hatte schon der Vorfahr einige so genannte „Kavaliershäuser“ errichten lassen, die der ganzen Anlage einen großzügigen, geradezu majestätischen Anblick verliehen, etwa so, wie es bei Königsschlössern in Frankreich üblich war. Nur waren hier Schloss und die zugehörigen Häuser viel kleiner.
In der altehrwürdigen Familie der Herzöge von Württemberg – seit 1806 trugen sie sogar den Titel König – war es seit Generationen üblich, dass die jüngeren Brüder des jeweiligen Throninhabers Kriegsdienste in den Armeen großer Reiche in Europa nahmen, wie Preußen, Österreich und Russland, um es dort zu etwas zu bringen. Mitunter heirateten sie auch Prinzessinnen aus deren Herrscherfamilien, häufiger allerdings aus dem zahlreichen Angebot der vielen kleineren souveränen Fürstenfamilien im einstigen Heiligen Römischen Rech deutscher Nation. So entstanden immer wieder einmal Nebenlinien des Herrscherhauses der Württemberger, die allerdings meist auch wieder nach einigen Generationen ausstarben. Einige dieser Nebenlinien erwarben durch Heirat, Erbschaft oder auch durch Kauf Grundbesitz weitab von der schwäbischen Heimat.
Schloss Carlsruhe / Schlesien, Mitte des 19, Jahrhunderts
Die Söhne in der „schlesischen Linie“ des württembergischen Königshauses hießen traditionsgemäß mit einem ihrer Vornamen Eugen; vielleicht war das eine Erinnerung an den sagenumwobenen „Prinzen Eugen“, den österreichischen Feldmarschall, der ein Jahrhundert zuvor eine Berühmtheit in Europa gewesen war. Sie trugen im Unterschied zum württembergischen König den Titel „Herzog“, fühlten sich aber durchaus als Teil ihrer Gesamtfamilie, einem der ältesten Herrscherhäuser in Europa.
Herzog Eugen – er wurde nur so nach seinem ersten Vornamen genannt – freute sich auf die Rückkehr nach Carlsruhe. Er hatte in seiner Jugend schon mehrfach für ein paar Jahre hier gelebt, mit seinen Eltern; dem Vater war das Schloss von dessen kinderlosen Onkel einst durch Testament zugefallen. Gerade an diese Jugendzeit hatte Eugen sehr angenehme Erinnerungen. Jetzt hatte er vor, sein Schloss für den Rest seiner Lebenszeit zu bewohnen, nachdem sein Vater schon vor sieben Jahren gestorben war.
Eugen atmete tief durch, als er vor dem Eingang des Schlosses aus seinem Schlitten stieg, Es war wie eine Rückkehr in die Heimat, in ein Leben in Ruhe und ohne Aufregungen, in ein Leben mit seiner Familie und vielleicht sogar mit seiner geliebten Musik.
Er war nun 41 Jahre alt, aber er hatte bereits eine lange militärische Laufbahn als General im Dienst des russischen Kaisers und ungezählte Schlachten hinter sich. Seine beiden Kinder waren hier in Carlsruhe geboren worden, doch danach war Eugen wieder im russischen Kriegsdienst für etliche Jahre unterwegs gewesen, während seine Familie in Sankt Petersburg lebte.
Endlich konnte er nun zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern – Marie war elf und Eugen Erdmann acht Jahre alt – ein ruhiges Familienleben führen, fernab vom steifen Zeremoniell des russischen Kaiserhofes und den Intrigen und heimlichen Anfeindungen in der russischen Armee. Er wusste genau, dass er diese Anfeindungen vor allem der Tatsache zu verdanken hatte, dass er einst der Lieblingsneffe der Frau des Zaren Paul gewesen war.
Herzog Eugen schüttelte sich, als ob er diese Erinnerungen abstreifen wollte, die ihn hier bei der Rückkehr in die Heimat plötzlich überfielen. Dann trat er zusammen mit seiner Gattin Helene entschlossen durch das Hauptportal des Schlösschens Carlsruhe. Hier sollte ihn nichts mehr an die ja häufig unangenehme, ja mitunter bedrohliche Vergangenheit erinnern.
9 Ca. 60 Kilometer
10 Rund 1200 Kilometer
11 Wiener Kongress zur Beendigung der Umwälzungen in Europa durch Napoleon 1815
12 gut 30 Kilometer
Fast ein Zarensohn
Carlsruhe, Frühjahr 1830
Zur Begleitung des Herzogs Eugen bei seiner letzten Reise von Sankt Petersburg in die Provinz Schlesien in Preußen hatten auch der kaiserlich-russische Major a. D. Wolfgang von Hofmann und seine junge Frau gehört. Der war zuletzt, in dem Kriege Russlands gegen die Türkei im Jahr 1828, der Adjutant des kaiserlichrussischen Generals Eugen von Württemberg gewesen, und er war, einige Jahre jünger als sein Vorgesetzter, zu einem geschätzten Vertrauten geworden. Er verehrte heimlich seinen Chef, und er hatte deshalb keinen Augenblick gezögert, ebenfalls den Abschied aus dem Dienst beim russischen Zaren zu nehmen und mit seiner Frau nach Carlsruhe zu ziehen, als ihm sein Chef das vorschlug.
Jetzt, in der winterlichen Ruhe, die das Schloss und die Wälder ringsum umgab, saßen die beiden ehemaligen Soldaten nicht selten zu zweit im gemütlichen Kaminzimmer zusammen und schlugen manche Schlachten noch einmal, die sie einst gemeinsam erlebt hatten. Heute allerdings ging die Erinnerung des Herzogs viel, viel weiter zurück, bis in seine Jugendzeit, die gewiss aufregend und ungewöhnlich genug gewesen war.
„Ich glaube, lieber Hofmann,“ begann Herzog Eugen, „ich sollte Ihnen einmal erzählen, was ich als heranwachsender Junge in Sankt Petersburg erlebt habe. Sie können das ja nicht wissen, Sie sind viel jünger, und Ihre Familie auf dem Gut im Magdeburgischen hatte damals wohl nur gerade gewusst, dass es in Sankt Petersburg russische Zaren gab. Aber was mit mir damals, vor fast drei Jahrzehnten, geschehen ist, werden Sie nicht glauben, aber es ist dennoch wahr.“
Der Herzog nahm einen tüchtigen Schluck aus dem Rotweinglas, das neben ihm auf dem Tisch stand, und begann seine Erzählung. „Sie müssen wissen, Hofmann, dass eine Schwester meines Vaters einst den Sohn der russischen Zarin Katharina geheiratet hat. Dieser Sohn hieß Paul, und er war der Thronfolger der Zarin, aber er mochte seine Mutter nicht. Als er nach dem Tod der Mutter endlich Zar wurde 13, machte er fast alles anders, als es seine Mutter einst getan hatte, die ja sehr lange als Zarin die Alleinherrschaft in Russland ausgeübt hat.“
Der junge Prinz Eugen war gerade mal zwölf Jahre alt und lebte bei seiner Mutter hier in Carlsruhe, als seine Eltern einen Brief von Vaters Schwester, der nunmehrigen Zarin Maria Feodorowna, erhielten, in dem sie dringend darum bat, ihren Neffen Eugen zu ihr an den Hof in Sankt Petersburg zu schicken. Einer Zarin konnte man einen solchen dringenden Wunsch nicht abschlagen, also musste der junge Prinz in die russische Hauptstadt reisen, begleitet von einem „Gouverneur“, einem russischen General von Diebitsch, als Aufpasser und vorübergehenden Erzieher.
Prinz Eugen von Württemberg hatte ein gutes Gedächtnis, und er hatte trotz seiner damaligen Jugend Menschenkenntnis, Wahrheitsliebe und Humor genug, seinem aufmerksamen Zuhörer die zum Teil absurden Vorkommnisse unterwegs auf der langen Reise und vor allem dann am Zarenhof drastisch zu schildern. Schön war es schon, dass die Tante und ihr Gatte, der Zar Paul, den jungen Verwandten Eugen offenbar in ihr Herz schlossen und verwöhnten. Absurd war es aber – und das fiel bereits dem aufgeweckten Zwölfjährigen damals auf, wenn er natürlich kein Wort dagegen sagen durfte – dass er zwar dem kaiserlichen Kadettencorps 14 zugewiesen wurde, gleichzeitig aber bereits zum russischen General ernannt wurde – mit zwölf Jahren!
Kadett war er praktisch nie geworden, aber der Titel als General galt offenbar am Zarenhof etwas. Eugen konnte zwar zuerst kein Russisch, aber mit Deutsch und dem in Hochadelskreisen in ganz Europa allgemein üblichen Französisch konnte er sich gut verständigen, So bekam er schnell mit, was um ihn herum passierte. Ihm blieb nicht verborgen, dass der Zar Paul von allen Mitgliedern seines Hofstaates und den Offizieren der kaiserlichen Garde heimlich gefürchtet und gehasst wurde und dass er wegen seines mitunter verrückten Handelns und seiner meist grundlosen Wutanfälle als geistesgestört und völlig unberechenbar galt.
„Ich habe gelesen, Hoheit“, fiel der ehemalige Adjutant von Hofmann ein, „dass behauptet wurde, dieser Zar Paul habe an der Geisteskrankheit Schizophrenie gelitten,“ „Das kann schon möglich sein, damit kenne ich mich nicht aus“, antwortete Eugen. „Ich weiß nur aus meiner Erinnerung, dass der Zar mitunter von äußerstem Misstrauen selbst gegen seine eigene Familie, vor allem seine damals schon erwachsenen Söhne, erfüllt war. Und das war wohl auch der Grund für das, was er offenbar mit mir vorhatte.“
Herzog Eugen erzählte, was er zwar persönlich damals gar nicht mitbekommen hatte, was ihm aber später von Freunden und Vertrauten am Zarenhof berichtet worden war, dass nämlich der Zar Paul offenbar vorhatte, seine beiden ehelichen Söhne Alexander und Konstantin zu enterben – wohl weil er glaubte, sie würden ihm nach dem Leben trachten. Stattdessen habe er vorgehabt, ihn, den Prinzen Eugen von Württemberg, den jungen Neffen seiner Frau, zu adoptieren und zum künftigen Thronerben des Zarenreiches zu machen.
In den dramatischen Tagen Ende März des Jahres 1801, als Zar Paul wohl diese Idee entwickelte, kam gleichzeitig der Plan einiger Offiziere der Leibgarde zur Ausführung, den Herrscher aller Reußen – so hieß auf Russisch sein Titel – umzubringen und den ältesten Sohn Alexander auf den Thron zu setzen. Das geschah auch, nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Zarenhauses der Romanows.
Der wahnsinnige Plan Pauls, den Ziehsohn seiner Frau, Eugen, zum Thronanwärter zu machen, kam so nicht zur Ausführung. Gute Freunde sorgten dafür, dass der junge Mann so schnell wie möglich Sankt Petersburg wieder verließ und in seine Heimat Schlesien nach Schloss Carlsruhe zurückkehrte.
„Wer weiß“, schloss der Herzog seine Erzählung, „vielleicht wäre ich damals auch umgebracht worden, diesmal auf Weisung des neuen Zaren Alexander, der vielleicht glauben mochte, ich hätte von dem absurden Plan seines Vaters gewusst und wäre voll damit einverstanden gewesen. Aber nichts hätte mir damals ferner gelegen.“
„Ich finde, Hoheit,“ kommentierte sein Sekretär von Hofmann diese erstaunliche Erzählung, „Sie müssten unbedingt diese Ihre Erinnerungen zu Papier bringen und veröffentlichen lassen. Heute, Jahrzehnte danach, kann kein Grund mehr zur Geheimhaltung bestehen. Und so plastisch und auch voller Humor, wie Sie es mir eben erzählt haben, wäre das ein interessanter Beitrag zur modernen Geschichtsschreibung!“
13 im Jahr 1796
14 eine Art Ausbildungsschule für künftige adlige Offiziere
Ein kleiner Schlaukopf
Holtkamp, Sommer 1834
Jetzt, in den längsten Tagen des Jahres, war es draußen noch lange hell, und es hätte der besonderen Erlaubnis nicht bedurft, die Küche im Haus des Bauern Hermbecker in Holtkamp zu benutzen. Diese Erlaubnis hatte Bauer Heinrich seinem Bruder gerne gegeben, ging es doch darum, seinem Neffen Christoph etwas beizubringen, hier, wo es selbst am Abend Licht gab und einen Tisch, auf dem man ein Buch oder Papiere ausbreiten konnte. Im Kotten des Bruders war dafür einfach kein Platz.
Der kleine Christoph hatte sich in seinen ersten Jahren gut entwickelt. Er war gesund geblieben und hatte keine der vielen Krankheiten eingefangen, die sonst so gerne die Gesundheit oder sogar das Leben kleiner Kinder bedrohten, Zusammen mit einigen Jungen und Mädchen im gleichen Alter war er, kaum dass er gut laufen konnte, zwischen den nächsten benachbarten Höfen herumgestreunt und hatte die unendlich vielen Möglichkeiten ausprobiert, die sich kleinen Kindern dort zum Spielen anboten. Irgendeine der Bauersfrauen vom einen oder anderen Hof hatte immer ein scharfes Auge auf die Kinderschar geworfen. Normalerweise passierte bei diesen Ausflügen auch nichts. So waren ja schon Generationen von künftigern Bauern und Bauersfrauen durch ihre Kleinkinderzeit gekommen.
Doch seit Kurzem nahm Vater Caspar seinen Sohn am Abend zu einer besonderen Stunde mit in das Haus seines Bruders. Denn der kleine Christoph hatte sich schon früh als ein besonderer Schlaukopf entpuppt. Seit er vernünftig sprechen konnte, hatte er Eltern und alle sonstigen Leute auf dem Hermbecker’schen Hof mit Fragen gelöchert: „Warum kann man die Milch der Kühe trinken?“ oder „Warum ist der Himmel blau?“
Je nach dem Wissen der Gefragten – und auch deren Lust, vernünftige Antworten zu geben – hatte man ihm geantwortet, und der kleine Kerl machte sich daraus in seinem Kopf irgendein Bild. Es blieb nicht aus, dass die Erwachsenen, die mit ihm zu tun hatten, ihn mit der Zeit „den kleinen Schlaukopf“ nannten, denn das, was bei dem fünfjährigen Jungen aus dem in seinem Kopf gespeicherten Wissen herauskam, war zwar oft sehr drollig, aber manchmal auch von überraschender Erkenntnis. Einige Erwachsene in seiner Nähe bekamen geradezu Hochachtung vor dem Kind und sagten ihm noch eine große Zukunft voraus.
Dazu gehörte vor allem auch sein Vater, der trotz seiner Eigenschaft als Heuerling im Kreise der Holtkamper Bauern geradezu als „Gelehrter“ galt, denn er konnte fließend Lesen und Schreiben. Er hatte das einst in der Isselhorster Schule vom Lehrer Bökemeier gelernt. Viele seiner Altersgenossen hatten zwar auch diese Schule besucht, aber mangels Interesse trotz mehrerer dort abgesessener Schuljahre nicht viel mehr als die Kunst mitgenommen, ihren Namen korrekt schreiben zu können. In einer Zeitung oder in einem Buch – wenn sie so etwas Ungewöhnliches je vor die Augen bekamen – hätten sie wohl auch noch einige Zeilen entziffern können.
Caspar Hermbecker hatte sich nicht weniger vorgenommen, als seinem so begabten Sohn bereits vor Eintritt in die Isselhorster Schule das Lesen und das Schreiben beizubringen. Daher hatte er sich von seinem Bruder die Erlaubnis erbeten, abends nach Feierabend in der Küche des Bauernhauses für eine Stunde mit seinem Sohn zu sitzen und zu üben.
Diese Küche war dazu auch gut geeignet, denn in der kälteren Jahreszeit verbreitete die Wärme ihres Herdes eine angenehme Temperatur. Die übrigen Bewohner des Hauses mussten dann allerdings für kurze Zeit darauf verzichten – und durch die dort aufgestellten Tranfunzeln 15 gab es auch genügend Licht, wenigstens in unmittelbarer Nähe dieser sehr einfachen Lampen.
Der kleine Christoph hatte nichts gegen die zeitweise Einschränkung seiner kindlichen Freiheit, im Gegenteil, er war stolz darauf, dass sein Papa ihm jetzt die Kunst des Lesens beibringen wollte. Und er lernte schnell. Auch sein Vater hatte ja schon diese Grundvoraussetzung für jede Wissenschaft in der Schule gut gelernt, aber sein Sohn schien ihn da noch in der Schnelligkeit zu übertreffen.
So gingen denn jetzt im Sommer Caspar und Christoph Hermbecker fast jeden Abend hinüber zum Hofgebäude des Bauern zum Lernen. Der Hof Hermbecker in Holtkamp war keineswegs der größte in dieser Bauerschaft, es gab viel prächtigere. Aber im Prinzip war er genau wie die anderen vor einiger Zeit neu errichtet worden.
Vorne kam man durch ein riesiges Tor ins Haus, es war hoch genug, dass ein voll mit Heu oder anderem Erntegut beladener Pferdewagen hindurchpasste. So konnte man das Heu gleich von oben auf den Speicherboden des Hauses befördern, der direkt unter dem Dach lag. Rechts und links neben der große Deele 16, gleich hinter dem Tor, standen links ein paar Kühe und rechts zwei Pferde in ihren Ställen, die nur von der Deele, also vom Inneren des Hauses, zugänglich waren.
Im hinteren Teil des Hauses kam man von der Deele in den Wohnbereich, das Fleet, auch Kammerfach genannt. In moderneren Häusern war zwischen Deele und Fleet eine Holzwand mit Tür eingezogen. Hier hatte das Bauern-Ehepaar auf der linken Seite eine abgeteilte Kammer mit ihrem Alkoven, dem großen Holzbett, in dem neben dem Ehepaar auch die kleineren Kinder schlafen mussten. Gegenüber, auf der anderen Hausseite, lag die Küche mit dem Herd. Dieser Herd war die einzige Wärmequelle für das gesamte Haus, wenn man nicht die Wärme mitrechnete, die die Kühe und Pferde ausstrahlten. Der Rauch von dem ständig beheizten Herd zog durch ein Loch am hinteren Hausgiebel ab, der Uhlenflucht 17.
Der Hof Holtkamp Nr. 15 im Jahr 1966, vermutlich um 1750 errichtet, inzwischen längst abgerissen und durch ein modernes Wohnhaus ersetzt
Für größere Kinder und eventuelle Knechte und Mägde gab es noch ein paar Kammern über den Ställen, gewissermaßen im ersten Stock, die man nur mit einer Holzleiter erreichen konnte.
In einigen größeren Bauernhäusern stand dort, wo anderswo Pferde ihren Platz hatten, ein großer hölzerner Webstuhl. Damit verdienten dann die Frauensleute des Hofes nebenbei etwas Geld. Sie webten die Leinenfäden, die zuvor mühevoll aus den Stängeln des Flachses gewonnen worden waren, zu einfacher Leinwand. Diese Produkte wurden dann nach Bielefeld in die große Stadt gebracht, wo inzwischen mehrere Fabriken zum Färben und zur Weiterverarbeitung der Leinwand durch Schneider entstanden waren.
Manche Bauernhäuser waren größer als das Hermbecker’sche Haus, und wohl auch in der einen oder anderen Einzelheit moderner, aber im Prinzip genauso gebaut. Kein westfälischer Bauer konnte sich in einem solchen Haus verirren.
Der kleine Christoph jedenfalls war stolz auf das Anwesen seines Onkels, und wenn er dorthin kam, wurde er freundlich begrüßt von Onkel und Tante und der alten Magd Tina, die dort vor allem für die Küche zuständig war. Sie war auch die treueste Zuhörerin der Fortschritte und ließ sich von dem kleinen Jungen geduldig die neu gelernten Buchstaben – und die Worte, die man aus den schon gelernten niederschreiben konnte – zeigen.
Vater Caspar hatte neulich in Isselhorst im Dorfladen eine Schiefertafel für seinen Sohn gekauft, eine flache Platte aus schwarzem Schieferstein, schön von einem Holzrahmen umgeben, und mit zwei Schnuren dran, an denen ein Kreidegriffel und ein Schwämmchen hingen. Mit dem ersteren konnte man die schwarze Tafel beschreiben, und mit dem letzteren konnte man das Geschriebene wieder abwischen, wenn man das Schwämmchen nass machte. Christoph war stolz darauf, dass er schon wie ein großer Schuljunge so ausgestattet war, obwohl er doch noch gar nicht in die Schule ging.
15 primitive Leuchter, betrieben mit Abfällen von Tierfett
16 Diele, in Süddeutschland Tenne genannt
17 wörtlich: Eulenloch
In der Schule
Isselhorst, Sommer 1837
Seit mehr als einem Jahr wanderte der kleine Christoph mit seinen kleinen, strammen Beinchen morgens zur Schule in das Städtchen Isselhorst. Den Weg – etwa eine Drittel Meile 1 - kannte er ganz genau, schließlich war er ihn schon vorher fast jeden Sonntag an des Vaters Hand gegangen, zur Kirche.
Die alte kleine Kirche stand in der Mitte des Ortes an einem kleinen Platz, um den sich einige Bürgerhäuser drängten. Hier hatte auch ein Laden Platz gefunden –„Laden“ stand stolz über dem Eingang, in dem die Bauern Rosinen, fertiges Mehl und zahllose andere Waren erwerben konnten, die neuerdings vor allem von den Frauen aus der Stadt und vom Lande gerne gekauft wurden – wenn das Geld dafür vorhanden war. Neben dem Laden gab es ein Gasthaus, das seine Existenz vor allem dem Umstand verdankte, dass die Männer von den Höfen ringsum regelmäßig nach dem Sonntagsgottesdienst dort einzukehren pflegten und ein oder zwei – manchmal auch ein bisschen mehr!– Gläschen Schnaps tranken. Der Gasthof war seit Jahrzehnten das Informationszentrum für Isselhorst und die umliegenden Bauerschaften, denn natürlich wurden dort eifrig alle Neuigkeiten von nah und fern herumerzählt und von allen Seiten betrachtet.
Auch ein studierter Arzt hatte sich vor einiger Zeit im Zentrum von Isselhorst niedergelassen, Allerdings ging seine Praxis nicht besonders gut, denn die Bauern weigerten sich aus alter Gewohnheit, einen „Studierten“ zu holen, wenn bei ihnen auf dem Hof jemand krank wurde, sich das Bein brach oder man sonst Sorgen mit der Gesundheit hatte. Man behalf sich mit alterprobten Hausmitteln oder dem Ratschlag eines angeblich besonders erfahrenen Heilers unter den Bauern, dabei war die Zahl der Unfälle und auch der Krankheiten auf dem Land bedrohlich hoch. So musste der Arzt im Wesentlichen von den Patienten leben, die aus dem kleinen Städtchen seine Dienste in Anspruch nahmen.
Eine Apotheke gab es Isselhorst nicht, aber im Nachbarstädtchen Brackwede, auf dem halben Weg zur großen Stadt Bielefeld, eine knappe Meile entfernt, konnte man neuerdings die Salben, Mixturen und Pillen eines Apothekers kaufen.
In der Mitte von Isselhorst, in der Nähe der Kirche, stand auch das alte Schulhaus, das die Gemeinde auf Weisung der preußischen Regierung vor über 30 Jahren hatte erbauen müssen. Es bestand aus einem größeren Saal für die Klasse, und im ersten Stock hatte der Schulmeister seine Wohnung. Hier auf dem Lande bestanden die Schulen gewöhnlich nur aus einem Klassenraum, und es gab auch nur einen Lehrer dafür. In größeren Städten war das anders, da gab es so viele Schüler bereits für die Volksschule, dass die Zöglinge in mehrere Klassen nach dem Alter gegliedert werden mussten. Dafür mussten mehrere Klassenräume und auch Lehrer vorhanden sein.