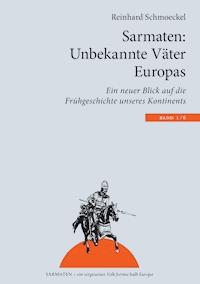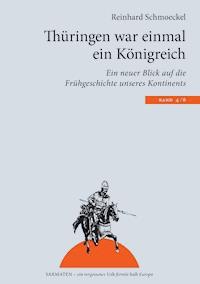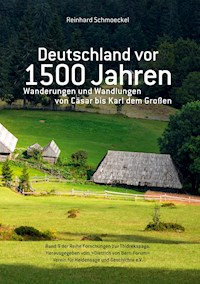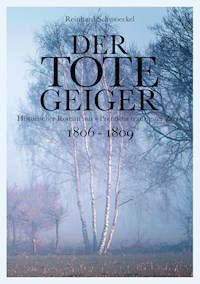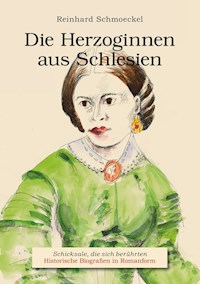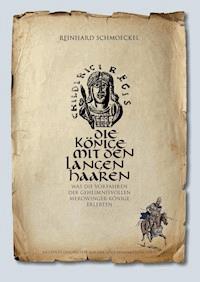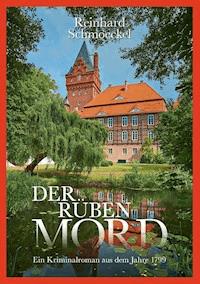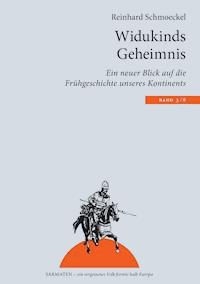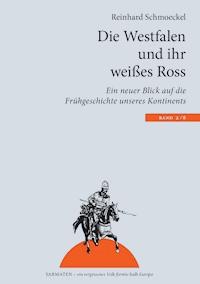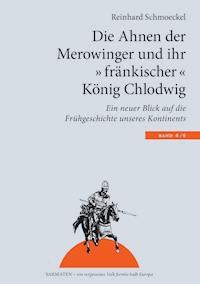
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sarmaten: Ein vergessenes Volk formte halb Europa
- Sprache: Deutsch
Von den Merowinger-Königen, den Gründern des Fränkischen Reiches im Frühmittelalter und Vorgängern der viel bekannteren Karolinger, weiß man nur wenig. Hauptsächlich liegt das daran, dass im Zusammenhang mit der katholischen Taufe des Königs Chlodwig um das Jahr 500 n. Chr. zwei Dinge unbedingt verschwiegen werden mussten: 1. dass dieser Chlodwig von sich behauptete, Blutsnachkomme von Jesus zu sein, 2. dass dieser Chlodwig nicht "fränkischer" = germanischer Herkunft war, sondern aus dem Volk der Sarmaten kam. Der Pakt zwischen Chlodwig und der katholischen Kirche zur Wahrung dieser Geheimnisse hat bisher gewirkt. Die Geschichtsforschung hat sie nie aufdecken können oder wollen. Erst jahrzehntelange Forschungen zum Volk der Sarmaten haben den Autor dieses Bandes 6 der Buchreihe zu neuen Erkenntnissen geführt, die in allen Einzelheiten mit Indizien aus zahlreichen Wissenschaften belegt werden können und plausibel die bewusste Geschichtsfälschung vor 1500 Jahren widerlegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarmaten
Ein vergessenes Volk
formte halb Europa
Band 6
Inhalt
Vorwort
Teil I
Gefangen von der Geschichtsfälschung: Das Wissen der „offiziellen“ Historiker
Die Ahnen der Merowinger-Könige: ungewiss und uninteressant
Was weiß man wirklich vom König Chlodwig?
Die „fränkische Wandersage“: eine „kecke Fabelei“?
Der aufschlussreiche Brief des Trithemius von 1513
War der gelehrte Abt ein Geschichtsfälscher?
Mittelalterliche Historiker und die „Wahrheit“
Das Buch über „die Könige und das Volk der Franken“
Mehrere Schichten Wahres und Falsches?
Der Fund des Historikers Gottfried von Viterbo
Zufügungen im späten Mittelalter
Die mysteriösen „fränkischen Königslisten“
Was bleibt an Vertrauenswürdigem?
Teil II
Blicke hinter den „Schleier“: Vermutungen zur wirklichen Geschichte
Die Wurzeln der Sarmaten
Alte Erinnerungen, garniert mit Halbwissen - Von „Troja“ nach Pannonien
„Sie bauten eine Stadt und nannten sie Sicambria“
Ein Sieg und ein Kaiser-Lob für die Sicambrier
Die Flucht und die „Separation“ ins Rheinland
Das Zusammentreffen von Sygambrern und Sugambrern
Die Flucht aus Thüringen
In einem Ort namens „Troja“
Die Versetzung nach Fanum Martis
Eine Hochzeit mit ungeahnten Folgen
„Nachkommen des Messias“ und die christliche Kirche
Nazoräer und Desponsyni
Chlodio, der „rex crinitus“
Namengeber und erster König
König Childerich und sein Freund Ägidius
Die thüringische Heirat und der Brauch der Pferdeopfer – Beweise in der Erde
Chlodwig, ein junger Mann mit großem Ehrgeiz
Die Bekehrungs-Legende und der Ort der Schlacht bei Tulbiacum
Zwei Seiten, ein Wunsch, aber ein schweres Hindernis
Das Vorspiel zur Taufe
Die Taufe und der geheimnisvolle Taufspruch
Die Geschichtsfälschung
Chlodwigs letzte Lebensjahre
Die Erfindung der „Troja-Mär“
Der Tabu-Bruch
Vorwort
Die Könige der Merowinger-Dynastie kennt man aus wissenschaftlichen Werken und populären Darstellungen. Sie haben einst das „Frankenreich“ gegründet und damit auch das heutige Frankreich. Es läge nahe, dass die historische Wissenschaft in unserem Nachbarland sich intensiv mit dieser Zeit beschäftigt und auch historisch nach ihr forscht.
Doch es ist merkwürdig: Im Jahr 1995 hat man zwar in Reims feierlich den 1500. Jahrestag der (christlichen) Taufe des Merowinger-Königs Chlodwig begangen, mit einer Messe mit dem Papst Johannes Paul II. Doch sein 1500. Todestag im Jahr 2011 wurde totgeschwiegen 1. Warum?
Hat man in Frankreich inzwischen geglaubt, weil die „Franken“ ja nach allgemeiner Ansicht „Germanen“ waren, seien die Merowinger keine „richtigen Franzosen“? Dabei gilt der Nachfolger der Merowinger, Charlemagne oder Karl der Große in unserem Nachbarland als „Urfranzose“, obwohl er mit großer Wahrscheinlichkeit germanischer Abstammung war. Merkwürdiger Wandel der Anschauungen!
Das hiermit vorgelegte Buch belegt, dass die Könige der Merowinger eben keine Germanen waren, allerdings auch keine Kelten. Die Frühzeit dieser Dynastie umgibt seit anderthalb Jahrtausenden ein Geheimnis. Zwei Behauptungen werden hier dargestellt und mit zahlreichen Indizien belegt:
Die Oberhäupter der Fürstenfamilie, die später den Namen Merowinger erhielt, waren Anführer eines Regiments von Sarmaten , das in römischen Sold erst wohl im Jahr 413 nach Nordfrankreich kam.
Der Taufe des Königs Chlodwig als (katholischer) Christ im Jahr 506 (!!) gingen langwierige Verhandlungen mit den gallischen Bischöfen voraus, denn beide Seiten wollten unbedingt bestimmte Behauptungen aus dem Bewusstsein der Menschen in Gallien gelöscht haben: Die Bischöfe konnten die Behauptung nicht dulden, die Merowinger seien leibliche Erben des Messias Jesus. Auf der anderen Seite leugnete König Chlodwig das Andenken an seine sarmatische Abkunft; dafür wollten er und eine Familie bereits seit Jahrhunderten „Franken“ gewesen sein. Aus dem Kompromiss, der schließlich gefunden wurde, entstand die langlebigste Geschichtsfälschung der Welt. Sie zeigt ihre Wirkung noch heute.
Diese für die Geschichtsforschung ziemlich umwerfenden Theorien sind das Ergebnis von fast zwanzig Jahren Forschung in der europäischen Frühgeschichte, die der Autor nicht nur nach dem bisher so unbekannten Volk der Sarmaten angestellt hat. Indiz fügte sich zu Indiz, hunderte inzwischen.
Die „Beweise“ für diese Behauptungen kommen nur zu einem kleinen Teil aus den einzigen von den Historikern anerkannten Quellen, den Texten antiker oder frühmittelalterlicher Historiker.
Können aber nicht auch Erkenntnisse der Archäologie zur Revision alter historischer Ansichten beitragen? Man muss allerdings sie richtig einzuordnen wissen. Auch die Sprachwissenschaft kann höchst aufschlussreiches Wissen beisteuern; doch ist das ja nach Ansicht der meisten (auf einen Lehrstuhl an einer Universität) „berufenen“ Historiker Sache der Kollegen von der philologischen Fakultät, von deren Fachbereich man nichts versteht.
Auch die Erforschung der „mündlichen Überlieferung“, der Sagen, kann sehr hilfreich sein, ebenso ein eingehendes Wissen über die Heraldik, des „Wappenwesens“, sowie der Volkskunde, der allgemeinen Religionswissenschaft und mancher anderen Wissensgebiete.
Es zeigt sich, dass die Forschungen eines „Außenseiters“, eines Privatforschers, der nicht im akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb eingebunden ist, mitunter weiter führen kann als die an alte wissenschaftliche Überzeugungen geknüpfte Lehre selbst der modernsten historischen Forschungen an den Universitäten.
In diesem Fall kommt hinzu, dass die historische Fälschung, um die es hier geht, seit anderthalb Jahrtausenden die Köpfe der Fachleute so mit einem unbewussten Tabu belegt hat, dass der Bruch dieses Tabus fast einer Gotteslästerung gleicht. „Bretter vor den Köpfen“, die hier durchbohrt werden müssen, sind dicker als gewöhnlich in der Geschichtswissenschaft.
Dieses Buch hätte allerdings nicht geschrieben werden können ohne die vielen Dutzende, ja Hunderte von Hinweisen von Lesern früherer, noch sehr unvollständiger Veröffentlichungen des Autors zum gleichen Thema. Sie zeigen zugleich, dass die hier vorgelegten Hypothesen und Belege wohl doch nicht allein im Kopf eines nicht ernst zu nehmenden „Möchtegern-Wissenschaftlers“ entstanden sein können.
Reinhard Schmoeckel
1 François Muller, Que sait-on exactement de Clovis? In: Etudes Touloises 2014
Teil I
Gefangen von der Geschichtsfälschung - Das Wissen der „offiziellen“ Historiker
1. Die Ahnen der Merowinger-Könige: ungewiss und uninteressant
Gut 50 Jahre nach dem Tod des Königs Chlodwig machte sich ein gebildeter Römer und christlicher Bischof in Gallien daran, die Geschichte seiner Könige zu erforschen und niederzuschreiben, die damals über das „Reich der Franken“ herrschten. Es war der bekannte Gregor von Tours (* vermutlich 538, + 592). Sein Werk – er nannte es neutral „Zehn Bücher Geschichte“ – wurde als „Fränkische Geschichte“ bekannt 2. In dem überaus unruhigen 6. Jahrhundert n. Chr., in dem er lebte, blieb er auch der einzige, von dem eine schriftliche Quelle bis heute überliefert werden konnte.
Über den eigentlichen Gründer des Frankenreichs, Chlodwig, und über dessen Vater Childerich berichtete Gregor eine ganze Menge, allerdings meist im Stil religiöser Legenden und daher wenig glaubhaft. Das, was heutige kritische Historiker tatsächlich über das Leben König Chlodwigs zu wissen meinen, wird im nächsten Kapitel dargestellt. Es ist nicht viel.
Doch ganz nach der Art eines unter schriftkundigen Menschen aufgewachsenen Gebildeten forschte er auch nach der Vorgeschichte dieser beiden Könige, ihren Ahnen oder Vorgängern. Das Wenige, was er gefunden hatte, übernahm er wörtlich in sein Werk. Damit sind zwei sonst „verschollene“ spätrömische Historiker wenigstens dem Namen nach bekannt geblieben. Denn die kurzen Zitate aus ihren Büchern sind das einzige, was man heute noch finden kann.
So gab er wörtlich einige Kapitel aus dem ihm noch bekannten Buch eines Sulpicius Alexander über einen Einbruch von Franken unter Marcomer und Sunno in die Provinz Germania II (um das Jahr 390) und römische Gegenfeldzüge wieder. Diese Namen und Ereignisse werden im Teil II dieses Buches noch eine gewisse Rolle spielen und daher dort an passender Stelle näher behandelt.
Außerdem zitierte Gregor einige Stellen aus dem Werk eines Renatus Frideridus Profuturus über die mehrfache Plünderung der einstigen Hauptstadt des Weströmischen Reiches, Trier, durch Franken in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts.
Was er sonst über das Volk seiner Könige, die Franken, erfahren konnte und niederschrieb, war nur wenig. Als typischer „Literat“ traute er eigentlich nur schriftlichen Quellen und hat das Wenige, was er aus der mündlichen Überlieferung erfahren konnte, mit deutlicher Distanz wiedergegeben. Einiges hat er – oder vermutlich schon seine Informanten – verwechselt.
Im Buch II., Kapitel 9 schrieb er wörtlich: „Es ist vielen unbekannt, wer der erste Frankenkönig gewesen ist.“ Daran schloss er die erwähnten Zitate an.
Gregor fährt dann selbst fort: „Solche Nachrichten haben uns die gedachten Geschichtsschreiber von den Franken hinterlassen, ohne dabei Könige namhaft zu machen. Man erzählt aber, die Franken seien aus Pannonien gekommen und hätten sich zuerst an den Ufern des Rheins niedergelassen. Dann seien sie über den Rhein gegangen und nach Thoringien gezogen, dort hätten sie nach Bezirken und Gauen gelockte Könige über sich gesetzt, aus ihrem ersten und sozusagen adligsten Geschlecht. Dies haben auch die Siege des Chlodowech (die Form des Namens Chlodwig bei Gregor) dargetan und bewiesen, wir reden daher im folgenden weiter davon. Wir finden ferner in den Konsullisten, dass der Frankenkönig Theudomer und seine Mutter Ascyla mit dem Schwerte hingerichtet worden seien.
Damals soll Chlogio, ein tüchtiger und sehr vornehmer Mann unter seinem Volke, König der Franken gewesen sein und zu Dispargum im Land der Thoringer Hof gehalten haben. In diesen Gegenden, das heißt südwärts, wohnten die Römer bis zur Loire, und jenseits der Loire fing die Herrschaft der Goten (gemeint: Westgoten) an. Die Burgunder, welche der Irrlehre des Arius folgten, wohnten jenseits der Rhone, in der Gegend der Stadt Lyon. Chlogio aber schickte Kundschafter aus nach der Stadt Cambrai, und als sie alles erforscht, folgte er ihnen nach, überwand die Römer und nahm die Stadt ein. Kurze Zeit hielt er sich hier auf und eroberte dann das Land bis zur Somme. Aus seinem Stamm, behaupten einige, sei der König Merowech entsprossen, dessen Sohn Childerich war.“
Das ist alles, was der Historiker Gregor über die Vorfahren des von ihm so hoch geschätzten Königs Chlodwig niedergeschrieben hat. Man spürt noch nach anderthalb Jahrtausenden förmlich die Enttäuschung, dass es ihm nicht möglich war, mehr aus schriftlichen Quellen zu erfahren. Sein Interesse an diesen Vorfahren scheint nach diesen vergeblichen Forschungen stark nachgelassen zu haben. Nach seiner Einschätzung handelte es sich ja sowieso um „heidnische Barbaren“, mit denen sich ein gebildeter Römer ohnehin nicht stärker als unbedingt nötig beschäftigen sollte, auch nicht als Historiker.
Moderne Geschichtsforscher haben Gregor das, was er hier über die „Ahnen der Merowinger“ geschrieben hat, auch nicht geglaubt. „Sagenhaft“ war ihr Urteil, vor allem über die Behauptung, die „Franken“ seien ursprünglich aus Pannonien (Ungarn) gekommen. Und „Sagen“, also mündliche Überlieferungen, kam nach Meinung der „klassischen“ Historiker keine größere Glaubwürdigkeit zu als „Märchen“.
Denn nach felsenfester Überzeugung mindestens aller deutschen Geschichtswissenschaftler seit einigen hundert Jahren waren ja die „Franken“ Germanen und setzten sich aus verschiedenen Stämmen zusammen, die jenseits des Niederrheins gelebt hatten, wenigstens zur Zeit des späten römischen Reiches. Im 19. Jahrhundert machte man aus diesen „fränkischen Stämmen“, die zu einer Einheit gedrängt hätten, noch ein großes „fränkisches Volk“. Die Reichseinigung in Deutschland in diesem Jahrhundert hatte hier eine angeblich parallele Geschichtsentwicklung vor anderthalb Jahrtausenden „hervorgezaubert“!
Dass es sich in Wirklichkeit erheblich anders verhielt, ist erst in den letzten Jahren einigen Historikern aufgegangen. Dazu muss im Kapitel II 5. das Nötige ausgeführt werden.
2 Gregor von Tours, Fränkische Geschichte, Essen-Stuttgart 1988 (Reihe Historiker des deutschen Altertums, übersetzt von Wilhelm von Giesebrecht, neu bearbeitet von Manfred Gebauer.
2. Was weiß man wirklich über die Könige Childerich und Chlodwig?
Die „fränkischen“ Könige Childerich und sein Sohn Chlodwig sind nun wahrhaft keine „Sagengestalten“ mehr, als die Gregor von Tours deren Vorfahren erscheinen ließ. Sie kommen in etlichen anderen Geschichtswerken aus dem Frühmittelalter vor und waren ganz sicher „historische Persönlichkeiten“.
Allerdings ist das tatsächliche Wissen über diese Personen, ihr Leben und ihre Taten immer noch stark beschränkt, trotz vieler geradezu begeisterter Schilderungen, die der Bischof dem ersten Christen unter den Franken, dem König Chlodwig, gewidmet hat. Bis vor wenigen Jahrzehnten hat die moderne Geschichtswissenschaft das auch mehr oder weniger uneingeschränkt geglaubt; erst in letzter Zeit werden die schriftlichen Überlieferungen kritischer hinterfragt.
König Childerich hatte historisch noch nicht die Bedeutung wie sein Sohn. Was über ihn aus der Sicht eines modernen Geschichtsforschers zu sagen ist, wird in dem entsprechenden Kapitel des Teils II dieses Buches vorgelegt werden.
Doch Chlodwig war der eigentliche Gründer des „Fränkischen Reiches“. Aber es ist erstaunlich wenig, was man wirklich über ihn weiß. Der französische Sprachwissenschaftler François Muller aus Pulligny in Lothringen (ehemals Universität Nanterre-Paris Ouest) hat in einem Aufsatz für die Zeitschrift des Geschichtsvereins Toul, Etudes Touloises3 im Jahr 2014 zusammengestellt, was sicher bekannt ist.
Seine Lebensdaten (467? – 511) scheinen einigermaßen gesichert zu sein. Nach dem Tod seines Vaters Childerich im Jahr 483 folgte er diesem als Oberhaupt eines noch sehr kleinen „Reiches“ bereits mit 16 Jahren. Doch galt bei den Germanen und wohl auch bei den Sarmaten damals als Grenze zur Volljährigkeit das 14. Lebensjahr. Es war also nicht ungewöhnlich, dass er sofort ohne Einschränkung die Königswürde übernehmen konnte.
Der Name Chlodwig ist die heute im Deutschen gebräuchliche Buchstabierung seines Namens, im modernen Französisch lautet er Clovis, im modernen Deutsch Ludwig. Gregor von Tours schrieb ihn in seinem Latein „Chlodowech“. Der später sehr häufige Name Louis für französische Könige ist von diesem Namen abgeleitet.
Chlodwig hatte nur drei Schwestern; eine davon, Audofleda, wurde im Jahr 494 dem damaligen König der Ostgoten in Ravenna, Theoderich, zur Gemahlin gegeben, zur Besiegelung eines Bündnisses zwischen den beiden Reichen. Später sollte dieser Theoderich den Beinamen „der Große“ erhalten. Für Chlodwig dürfte es ein Glück gewesen sein, dass er keine Brüder hatte, denn in seiner Familie waren blutige Kämpfe um die Macht zwischen Brüdern sowohl in der Generation seines Großvaters Merowech wie auch nach seinem Tod geradezu üblich.
Der König war zweimal verheiratet. Von der ersten Frau kennt man den Namen nicht, sie dürfte aus einem rechtshreinischen Germanenstamm gekommen sein. Weil sie „Heidin“ war, halten manche Historiker sie nur für eine „Konkubine“. Doch sie gebar bereits 495 (?) den ältesten Sohn Theuderich, der mit den späteren Söhnen völlig gleichberechtigt, vielleicht sogar bevorrechtigt war.
Nach dem Tod dieser ersten Frau heiratete Chlodwig die burgundische Prinzessin Chrodechilde (auf Lateinisch Chrodegildis), die Tochter des Königs Chilperich II. Dieser Hochzeit ging eine bemerkenswerte „Story“ voraus, die an geeigneter Stelle im Teil II dieses Buches erzählt werden muss. Mit ihr hatte der König vier Söhne, von denen allerdings der erste schon bald nach der Geburt starb.
Von Chlodwig existiert weder eine Statue noch ein Bildnis, nicht einmal eine Beschreibung seiner Physiognomie, betont der Forscher Muller. Aber seine langen „gelockten“ Haare werden erwähnt, doch diese Eigenart teilte er mit seinen Vorfahren zurück bis zu König Chlodio, und auch alle späteren merowingischen Könige, die ja alle von Chlodwig abstammten, sollen diese Zier aufgewiesen haben. Sie hatte etwas Wichtiges zu bedeuten, darauf wird ebenfalls im Teil II des Buches genauer eingegangen werden müssen.
Ebenfalls sollen auf seinem Rücken dicke Haarborsten „wie auf dem Rücken eines Ebers“ gewachsen sein, ein Merkmal, das offenbar ebenfalls in der Familie der Merowingerkönige erblich war 4. Auch hierzu werden im Teil II wichtige Vermutungen dargestellt.
Von den verschiedenen Kriegen, die König Chlodwig führte, um sein Reich zu vergrößern, sind nur zwei im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches von Bedeutung. Bei beiden ist allerdings der Ort der Entscheidungsschlacht umstritten, bei einer auch das Jahr.
Die eine Schlacht war die gegen die Alemannen. Gregor von Tours behauptet, in ihr habe Chlodwig dem Christengott versprochen, sich taufen zu lassen, wenn er den Sieg erringen sollte, eine mehr als zweifelhafte Erzählung. Bisher nahm man in Historikerkreisen an, die Schlacht habe sich im Jahr 496 ereignet, doch deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass sie erst 506 stattfand. Und hier ist auch der Ort von großer Bedeutung. Vor allem deutsche Historiker sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass sie bei Zülpich stattfand, einem Städtchen etwa 35 Kilometer südwestlich von Köln im Rheinland. In der lothringischen Stadt Toul (an der oberen Mosel) ist man dagegen sicher, dass diese Schlacht dicht vor ihren Stadtmauern stattgefunden hat. Darauf wird im Teil II, Kapitel 18 genauer eingegangen werden.
Ob die Schlacht gegen das Heer der Westgoten in Vouilly in Südwestfrankreich oder anderswo stattfand, ist nicht so entscheidend, auch wenn Wissenschaftler darüber streiten. Das Datum scheint festzustehen, es fiel in den Sommer des Jahres 507.
Erst danach – und nicht schon 496! – begann die Phase, in der Chlodwig Christ wurde. Laut Gregor musste er erst mehrere Monate sorgfältig in den neuen Glauben eingeführt werden, ehe er die heilige Taufe empfing. Doch in Wahrheit scheint eine lange Phase des Zögerns auf beiden Seiten diesem Schritt vorangegangen zu sein, warum, das wird im Teil II ausführlich erklärt. Was dabei herauskam, war vor allem die Geschichtsfälschung, die ihre Wirkung bis heute nicht verloren hat.
In die letzte Zeit der Königsherrschaft Chlodwigs scheint die Abfassung des „salischen Gesetzes“ („Lex Salica“) gefallen zu sein. Es handelte sich um die schriftliche Festlegung von Gewohnheitsrecht (unter Germanen im Fränkischen Reich?) in lateinischer Sprache. Von Namen dieser Rechtssammlung haben Historiker seit Jahrhunderten abgeleitet, die Franken, denen der König Chlodwig entstamme, gehörten zu einem Stamm der „Salier“. Doch deutet keine Silbe in den alten Quellentexten Gregors und der ihm folgenden historischen Schriften aus dem Frühmittelalter (siehe dazu das nächste Kapitel) auf eine solche Herkunft; sie ist nur ein Phantasieprodukt viel späterer Historiker.
Chlodwig starb im November des Jahres 511; er wurde in Paris in einer Kirche feierlich beigesetzt.
3 Siehe Fußnote 1
4 So berichtete der byzantinische Schriftsteller Theophanes im 6. Jahrhundert von den Königen der Merowinger, zitiert von Jakob Grimm, Deutsche Mythologie Band I, Berlin 1875/78, S. 324 (Faksimile-Ausgabe Graz 1986)
3. Die „fränkische Wandersage“: eine „kecke Fabelei“?
Etwa 20 Jahre nach dem Tod Gregors von Tours machte sich ein anderer Chronist in Gallien daran, die Geschichte des Fränkischen Reiches zu beschreiben, natürlich ebenfalls auf Lateinisch. Man kennt den Namen eines Mönchs Fredegar, weiß aber kaum etwas über ihn. Er scheint im Jahr 613 (und wahrscheinlich auch noch etwas später) geschrieben zu haben. Ein weiterer Teil der recht umfangreichen Texte dürfte etwa um das Jahr 658 verfasst worden sein; man nennt das Ganze daher auch die „Chronik Fredegars und seiner Fortsetzer“ 5.
Anders als der Bischof Gregor hatte der Mönch Fredegar offenbar keine Hemmungen, Dinge über die Frühzeit der „Franken“ wiederzugeben, die ihm mündlich erzählt worden waren. Nach Lage der Dinge konnte er auf andere Weise auch überhaupt nichts erfahren haben. Vermutlich hat er sich bei verschiedenen alten Adelsfamilien aus der engen Umgebung des Königshauses erkundigt, was man dort über die Vorfahren noch wusste. Das war erstaunlicherweise zum Teil den bereits von Gregor von Tours in Erfahrung gebrachten Informationen ziemlich ähnlich, zum Teil ging es aber weit darüber hinaus, in Zeiten, die möglicherweise anderthalb Jahrtausende zurück lagen!
Es sind zwei Kapitel im „Buch III“, die hier wörtlich zitiert werden müssen, damit der Leser an Stellen weiter hinten in diesem Buch, wenn darauf Bezug genommen wird, nachschlagen kann, ob das Behauptete auch stimmt.
Kapitel 2:„Über die ältesten Frankenkönige schrieb der heilige Hieronymus, was schon vorher die Geschichte des Dichters Vergil berichtet: Ihr erster König sei Priamus gewesen, als Troja durch die List des Odysseus erobert wurde, seien sie von dort fortgezogen und hätten und hätten dann Friga als ihren König gehabt; sie hätten sich geteilt, und der eine Volksteil wäre nach Mazedonien gezogen, der andere hätte unter Friga – sie wurden als Frigier bezeichnet – Asien durchzogen und sich am Ufer der Donau und am Ozean niedergelassen, dann hätten sie sich nochmals geteilt und die Hälfte von ihnen sei mit ihrem König Francio nach Europa gezogen. Sie durchwanderten Europa und besetzten mit ihren Frauen und Kindern das Ufer des Rheins. Nicht weit vom Rhein versuchten sie eine Stadt zu bauen, die sie nach Troja benannten. Dieses Werk wurde zwar begonnen, aber unvollendet. Der andere Teil, der am Ufer der Donau zurückgeblieben war, erwählte sich Torcoth zum König, nach dem sie in diesem Lande Türken genannt wurden, und die anderen wurden nach Francio als Franken bezeichnet. …“
Für die Übersetzung des lateinischen Wortes „Torci“ in „Türken“ ist der moderne Übersetzer Kusternig verantwortlich. Als Philologe scheint er nicht viel von Geschichte verstanden zu haben. Denn wenn hinter der „Sage“ von „Frigern“ (Phrygiern?) und Mazedoniern, von „Torci“ (in Wahrheit wohl ein Stamm der Sarmaten!) und Vorgängern von „Franken“ historisch irgend etwas halbwegs Reales stecken sollte, dann spielte sich das spätestens in der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends ab! Da aber war von den späteren Türken in Kleinasien noch für mehr als tausend Jahre keine Rede. Die möglichen Zusammenhänge werden im Kapitel II. 1 näher erklärt.
Kapitel 9:„Die Franken wählten nach sorgfältigen Überlegungen einen König, der sich wie früher durch langes Haar auszeichnete, aus dem Geschlecht des Priamus, Friga und Francio, sein Name war Theudomer, Sohn des Richimer. … Ihm folgte in der Herrschaft sein Sohn Chlodio, der stärkste Mann seines Volkes, der in der Feste Esbargum im Gebiet der Thoringer residierte. … Man erzählt, Chlodio habe sich einmal im Sommer mit seiner Gattin an den Meeresstrand begeben, als seine Gemahlin mittags zum Baden ins Meer hinaus watete, habe sie ein Meer-Ungeheuer mit Stierkopf angefallen. Als sie nun daraufhin von dem Untier oder (eventuell auch als „sowohl als auch“ zu übersetzen!) von ihrem Mann empfing – sie gebar jedenfalls einen Sohn mit dem Namen Meroveus, nach dem später die Könige der Franken Merowinger genannt wurden.“
Gregor von Tours konnte noch nichts von der Flucht der „Franken-Vorfahren“ aus Troja erfahren haben, denn zu seiner Lebenszeit war die „Troja-Mär“ noch nicht erfunden (siehe dazu das Kapitel II.24). Für Fredegar war die Geschichte jedoch bereits selbstverständlich, wurde aber auch nicht vertieft.
Noch eine dritte Handschrift aus dem frühen Mittelalter berichtet etwas über die „Ahnen der Merowinger“. Es ist das „Liber historiae Francorum“ genannte Werk eines unbekannten Verfassers, das angeblich um das Jahr 727 entstanden sein soll.
Genau wie bei den bisher genannten Geschichtswerken existiert auch von diesem heute keine Original-Handschrift mehr. Immerhin sind aber alle drei Manuskripte später mehrfach und immer wieder abgeschrieben worden, so dass ihre Texte bis ins 16. Jahrhundert überdauert haben. Ab dann konnte die neu erfundene Druckkunst diese so wichtigen Quellen „verewigen“. So viel zu derartig alten Handschriften; kein einziges Buch aus der Antike oder aus dem frühen Mittelalter hat ohne die oft wiederholte Abschreibarbeit fleißiger Mönche in den europäischen Klöstern im Original die lange Zeit überstanden.
Das „Liber historiae Francorum“ ist zwar das späteste Geschichtswerk, das für die Beweisführung in diesem Buch so wichtig ist. Aber es enthält erstaunlicherweise die ausführlichste Darstellung der „fränkischen Wanderung“ mit Informationen, die den älteren Werken fehlen, aber dennoch auch wieder Teile, die den Berichten des Gregor und des Fredegar überraschend ähneln. Wieder sind ausschließlich mündliche Informationen als Quelle denkbar. Doch in den alten Adelsfamilien des Frankenreichs, die wohl als Informanten dienten, wird genau wie später in solchen „Dynastien“ der Stolz auf die Taten der Vorväter so groß gewesen sein, dass Lieder oder Geschichten darüber jedes Jahr oder öfter vor allen Mitgliedern vorgetragen wurden und so von Generation zu Generation weitergetragen wurden.
Aus diesem Buch 6 sind sogar fünf ausführliche Kapitel für das Thema „Die Ahnen der Merowinger“ von Belang (Buch I).
Kapitel 1: „Den Anfang, die Herkunft und die Taten der Frankenkönige und ihrer Völker will ich erzählen. In Asien liegt die Stadt der Trojaner. Diese Stadt heißt Ilium und dort herrschte Äneas. Das Volk war tapfer und stark, die Männer voll unbändiger Kriegslist und stets waren sie in Kämpfe verwickelt, bis sie die Nachbarschaft im Umkreis unterworfen hatten. Da erhoben sich die Könige der Griechen mit einem großen Heer gegen Äneas und kämpften gegen ihn in einer schrecklichen Schlacht, und viel Volk der Trojaner kam dort um. Äneas floh deshalb und verschanzte sich in der Stadt Ilium, sie kämpften um diese Stadt zehn Jahre lang. Als sie sie endlich erobert hatten, floh der Tyrann Äneas und siedelte seine Leute in Italien zum Kampf an. Andere Fürsten, wie etwa Priamus und Antenor, verluden das restliche zwölftausend Mann starke Heer der Trojaner auf Schiffe und fuhren bis zu den Ufern des Don. Dort zogen sie durch die Asowschen Sümpfe, in deren Nähe sie schließlich nach Pannonien kamen, und erbauten eine Stadt, der sie in Erinnerung an ihre Vorfahren den Namen Sicambria gaben. Dort wohnten sie viele Jahre und wurden ein großes Volk.
Kapitel 2 :In jener Zeit empörten sich, wie schon oft, die schrecklichen, bösen Alanen gegen Valentinian, den Kaiser der Römer und der anderen Völker. Er stellte von Rom aus ein großes Heer auf und marschierte gegen sie und bezwang sie in einer Schlacht entscheidend. Geschlagen wandten sie sich über die Donau und kamen auf ihrer Flucht zu den Asowschen Sümpfen. Da sprach der Kaiser: ‚Wer auch immer in diese Sümpfe vordringen kann und dieses böse Volk von dort verjagt, dem will ich auf zehn Jahre einen Ehrensold gewähren‘. Da versammelten sich die Trojaner, legten, wie sie es gelernt hatten, einen Hinterhalt, stießen mit dem übrigen Römervolk in die Asowschen Sümpfe vor, vertrieben die Alanen von dort und vernichteten sie mit der Kraft ihres Schwertes. Damals gab ihnen Kaiser Valentinian aufgrund ihrer unbeugsamen Verwegenheit den Namen Franken, was in der attischen Sprache soviel wie „die Wilden“ heißt.
Kapitel 3:Als zehn Jahre verstrichen waren, sandte der erwähnte Kaiser Steuereintreiber zu den Franken unter der Führung des römischen Senators Primarius (oder Ersten Senators?), denen sie die üblichen Abgaben geben sollten. Jene aber trafen in ihrer wilden und ungestümen Art eine törichte Entscheidung und sagten zueinander: ‚Wir haben die Alanen besiegt, jenes tapfere unabhängige Volk, das der Kaiser samt dem römischen Heer nicht aus den Sumpfverstecken hatte vertreiben können. Warum sollten also wir, die wir sie besiegten, Steuern zahlen? Wir wollen uns daher gegen diesen Primarius und seine Steuereintreiber empören, sie töten und ihnen alles wegnehmen, was sie mit sich führen; dann verweigern wir den Römern die Abgaben, und wir werden gemeinsam frei sein.‘ So bereiteten sie ihnen einen Hinterhalt und töteten sie.
Kapitel 4:Als der Kaiser das hörte, wurde er überaus zornig, befahl ein Heer aufzustellen, das aus Römern und anderen Völkern bestand, übertrug das Oberkommando Arestarcus und ließ die Truppen gegen die Franken ziehen. Dort kam es aber zu einer heftigen Schlacht zwischen den beiden Völkern. Schließlich mussten die Franken einsehen, dass sie einem so großen Heer nicht gewachsen waren, und zogen sich unter sehr schweren Verlusten zurück; auch Priamus, der tapferste unter ihnen, kam dort ums Leben. Sie verließen Sicambria, kamen zu den am äußersten Rhein gelegenen Städten Germaniens und ließen sich dort mit ihrem Anführern Marchomir, dem Sohn des Priamus, und Sunno; dem Sohn Antenors, nieder; sie wohnten viele Jahre hier. Nach dem Tod Sunnos fassten sie den Entschluss, dem Beispiel der übrigen Völker folgend einen König einzusetzen. Auch Marchomir riet ihnen dazu, und so wählten sie und erhoben dessen Sohn Faramund zu ihrem König mit dem gelockten Haar …
Kapitel 5:Nach dem Tod König Faramunds erhoben sie seinen Sohn Chlodio zum König mit dem gelockten Haar im Reiche seines Vaters. Seit dieser Zeit wurden gelockte Könige die Regel. In der Folge erkundeten sie das Reich der Toringer und ließen sich dort nieder. König Chlodio wohnte in Germanien in der Festung Dispargum im Siedlungsgebiet der Toringer. … König Chlodio sandte von der toringischen Feste Dispargum Kundschafter bis zur Stadt Cambrai. Er selbst überquerte später mit einem großen Heer den Rhein, tötete viel Volk der Römer und trieb sie in die Flucht. …“
In den beiden in diesem Kapitel zitierten Geschichtswerken werden bruchstückhaft einige Namen früherer Könige aus der Sippe der späteren Merowinger genannt, und es wird behauptet, die Franken stammten aus dem von Griechen eroberten Troja ab. Erst nach verschiedenen Wanderungen seien sie an den Rhein gekommen, allerdings schon vor langer Zeit. Man hat sie auch zusammenfassend „Wandersage der Franken“ genannt.
An einer bestimmten Stelle des „Liber“-Berichts muss man eigentlich noch ein längeres Zitat aus der „Frankengeschichte“ des Gregor von Tours einfügen. In einem Kapitel, in dem er ausführlich vom Krieg der Söhne König Chlodwigs gegen die Thüringer im Jahr 531 berichtet, bringt er plötzlich wörtlich (!) eine Rede des Königs Theuderich an seine Krieger, in der er sie an die „Untaten der Thüringer“ erinnert, die diese ihren Vorfahren zugefügt hätten (Buch III, Kap. 7). Was es damit auf sich hat, wird in Kapitel II. 7. dieses Buches näher erklärt. Doch bisher scheint keinem einzigen Geschichtsprofessor überhaupt auch nur aufgefallen zu sein, welche Bedeutung diese Textstelle hat.
Aus diesen Quellen haben bald darauf die in vielen Klöstern entstehenden „Weltchroniken“ und ähnliche Werke Kurzfassungen festgehalten, teils mit eigenen Worten, teils unter wörtlichen Zitaten, aber ohne Zufügung neuer Einzelheiten. Bis ins späte Mittelalter ist diese „Legende“ offenbar wohl von den Autoren, die sie wiedergaben, wie von deren Lesern ohne einen Anflug von Zweifeln geglaubt worden.
Ganz anders stand es mit den modernen historischen Wissenschaftlern, etwa seit dem späten 19. Jahrhundert. Hier urteilten die Fachleute, die sich mit diesen Texten beschäftigten, empört und ablehnend. Es handle sich um „Erzeugnisse kindischer Gelehrsamkeit und kecker Erfinder“, meinte W. Wattenbach, der erste Herausgeber des „Liber“ in modernem Druck 7. Auch Bruno Krusch, der Bearbeiter des „Fredegar“ für den Abdruck in den Monumenta Germaniae Historiae 8, hielt diesen Autor für den Erfinder der „Trojamär“.
Noch Friedrich Panzer nannte in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Ganze eine „gelehrte Fabelei“ 9 . Selbst der zeitgenössische amerikanische Forscher Patrick J. Geary, der sonst sehr moderne Ansichten hinsichtlich der Entstehung der „Franken“ vertritt, hält beide Legenden (Gregor mit der von ihm berichteten Herkunft der Franken aus Pannonien und Fredegar mit der Herkunft aus Troja) für „Phantasieprodukte“10. Was nach Ansicht des Autors dieses Buches wirklich dahinter steckt, wird im Teil II genau erläutert.
Den erwähnten Historikern (und vielen anderen, die man ebenfalls zitieren könnte) ist nicht aufgefallen, dass alle drei Texte aus dem Frühmittelalter nicht mehr verstandene Bruchstücke aus der mündlichen Erinnerung in bestimmten Adelsfamilien aus der nächsten Umgebung der Königsdynastie wiedergeben. Bestimmte Floskeln, die sich in allen drei Texten wiederholen (z.B „Chlodio mit dem gelockten Haar“, die „Festung Dispargum im Gebiet der Toringi“, „Chlodio schickte Kundschafter …“ usw.) machen es sicher, dass fest in den Köpfen geübter Erzähler eingeprägte Wendungen selbst in verschiedenen Jahrhunderten immer noch in gleicher Weise erzählt wurden.
Allerdings kann das wohl nur Forschern auffallen, die sich lange mit der oralen (mündlichen) Überlieferung in Zeiten „vor der Schrift“ beschäftigt haben, also mit sogenannten „Sagen“. Das dürfte für Historiker an deutschen Universitäten selbst im beginnenden 21. Jahrhundert nur selten der Fall sein.
Stattdessen konnten für diese Fachleute die „unglaublichen“ Erzählungen der mittelalterlichen Texte entweder nur „Lesefrüchte“ aus anderen Büchern gewesen sein, oder – viel wahrscheinlicher – das Erzeugnis der blühenden Phantasie der damaligen Autoren, vorrangig zum Zwecke der „politischen“ Beeinflussung der Leser.
„Aufgabe“ solcher Fabeln oder Legenden sei die Bildung eines Traditionsbewusstseins des entstehenden „fränkischen Volkes“ gewesen, so wie die ebenfalls im Frühmittelalter entstandenen Werke über die „Origo gentis“ der Goten oder der Langobarden oder der Angelsachsen. Eine Historikerin, die sich erst kürzlich intensiv mit derartigen „Origines gentis“ beschäftigt hat, bezieht jedenfalls ohne nähere Prüfung auch die „fränkische Wandersage“ in diese Art Werke ein 11.
Diese Wandersage sei wichtig gewesen „für die Herausbildung eines mittelalterlichen französischen Geschichtsbewusstseins“, behauptete auch der Franken-Forscher tschechischer Nationalität Frantisek Graus, doch musste der sich von Reinhard Schneider belehren lassen, dass sich diese Fabel „gerade nicht zu den entscheidenden Traditionen Frankreichs herausgebildet“ habe 12.
5 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii libri quattuor … ed. Bruno Krusch, (MGH SS. Rer. Mer. , Hannover 1888, übersetzt von Andreas Kusternig, in der „Freiherr-vom-Stein-Gedächtnis-Ausgabe“, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt 1984
6 Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters (sog. Freiherr-vom- Stein-Ausgabe, Wissenschaftl. Buchgesellschaft Darmstadt 1984. Band 4 a. Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts; übersetzt von Andreas Kusternig
7 W. Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Merowinger und Karolinger, 1893/94
8 Fredegar, Chronicae II, 4 -9, ed. Bruno Krusch (MGH SS. Rer. Mer. II) Hannover 1888, zitiert bei E. Ewig, Trojamär, S. 2, Anm. 13
9 Friedrich Panzer, Nibelungische Problematik, SB d. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse Jg. 1953/54, 3. Abh.
10 Patrick J. Geary, Die Merowinger, München 1996 (aktual. Neuausgabe), S. 84
11 Alheydis Plassmann, Origo gentis – Identifikations- und Legitimationsstiftung in frühen und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen; Berlin 2006
12 Reinhard Schneider, Das Frankenreich, Oldenbourg Grundriss der Geschichte, München 1990, S. 9
4. Der aufschlussreiche Brief des Trithemius von 1513
Die in den vorigen Kapiteln behandelten Texte aus dem Frühmittelalter waren im Prinzip stets bekannt, wenn auch nur von wenigen Historikern beachtet, und wenn, dann falsch.
Der lateinisch geschriebene Brief aus dem Jahr 1513, der in diesem Kapitel vorgestellt und kommentiert wird, dürfte von keinem einzigen Geschichtsforscher der Neuzeit je auch nur aufmerksam gelesen worden sein. Dabei scheint es die alte Quelle zu sein, die am überzeugendsten die Realität über die Vorfahren der Merowinger-Könige andeutet.
Am Anfang des 16. Jahrhunderts begannen sich der damalige Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“, Maximilian I. (der Großvater Karls V.) sowie Historiker und Gelehrte aus seiner Hofkanzlei in Innsbruck für die Behauptung zu interessieren, auch das Fürstenhaus der Habsburger (die Familie Maximilians) sei genealogisch mit den Merowingern verknüpft. Sie stamme also von dieser „heiligen“ Dynastie ab, die einst die Römer in der Herrschaft über Mitteleuropa abgelöst hatten.
Der kaiserliche Rat Jacob Mennel legte nach längeren Forschungen seinem Dienstherrn im Jahr 1507 auf dem Reichstag zu Konstanz eine gedruckte „Cronica Hapsburgensis nuper rigmatice (jüngst gereimt) edita“ vor. Sie bestand aus einem längeren Gedicht in deutscher Sprache 13. Darin wurde erstmals eine vollständige Genealogie der Grafen von Habsburg veröffentlicht, die deren direkte Abstammung auf einen „König Odoperth“ zurückführte, der ein Sohn des Königs Clotarius gewesen sei. Gemeint war wohl damit Chlothar, einer der Söhne Chlodwigs.
Die historische Glaubwürdigkeit dieser genealogischen Ableitung ist sehr gering, spielt aber für die Beweisführung in diesem Buch keine Rolle. Die vor Chlodwig genannten Königsnamen aus dem Haus der Merowinger lauten: Priamus, Marcomir, Pharamund (Faramund), Clodio, Meroveus und Childericus. Alle diese Namen kamen in den Werken über die frühen Franken aus dem Mittelalter vor (siehe die vorigen Kapitel), die ja auch den Historikern des frühen 16. Jahrhunderts bekannt waren. In dieser Beziehung brachte das Werk von Jacob Mennel nichts Neues.
Einige Jahre nach dieser Buchveröffentlichung erhielt Kaiser Maximilian einen – nach der Art der Zeit lateinisch geschriebenen – Brief des Abtes Johannes Trithemius aus Würzburg, dem Kaiser schon durch häufigen Briefwechsel bekannt. Darin wollte der Abt seinem Kaiser weitere Einzelheiten über die Genealogie der Habsburger zukommen lassen, im Anschluss an Mennels Forschungen, die Trithemius natürlich kannte und in keiner Weise bezweifelte.
Er erinnerte sich an ein altes Manuskript, das er einst in seinem Kloster Sponheim in seiner Sammlung gehabt und gelesen hatte, und das von einem Historiker namens Hunibald aus der Zeit des Königs Chlodwig stammen sollte. Dieser Brief von 1513 ist im kaiserlichen Hofarchiv sorgfältig aufbewahrt worden 14. Seit 1840 ist er auch gedruckt zu lesen.
Eine deutsche Übersetzung dieses Textes existierte bisher noch nicht. Die hier vorgelegte stammt vom Autor dieses Buches, der zwar kein studierter Philologe ist, aber als Schüler eines humanistischen Gymnasiums vor dem Zweiten Weltkrieg so viel Latein gelernt hat, dass er diesen Text wohl richtig ins Deutsche bringen konnte.
Die wichtigen Teile des Briefes des Abtes Trithemius an Kaiser Maximilian I. aus dem April 1513 werden hier also erstmals in Deutsch wiedergegeben:
„Hunibald schrieb, wenn ich mich richtig erinnere, vom Ursprung und den Taten der Franken in 18 Teilen („Büchern“) in einem Band. Die Zeit des Königs Chlodwig, Königs der Franken in Germanien und Gallien, war die fünfte