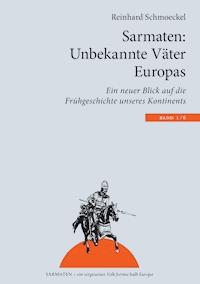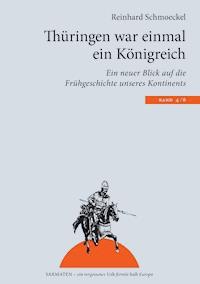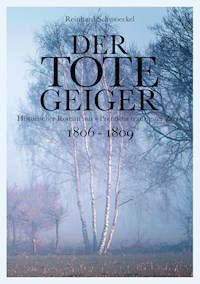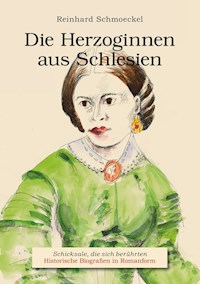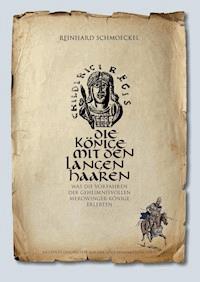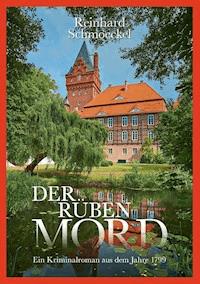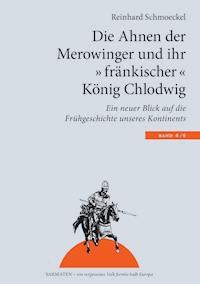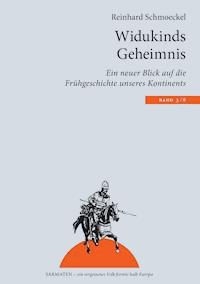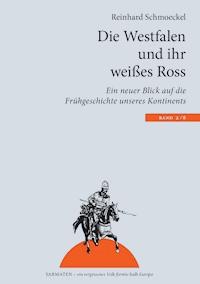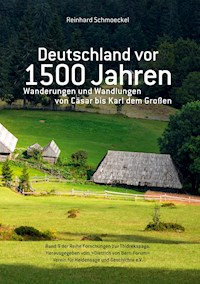
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beschreibt und erklärt Laien, die an unserer Geschichte interessiert sind, verständlich auf nur gut 200 Seiten, was in Deutschland in den ersten 800 Jahren nach Christi Geburt passiert ist und welche Wandlungen hier geschehen sind; nur wenige Fachleute kennen sich da aus. Darüber hinaus ergibt diese Materialsammlung ganz neue und überraschende Erkenntnisse zur deutschen und europäischen Frühgeschichte: Sowohl die Begründer des angeblichen "Frankenreichs" (im heutigen Frankreich), die Dynastie der Merowinger, wie auch in Deutschland der Adel der (Nieder-)Sachsen, der Thüringer und der Schwaben kamen aus dem Volk der Sarmaten, das von der Geschichtswissenschaft völlig übersehen wird. Es werden wohl noch einige Generationen vergehen, bis dieses Wissen in Deutschland allgemein ist. Aber hier sind die Fakten !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Die Römer wollen ganz Germanien, doch müssen sie sich bescheiden
(ca. 50 v.Chr. -100 n.Chr.)
Am Rhein eine Zeit des Friedens, dann aber immer mehr Wanderungen
(ca. 100 – 280 n. Chr.)
Viel Neues im Römerreich, doch in Germanien nur noch Verteidigung
(284 – 375 n .Chr.)
Im Osten bedrohen die Hunnen das Reich, im Westen herrscht Angst und Chaos
(376 – 455 n. Chr.)
Ein altes Volk zerfällt, ein Kaiserreich wird vergessen, und eine neue Macht entsteht
(456 – 511 n. Chr.)
Das Frankenreich dehnt sich aus, und von Osten kommen neue Einwanderer
(511 – 613 n. Chr.)
7 Im Westen wie im Osten: überall tiefer Wandel
(613 – 714 n. Cr.)
Eine starke Macht herrscht in unserem Land und in fast ganz Europa
(714 - 814 n. Chr.)
Nachwort
Bücher von Reinhard Schmoeckel
Vorwort
Der hiermit vorgelegte Band erscheint als Band 9 der Reihe „Forschungen zur Thidrekssaga, herausgegeben vom Dietrich von Bern-Forum – Verein für Heldensage und Geschichte e.V.“. Warum, obwohl darin nur recht wenig von der Thidrekssaga die Rede ist?
Seit mehr als 40 Jahren habe ich mich als privater Forscher ziemlich intensiv mit der Frühgeschichte Deutschlands und Europas beschäftigt. Im Laufe dieser Arbeit glaube ich, eine ganze Reihe von wichtigen Vorgängen und Entwicklungen aus dieser in vielen Bereichen noch weitgehend unbekannten Zeitperiode herausgefunden zu haben, vor allem auch solche, die bisher noch nicht in die Vorstellungen der „zünftigen“ Geschichtswissenschaft eingedrungen sind.
Dieses Buch enthält eine Zusammenfassung und gewissermaßen einen Abschluss dieser Erkenntnisse aus einem langen Forscher-Leben in einer Form, die auch für an Geschichte interessierte Laien lesbar ist, also „populärwissenschaftlich“.
In meinen Untersuchungen zur Frühgeschichte unseres Landes stieß ich ziemlich früh auf die „Thidrekssaga“. Das ist ein umfangreicher Sagentext in nordischer Sprache, aber offensichtlich nur eine Übersetzung aus viel älteren niederdeutschen, lange nur mündlich überlieferten, Sängertexten. Die Erforschung dieses „Rätselbuches der deutschen Frühgeschichte“ hat mich überhaupt auf den Pfad gebracht, der mich meine Entdeckungen finden ließ.
Im Jahr 2000 habe ich den Verein „Thidreksaga-Forum e.V.“ und die Vierteljahreszeitschrift DER BENER gegründet und war lange der Vorsitzende und Redakteur der Zeitschrift. Der Name des Vereins wurde später in „Dietrich von Bern-Forum e.V.“ geändert. Er vereinigt eine nicht unbeträchtliche Zahl von Laien forschern und an dem Thema interessierten Lesern, übrigens keineswegs nur aus Deutschland.
Neben mir haben viele andere Autoren wichtige Sachbeiträge in den inzwischen über 80 umfangreichen Heften der Zeitschrift geliefert und manche Rätsel dieser Sage lösen helfen, aber auch Aufklärung über zahlreiche andere Aspekte der Geschichte jener Zeit gebracht. Gerade die Auseinandersetzung mit zum Teil erheblich von meiner Meinung abweichenden Thesen, aber auch die Erkenntnis erstaunlicher Übereinstimmungen mit Funden von Kollegen hat meine eigenen Erkenntnisse gefördert, auch solche, die mit dem engeren Thema „Thidrekssaga“ nichts zu tun hatten. Das alles hat mein Wissen über die vermutlich reale Geschichte jener Jahrhunderte in unserem Land sehr stark vermehrt.
Die Erkenntnisse dazu eröffneten sich mir auch nur schrittweise, aber ich habe sie im Laufe mehrerer Jahre in verschiedenen gedruckten Büchern veröffentlicht, immer wieder ergänzt durch neues Wissen, zum Teil, wie gesagt, durch Sach-Hinweise meiner Autoren-Kollegen, aber auch von Lesern meiner Aufsätze und Bücher, die sich allmählich wie Puzzlestückchen in ein schon in Umrissen vorhandenes Bild fügten.
Immer deutlicher schälte sich dabei heraus, dass die seit jeher von den Historikern geübte Methode, ausschließlich schriftliche Quellen (aus der betreffenden Zeit oder wenigstens kurz danach verfasst) als Belege für geschichtlicher Erkenntnisse zu verwenden, nicht genügen kann.
Sind nicht auch Argumente aus der Sprachwissenschaft, der Religionsgeschichte, der Heraldik, der Ortsnamenkunde und zahlreichen anderen Wissenschaften berechtigt, zur Beweisführung in einem Buch über Geschichte herangezogen zu werden? Es war für mich erstaunlich zu beobachten, wie Indizien aus solchen „Nebenwissenschaften“ – vielfach eben von Kollegen oder Lesern geliefert – sich immer mehr zu einem überzeugenden Bild zusammenfügten.
Und noch eine weitere Ebene von „Geschichtsquellen“ scheint es zu geben. Sie hat sich allerdings nur in ganz seltenen Fällen erhalten und kann auch nur dann ausgeschöpft werden, wenn zufällig ein „Kundiger“ mit ihnen in Berührung kommt. Das ist das im Unter bewusstsein des Gedächtnisses der Angehörigen mancher sehr, sehr alter Familien bewahrte Wissen über sehr, sehr alte Zustände oder Verhältnisse. Im Gespräch mit einer alten Freundin und Kollegin im Vorstand des „Dietrich von Bern-Forums“ hat sich das noch im Jahr 2020 überraschend gezeigt. Im Buch wird darauf an passender Stele eingegangen.
Bedingt durch die Zeit und die Region, der meine Forschungen galten, kann ich nur wenige Beweise für meine Thesen anführen, wie sie ein akademischer Historiker verlangt, nämlich schriftliche Quellen. In Deutschland konnte vor 1500 Jahren niemand schreiben, und die schriftkundigen Völker im Süden und Südosten interessierten sich kaum für diese Gegend.
In meinen inzwischen veröffentlichten Büchern habe ich ausführlich die Belege für meine Thesen zusammengetragen und erläutert und auch die wissenschaftlichen Quellen genannt, auf die ich mich gestützt hatte. Hinzu kommen verschiedene ausführliche Aufsätze in der Zeitschrift DER BERNER.
In diesem Buch, eben einer kurzen Zusammenfassung, verzichte ich aus Platzgründen auf umfangreiche Begründungen und Quellenbelege und kann nur (in den Anmerkungen) die Stellen in diesen Büchern und Aufsätzen nennen, wo ein interessierter Leser genauere Ausführungen und auch Quellenangaben dazu finden kann.
Der Leser wird bald begreifen, dass es unmöglich ist, sich beim Bericht über das, was hier vor 2000 oder 1500 oder 1200 Jahren geschehen ist, auf das geographische Gebiet zu beschränken, das wir heute Deutschland nennen. Immer haben Vorgänge, die sich westlich oder östlich davon vollzogen, eine entscheidende Rolle für die Geschichte hier gespielt. Unser Land mitten in Europa ist von Anbeginn eine Region gewesen, in die fremde Völker mit anderen Sprachen, anderer Abstammung und Gebräuchen eingewandert sind und sich mit bisherigen Einwohnern vermischt haben oder ihnen wenigstens sprachlich eine andere Prägung gegeben haben. Wer behauptet, vor kurzem noch habe es ein einheitliches „deutsches Volk“ gegeben, das bewahrt werden müsse, weiß nichts von deutscher Geschichte.
Hier, in diesem Buch kann man etwas über die unbekanntesten Jahrhunderte dieser Geschichte lernen, die ersten 800 Jahre nach der Zeitenwende. Und der Leser, der sich vorrangig für die Thidrekssaga interessiert, kann das, was dort erzählt wird, einordnen in das, was rundherum passierte.
Dortmund, im Herbst 2020
Reinhard Schmoeckel
Kapitel 1
Die Römer wollen das Land - und müssen sich bescheiden
ca. 50 v. Chr. – 100 n. Chr.
Dieses Buch will erzählen, was in Deutschland an Wichtigem in den acht Jahrhunderten nach der Zeitenwende stattfand. Doch zuvor ist es nützlich, einen ganz kurzen Blick auf die Jahrtausende zu werfen, die davor lagen und in denen es schon Menschen in diesem Gebiet gab
Denn anders als in anderen Erdgegenden hatte das Eis der letzten Eiszeit, das zuvor lange ganz Norddeutschland in riesigen Gletschern überdeckt hatte, erst vor relativ kurzer Zeit zu schmelzen begonnen und hatte sich nach Nord-Skandinavien zurückgezogen (spätestens ab 13 000 v. Chr.). Ungeheure Wälder hatten sich in dem vom Eis freigegebenen Gebiet gebildet, aber es war noch immer nass, voller Seen und Sümpfe. Ähnliches galt für das Alpenvorland in Südbayern, wo auch die Alpengletscher zu einem großen Teil verschwunden waren. Mammuts und Rentiere gab es hier nicht mehr, dafür Hirsche, Wildschweine, Steinböcke, Wölfe und Bären.
Und natürlich Menschen. Ganz wenige Jäger und Sammler hatten noch während der Eiszeit in den eisfreien Gebieten im mittleren Deutschland Mammuts gejagt, die aber eben immer weiter nach Norden abzogen, so wie das Eis schmolz. Einige kleine Menschengruppen waren dieser Art Jagdbeute immer weiter nach Norden gefolgt, bis ins nördliche Skandinavien. Von ihnen stammen die Sami ab, die man auch Lappen nannte.
Ganz wenige der Eiszeitjäger blieben im Lande und mussten sich auf eine neue Landschaft einstellen, auf Wälder, Moore, Flüsse und neues Jagdwild. Doch sie blieben nicht lange allein. In mehreren Schüben im Abstand von einigen tausend Jahren kamen Menschen in Mitteleuropa an, die zuvor in Kleinasien, im nördlichen Teil der Balkanhalbinsel und nördlich des Schwarzen Meeres gelebt hatten, dort, wo es auch während der Eiszeit kein Eis gegeben hatte. Langsam nach Norden vordringend, siedelten sie sich hier in kleinen Dörfern an, denn diese Menschen waren keine Jäger und Sammler mehr, sondern Ackerbauern (und Kleintierzüchter).
Irgendwann erreichten Gruppen dieser Einwanderer auch die Küsten der Nordsee und der Ostsee und konnten sich jenseits des Meeres in Südskandinavien (Dänemark, Südschweden, Südnorwegen) festsetzen. Hier wurden sie oder Teile davon zu geschickten Hochseefischern, die mit ihren Ruderbooten Jagd auf Robben und Meeresfische machten.
Immer wieder kamen neue Gruppen von Menschen aus Südosteuropa und brachten neue Künste mit, z. B. das Gewinnen und Verarbeiten von Kupfer, später auch das Vermischen von Kupfer und Zinn zur haltbaren Bronze.
Es war nach dieser Eiszeit wieder recht warm geworden in Europa und in Deutschland. Vor 5000 - 3000 Jahren herrschte in Mitteleuropa ein Klima wie heute rund um das Mittelmeer. In der sogenannten Bronzezeit – in eben jener Epoche – war es angenehm, hier zu leben, und selbst weit entfernt von einander wohnende Menschengruppen erfuhren Neues durch die Händler, die mit ihren Ochsenkarren oder auf Schiffen quer über das Mittelmeer und den Atlantik nun weite Wege zurücklegten, um ihre inzwischen vielfältigen Waren gewinnbringend abzusetzen.
Dumme „Steinzeittypen“ waren die Menschen hierzulande damals ganz gewiss nicht mehr. Etwa zur gleichen Zeit, als in Britannien die Menschen die berühmte Anlage von Stonehenge (in ihrer letzten Phase, etwa um 2800 v. Chr.) bauten, legten etwa in Westfalen die Menschen eine riesige Karte des Sternenhimmels auf vielen tausend Quadratkilometern an, indem sie die Punkte am Himmel mit großen Steinmalen maßstabgerecht abbildeten. Die einzelnen Punkte blieben seitdem in der Erinnerung der dort lebenden Menschen so eindrucksvoll „heilig“, dass noch mehr als 3500 Jahre später die ersten christlichen Kirchen exakt am Ort diese Steinmale gebaut werden konnten 1.
Wieder etwas später kamen neue kleine Menschengruppen von Osten nach Mitteleuropa, diesmal auf der Flucht vor Hitze- und Trockenperioden in ihrer Heimat nördlich des Schwarzen Meeres. Es waren keine Eroberer, dafür waren sie viel zu wenig, aber sie brachten es fertig, den Menschen in Ost- und Mitteleuropa, zwischen denen sie sich niederließen, in wenigen Generationen klarzumachen, dass sie die Herren waren und dass ihre neuen Untergebenen sich nach ihrer Sprache zu richten hatten. Dies war der Beginn der Verbreitung von indeoeuropäischen Sprachen in Europa, denn die Neuankömmlinge brachten eine noch ziemlich einheitliche Sprache von ihren alten Wohnsitzen beiderseits der unteren Wolga mit 2. Das geschah um etwa 2000 v. Chr. In wenigen Jahrhunderten sprachen die Menschen in Ost- und Mitteleuropa ein Idiom, das die Sprachwissenschaftler „Alteuropäisch“ nennen, doch entstanden schnell verschiedene Dialekte und bald auch eigene Sprachen daraus.
In der Mitte des letzten Jahrtausends v. Chr., also etwa um das Jahr 500, lebten in heutigen Deutschland im Wesentlichen drei unterscheidbare Gruppen von Menschen. Im Süden waren es Kelten, einem Volk mit eigener Sprache, die sich in der langen Zeit aus dem Ur-Indoeuropäischen weiter entwickelt hatte. Diese Kelten waren durchaus ein Kulturvolk; da sie aber offenbar bewusst nichts Schriftliches über ihre Städte, ihre Geschichte und ihre wissenschaftlichen Leistungen von sich gegeben haben, weiß man nur wenig über sie. Damals, also in der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr., waren sie in halb Europa ansässig, von Frankreich über Süddeutschland, Österreich und große Teile der Balkanhalbinsel – lange vor den Römern. Allerdings haben die vielen verschiedenen keltischen Stämme nie so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt oder nach großflächiger Herrschaft gestrebt. In der Beziehung waren sie ganz anders als die Römer, die ihnen als „Herren Europas“ folgen sollten.
Ganz im Norden Deutschlands, an der Nord- und Ostseeküste, vor allem aber auch in Dänemark, Schleswig-Holstein, Südschweden und Südnorwegen, lebten Menschen, denen die Archäologen den Namen „nordische Kultur“ gegeben haben. Sie waren die Nachkommen der Menschen, die schon Jahrtausende vorher diese Gegenden besiedelt hatten. Wahrscheinlich war ihre Sprache auch schon eine Frühform des Germanischen, aus dem Alteuropäischen weiter entwickelt, aber mit vielen Worten, die nicht aus dieser „Ursprache“ stammen können.
Zwischen beiden, den Kelten im Süden und den Früh-Germanen im Norden, muss es in Deutschland noch eine dritte Bevölkerungsgruppe gegeben habe, die wohl damals eben keine der beiden Sprachen benutzte, sondern ein anderes Idiom, aber ebenfalls indoeuropäischer Abstammung. Es waren offenbar wehrhafte, aber zäh an ihrem Boden festhaltende Bauern, die – in mehrere Stämme geteilt – zwischen dem südlichen Holland und der Aller quer durch das heutige Nordwestdeutschland siedelten. Drei deutsche Professoren aus verschiedenen Fachwissenschaften haben in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Menschengruppe „Nordwestblock“ getauft 3 . Doch hat der Großteil der deutschen Historiker, Sprachwissenschaftler und Archäologen lieber keine Kenntnis davon genommen, weil einige Kollegen die Thesen der drei Wissenschafter heftig kritisiert hatten.
Zwei Ereignisse aus der Zeit vor Christi Geburt müssen noch erwähnt werden, weil sie auch danach noch für Menschen im heutigen Deutschland von Bedeutung waren. Das eine war eine deutliche Klimaverschlechterung ab der Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends. Zuvor hatte sich zwar schon lange die Warmzeit (das sogenannte „Atlantikum“) in ein normales, „mitteleuropäisches“ Klima verändert. Aber nun wurde es für lange Zeit deutlich kühler und regnerischer, wenigstens im nördlichen Mitteleuropa. Das hatte Notzeiten vor allem für die Germanen im Norden und die „Nordwestleute“ in Deutschland zur Folge, schlechte Ernten, Hunger und auch das Abreißen von früher recht lebhaften Verbindungen zu den Völkern weiter im Süden. Allerdings wurden die Menschen dort – für lange Zeit ungestört von Einflüssen von außen – auch so hart, so kräftig und so rücksichtslos, wie sie ein paar Jahrhunderte später in der sogenannten „Germanischen Völkerwanderung“ zutage traten.
Das zweite Ereignis hatte seinen Ursprung weit weg, in den riesigen Steppen Südrusslands und Kasachstans. Die dort lebenden Viehhirten, Menschen mit indoeuropäischer Sprache, den alten Persern verwandt, hatten die bei ihnen in großen Herden lebenden Wildpferde längst gefangen, gezähmt und als Zugtiere für Wagen entdeckt. Im letzten Jahrtausend v. Chr. hatten sie auch gelernt, auf diesen Pferde zu reiten. Das machte sie allen Bauern überlegen und zugleich auf ihre neue Stärke stolz und angriffslustig.
Zwischen etwa 800 und 500 v. Chr. zogen Scharen berittener Kimmerier und später Skythen von dort immer wieder in die reichen Gegenden Babyloniens, Kleinasiens, ja bis nach Ägypten, um dort zu plündern. Das hat die Geschichte dieser Gegenden für Jahrhunderte stark beeinflusst. Um das Jahr 500 v. Chr. kamen auch Scharen der Skythen über den Balkan und Ungarn bis nach Deutschland, zu demselben Zweck. Man hat Waffenreste und andere Hinterlassenschaften in verschiedenen Gegenden unseres Landes gefunden.
Im Allgemeinen sind diese Überfälle nur kurzzeitige Episoden geblieben und haben keine langfristigen Folgen im überfallenen Land hinterlassen. Es scheint aber auch Ausnahmen gegeben zu haben, dass nämlich kleine Gruppen dieser fremden Reiter sich einfach hier niederließen und danach recht friedlich unter der einheimischen Bevölkerung ihre Gene in ungezählten Generationen weiter vererbten.
Ob das auch anderswo geschehen ist, muss im Augenblick offen bleiben. Aber für eine bestimmte Gegend Westfalens, das westliche Sauerland, hat ein Heimatforscher und Genealoge festgestellt, dass dort offenbar seit zweieinhalb Jahrtausenden Menschen leben, die die typischen schwarzen Haare der einstigen Steppenkrieger aus dem Volk der Skythen und wohl auch andere genetische Eigenschaften bis in die Gegenwart vererbt haben. Zur Zeit des Römers Caesar bildeten sie offenbar einen wichtigen Teil des angeblichen „Germanen“-Stammes der Sigambrer. Im 4. Kapitel dieses Buches wird diese „Erbschaft“ noch einmal eine wichtige historische Rolle spielen.
* * *
Dieses Buch will ja die frühe Geschichte Deutschlands von den ersten Kontakten mit den Römern an erzählen und dabei viele bisher oft falsch verstandene Annahmen richtig stellen. Das muss beginnen bei dem römischen Feldherrn und Politiker Caesar. Doch bevor auf seine Feldzüge und kurzen Abstecher über den Rhein eingegangen werden kann, muss noch eine Art von Gesamtblick auf das Land damals geworfen werden, um das es hier geht.
Die Bundesrepublik Deutschland von heute umfasst etwa 360 000 Quadratkilometer, und auf dieser Fläche leben mehr als 83 Millionen Menschen, 232 pro Quadratkilometer. Doch damals, kurz vor der Zeitwende, waren es vielleicht nur etwa 1 – 2 Millionen Menschen, 3 – 4 pro Quadratkilometer. Die riesigen Wälder, die einst nach dem Ende der Eiszeit hier gewachsen waren, konnten von den kleinen Gruppen von Bauern nur an wenigen Stellen gerodet und in Ackerland verwandelt werden. Weite Regionen, vor allem im Norden Deutschlands, waren noch bedeckt von großen und kleinen Seen und vor allem Sümpfen, die sich für eine Ansiedung nicht eigneten. Alle paar Dutzend Kilometer gab es eine kleine Ansiedlung, ein Dorf von 8 – 10 Häusern und Ställen, mit einigen frei gerodeten Feldern ringsum. Dazwischen nur Wald oder Moor, durch das nur wenige Trampelpfade führten. Diese Menschenleere muss man sich vor Augen führen, wenn man die frühe Geschichte unseres Landes verstehen will.
In der Mitte des letzten Jahrhunderts vor Christi Geburt machte in der Stadt Rom ein angesehener Politiker und Feldherr von sich reden: Gaius Julius Caesar. Die einst kleine Stadt Rom hatte in den gut 300 Jahren zuvor nicht nur ganz Italien, Spanien, die Balkanhalbinsel, Griechenland, Kleinasien und weite Gebiete im Nahen Osten erobert, sondern auch Ägypten und die Küste Nordafrikas. Vom heutigen Frankreich – die Römer nannten es Gallien – gehörte schon das Gebiet an der Mittelmeerküste dem römischen Staat an. Der bisher schon sehr erfolgreiche römische General Caesar hatte sich vorgenommen, auch den Rest Galliens zu unterwerfen, Er wollte damit die Schande auslöschen, dass einst vor über dreihundert Jahren ein Haufen von Kelten (von den Römern Gallier genannt) für kurze Zeit Rom erobert hatte.
In einem zehnjährigen erbitterten Krieg gelang es Caesar, einen gallischen (keltischen) Stamm nach dem anderen im heutigen Frankreich zu besiegen und zu unterwerfen. Er dürfte gewusst haben, dass Kelten (nach seiner Ausdrucksweise Gallier) auch östlich des Rheins lebten, durch das ganze Süddeutschland und Österreich bis ins heutige Ungarn. Jedoch auch diese Gebiete zu erobern, schien ihm wohl noch utopisch. Stattdessen wusste er, dass der Rhein, von Süden nach Norden fließend, eine gute und auch einigermaßen leicht zu verteidigende Grenze sein konnte.
In seinem Kriegsbericht „De bello Gallico“ (noch heute muss jeder Lateinschüler Stücke davon lesen und übersetzen lernen) hat er seinen Römern und auch noch der Wissenschaft bis in die Neuzeit weisgemacht, links des Rheins – also westlich – hätten die Gallier gewohnt, und östlich die „barbarischen Germanen“. Um die zu züchtigen – Caesar hatte schon zu Beginn seines Gallien-Feldzuges eine große Schlacht mit Germanen ausfechten müssen 4 – hatte er mit einem Teil seiner Truppen kleine Ausflüge über den Rhein gemacht und die dort lebenden Germanen natürlich „glorreich besiegt“. Er hatte sogar von seinen Soldaten eine Holzbrücke über den Rhein bauen lassen, bei Unkel südlich von Bonn. Die Reste dieser Brücke werden im 4. Kapitel dieses Buches noch eine wichtige Rolle spielen.
Der Rest des Lebens Caesars ist Geschichtskundigen bekannt: nach seinen Erfolgen in Gallien errang er in Rom die Alleinherrschaft, wurde aber eben deswegen ermordet (44 v. Chr.). Die Folge war ein lange dauernder Bürgerkrieg, den schließlich Caesars Großneffe Octavian für sich entschied. Von 31 v. Chr. – 14 n. Chr. war er unter dem Namen Augustus Alleinherrscher im Römischen Reich. Im Inneren herrschte in dieser Zeit Frieden, aber nach außen war Rom weiter so aggressiv wie zuvor.
Es scheint zu den Hauptzielen der römischen Politik in den Jahrhunderten zuvor gehört zu haben, alle paar Jahre eine neue Region rund um das Mittelmeer zu erobern: teils des Prestiges wegen, teils aus wirtschaftlichen Gründen: Jede neue Provinz konnte wichtige Rohstoffe oder Waren liefern, vor allem aber auch Sklaven, die dann kostenlose Arbeitskräfte für die reiche Oberschicht Roms stellten. Zu Augustus Zeiten waren praktisch bereits alle Länder rund um das Mittelmeer in römischer Hand, nun musste es im Norden Europas weiter gehen.
Ab dem Jahr 15 v. Chr. führte der Stiefsohn des Augustus, Drusus, teilweise zusammen mit seinem Bruder Tiberius, Feldzüge am Nordrand der Alpen. Dabei gelang es ihm, das ganze Gebiet zwischen den Alpen und der Donau zu erobern: die heutige Schweiz, Südbayern, Österreich bis zur Donau, große Teile des heutigen Ungarn. Fünf neue Provinzen konnte das Römische Reich dort einrichten: Raetia (im wesentlichen die Schweiz und Südbayern), Noricum (Österreich südlich der Donau), Pannonia (Ungarn südlich und westlich der Donau ) , Moesia und Illyrica. Wieder war der wirtschaftliche Gewinn groß. Diese Gebiete hatten zwar nicht sehr viele Einwohner, aber sie waren reich an Bodenschätzen und konnten landwirtschaftliche Erzeugnisse liefern.
Augustus hatte sicher keine maßstabgerechte Landkarte von Europa, aber doch eine einigermaßen zutreffende Vorstellung, dass zwischen den bisher eroberten Regionen westlich des Rheins und südlich der Donau (etwa bis zum heutigen Passau) ein riesiges Dreieck von noch nicht erobertem Land lag: die sogenannte „Germania libera“.
Um dieses Land zu erobern, waren ab etwa 16 v. Chr. viele zehntausend römische Legionäre an der Rheinfront in zahlreichen Kastellen stationiert, und alle paar Jahre zogen sie über den Rhein zu neuen Eroberungen aus. Ihr Oberbefehlshaber war Drusus. Das Ziel war, die gesamte „Germania“ bis zur Elbe zu besetzen, Dieser Fluss schien eine weitere sinnvolle Grenze weit im Osten zu sein; Böhmen – damals von germanisch sprechenden Stämmen unter dem Anführer Marbod besetzt – galt schon als eine Art Vasallenreich der Römer.
In den 25 Jahren zwischen 16 vor und 9 nach Christi Geburt war den Römern schon einiges .an „Kultivierung der germanischen Barbaren“ geglückt. Westlich des Rheins waren die Römerkastelle Köln, Vetera (bei Xanten am Niederrhein) und Mainz Ausgangspunkte fast jährlicher römischer Feldzüge ins Germanenland. Einige Stämme galten dabei als „besiegt“, zum Teil wurden sie vom Ostufer des Rheins ans andere Ufer „umgesiedelt“, so z. B. die Sigambrer, was aber nur für einen Teil diese Stammes glückte. In anderen Stämmen hatten sich romfreundliche „Parteien“ gebildet, die sich mit ihren Widersachern im eigenen Haus stritten, so etwa bei den Cheruskern.
In diesen 25 Jahren scheinen die Römer auch bereits einige Versuche gemacht zu haben, nicht nur entlang der Lippe zur Sicherung des Vormarsches ins Landesinnere (mittels Schiffen auf dem Fluss!) Kastelle anzulegen, sondern auch zivile Ansiedlungen zu bauen. Zwei Beispiele dafür wurden erst vor relativ kurzer Zeit von Archäologen gefunden: Dorla und Waldgirmes in Nordhessen. Dass wahrscheinlich das heute noch vorhandene Portal des Klosters Corvey an der Weser (bei Höxter) aus jener Zeit stammt , also von Römern erbaut wurde, leugnen bis heute die dort Zuständigen – weil es nicht in ihr Weltbild passt.
Im Jahr 9 n. Chr. sollte dann ein Aufstand mehrerer Stämme im heutigen Westfalen und südlichen Niedersachsen unter Anführung des Häuptlings Arminius diesen römischen Erobererträumen ein Ende machen. Die Niederlage des römischen Provinzgouverneurs Varus mit drei Legionen in der Schlacht „im Teutoburger Wald“ ist so bekannt, dass sie hier nicht näher beschrieben werden muss. Ohne Zweifel war sie ein Wendepunkte in der Geschichte unseres Landes, das nur damals noch nicht Deutschland hieß.
Auch ist es in diesem kurzen Überblick über 850 Jahre Geschichte nicht sinnvoll, ausführlich der Frage nachzugehen, ob die berühmte Schlacht tatsächlich im Teutoburger Wald (etwa in der Nähe von Detmold, wo das Hermannsdenkmal steht) ausgetragen wurde oder fast 100 Kilometer entfernt bei Kalkriese am Nordrand des Wiehengebirges, wo viele Funde gemacht wurden und heute ein Museum die „Varusschlacht“ dem Publikum nahe bringt. Doch ist immer noch nicht geklärt, ob dort nicht eine ganz andere Schlacht zwischen Germanen und Römern stattfand.
Doch eine Frage gehört in dieses Buch: war dieser berühmte Arminius überhaupt ein Germane? Es gibt durchaus Gründe, daran zu zweifeln. Denn die Cherusker, wie auch die Marser und andere als Aufständische genannte Stämme lebten genau in dem Gebiet, das in den Jahrhunderten davor als das Gebiet der „Nordwestleute“ bezeichnet wurde (von den auf S. 9 genannten Professoren, wenn auch deren Annahme von Kollegen bestritten wird). Schon sie haben die Frage aufgeworfen, ohne dass sie eine eindeutige Antwort darauf gegeben haben.
Für gebildete Römer wie Caesar, Drusus (oder auch ein paar Jahrzehnte später Tacitus) kam es nicht in Frage, eine fremde Sprache (außer griechisch) zu lernen. Wozu hatte man Dolmetscher? Für sie hatten alle „Barbaren jenseits des Rheins“ Germanen zu sein. Arminius war ja selbst jahrelang Offizier in der römischen Armee gewesen und konnte Latein. War er vielleicht Germane, aber seine cheruskischen Krieger nicht? Die drei Professoren haben das angedeutet, aber sie haben sich gehütet, den komplizierten Begriff in der Vor- und Frühgeschichte namens „Überschichtung“ näher aufzuklären.
In ungezählten Fällen der Geschichte ist es vorgekommen, dass ein fremdes Volk mit eigener Kultur und eigener Sprache erobernd bei einem Nachbarn mit anderer Sprache einbrach. Wir müssen uns, wenn wir verstehen wollen, was dann passierte, von der in unseren Köpfen eingebrannten Vorstellung lösen, dabei seien alle Unterlegenen entweder totgeschlagen oder vertrieben worden. Manchmal wird auch das passiert sein, aber viel häufiger war es, dass das im Kampf unterlegene Volk in Zukunft den neuen Herren als Knechte dienen musste, nicht als Sklaven, aber doch in einer unterlegenen Rolle. Dazu gehörte auch, dass die Menschen aus der neuen Unterschicht nunmehr die Sprache der Eroberer verwenden mussten, wenn sie mit ihnen zu reden hatten. In wenigen Generationen war dann die Sprache der Sieger völlig auf die Besiegten übergangen. Das ist, in einfachen Worten erklärt, der Vorgang der „Überschichtung“ 5
Es scheint so, dass in den Jahrhunderten unmittelbar vor und nach der Zeitenwende in Norddeutschland eine langsame Wanderung (und gleichzeitig auch Eroberung und „Überschichtung“ Anderssprachiger) von germanisch sprechenden Völkern nach Süden erfolgte. Jedenfalls ist nur so zu erklären, dass einige Jahrhunderte später, als es die ersten schriftlichen Zeugnisse aus diesem Gebiet gab, die Menschen dort eine Sprache benutzt haben müssen, die bereits dem Deutschen ähnelte, allerdings in der Form einer alt-nieder deutschen Aussprache. Im „höher“ gelegenen Teil Deutschlands, der Mitte und im Süden, benutzte man eine etwas andere Sprache, das „Hoch deutsche“ (in seinen Zeitepochen „althochdeutsch“, „mittelhochdeutsch“, „neuhochdeutsch“). Beide Sprachen unterschieden sich in der Frühzeit noch erheblich, doch gibt es in der nieder deutschen Sprache keine so berühmten Epen wie das (mittel hoch deutsche) Nibelungenlied.
So ist es also durchaus möglich, dass bei den Cheruskern zu Augustus Zeiten zwar die Häuptlingsfamilie (Arminius) und etliche engere Gefolgsleute Germanen waren (also „von Hause aus“ germanisch sprachen), dass aber die Masse der Krieger „eigentlich“ noch „Nordwest-Leute“ waren. Die drei Professoren haben das in ihrem inzwischen 60 Jahre alten Buch angedeutet.
Nach der so vernichtenden Niederlage des Varus brauchte das Römische Reich ein Jahr, ehe es wieder in Germanien offensiv vorgehen konnte. Besonders erfolgreich waren diese Vorstöße jedoch nicht.
Im Jahr 14 n. Chr. starb der erste „princeps“ des Römischen Reiches (oder nach unserem Ausdruck „Kaiser“) Augustus. Nachfolger wurde sein Stiefsohn Tiberius, der vorher ja mehrfach in Germanien Heere kommandiert hatte. Nun war es dessen Neffe Germanicus, der für einige Jahre die Heere befehligte, die in Germanien östlich des Rheins versuchen sollten, die römische Herrschaft wiederherzustellen. Germanicus bedeutet übrigens nicht „Germane“, sondern „Sieger über Germanen“, doch war es damit nicht besonders weit her. Er zog mehrere Jahre lang durch das heutige Westfalen und südliche Niedersachsen, zerstörte und plünderte mehrere Ansiedlungen der dortigen Bewohner, errang auch einige Siege in Gefechten, musste aber auch Niederlagen einstecken. Vielleicht war die Schlacht bei Kalkriese (siehe S. 15/16) eine Schlacht des Germanicus.
Im Jahr 16 stoppte der neue Kaiser die Kämpfe um die „Germania libera“, indem er seinen Neffen zurückrief. Er soll das mit den verlogenen Worten getan haben, Germanicus habe bereits genug gesiegt, um ihm einen schönen Triumphzug in Rom auszurichten. Außerdem solle man die Germanen ihren bekannten internen Kämpfen überlassen.
Die von Römern besetzten Gebiete westlich des Rheins wurden in zwei Militärbezirke, später in zwei Provinzen, geteilt: Niedergermanien (Hauptstadt Köln - damals Colonia Claudia Ara Agrippinensium, CCAA, genannt ) und Obergermanien (Hauptstadt Mainz, Moguntiacum). Die Grenze zwischen beiden Provinzen verlief am Vinxtbach, etwa halbwegs zwischen Bonn und Koblenz. Diese Teilung hatte durchaus sichtbare Folgen. Denn während die Befehlshaber von Niedergermanien stets den Fluss Rhein als ihre Grenze und zu verteidigenden „Limes“ ansahen, konnten die Befehlshaber im Süden doch bald wieder über den Rhein setzen und ihre Provinz über den Fluss hinweg nach Osten ausdehnen. Die wenigen Einwohner im heutigen Hessen und Baden-Württemberg, die es damals nur gab, waren wohl zu schwach, um sich dagegen zu wehren.
So entstand im Laufe der Jahrzehnte hier ein „Limes“, der in Etappen immer weiter nach Osten vorgerückt wurde, im Bestreben, die Grenze zur „Germania libera“ abzukürzen, die zwischen dem Oberrheiu und der oberen Donau ein riesiges Dreieck bildete und damit unnötig viele Soldaten zu ihrer Bewachung benötigte. Das Wort „Limes“ bedeutete ursprünglich nur eine Art Grenzzaun, später wurde daraus ein Grenzwall mit nur wenigen Toren zum Durchlass, Wachttürmen im Sichtabstand und im Hinterland zahlreiche kleine Militärkastelle, in denen römische Soldaten und allerlei Hilfstruppen aus anderen Gegenden des Römerreichs stationiert waren.
In der besten Zeit erstreckte sich dieser Grenzwall quer durch das südliche Hessen, mit einem „Zipfel“ bis in die fruchtbare Gegend südlich von Gießen, die Wetterau, und von dort aus fast schnurgerade nach Süden bis in die Gegend von Lorch (bei Schwäbisch Gmünd) und von dort weit nördlich der Donau bis etwa nach Regensburg. Er kürzte damit die zu bewachende Grenze ganz erheblich ab.
Wer damals in diesen Regionen Deutschlands lebte, haben die römischen Schriftsteller nicht überliefert, es interessierte sie nicht. Es können nur wenige Menschen gewesen sein, vermutlich größtenteils noch mit keltischer Sprache. In den Jahrhunderten römischer Herrschaft werden sich vermutlich Menschen aus allen möglichen Gebieten des riesigen Römerreichs dort angesiedelt haben, aber in Wahrheit auch nur sehr, sehr wenige Menschen.
Der „Limes“ war keine „Berliner Mauer“, auf deren Überquerung unweigerlich die Todesstrafe stand. Sie sollte aber die „Germanen“ von jenseits hindern, nach Belieben irgendwo die Grenze zu überqueren. Friedliche Grenzübertritte, etwa zum Handel, waren an den dafür vorgesehen Toren durchaus erlaubt und wurden auch häufig benutzt. Gegen kriegerische Angriffe auf den Limes, die wohl immer wieder einmal vorkamen, gab es eine große Zahl von Wachttürmen unmittelbar am Limes, im Sichtabstand von einander, sowie etwas dahinter kleine Kastelle für römische Grenzwächter, die bei einem feindlichen Angriff schnell alarmiert werden konnten.
In den nächsten Jahrzehnten beruhigte sich die Lage am Limes, am „nassen“, dem Rhein, sowie an der Grenzmauer weiter im Süden. Dir nächste größere Unruhe, die im heutigen Deutschland zu verzeichnen war, entstand in der römischen Provinz Niedergermanien. Indirekt hatte sie zu tun mit dem römischen Kaiserthron, auf den inzwischen ein später Nachkomme der Kaiserfamilie geraten war, Nero, dessen geistige Abnormität zunehmend zutage trat und der im Jahr 68 abgesetzt und zum Selbstmord gezwungen wurde. Dieses Jahr wird als „Vier-Kaiser-Jahr“ bezeichnet, weil sich nach Nero drei hohe Generäle um den Kaisertitel stritten. Einer davon war der Befehlshaber in Köln, Vitellius, der mit seinen Truppen nach Rom zog, um im dortigen „Kaiser-Wettlauf“ mitzumachen. Vergeblich, denn ein weiterer Bewerber um den Thron, der General Vespasian, kam mit seinen Truppen aus dem Nahen Osten nach Rom und besiegte Vitellius, der in der Schlacht umkam.