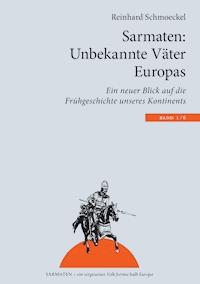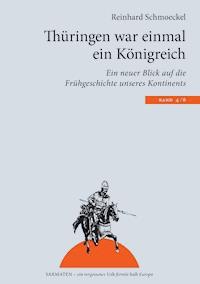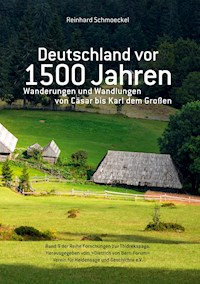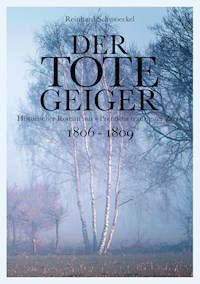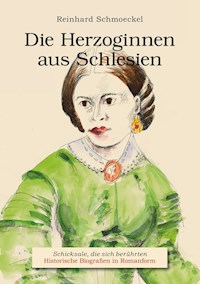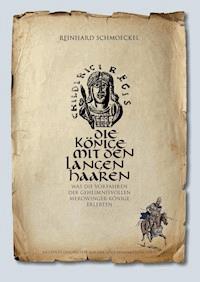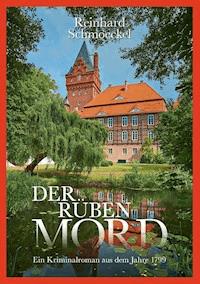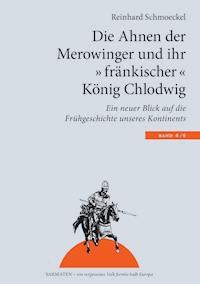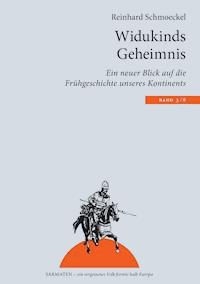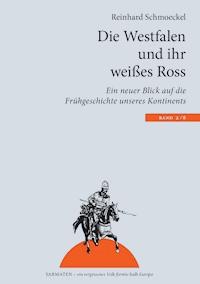Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das "Zeitalter des Menschen" begann erst richtig nach dem Ende der Eiszeit. Damals entstanden aus dem "homo sapiens" die "Menschen mit weißer Hautfarbe", die Vorfahren fast aller heute in Europa, Westasien und Nordafrika lebenden Menschen. Ihre Entwicklung wird mit einer Zusammenschau der Forschungsergebnisse der Archäologie, der Klimakunde, der Humangenetik, der Sprachwissenschaft und anderer Wissenschaften dargestellt, aber für jedermann verständlich, und zwar nicht, wie üblich, nach "Kulturen" oder Völkern getrennt, sondern in zeitlicher Reihenfolge, und damit vergleichbar. Ein Geschichtsbuch, das es so noch nicht gab, und zugleich ein Musterbeispiel für ein gutes populärwissenschaftliches Sachbuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Verzeichnis der Abbildungen und Karten
Die „Alte Welt“ der Antike
Menschliches Stammbaum-Schema
Entwicklungsgeschichte des Menschen
Der Weg des Homo erectus in die Welt
Maximalvergletscherung der letzten Eiszeit
Eurasien im Kältemaximum d. Weichsel-Eiszeit
Haplogruppen-Wanderungen ca. 20 000 v. Chr.
Haplogruppen-Wanderungen vor ca. 15 000 Jahren
„Urgroßmutter-Sprachkerne“ in Eurasien
„Sternen-Straßen“ in der Steinzeit
Die „Große Windrose“ vom Mont Poupet
Catal Höyük – Eine Stadt vor 9000 Jahren
Menschenwanderungen vor 12 000 – 7000 Jahren
Schriftzeichen der Vinca-Kultur (6000 v. Chr.)
Völker u. Sprachfamilie in der frühen Jungsteinzeit
Megalithische Bauweisen in Eurasien
Wanderungen der Kurgan-Kultur in der Jungsteinzeit
Die „Externstein-Pyramide“
Völker und Sprachen um 2500 v. Chr.
Die Äste der „alt-westindoeuropäischen“ Sprache
Wichtige Wanderungen 2000 – 1500 v. Chr.
Sprachen um 1300 v. Chr.
Die spätbronzezeitliche Wanderungsperiode
Verzweigungen der ie. Sprachen in Europa
Völkerwanderungen zwischen 1000 und 750 v. Chr.
Kulturen in Mittel- und Osteuropa 1000-750 v. Chr.
Die Zeit des persischen Weltreichs um 500 v. Chr.
Die Alte Welt z. Zt. Alexanders d. Gr. (325 v. Chr.)
Das Römische Reich in der Kaiserzeit
Abb.-Nachweis: S. →: „Geschichte“ 8/2002; S. → SPIEGEL 6/2004; S. →: Meier, Vorzeit war ganz anders. - S. →: Meier, Neues aus Alesia III (2012).- S. →: Internet; omniglot.com/Writing. - S. →: Wikipedia: Megalithbauten. - S. →: Machalett, Die Externsteine (2010)
Vorwort
Wie lebten eigentlich die Menschen in unserem Kontinent, bevor die Ägypter ihre Pyramiden bauten und ihre Hieroglyphen in Stein kratzten, die Babylonier ihre Tontafeln mit Keilschrift beschrieben und die Griechen ihre bis heute unvergessenen Epen dichteten? Immerhin war das ja die Zeit, da die Menschen nach ungezählten Generationen von ihrem Jäger- und Sammler-Dasein Abschied nahmen und sich auf eine völlig neue Lebensweise umstellten.
Erst nach der letzten Eiszeit fing auf unserem Planeten in Wirklichkeit das „Zeitalter des Menschen“ an, in dem der Homo sapiens, der moderne Mensch, die Fähigkeiten entwickelte, die dann immer mehr die Erde umgestalteten. Im westlichen und inneren Asien und seinem „Anhängsel“ Europa begann diese Entwicklung wohl mit am frühesten auf der Erde.
Mancher Leser möchte vielleicht gerne etwas über die Vorgeschichte der Menschen wissen. Für Historiker beginnt Geschichte ja erst mit dem Vorliegen schriftlicher Quellen; da werden die vielen hunderttausend Jahre menschlicher Existenz in der Vergangenheit etwas abwertend als „Vorgeschichte“ zusammengefasst.
Populärwissenschaftliche Zeitschriften bringen mitunter reich bebilderte Berichte über neue, Aufsehen erregende Funde alter menschlicher Überreste wie dem „Ötzi“. Man kann daraus Vieles verstehen, wie Menschen zu bestimmten, lange vergangenen Zeiten lebten. Aber erfährt man auch daraus, was diese Menschen er lebten? Also das Geschehen, das sie mit ihren Zeitgenossen verband? Das darzustellen, wird kaum je versucht.
Dabei ist dies doch nichts anderes als Geschichtsschreibung, die man hier zwar nicht aus Schriftstücken entnehmen, aber durchaus aus Forschungen zahlreicher Wissenschaftsdisziplinen schließen kann, heutzutage sogar oft recht konkret. Hier gibt es überall einzelne Indizien, Hinweise, plausible Behauptungen, die man allerdings erst aus den Werken der verschiedensten Fachleute zusammensuchen muss.
Es ist ja nicht so, dass man überhaupt nichts darüber wüsste; im Gegenteil. Da mühen sich hunderte, ja tausende von Fachleuten verschiedener Wissenschaften in aller Welt seit Jahrzehnten intensiv darum, die Rätsel der Vergangenheit der Menschen und der Erde in den letzten Jahrtausenden zu entschlüsseln, und sie sind auch schon weit damit gekommen. Aber selbst historisch interessierte Laien erfahren kaum etwas davon, und wenn, dann nur in Bruchstücken, die meist unverständlich bleiben. Erst recht dringt kaum etwas von den neuen Erkenntnissen in den Schulunterricht des Fachs Geschichte.
Das hat viele Gründe. Die Wissenschaften, die an dieser Entschlüsselung der Vergangenheit der Menschen beteiligt sind, benutzen ganz unterschiedliche Instrumente und Fachausdrücke. Auch die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse (oder richtiger Zwischen-Ergebnisse) erfolgt in der Regel in kleinen Bröckchen, die nur für Fachleute etwas aussagen. Außerdem scheuen die Wissenschaftler im Allgemeinen den Blick „über den Tellerrand“ ihres eigenen Fachbereichs, einerseits, weil sie selbst kaum etwas von den anderen, ebenfalls an der Erforschung der menschlichen Vergangenheit beteiligten Wissenschaften verstehen, andererseits, weil es sich eben für einen „Kollegen“ nicht gehört, sich mit Sachverstand zu Themen dieser Nachbarfächer zu äußern.
Inzwischen sind allerdings schon einige Bücher erschienen, in denen Fachgelehrte versuchen, ihr Forschungsgebiet und dessen Ergebnisse in der Entschlüsselung der menschlichen Vergangenheit so verständlich wie möglich dazustellen und mit den Ergebnissen anderer Wissenschaften zu verknüpfen. Doch eben weil sie Wissenschaftler sind, bemerken sie nicht, dass ihre Darstellungsweise meistens viel zu ausführlich für normale Leser ist und trotz allem Bemühen den Laien überfordert.
So muss ein Schriftsteller es wagen, über die Grenzen heutiger Wissenschaftsdisziplinen hinweg zu blicken, sich diese Informationen aus den unterschiedlichsten Publikationen zusammen zu klauben und plausible Zusammenhänge in allgemein verständlicher Form darzustellen. Diese Form der Wissensvermittlung nennt man „populärwissenschaftlich“, und in den Kreisen der „berufenen“ Wissenschaftler (berufen auf einen Lehrstuhl oder an ein anerkanntes Forschungsinstitut) gilt sie nicht viel.
Das vorliegende Buch greift aus der Millionen Jahre zählenden Entwicklung des Primaten der Art „Hominiden“ und später der Spezies „Homo“ bis zum Menschen des 21. Jahrhunderts die Periode heraus, die der (schriftlich bezeugten) „Geschichte“ unmittelbar vorausging, nämlich die etwa 15 000 Jahre zwischen dem Ende der letzten Eiszeit und der Entstehung der ersten „Hochkulturen“, die nun den Historikern auch Schriftliches liefern.
Das Buch beschränkt sich zugleich auf die Region „Eurasien“. Das ist das riesige Gebiet zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Gebirgsmassiv des Pamir in Innerasien. Geographisch bildet diese Region eine gewisse Einheit, was ihre klimatische Entwicklung und ihre Besiedlung durch die Menschen angeht. Es war das Gebiet der „Alten Welt“, die den Geographen der Griechen und Römer durchaus vertraut war.
Oder ganz anders und doch ähnlich ausgedrückt, beschreibt das Buch nur die Entwicklung der Menschen aus der Gruppe der Europiden, wie man sie im Fachjargon nennt. Das sind die Menschen „weißer“ Hautfarbe, im Unterschied zu den Negriden und den Mongoliden, die andere Erdteile bevölkern. Und diese Europiden entstanden und lebten genau im eben umrissenen Eurasien. Dabei bildete das Mittelmeer keine Schranke, denn auch das Südufer dieses Meeres, das heutige Nordafrika von Marokko bis nach Ägypten, war (und ist im Wesentlichen auch heute) von Menschen europiden Typs bevölkert. Es scheint auch so, dass die meisten Menschen in diesem riesigen Gebiet heute noch Sprachen benutzen, die man auf ganz wenige uralte Sprachfamilien - oder sogar eine gemeinsame Ursprache? – zurückführen kann.
Schon die letzten Sätze verraten, dass in diesem Buch der Versuch gemacht wird – allerdings eben beschränkt auf die erwähnten Jahrtausende und die umschriebene Region – die neuesten Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften zusammen zu führen:
Der historischen
Klimaforschung
: Wie entwickelte sich seit der Eiszeit das Klima in den Teilregionen Eurasiens, und welche Folgen hatte das für Pflanzen- und Tierwelt sowie die Menschen, die hier lebten? Das war in den einzelnen Großlandschaften Eurasiens recht unterschiedlich.
Der
Humangenetik:
man kann inzwischen aus der DNA jedes heute lebenden Menschen seinen väterlichen und auch seinen mütterlichen „Urahnen“ vor vielen zehntausend Jahren feststellen: Die Erforschung der so genannten „Haplogruppen“ vorgeschichtlicher Menschen mit der gleichen DNA-Markierung macht rasante Fortschritte.
Der
Anthropologie:
sie kann verschiedene Typen nach der äußeren Erscheinungsform der Menschen unterscheiden. Wo und wann mögen diese verschiedenen Gruppen bei den Menschen in Eurasien entstanden sein, sich verbreitet - - und vermischt haben?
Der
Archäologie:
sie hat aus ihren Funden in der Erde zahlreiche „Kulturen“ der Menschen in der Alt-, Mittel-, Jungsteinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit definiert und kennt ihre typischen Hinterlassenschaften. Haben sie etwas mit Haplogruppen oder Menschentypen zu tun?
Der
Sprachwissenschaft
(Linguistik): Sie weiß heute schon viel über das Alter der Sprachen, die gegenwärtig in Eurasien verwendet werden, aber auch über deren Abstammung von älteren Sprachfamilien, deren Existenz weit in die in diesem Buch dargestellte Zeit hineinreicht.
Der
Geschichtswissenschaft
: Sie hat inzwischen Vieles über das erste Auftreten historischer Völker im Raum Eurasiens erforscht. Lässt sich dieses Wissen mit den Informationen aus den anderen genannten Wissenschaftszweigen zusammenbringen?
Der
Kulturgeschichte:
Auch hier haben Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen Erstaunliches über das frühe Auftreten von Kunst, Religion und Schrift, Erdvermessung und Astronomie, über die Kunst der Anfertigung von Werkzeugen und Waffen, der Verwendung von Metallen und der Beherrschung der Natur in Form von Pflanzen- und Tierzucht und anderen Fortschritten unter den frühen Menschen herausgefunden.
Dieses Buch unterscheidet sich auch in einer anderen Hinsicht völlig von den üblichen Werken über menschliche Früh- oder Vorgeschichte. Diese behandeln die einzelnen archäologischen „Kulturen“ oder Völker jeweils für sich, von ihrem Beginn bis zu ihrem „Ende“, gewissermaßen „vertikal“ getrennt. Doch hier wird versucht, dem Leser eine Vorstellung vom allmählichen Fortschreiten der menschlichen Entwicklung in allen Regionen der „Alten Welt“ zu geben, in Kapiteln, die sich zeitlich folgen, eine gleichsam „zeithorizontale Geschichtsdarstellung“. Das ist eine ausgesprochene Seltenheit unter historischen Werken.
Und auf noch einen weiteren Unterschied zu „herkömmlichen“ Geschichtswerken ist hinzuweisen. Gerade in den allerletzten Jahren kann man veröffentlichte Forschungen über ganz neue Erkenntnisse zur Frühgeschichte der Menschen finden, die noch nicht ihren Weg in die „offiziellen“, zusammenfassenden Buchwerke gefunden haben. Vielen dieser erstaunlichen Hinweise geht das vorliegende Buch nach und stellt damit nach der Überzeugung des Autors ein Geschichtswerk dar, das auf dem heutigen Buchmarkt sonst nicht anzutreffen ist.
Hier sei die in die gleiche Richtung gehende Erkenntnis des Professors Josef H. Reichholf („Warum die Menschen sesshaft wurden“, Frankfurt/M. 2012) zitiert, der ebenfalls als „Außenseiter“ (der Autor ist Biologe und kein Archäologe) zu der Überzeugung kam: „Sicher ist jedoch, dass „die Geschichte“ nicht erst mit der europäischvorderasiatischen Geschichte beginnt. Den Hochkulturen des „Fruchtbaren Halbmonds“ ist eine weit ältere Kultur vorgelagert, über die wir so gut wie nichts wissen. Sie entstand in Asien und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach im zentralen Bereich, nicht an den Rändern des Kontinents. In diese strahlte sie erst nachträglich aus, als sich in Zentralasien die Lebensbedingungen nachhaltig veränderten.“
Ist es nicht auch für Laien von Interesse, etwas über die gemeinsame Vorgeschichte dieser Menschen zu erfahren, die ja die Urahnen fast aller Europäer, Westasiaten und Nordafrikaner von heute sind? Das trifft sogar noch am Beginn des 21. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung zu, trotz der Wanderung von Millionen, etwa von Türken nach Deutschland oder von Nordafrikanern nach Frankreich.
Die Form der populärwissenschaftlichen Darstellung verbietet es, umfangreiche Anmerkungen auf jeder Seite zu bringen. Stattdessen macht ein ausführliches Literaturverzeichnis erkennbar, aus welchen Quellen der Autor sein Wissen geschöpft hat.
Bonn, Herbst 2015
Reinhard Schmoeckel
Teil I
Die Wege zum Erforschen des Vergangenen
Wie funktionieren die Werkzeuge der verschiedenen Wissenschaften?
Vorbemerkung
Dieses Buch will keine „Fantasy-Geschichte“ sein, kein „historischer Roman“, sondern möchte dem Leser Vorgänge vor zehntausend oder sechstausend Jahre in unserem Kontinent „Eurasia“ vor Augen stellen, so, wie sie nach neuestem Stand der Wissenschaft wohl abgelaufen sind. Der Leser soll dabei auch verstehen können, wie die Wissenschaftler zu ihren Erkenntnissen gekommen sind, er soll nicht „nur glauben“ müssen.
Dieser erste Teil des Buches ist für vor allem für die Leser geschrieben, die weder Archäologen noch Sprachwissenschaftler noch Humangenetiker sind, und die auch nicht den Ehrgeiz haben, bis ins Detail die Arbeitsweisen dieser Wissenschaftler zu verstehen. Das zu erklären ist auch nicht das Ziel. Doch der Leser soll die Überzeugung gewinnen, dass die später in diesem Buch erwähnten Ergebnisse der verschiedenen Wissenschaften vertrauenswürdig sind. Wie immer mögen auch in diesen Forschungszweigen Einzelheiten umstritten sein. Das gilt aber im Allgemeinen nicht für das, was in diesem Buch wiedergegeben wird. Und wenn doch, dann wird das an geeigneter Stelle näher beschrieben.
Doch diese Fachgelehrten sind es, die seit etwa zwei Jahrhunderten unermüdlich auf ganz verschiedenen Wegen den Geheimnissen der Vergangenheit der Spezies „Mensch“ auf der Spur sind. Sie haben sich von den Vorstellungen der Bibel gelöst, die vorher fast zwei Jahrtausende lang für die Auffassung bestimmend war, woher die Menschen kamen und wie sie früher gelebt hätten.
Die folgenden kurzen Kapitel versuchen, die meist langen Wege zu beschreiben, auf denen diese Wissenschaften zu ihren neuen Erkenntnissen gekommen sind, und auch ein wenig von den Methoden zu erklären, mit denen sie arbeiten. Dabei muss natürlich Vieles sehr vereinfacht werden, und die Professoren mancher Universitätsfächer werden bemängeln, dass ja ganz Wichtiges fehlt.
Diese Beschreibungen deuten dabei auch die historische Entwicklung an, die diese Wissenschaftszweige selbst im Laufe der jüngeren Vergangenheit, nämlich etwa den letzten zweihundert Jahren, genommen haben. Die Reihenfolge hier im Buch entspricht in etwa den Zeiten, in denen sie nacheinander in Erscheinung getreten sind, wenigstens in ihrer modernen Form.
Wer unter den Lesern dieses Buches „nichts für Wissenschaft übrig hat“, der mag diesen Teil überschlagen. Aber er wird es bereuen, wenn ihm später nicht verständlich wird, was da alles erzählt wird – und wenn er es nicht glauben kann, weil ihm aus unbewussten Prägungen von der Jugend her ganz Anderes über die frühe Menschheit im Gedächtnis schwebt.
Kapitel 1
Historische Völkerkunde
Von der Bibel zu Herodot und „den Alten“
Wenn man den Fortschritt begreifen will, den das Wissen um die Vergangenheit des Menschen in den letzten zweihundert Jahren gemacht hat, muss man versuchen, sich einmal vorzustellen, was belesene Wissenschaftler etwa zur Zeit Goethes davon wussten. Dieser Dichter selbst war nebenbei einer der Mutigen, der mit wachen Sinnen und ohne Scheu vor „Tabus“ Überlegungen genau dazu anstellte, auch wenn er nicht zu den bahnbrechenden Forschern auf diesem Gebiet zählt.
Die Zeit der „Aufklärung“ im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war die Epoche, in der zahlreiche verschiedene Wissenschaften bereit waren, sich von uralten Fesseln zu lösen. Das galt gleichermaßen für Historiker wie für Naturwissenschaftler. Was aber wusste ein studierter Historiker zur Goethe-Zeit etwa von Menschen und Völkern vor Christi Geburt?
Da gab es die Bibel, deren Berichte damals noch alle Menschen wörtlich glaubten. Gott hatte einst die Welt erschaffen und darin im Paradies Adam und Eva als den Ureltern der Menschen das Leben geschenkt. Einige Zeit danach hatte die Sintflut noch einmal alles Leben vernichtet, was nicht in Noahs Arche Platz gefunden hatte. Von seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet sollten alle heutigen Menschen abstammen.
Und das Ganze war gar nicht so lange her, denn der göttliche Schöpfungsakt hatte genau 3761 Jahre vor Christi Geburt stattgefunden. So hatten es jüdische Gelehrte im frühen Mittelalter nach den Berichten und Generationenfolgen im Alten Testament der Bibel ausgerechnet, und diesem Kalender folgen gläubige Juden und der Staat Israel heute noch (sie begannen im Jahr 2012 das Jahr 5773 seit Gottes Schöpfungsakt). Christliche Gelehrte hatten Zahlen ausgerechnet, die etwas davon abwichen – aber was machte das schon aus?
Aus der Bibel konnte man auch entnehmen, dass es neben dem Volk Gottes, den Juden, noch andere Völker gegeben hatte, Philister und Kanaanäer, Ägypter und Babylonier, Assyrer und Hethiter und ein paar andere.
Daneben wusste am Ende des 18. Jahrhunderts ein gebildeter Europäer, der ein Gymnasium besucht hatte, auch noch, dass ein griechischer Schriftsteller namens Herodot im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt über zahlreiche Völker des östlichen Mittelmeerraums alle möglichen Anekdoten aufgeschrieben hatte, aus denen man einiges lernen konnte.
Auch einige etwas spätere Geografen der Antike, meist Griechen oder Griechisch schreibende, hatten etwas über die Welt zu ihrer Zeit aufgeschrieben, aber das war am Ende des 18. Jahrhunderts noch ein Wissen, über das nur ganz wenige Spezialisten verfügten. Man nannte damals die Schriftsteller aus der griechischen und römischen Antike zusammenfassend „die Alten“ und glaubte ihnen unbesehen.
Immerhin hatten diese Geografen bereits eine Vorstellung gehabt von einer „Alten Welt“, die vom Atlantik über ganz Europa und Nordafrika sich nach Osten über das „Heilige Land“ Palästina hinaus weit nach Osten erstreckte und bis in die fernen Bergzüge im Inneren Asiens reichte. Ein großer Teil davon – die Osthälfte – war einst im Reich des Makedonenkönigs Alexander des Großen vereinigt gewesen, und später im Römischen Reich hatte wenigstens der Westteil dieser „Alten Welt“ eine Einheit der Herrschaft, des Rechts und der Wirtschaft gebildet.
Die Karte auf der Seite 14, die wenigstens grob die Herrschaftsbereiche Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert vor Christi Geburt und der römischen Kaiser etwa fünf Jahrhunderte später wiedergibt, nämlich „die Alte Welt“ nach der Vorstellung „der Alten“, wird erstaunlicherweise in ganz ähnlicher Form später in diesem Buch noch einmal zu sehen sein, als Region auf der Erde, in der sich ein paar zehntausend Jahre früher die Menschen der „weißen Rasse“ oder die „Europiden“ entwickelten.
Aus der „Neuen Welt“, aus Amerika, waren natürlich zur Goethe-Zeit schon alle möglichen Geschichten über die dortigen Indianer nach Europa gedrungen, ebenso über das zeitgenössische China und Indien. Afrika galt immer noch als im Inneren völlig unbekannter Erdteil, und von Australien hatten zu Goethes Zeit sehr wissbegierige Zeitgenossen mitbekommen, dass dieser Erdteil gerade erst von wagemutigen Seefahrern entdeckt worden war.
Aber das alles betraf die fernen Völker, die gleichzeitig mit den Zeitgenossen Goethes und Napoleons lebten. Über Völker, die tausend oder zweitausend oder gar dreitausend Jahre vorher existiert hatten, machte man sich keine Gedanken. Mehr als aus der Bibel oder aus den Schriften „der Alten“ konnte man doch nicht über sie erfahren.
Kapitel 2
Sprachwissenschaft
Das Erforschen alter Sprachen und ihrer Verwandtschaft
Ein Abwenden von dieser resignierenden Haltung, was die Menschen vor sehr langen Zeiten anging, könnte von einem Vortrag ausgegangen sein, den ein englischer Wissenschaftler im Jahr 1786 im fernen Kalkutta in Ostindien hielt. Es war das Todesjahr Friedrichs des Großen.
Der Oberrichter Sir William Jones der Britisch-Ostindischen Gesellschaft war nicht nur Jurist, sondern auch ausgezeichneter Sprachkenner, der angeblich ein Dutzend ganz verschiedener Sprachen lesen, verstehen und sprechen konnte. Er lernte auch das Sanskrit, die alte Kultursprache Indiens. Und nach sorgfältigen Studien stellte er in seinem Vortrag fest: „Das Sanskrit steht dem Lateinischen und dem Griechischen sowohl in seinen Wortwurzeln wie in seinen grammatischen Formen zu nahe, als dass dies ein Zufall sein könnte, ja so nahe ist es ihnen, dass kein Philologe alle drei Sprachen untersuchen kann, ohne zu dem Glauben zu kommen, dass sie aus einer gemeinsamen Wurzel, die vielleicht nicht mehr existiert, entsprungen sind, Es besteht ein ähnlicher Grund zu der Vermutung, dass sowohl das Gotische (gemeint ist das Germanische) wie das Keltische .. denselben Ursprung wie das Sanskrit haben, und das Altpersische könnte man vielleicht zu derselben Familie rechnen.“.
Dieser Vortrag war so etwas wie die Geburtsstunde einer neuen Wissenschaft, die heute Sprachwissenschaft oder Linguistik heißt. Im ersten Jahrhundert ihrer Existenz nannte man sie allerdings Indogermanistik. Denn es ging damals vielen Forschern aus allen wichtigen Ländern unseres Erdteils um den Nachweis, dass zahlreiche Sprachen des Altertums in Europa und von Persien bis Indien Kinder einer „Sprachfamilie“ seien, die man „Indogermanisch“ nannte. Man glaubte anfangs, die indische Sprache sei der östlichste Vertreter dieser Familie, und die germanische Sprache der westlichste. (Das stimmt allerdings nicht ganz, denn die keltische Sprache, die ebenfalls dazu gehört, ist heute die westlichste).
Von den Völkern im frühen Altertum – und noch davor? – mit Sprachen aus dieser Familie, wird im Teil III dieses Buches noch viel die Rede sein. Heute nennt man sie zusammenfassend Indoeuropäer. Denn fast alle Europäer benutzen Sprachen, die Nachfahren dieser Familie sind.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts, als sich die Indogermanistik zu einer wichtigen und viel diskutierten Wissenschaft entwickelte, geschah es auch, dass – unabhängig von deren Forschungen – zwei andere alte Kultursprachen enträtselt werden konnten: das Alt-Ägyptische und die Sprache der Babylonier. Fleißige Forscher hatten anhand mehrsprachiger Inschriften deren Schriftsysteme entziffern können und dann auch Schritt für Schritt die Sprachen selbst enträtselt.
„Sprachvergleichung“ war das Zauberwort, mit dem die Forscher im 19. Jahrhundert die Verwandtschaften alter Sprachen aufsuchten und dabei zugleich die Geheimnisse einer seit mindestens viertausend Jahren nicht mehr gesprochenen und nie geschriebenen Sprache aufdeckten. Man suchte ähnlich lautende Worte mit ähnlicher Bedeutung in den heutigen und frühen Sprachen und stellte sie in Gruppen zusammen. Wenn es viele solcher Übereinstimmungen gab – allein für die von William Jones genannten Sprachen waren es tausende! – dann ließ sich an ihrer Verwandtschaft nicht zweifeln. Und wenn man die unterschiedlichen Aussprachen der Worte auf eine mögliche gemeinsame Wurzel zurückführte, konnte man das entsprechende Wort ermitteln, das aus der „Ursprache“ stammen musste.
Im Jahr 1863 machte der deutsche Indogermanist Schleicher den Versuch, eine kleine Geschichte „Das Schaf und die Rosse“ in „Indogermanisch“ zu verfassen, in einer Sprache, die vorher nie aufgeschrieben worden war. Er hatte Pech, einige Jahrzehnte später schrieb ein anderer Professor der Indogermanistik die gleiche Fabel noch einmal nieder; doch nun lautete sie erheblich anders. Heute würde kein Wissenschaftler mehr so mutig sein, dieses Experiment zu wiederholen. Im 21. Jahrhundert weiß man vielleicht etwas genauer als damals, wie wenig man wirklich weiß …
Ein wichtiges Streitthema zwischen Sprachwissenschaftlern war – und ist zum Teil noch heute – die Frage, wie sich die verschiedenen Einzelsprachen entwickelt haben. Gliederten sie sich aus einer ursprünglich einheitlichen Sprache im Laufe der Zeit aus? Oder haben sich verschiedene Dialekte oder sogar ganz unterschiedliche Sprachen zu einer neuen gemeinsamen Sprache zusammengefunden?
Für beides lassen sich Beispiele in der jüngeren Historie finden, und vermutlich war es auch in der Vorgeschichte der Menschen nicht anders. Unterschiedliche Sprachentwicklung, das heißt Aufspaltung einer vorher einheitlicheren Sprache durch zunehmende Isolation von Menschengruppen auf der einen Seite – und Sprachangleichung auf der anderen Seite, zum Beispiel durch Unterwerfung einer Menschengruppe durch eine anderssprachige Herrenschicht oder durch regen Handelskontakt: beide Faktoren dürften sich ständig überkreuzt und auf die menschlichen Sprachen in aller Welt eingewirkt haben.
Irgendeine, wenn auch fast von Anfang an in Dialekte gegliederte „Ursprache“ der Indoeuropäer wird man also als „Großmutter“ dieser Sprachfamilie annehmen dürfen. Da man inzwischen die Bibel-Geschichten von Adam oder von Noah und seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet nur noch als Gleichnisse verstand und nicht mehr wörtlich auslegte, blieb die Frage, ob nicht diese „Großmutter“ wiederum eine Mutter gehabt haben müsse, ob man nicht also auch eine „Urgroßmutter“ finden könne.
Hier begannen auch die Fachleute für andere Sprachfamilien, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts an den Universitäten herangewachsen waren. in den wissenschaftlichen Disput einzugreifen. Die Sprache der alten Babylonier gehörte zu einer Gruppe untereinander verwandter Sprachen, denen man den Namen „Semitisch“ gegeben hatte, nach Sem, dem „ersten Sohn Noahs“. Zu dieser Familie zählen heute vor allem das Arabische, aber auch das alte Hebräische und das moderne Ivrit, die Sprache der Israelis.
Und die alten Ägypter waren offenbar mit ihrer Sprache Väter – oder nicht vielleicht in Wahrheit „Enkel“? – einer weiteren Sprachfamilie, die man „Hamiten“ nannte (nach dem „zweiten Sohn Noahs“). Diese waren einst in größerer Zahl in Nordostafrika vertreten. Gehörten dann alle restlichen Sprachen zur „Familie Japhets“, des dritten Sohnes des sagenhaften Noah?
Diese Theorie musste man bald beiseite legen, denn allein aus Innerasien mussten noch zwei große Sprachfamilien stammen, wie weitere Forschungen feststellten. Das waren die „Uralischen Sprachen“, aus denen sich in den letzten 2000 Jahren die Sprachen der Ungarn, der Finnen, Esten und einiger verwandter Völker entwickelten. Eine weitere große Sprachfamilie war die der Turk-Völker, die man auch „Altai-Sprachen“ nannte. Und diese beiden Sprachstämme wiesen auf eine gewisse Urverwandtschaft vor vielen tausend Jahren hin, daher auch ihr zusammenfassender Name „Ural-Altaische Sprachen“.
Im Nordwesten Afrikas nördlich der Sahara, auf den Kanarischen Inseln und in Spanien könnte zur gleichen Zeit eine Sprache benutzt worden sein, die wiederum Mutter einiger vielleicht verwandter Tochtersprachen wurde. Man nennt sie in Fachkreisen „Atlanto-libysch“.
Außerdem muss es in Vorderasien und im Kaukasus-Gebiet vor etlichen tausend Jahren eine weitere uralte Sprachfamilie gegeben haben, aus der mehrere untergegangene Sprachen der Antike stammen, von deren einstiger Existenz man aber weiß. Zahlreiche kleine isolierte Sprachen im Kaukasus könnten heute noch die Überreste dieser Sprachfamilie sein, die man vielleicht „Alt-vorderasiatisch“ nennen könnte. Die „professionelle“ Sprachwissenschaft hat aber wohl bis heute diese, in der alten Geschichte nicht unwichtige, Sprachfamilie noch nicht für sich entdeckt.
Als einige Forscher die Wortstämme und Grammatik der Sprachen aller dieser Familien näher verglichen, stellten sie überraschende, offenbar uralte Verwandtschaften auch zwischen ihnen fest, zwar nicht mehr so viele, wie etwa zwischen den indoeuropäischen Sprachen, aber immerhin doch nicht zu übersehen. Auch einige andere Sprachen aus Sibirien und dem Fernen Osten gehören noch dazu. Könnten diese Verwandtschaften auf eine einst gemeinsame „Urgroßmutter-Sprache“ vor zehntausend oder mehr Jahren hindeuten?
In westeuropäischen Forscherkreisen wird diese „Ur-Sprachfamilie“ heute „Nostratisch“ genannt (nach „noster“ lateinisch: „unser“). Russische und andere Forscher aus der ehemaligen Sowjetunion, die sich ebenfalls viel damit beschäftigt haben, nennen sie „boreisch“ (sprich „boré-isch, aus dem Griechischen: nördlich).
Diese Sprache könnte man natürlich heute nicht einmal ansatzweise aufschreiben. Aber immerhin verdichtet sich die Vermutung, dass es in der Frühzeit Eurasiens, vor 20 000 oder vielleicht auch noch 10 000 Jahren, eine mehr oder weniger gemeinsame Sprache aller (oder fast aller?) Menschen im Raum zwischen Atlantik und Sibirien gab.
Alle anderen Sprachen auf dieser Erde, vor allem in Ost- und Südasien, Australien und Afrika, gehören zu völlig anderen Sprachfamilien, die sich offenbar ganz unabhängig von denen in Eurasien entwickelt hatten. Die Sprachen der Indianer in Amerika sind ein Sonderfall; zu ihrer Herkunft wird im Teil II Einiges gesagt werden müssen.
Auf den letzten Seiten wurde in Kürzestfassung ein Überblick über die Entwicklung der Sprachwissenschaft in den letzten zweihundert Jahren gegeben, der natürlich höchst lückenhaft ist.
Doch diese Wissenschaft ist damit zu einem sehr wichtigen Instrument geworden, etwas über die frühe Vergangenheit der Menschen zu erfahren. Mit ihren Methoden und durchaus logischen und plausiblen Begründungen ist sie in eine Zeit vor- (oder richtiger: zurück-) gestoßen, die weit, weit vor allen schriftlichen Quellen liegt. Tatsächlich sind wir mit den hier nur angedeuteten Vermutungen genau in der Zeit der „Morgenröte der Alten Welt“ angekommen, der Zeit, die in diesem Buch möglichst verständlich dargestellt werden soll.
Kapitel 3
Archäologie
Eine Wissenschaft zwischen Historie und Naturwissenschaft
Herzöge oder Könige im Barockzeitalter fanden mitunter Spaß daran, in ihren Schlössern „Kuriositätenkabinette“ anzusammeln, Ausstellungen merkwürdiger Funde aller Art, von Steinen in seltsamen Formen über alte verrostete Schwerter oder große Knochen, die man durch Zufall in der Erde gefunden hatte. Niemand dachte damals daran, systematisch die Erde nach interessanten Überresten der Vergangenheit zu durchforschen.
Das änderte sich wohl erst, als im Nahen Osten und in Ägypten von Abenteurern und frühen Forschern immer mehr Funde aus dem Sand geborgen wurden, die erste Aufschlüsse über die dortigen Hochkulturen gaben. Damals, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kann man wohl die Geburtsstunde der Archäologie als moderne Wissenschaft ansetzen.
Heute ist sie ein anerkannter Zweig der angewandten Wissenschaften, wobei unklar ist, ob man sie im weiteren Sinne zur Geschichtswissenschaft oder zur Naturwissenschaft rechnen soll. Sie dient mit ihren Funden der besseren Erkenntnis alter Geschichte, aber sie nutzt vielerlei Entdeckungen und Methoden zahlreicher naturwissenschaftlicher Forschungsrichtungen, um ihre Funde zu sichern, zu erklären und zeitlich zu bestimmen.
Es gibt heutzutage wohl kaum eine Region dieser Erde, wo nicht schon Archäologen tätig gewesen sind, und praktisch keine Epoche der Erd- und speziell der Menschheitsgeschichte ist dabei unbeobachtet geblieben. Archäologische Funde füllen in aller Welt die Museen und die nur den Fachleuten zugänglichen Magazine; es sind viele Millionen inzwischen. Unübersehbar ist auch das Schrifttum über archäologische Funde, verstreut in Hunderte von Fachzeitschriften und deren Jahrgänge über Jahrzehnte, sowie in zehntausende von Monografien. Auch unter den Archäologen war es unvermeidbar, dass sie innerhalb der unzähligen Forschungsbereiche in dieser groß gewordenen Wissenschaft zu Spezialisten eines nur sehr kleinräumigen Sektors werden mussten.
Vor etwa 150 Jahren mag eine archäologische „Kampagne“ mehr dem Suchen nach einem Schatz geähnelt haben. Rücksichtslos wurde drauflos gegraben, hauptsächlich kam es auf das materielle Ergebnis – das Eisenschwert, die Goldmünzen oder andere Kostbarkeiten – an, die man bergen wollte. Heute wird jeder freigelegte Knochen oder Stein sorgfältig vermessen und in Pläne eingetragen, und an die Stelle von Baggern oder Spaten sind Pinsel und Spachtel als „Grabwerkzeuge“ getreten. Die Anwendung zahlreicher naturwissenschaftlicher Spezialmethoden soll dem Fundstück möglichst viele verschiedene Angaben entlocken.
Eines ist das gemeinsame Schicksal aller Archäologen. Was sie aus der Erde graben, ist – von ganz wenigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen - nicht mit einem Stempel versehen: „Angefertigt im Jahr x vor Christi Geburt von Y“. Das heißt, ihre Funde sind nicht ohne weiteres einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Hersteller (Mensch oder Volk) zuzuordnen.
Es gibt ein paar Faustregeln für die Archäologen: Was in der Erde zu oberst liegt, ist normalerweise jüngeren Datums als das, was in der Schicht darunter zu finden ist. So ist die häufigste Datumsangabe in dieser Wissenschaft die relative: „Das betreffende Fundstück ist älter als …., aber jünger als …“
Seit einigen Jahrzehnten hilft die sogenannte „C 14-Methode“ zu einer etwas genaueren Datumsbestimmung: Hiermit können winzige radioaktive Rückstände in organischen Materialien gemessen werden. Ihr Zerfall endet mit dem „Tod“ des betreffenden Menschen, Tieres, Pflanze; die Zeit seit diesem Ende lässt sich messen; allerdings meist doch nur recht grob. Inzwischen gibt es aber zahlreiche weitere von den Naturwissenschaften zur Verfügung gestellte Messmethoden.
Eine weitere Eigenart der Archäologie macht für den Laien das Lesen von Berichten über Funde oft sehr schwierig. Weder menschlichen Knochen noch anderen Fundstücken kann man ohne weiteres ansehen, welchem Volk der Tote entstammte oder woher das Schwert kam, das man im Boden gefunden hat. Man kann allerdings mit früheren gleichartigen Fundstücken vergleichen. Archäologische Fachzeitschriften sind voll von Landkarten, auf denen solche gleichartigen Funde eingezeichnet sind – doch hilft das keineswegs immer weiter in der sicheren Identifizierung.
Für Zeiten vor mehr als etwa 2000 Jahren gibt es – wenigstens für Europa – nicht einmal Völkernamen, die man verwenden könnte. So hilft sich die Gilde der Archäologen mit der Nennung von „Kulturen“, von denen man gleichartige Hinterlassenschaften finden kann. Diese „Kulturen“ (als Ersatz für die nicht bekannten Völkernamen) haben Namen nach unaussprechlichen Fundorten im Südwesten Frankreichs oder Osteuropas, z. B. Aurignacién, Tardenoisién oder Predmost, wo man zuerst oder vorwiegend Funde der betreffenden Art gemacht hat. Oder man nennt etwa Kulturen nach der typischen Form oder Verzierung von Tontöpfen, z. B. Glockenbecher-Kultur oder Linienbandkeramik. Sobald man über solche Kulturen mehr wissen möchte als in den modernen populärwissenschaftlichen bunten Zeitschriften wie Geo zu finden ist, verirrt sich der Laie ziemlich hoffnungslos im Dschungel derartiger „Ersatz-Völkernamen“.
Dabei hat die Wissenschaft der Archäologie durchaus recht mit dem Vermeiden der Vergabe von Völkernamen für ihre Fundstücke, selbst für jüngere Zeiten, in denen die Geschichtswissenschaft bestimmte Völker in bestimmten Gegenden benennen kann. Denn kann man sicher sein, dass nur dieses Volk diese bestimmte Art von Verzierungen benutzte? Könnte es nicht auch ein Import von ganz anderswo her gewesen sein? Man sieht, das Interpretieren von Funden aus der Erde hat seine Fallstricke, und die meisten Archäologen sind als strenge Wissenschaftler sich dessen bewusst.
Auch die Wissenschaft der Archäologie hat in den letzten 150 Jahren das Wissen um die Vergangenheit des Menschen ungeheuer vermehrt, gerade auch, was die weiter zurück liegende Vergangenheit angeht, die Zeiten vor mehreren tausend bis vielen zehntausend Jahre.
Doch die Grenzen der Erkenntnis sind eben schon angedeutet worden. Es ist einerseits die Anonymität, die den meisten archäologischen Funden von Natur aus anhaftet. Und es ist gleichzeitig die Überfülle von Funden, die auch ständig wächst. Sie erlaubt einen Überblick darüber nur noch jeweils wenigen Spezialisten für ihr ganz besonderes Teilstück der Archäologie. Der Laie in diesem Wissenschaftsfach steht beiden Erscheinungen ziemlich hilflos gegenüber.
Kapitel 4
Geologie und historische Klimakunde
Was geschah auf der Erde vor der „Sintflut“?
Für die Bibelgläubigen stand es einst fest: Einige Zeit nach der Erschaffung des Menschen durch Gott ließ dieser eine verheerende Flut, die „Sintflut“, über die Erde schwemmen, und nur die Insassen der „Arche Noah“, Noah und seine Familie sowie die Tiere, von jeder Art ein Pärchen, überlebten und konnten sich danach vermehren. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nannte man daher die „Sintflut“ auch „wissenschaftlich“ Diluvium (Überschwemmung) und die Zeit davor „Antediluvium“. Über diese Zeit brauchte man eigentlich nichts zu wissen.
Es ist nicht nötig, die Geschichte der wissenschaftlichen Geologie in ihrer Entwicklung von der Zeit der „Aufklärung“ bis weit in das 19. Jahrhundert hinein hier im Einzelnen darzustellen. Doch auch hier lernten die Forscher, die sich dafür interessierten, dass der Planet Erde doch wohl erheblich viel älter sein musste als die gläubigen Juden nach dem Alten Testament ausgerechnet hatten. Die Zahl der Milliarden Jahre wächst immer noch, die man seit dem „Urknall“ der Entstehung von Materie im Weltall und damit der Himmelskörper und somit im weiteren Verlauf auch unserer Erde als vergangen annimmt.
Inzwischen hat die Wissenschaft der Geologie auch einwandfrei nachgewiesen, welche völlig verschiedenen Erdzeitalter unser Planet hinter sich hat, wie aus einem glühenden, aber langsam erkaltenden Himmelskörper allmählich Erdteile und Ozeane entstanden. Die Geologen konnten immer besser erklären, wie Lebewesen aus dem Wasser auf das Land kamen und sich im Laufe von Milliarden Jahren zu der Fülle von Pflanzen und Tieren – und Menschen! – entwickelten, die wir heute kennen.
Auch die Oberfläche unseres Planeten hat sich im Lauf dieser langen Zeit mehrmals total verändert. Wo sich einst in Ozeanen Meersalz, Sand und die Reste toter Tiere und Pflanzen ablagerten, falteten sich später hohe Gebirge auf, und frühere tropische Palmenwälder wurden im Lauf von Millionen Jahren zu Kohle oder zu Erdöl tief unter der Erdoberfläche. Aus einem riesigen Erdteil „Pangaia“ entstanden im Lauf von Milliarden Jahren durch Auseinanderdriften großer Stücke davon die Erdteile, die man heute kennt.
Inzwischen weiß man auch sicher, dass die Nordhalbkugel unseres Planeten im Laufe der letzten 250 Millionen Jahre nicht weniger als viermal von Eiszeiten heimgesucht war, in denen ein riesiger Eispanzer große Teile des Landes und des Ozeans bedeckten, für jeweils Millionen Jahre. Und dazwischen gab es wieder Warmzeiten von ebenfalls langer Dauer, in denen es in Europa, Nordasien und Nordamerika wärmer war als heute. Die letzte Eiszeit ist erst seit etwa 15 000 Jahren vorüber.
Was das Auftreten und das Ende von Eiszeiten auslöst, ist heute in der Zunft der Geologen und Klimaforscher noch nicht endgültig geklärt. Es war wohl das zufällige Zusammentreffen von Verlagerungen der Erdachse, die Auswirkungen auf den Sonnenstand haben, und anderer Ursachen, auf die die Menschen nun einmal keinen Einfluss haben.
Eine für dieses Buch sehr wichtige Folge der letzten Eiszeit und ihres Endes muss bereits hier beschrieben werden, da erst das Wissen darum viele Vorgänge verständlich macht.
Wenn tausende von Jahren lang der Regen nicht in Bäche und Flüsse ablaufen kann, sondern zu Schnee und Eis wird, weil die Außentemperaturen so kalt sind, dass es auch im Sommer nicht abschmelzen kann, türmt sich dieses Eis im Laufe der Zeit zu wahren Gebirgen auf. Das hat gleichzeitig zur Folge, dass der Meeresspiegel langsam sinkt, denn alles Regenwasser auf dieser Erde stammt letztlich aus den Ozeanen, wo es durch Verdunstung hochsteigt und in Form von Wolken durch Winde verfrachtet wird und über dem Festland wieder niedergeht. Doch in Eis erstarrtes Wasser kann nicht im normalen Kreislauf wieder in die Meere zurückkehren.
So ging es während der letzten vier Eiszeiten: der Meeresspiegel sank jeweils weltweit um bis zu 100 Meter, und flache Meere wie die Nordsee, die Ostsee oder das Mittelmeer (an einigen Stellen) trockneten teilweise oder ganz aus, so dass mindestens während der letzten Eiszeit Menschen dort leben konnten, wo jetzt Schiffe fahren. Später stieg das Wasser der Ozeane wieder an.
Für eine „Sintflut“ war da nach den Forschungen der Geologen wahrlich kein Platz, obwohl sicher auf unserem Planeten an zahlreichen Stellen verheerende Überschwemmungen aufgetreten sein müssen, seit es Menschen unserer Art, also der Spezies „Homo sapiens“, gegeben hat.
Für dieses Buch ist es von großer Wichtigkeit, wie sich das Klima auf der Erde und speziell in Eurasien seit diesem Ende der letzten Eiszeit entwickelt hat. Das ist das Forschungsgebiet einer speziellen Wissenschaftsrichtung, der historischen Klimaforschung, die noch gar nicht so alt ist. Auch hier war es dem vereinten Wirken von Wissenschaftlern aus vielen Ländern möglich, relativ verlässlich festzustellen, wie im „Holozän“ (so der wissenschaftliche Name des jüngsten Erdzeitalters nach der Eiszeit) das Wetter in unseren Breiten im Durchschnitt verlief.
Begriffe wie „Tundrenzeit“ oder „Dryas“, „Alleröd“, „Boreal“, „Atlantikum“ und „Subatlantikum“ sagen dem Fachmann nicht nur, in welchem Jahrtausend vor Christi Geburt diese Klimaphasen anzutreffen waren, sondern auch, welche Durchschnittstemperaturen damals hierzulande herrschten, welche Pflanzen das Land bedeckten und welche wichtigen Tiere etwa dort lebten. Kurz gesagt, selbst in den letzten 15 000 Jahren herrschte hier ein keineswegs regelmäßiger Wechsel zwischen wärmeren und kälteren Zeiten. Allerdings gilt diese Einteilung im Wesentlichen nur für Europa; in Asien und vor allem Sibirien weicht sie etwas davon ab. Nordafrika, anders ausgedrückt die Sahara, war zu Ende der letzten Eiszeit ein Paradies für große afrikanische Herdentiere, trocknete seitdem aber in steigendem Maße aus.
Auch dieser Wissenschaftsbereich hat mit seinen Forschungen in den letzten anderthalb Jahrhunderten Einzelheiten zusammengetragen, die unser Wissen über die ältere und jüngere Vergangenheit der Erde ungeheuer vermehrt haben. Dazu gehört natürlich auch das Wissen um die natürliche Umgebung der Menschen, die darin gelebt haben, eine Umgebung, die sich oft und nachhaltig verändert hat.
Die Menschen haben sich dieser wandelnden Umgebung immer wieder anpassen müssen - - und sie haben es geschafft, so sehr, dass sie seit der „Morgenröte der Alten Welt“ die Veränderung ihrer natürlichen Umgebung nunmehr zu einem erheblichen Teil selbst in die Hand genommen haben. Ob das immer zum Segen oder zum Fluch dieser Umwelt gereicht hat, das zu entscheiden, ist nicht leicht.
Kapitel 5
Anthropologie
Von der Rassenkunde zur Suche nach immer älteren Hominiden
Die Feststellungen der Geologie – dass nämlich die Geschichte des Planeten Erde unendlich viel länger gewesen sein müsse als Theologen aus der biblischen Schöpfungsgeschichte gefolgert hatten – ließen die Wissenschaftler nicht unberührt, die sich mit der „Krone der Schöpfung“, nämlich dem Menschen, beschäftigten.
Dass man die Pflanzen- und auch die Tierwelt in ein zwar sehr vielfältiges, aber auch durchaus logisches System einteilen konnte, hatte der schwedische Wissenschaftler Linné schon im 18. Jahrhundert gezeigt. Spätere Forscher versuchten daher, auch die Menschen auf der Erde in Rassen einzuteilen, nach ihren äußeren Erscheinungsformen, die ja nicht zu übersehen sind.
Charles Darwin war es in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der die Zugehörigkeit auch der Spezies „homo“ zur Tierwelt, und hier in der Nähe der höchstentwickelten Affen, der „Primaten“, zur Theorie erhob. „Der Mensch stammt vom Affen ab“, so hat der Volksmund die Lehre Darwins seinerzeit vereinfacht. Darwin lieferte auch eine Erklärung, dass die „Anpassung der Arten“, d.h. ihre Veränderung infolge von Umwelteinflüssen, jeweils lange Zeit brauche.
Das späte 19. Jahrhundert war dann eine Zeit, in der die „Rassenkunde“ der Menschen von einigen damals populären Philosophen in eine verhängnisvolle Richtung gedrängt wurde. Ihnen ging es nicht um eine Definition von „Menschenrassen“ in möglichst klarer wissenschaftlicher Form, sondern sie propagierten die moralische „Überlegenheit der weißen Rasse“, und innerhalb dieser speziell der „nordischen Rasse“. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollte diese Denkrichtung sich mit dem in Europa weit verbreiteten unterschwelligen Hass auf „die Juden“ verbinden und im Nationalsozialismus Hitlers bis zum Völkermord steigern.
Unglücklicherweise hatten die Rassentheoretiker ihren Begriff der „arischen Herrenrasse“ aus der Sprachwissenschaft entlehnt; dort ist „arisch“ der Name einer indogermanischen Sprachen-Teilgruppe, aus der sich später das Altindische und Altpersische entwickeln sollte. Mit Rassen hat er nichts zu tun. Während des Hitler-Regimes wurden jedoch die Deutschen „arisch-nordischer Rasse“ den „jüdischen Untermenschen“ entgegengesetzt und die letzteren zu Millionen in den Vernichtungslagern vergast. Noch siebzig Jahre später hat das allerdings die Folge, dass in Deutschland Worte wie „Rasse“, „arisch“ oder „indogermanisch“ mit einem unbewussten Tabu belegt sind; sie dürfen praktisch in wissenschaftlichen Werken nicht verwendet werden.
Abseits der inzwischen zu einer „verfemten“ Wissenschaft gewordenen Rassenforschung waren Anthropologen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts speziell ausgebildete Mediziner, die sich besonders gut mit dem menschlichen Knochenbau und seiner möglichen Entwicklung in vergangenen Jahrtausenden auskannten. Ihnen war es auch möglich, die typischen Unterschiede in alten menschlichen Schädeln oder Knochen zu erkennen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in immer größerer Zahl in Europa und in Übersee zufällig gefunden wurden.
Dazu gehörte auch das berühmte Schädeldach eines „Neandertalers“, das 1856 in der Nähe von Düsseldorf auftauchte. Es dauerte lange, ehe man in ihm eine eigene Menschenart erkannte, den „homo sapiens neandertaliensis“; ein berühmter Arzt hatte den Schädel seinerzeit noch als Überrest eines „russischen Kosaken mit Gehirndeformation“ diagnostiziert.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden an allen möglichen Stellen der Erde Schädelteile und Knochen von Menschen ausgegraben und der einschlägigen Fachwissenschaft präsentiert, die sehr lange in der Erde gelegen haben mussten; von zehntausend Jahren bis zu mehreren hunderttausend Jahren. Und in Afrika stießen Forscher auf Überreste, von denen sie nicht mehr klar sagen konnten, ob sie einem primitiven Menschen oder einem Affen zuzuordnen waren. Der griechische wissenschaftliche Begriff „Pithekanthropus“ („Affenmensch“) drückt diese Zwischenstellung aus. In Südafrika fand man den möglichen Urahn der heutigen Menschen, den „Australopithecinen“ (Südlichen Affenmenschen).
Die im Kapitel 3 (Archäologie) erwähnten modernen, sich immer mehr verbessernden Möglichkeiten einer Zeitbestimmung alter Funde ließen auch hier keine Zweifel mehr. Die Entwicklung der zoologischen Spezies „homo“ und ihre Abtrennung vom Zweig der Affen musste schon vor Millionen Jahren ihren Anfang gehabt haben. Lange vor dem Erscheinen des heutigen Menschen musste es andere, primitivere Menschenarten gegeben haben, die sich bereits über mehrere Kontinente verbreitet hatten. Zusammenfassend nennt die Wissenschaft diese älteren Menschenarten „Hominiden“. „Homo habilis“, „homo erectus“, „homo robustus“…; die Fachleute kennen noch viele Arten mehr.
Im Kapitel 1 des Teils II dieses Buches wird in Kurzform noch einmal auf den Werdegang dieser „Vormenschen“ vor 1 – 2 Millionen Jahren eingegangen werden. Umstritten war bis vor kurzem aber, wo der Frühmensch entstanden sei. Es gab viele Forscher, die meinten, solche Formen früher „Hominiden“ hätten sich unabhängig voneinander an verschiedenen Stellen unseres Erdballs von urverwandten Primaten getrennt. Inzwischen scheint sich in Fachkreisen die Überzeugung Bahn gebrochen zu haben, dass Afrika, und zwar vorzugsweise der Nordosten dieses Kontinents, die „Wiege“ aller verschiedenen Menschenarten gewesen sei. Diese seien dann in langen Zügen, die zehntausende von Jahren dauern konnten, durch Vorderasien nach Süd- und Ostasien und auch nach Europa gewandert. Allerdings seien diese frühen Hominiden-Arten später irgendwann ausgestorben.
Man muss als Laie dabei bedenken, dass der Mensch und seine Vorstufen seinerzeit das seltenste und verletzlichste Säugetier seiner Größenordnung war. So hat einst der deutsche Vorgeschichtsforscher Alfred Rust den Menschen der „Vor-Eiszeit“ treffend gekennzeichnet. Von jeder Hominiden-Art lebten vielleicht nur wenige hundert bis wenige tausend Individuen gleichzeitig.
Von beiden Menschenarten wird der Leser im Kapitel 2 des nächsten Buchteils noch manches lernen können.
Heute ist auch die Wissenschaft der Anthropologie ein recht zuverlässiger Deuter der Vergangenheit des heutigen Menschen und seiner Vorfahren, vor allem, seit sich zu der Klarheit über die Bedeutung gewisser Formen menschlicher Knochen das Wissen um die Bedeutung der „DNA“ im Körper jedes Menschen gesellt hat. Zur Erklärung der neuen Wissenschaft der Humangenetik dient das nächste Kapitel dieses Buchteils.
Kapitel 6
Humangenetik
Der „Plan“ des menschlichen Körpers macht uralte Völkerwanderungen sichtbar
Den Seitenzweig der Medizin, der hier zu behandeln ist, die Humangenetik, gibt es erst seit recht kurzer Zeit, und die spezielle Forschungsrichtung darin, die für dieses Buch von höchster Bedeutung ist, hat überhaupt erst vor gut drei Dutzend Jahren begonnen.
Gerade diesem Wissenschaftszweig – oder richtiger einem kleinen Teil seiner Erkenntnisse – muss eine etwas ausführlichere Erklärung gewidmet werden, weil mancher Laien-Leser dieses Buches sonst denken dürfte: „Die Wissenschaftler können einem viel erzählen; ich verstehe es nicht und ich glaube es daher auch nicht.“ Hier soll der Versuch gemacht werden, die Zusammenhänge von unveränderlicher Erbsubstanz und ihrem dennoch eintretenden allmählichen Wandel zu erklären, möglichst ohne Laien mit komplizierten Fachbegriffen zu quälen.
Es geht um die immer noch geheimnisvolle Substanz „DNA“. Der Begriff ist die Abkürzung des wissenschaftlichen Kunstworts „Desoxyribo-nucleic acid“. Sie ist in den Millionen Körperzellen jedes Lebewesens, auch des Menschen, vorhanden und enthält eine codierte Botschaft in Form einer Folge von vier unterschiedlichen Chemikalien, die aneinander haften. Sie sagt den Zellen, was sie tun müssen. Sie ist die sogenannte „Erbinformation“.
Die DNA gibt den Zellen unter anderem an, welche Proteine sie produzieren müssen, diese wiederum sind es, die den Körper aufbauen und funktionieren lassen. Die Reihenfolge der Aminosäuren, aus denen diese Proteine gemacht sind, ist in keinem Körper völlig gleich (außer bei eineiigen Zwillingen). Diese gesetzmäßige Verschiedenheit ermöglicht der Kriminalistik den „DNA -Abdruck“, der jeden Menschen eindeutig identifizieren kann, der irgendwo an einem Ort eine eigene Körperzelle hinterlassen hat, sei es ein Haar oder eine Spur seines Spermas. Das weiß die Fachwissenschaft allerdings erst seit etwa 30 Jahren.
Auch wenn jede der zahllosen Zellen in einem lebendigen Körper normalerweise andere Aufgaben hat – beispielsweise einen Teil der Haut des Körperorgans Leber zu bilden – „weiß“ jede dieser Zellen, wie der gesamte Körper aussehen muss, damit er ein funktionsfähiges Exemplar der Gattung „Mensch“ darstellen kann.
Bei der Teilung von Zellen – das passiert ständig während des Heranwachsens des Embryos im Ei oder Mutterleib, aber auch während der Lebenszeit des Individuums – wird die codierte Information in dieser DNA genau kopiert. Das muss auch sein, sonst würde es keine gesunden und lebensfähigen Menschen (oder Löwen oder Eichenbäume) geben.
Dennoch kommen immer wieder einmal Veränderungen dieser Informationen vor. Man nennt sie wissenschaftlich Mutationen. Es wird eine bestimmte Teil-Information innerhalb der DNA nicht korrekt kopiert; diese kleine Veränderung wird dann an die Nachkommen des betreffenden Individuums vererbt.
Ein Teil solcher Mutationen kann für den Körper schädliche Folgen haben: es entsteht z. B. eine gefährliche Veränderung im Blut. Mitunter sind sie so schädlich, dass Träger dieser Mutation früh sterben und keine weiteren Nachkommen erzeugen können. Diese Mutation stirbt dann aus, allerdings nicht immer.
Andere DNA-Mutationen können für das Individuum, in dem sie entstehen, sowie für seine Erben nützliche Folgen haben. Beispielsweise heißt es, dass die Frühmenschen, die ja in Afrika entstanden (siehe Kapitel I/5), eine schwarze Haut hatten, die sie besser gegen die intensive Sonnenstrahlung schützt. Auch diese spezielle Hautfarbe wurde durch Mutationen erworben, vermutlich in der ausgeprägten Form erst nach zehntausend Jahren.
Als dann Teile dieser „Schwarzen“ als homo sapiens ins damals besonders kalte und lichtarme Europa und Nordasien kamen (siehe dazu Kapitel II/3), erwarben sie durch weitere einander folgende und bleibende „nützliche“ Mutationen eine helle Haut, was ihnen hilft, die hier nur schwache Sonnenstrahlung besser auszunützen, mit Hilfe des Vitamins D (Näheres dazu im Kapitel II/2). Es entstand die „Weiße Rasse“ – man sollte sie vielleicht besser „die Menschen mit heller Haut“ nennen – oder die „Europiden“. Solche nützlichen Mutationen haben dann die Chance, sich durch Vererbung an viele Nachkommen immer weiter zu verbreiten.
Sie haben auch einen langen Bestand. Ja, sie sind es, die überhaupt die Evolution, die allmähliche Anpassung von Pflanzen- und Tierarten an die sich verändernde Umwelt, ermöglichen. Das braucht immer eine lange Zeit. Doch nur so sind im Laufe von Milliarden Jahren die verschiedenen Pflanzen- und Tierarten – und auch Menschenarten! – und ihre unzähligen Untergruppen und Abwandlungen entstanden. Erst mit dem noch ganz neuen Wissen um die Erbsubstanz DNA hat die Wissenschaft die Erklärung für die alte Lehre Darwins von der „Anpassung der Arten“ gefunden.
Das Prinzip der Vererbung und der gelegentlichen Veränderung des Erbguts sei an einem Beispiel erklärt. Von einem Eichenbaum fallen jährlich tausende von Eicheln als Samen auf die Erde. Solche Eicheln, die auf günstigen Boden fallen und nicht von Eichhörnchen verzehrt werden, können dann nach einem Jahr einen winzigen Spross über die Erde entsenden, mit einigen Wurzelfädchen unter der Erde. Wenn kein Reh den Eichensprössling frisst, hat er nach einem Jahr schon einige kleine Seitentriebe und winzige Blätter. Er wächst weiter und entwickelt kleine Zweige, die im Laufe der Zeit zu großen Ästen werden und später weitere Zweige mit immer mehr Blättern wachsen lassen. Nach vielen Jahren wird ein mächtiger Baum daraus, mit zahlreichen dicken Ästen, die wiederum Ansatzpunkt für weitere Äste, tausende von Einzelzweigen und Millionen Blättern sind.
Ab jetzt passt das Beispiel Eichenbaum nicht mehr ganz, denn Mutationen, die es selbstverständlich auch im Erbgut dieser Pflanze geben kann, vollziehen sich in den Samen, sprich Eicheln. Aber nehmen wir einmal an (bei der Eiche so nicht möglich), es komme an einem Seitentrieb eines Astes eine wichtige „nützliche Mutation“ vor, dann werden dort auch alle weiteren kleinen Zweige und Blätter, die aus diesem Zweig entwachsen, auf Dauer diese Veränderung in sich tragen. Und etliche Zeit später gibt es an einem kleinen Seitenzweig dieses Astes eine weitere Mutation, die dann von den Abkömmlingen dieses Triebs weitergegeben wird. So darf man sich die allmähliche Entstehung von einander abweichender Pflanzen- und Tierarten und deren Untergruppen und Rassen vorstellen, wenn man sie mit einem mächtigen, im Lauf von Jahrhunderten gewachsenen Eichenbaum vergleicht.
Das ist – sehr vereinfacht dargestellt – das Prinzip der Anpassung der Arten und auch ihrer allmählichen Auseinanderentwicklung in der gesamten Pflanzen- und Tierwelt, ein „Urgesetz“ des Lebens.
Neben diesen schädlichen oder nützlichen Mutationen des Erbguts kommen auch – viel häufiger als diese – „indifferente“ Mutationen vor. Sie schaden weder dem betreffenden Lebewesen noch nützen sie ihm ausdrücklich, aber manche verändern vielleicht sein Aussehen und das seiner Nachkommen, weil ja auch diese Mutationen erblich sind. So lassen sich etwa bei den Menschen mit weißer Haut die verschiedenen Typen mit blauen oder braunen Augen oder mit blondem oder schwarzem Haar erklären.
Noch sehr jung ist die bahnbrechende Erkenntnis, dass es in der DNA jedes Menschen ein Chromosom gibt, das es den Wissenschaftlern erlaubt, sehr weit zurück in die Generationen seiner Vorfahren zu blicken, wenn sie beispielsweise die Speichelprobe eines Menschen im Labor untersuchen. Diese „Marker“ zeigen keine Veränderung im Körper an, sondern die Abstammung. Sie sind auch nur ein winziger Abschnitt in dem außerordentlich langen Strang der miteinander verbundenen DNA-Informationen für die Körperzellen.
Man kann diese Marker ein wenig mit den Familiennamen vergleichen, die ja in den meisten modernen Völkern des westlichen Kulturkreises unveränderlich sind, hier allerdings nur im Mannesstamm. Diese Marker sind sogar unbestechlicher als die modernen Familiennamen, denn sie lassen sich durch keine Adoption, kein „Kuckuckskind“ oder eine (gesetzlich mögliche oder illegale) Namensänderung täuschen. Und sie gelten für Männer und Frauen, aber völlig getrennt.
Der eine dieser „Marker“ mit dem Namen mtDNA („mitrochondriale DNA“) ist der von Frauen. Er ist identisch mit dem entsprechenden Chromosom der Mutter der „Probandin“, und dieses wieder mit dem Marker ihrer Mutter und Großmutter. In dieser mütterlichen Abstammungsfolge haben alle Menschen die gleiche mtDNA, über viele Generationen zurück - - bis zu irgendeiner „Ur-Ur-Großmutter“, bei der an dieser „Marker“-Stelle eine kleine Mutation aufgetreten ist, die sie von ihrer Mutter unterschied.
Der andere Marker heißt in der humangenetischen Wissenschaft Y-DNA und findet sich nur bei Männern. Er ist identisch beim Vater des Mannes und bei dessen Vater und Großvater. Wieder könnte man die Linie über viele Generationen verfolgen.
Bei Frauen treten an der mtDNA häufiger Mutationen auf als bei der Y-DNA der Männer; sie sind auch im Labor leichter aufzufinden und zu verfolgen. Darum hat die Forschung den weiblichen Marker eher entdeckt als den männlichen.
Hier passt wieder (wenigstens ungefähr) der Vergleich mit dem Eichenbaum, bei dem hier und da einmal an einem Seitenast eine wichtige Mutation vor sich ging, die dann von dieser Stelle aus weitergegeben wurde, bis an einem weiteren Seitenast dieses Astes wieder eine Mutation passierte. Könnte man jeweils von dort aus den Entwicklungsweg zurück verfolgen und die Punkte, an denen Mutationen auftraten, genau kennzeichnen, dann käme man mit viel Glück bis zu der Eichel, die einst vor Jahrhunderten in die Erde gelangte und das Entstehen des ganzen Eichbaums in Gang setzte, und man wüsste gleichzeitig, wo und wann im Lebenslauf dieser Eiche die unterscheidenden Mutationen auftraten.
Genau das ist erstaunlicherweise durch die weibliche und männliche „Marker“–DNA für die Menschen auf der Erde möglich. Seit Jahren läuft ein ehrgeiziges weltweites Forschungsprogramm, durch das möglichst viele heute lebende Menschen in allen Ländern der Erde und aus allen Völkern auf ihre „Marker“ untersucht und die Ergebnisse statistisch ausgewertet werden.
Inzwischen haben die Humangenetiker ermittelt, dass offenbar alle heute lebenden Frauen dieser Welt zu nicht mehr als etwa 25 „Stammästen“ gehören, Man hat sie mit den Buchstaben A - X bezeichnet und nennt sie „Haplogruppen“ (nach dem griechischen Wort „Einzig, alleinstehend“). Einige davon umfassen nur wenige zehntausend, andere dagegen Millionen Frauen auf der ganzen Welt. Nur einige wenige davon werden allerdings für die Entwicklung der „Europiden“ eine Rolle spielen, um die es in diesem Buch vorrangig geht.
Jede dieser Haplo-Gruppen hat sich im Laufe der langen Zeit in zahlreiche Untergruppen zerteilt; auch sie werden heute von der Fachwissenschaft sorgfältig mit Zahlen und Buchstaben unterschieden. Aber jede endet bei der Rückverfolgung der Verwandtschaft bei einer „Urmutter“, die sich durch irgendeine Mutation von ihrer Mutter unterschied und damit einen neuen Ast begründete.
Man weiß inzwischen auch, dass z.B. bei der weiblichen mtDNA die Haplo-Gruppe J durch Mutation aus der Haplo-Gruppe R entstanden ist, und zwar vor etwa 45 000 Jahren; man kann sogar annehmen, dass diese Mutation in Westasien geschehen ist (dazu etwas Genaueres am Ende dieses Kapitels) .
Und alle diese verschiedenen Haplo-Gruppen (oder „Verwandtschafts-Äste“) durch die Mütter führen letztlich – davon ist die Zunft der Humangenetiker heute fest überzeugt – zu der „mitrochondrialen Eva“ des homo sapiens, die vor etwa 175 000 oder 200 000 Jahren in Afrika gelebt haben muss. Diese eine Frau gilt als die „Urmutter“ aller heutigen Menschen.
Ganz Entsprechendes gilt auch für alle heute auf der Erde lebenden Männer, deren väterliche Verwandtschaft man durch die sogenannte „Y-DNA“ feststellen kann. Die gut 20 Haplo-Gruppen der männlichen Verwandtschaft haben ebenfalls Bezeichnungen von A – T, dürfen aber nicht mit den gleich benannten mtDNA-Haplo-Gruppen der Frauen verwechselt werden. Und auch ein gemeinsamer einzelner „Adam“ all dieser Männer gilt für die Wissenschaft der Humangenetik als sicher: er soll vor 60 000 bis 90 000 in Afrika gelebt haben.
Hier hört für jeden normalen Leser das Verständnis auf. „Adam“ und „Eva“ müssen doch zusammen gelebt haben und ein Paar gewesen sein! Die Fachleute machen sich wenig Mühe, diese Denkhürde für Laien zu beseitigen, für sie ist ja alles klar, dass es sich in der „wahren“ Schöpfungsgeschichte des Menschen ganz anders verhielt als nach der schönen Bibel-Erzählung. Doch hier soll versucht werden, auch dem Laien zu erklären, was es damit wohl auf sich hat. Dabei muss auf die Erkenntnisse der modernen Anthropologie über das Leben der Frühmenschen in Afrika (siehe Kapitel I/5) zurückgegriffen werden.
Versuchen wir uns in Gedanken etwa 175 000 Jahre zurück zu versetzen, in die Savanne Ostafrikas, wo damals Horden von „Hominiden“ (Frühmenschen) lebten, möglicherweise aus einer in Afrika zurückgebliebenen Art des Homo heidelbergensis. Eine etwas nähere Beschreibung dieses Zustandes können die Leser im Kapitel II/1 finden. In einer Horde waren, so nimmt man an, 20 – 30 Männer und Frauen und Kinder stets zusammen, sie trafen sich gelegentlich mit anderen Horden, mit denen sie manches neu erworbene Wissen, Werkzeuge und Frauen tauschten. Von allen Frühmenschen dieses Typs gab es damals allerdings vielleicht in ganz Afrika nicht mehr als wenige tausend Individuen, die gleichzeitig lebten. Diese extrem niedrige Zahl muss man bei Überlegungen zu jenen längst vergangenen Zeiten stets berücksichtigen.
In der Eizelle einer Frau aus einer dieser Horden muss nun eine sehr wichtige „nützliche“ Mutation der DNA aufgetreten sein. Erzeugte sie vielleicht eine Veränderung des menschlichen Kehlkopfes, die eine bessere Artikulation, eine ausgefeiltere Sprache, ermöglichte? Jedenfalls muss diese „Eva des modernen Menschen“ bei ihren Kindern den Anfang einer bahnbrechenden erblichen körperlichen Veränderung ausgelöst haben, den Beginn der Entwicklung der weiteren Nachkommen zum „homo sapiens“. Aber nur eine ihrer Töchter oder Enkeltöchter konnten mit dem bei ihr veränderten Marker in ihrer mitrochondrialen DNA die „Nachricht“ über die erfolgte Mutation weitergeben. Erst sie kann man eigentlich die „Eva“ nennen.
Im Laufe vieler Generationen konnte sich die neue Menschenart vermehren und sich auch untereinander paaren und so die Chance zu weiteren nützlichen Mutationen vermehren. Wie viele Generationen von Menschen können im Laufe von 10 000 Jahren Nachkommen zeugen? 400 bis 500 dürften es gewesen sein. Im Kapitel II/2