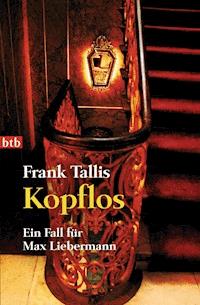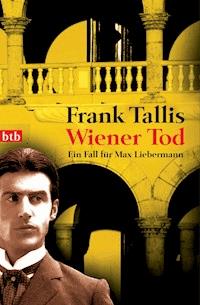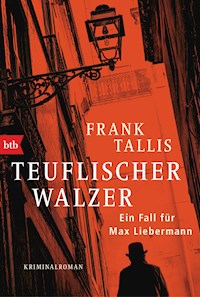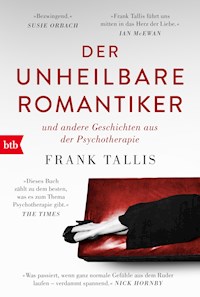
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Liebe sind wir alle gleich: Jeder sehnt sich nach Liebe, jeder verliebt sich, jeder hat schon Liebeskummer erlebt. Aber was passiert, wenn die Liebe zur Obsession wird? Die Angestellte einer Anwaltskanzlei ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr Zahnarzt sie liebt und dass das Schicksal sie beide füreinander bestimmt hat bis in alle Ewigkeit. Eine Witwe bekommt Besuche von dem Geist ihres verstorbenen Ehemanns. Ein Akademiker ist seinem Spiegelbild verfallen. Eine wunderschöne Frau wird von Eifersucht auf die Rivalin geplagt, die es gar nicht gibt. Ein Nachportier ist besessen lasziven Dämonen.
Mit diesen Fallgeschichten aus seiner Praxis nimmt uns der Schriftsteller und klinische Psychologe Dr. Frank Tallis mit auf eine höchst faszinierende Reise durch die Seelenlandschaft von Liebenden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Wenn wir lieben, flirten wir mit dem Wahnsinn.
In der Liebe sind wir alle gleich: Jeder sehnt sich nach Liebe, jeder verliebt sich, jeder hat schon Liebeskummer erlebt. Aber was passiert, wenn die Liebe zur Obsession wird? Die Angestellte einer Anwaltskanzlei ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr Zahnarzt sie liebt und dass das Schicksal sie beide füreinander bestimmt hat bis in alle Ewigkeit. Eine Witwe bekommt Besuche von dem Geist ihres verstorbenen Ehemanns. Ein Akademiker ist seinem Spiegelbild verfallen. Eine wunderschöne Frau wird von Eifersucht auf die Rivalin geplagt, die es gar nicht gibt. Ein Nachtportier ist besessen von lasziven Dämonen.
Mit diesen Fallgeschichten aus seiner Praxis nimmt uns der Schriftsteller und klinische Psychologe Dr. Frank Tallis mit auf eine höchst faszinierende Reise durch die Seelenlandschaft von Liebenden.
»Frank Tallis führt uns mitten in das Herz der Liebe.«Ian McEwan
Zum Autor
FRANK TALLIS ist Schriftsteller und praktizierender klinischer Psychologe. Neben einer Vielzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist er vor allem für seine Erfolgsserie um den Wiener Psychoanalytiker Max Liebermann bekannt, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Tallis lebt in London.
Frank Tallis
Der unheilbare Romantiker
und andere Geschichten aus der Psychotherapie
Aus dem Englischenvon Liselotte Prugger
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Uncurable Romantic« bei Little Brown, an imprint of Little, Brown Book Group, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Juli 2019 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2018 by Frank Tallis
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: semper smile, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Nico Taylor
Covermotiv: © Getty Images
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-22143-0V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Nicola, unheilbar
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Die Anwaltsgehilfin Liebe, die kein Nein akzeptiert
Kapitel 2 Ein Geist im Schlafzimmer Alterslose Leidenschaft
Kapitel 3 Die Frau, die es nicht gab Argwohn und destruktive Liebe
Kapitel 4 Der Mann, der alles hatte Süchtig nach Liebe
Kapitel 5 Der unheilbare Romantiker Über die Unmöglichkeit der perfekten Liebe
Kapitel 6 Der amerikanische Evangelist Fleischliche Sünden
Kapitel 7 Das Strumpfspiel Dr. B. und Fräulein O. – ein warnendes Beispiel
Kapitel 8 Narziss Lust im Spiegel
Kapitel 9 Der Nachtportier Schuld und Selbstbetrug
Kapitel 10 Der »gute« Pädophile Befleckte Liebe
Kapitel 11 Das Paar Absurde Liebe
Kapitel 12 Hirnschnitte Sezierte Liebe
Danksagung
Vorwort
Der römische Philosoph Lukrez ist berühmt für sein umfangreiches Lehrgedicht De rerum natura (Über die Natur der Dinge). Es enthält Abschnitte über eine breite Palette von Themen, wie die Bewegung von Atomen, den Kosmos, Zeit – und eine ganze Menge über Psychologie.
Unter Lukrez’ Werken über Seele und Verhalten findet sich eine Beschreibung dazu, was geschieht, wenn sich Menschen verlieben. Er beobachtet, dass Liebestrunkene häufig durch unstillbare Sehnsüchte erregt und aufgewühlt werden. Sexuelle Vereinigung, oft leidenschaftlich und heftig, führt nur zu einer zeitweiligen Linderung, denn Liebende wollen immer mehr voneinander. Es ist, als beschriebe Lukrez eine Sucht. Er verwendet eine Sprache, die suggeriert, dass man, wenn man sich verliebt, krank oder – noch schlimmer – verrückt wird. Die Liebe, sagt er, ist wie eine unbesiegbare Krankheit, und Liebende siechen an unsichtbaren Wunden dahin. Sie sind liebeskrank: Sie sind schwach und vernachlässigen ihre Pflichten, sie verhalten sich närrisch und verprassen ein Vermögen mit übertriebenen Geschenken, sie werden eifersüchtig und unsicher.
Nachdem Lukrez all diese Symptome beschrieben hat, bedient er sich eines Hilfsmittels, das viele Komiker einsetzen. Er kehrt unsere Erwartungen um und bringt uns so zum Lachen. Er sagt: »So sieht es aus, wenn alles gut geht – aber stellen Sie sich vor, wie es aussieht, wenn es nicht gut geht.« Urplötzlich ist er kein klassischer Philosoph mehr, sondern ein Freund oder Trinkkumpan.
Lukrez führt weiter aus, was passiert, wenn die Liebe scheitert. Liebende verfallen einem Wahn und verlieren die Fähigkeit, objektive Urteile zu fällen. Sie erleben eine Art ständiger Halluzination. Gewöhnliches, ja sogar hässliches Aussehen wird als außerordentliche Schönheit wahrgenommen. Sie können nicht ohne ihre Liebste oder ihren Liebsten sein, und alle anderen Menschen werden unwichtig. Verliebte werden unterwürfig und hilflos, und was immer ihnen Freude macht – Sinnlichkeit, gemeinsame Lust – ist nur dazu angetan, sie einzuschränken. Die Göttin der Liebe, warnt Lukrez, hat starke Fesseln.
Es ist wirklich bemerkenswert, dass ein römischer Philosoph, der vor mehr als zweitausend Jahren gestorben ist, mit einer Beschreibung von Liebeskummer aufwarten kann, die wir alle verstehen. So gesehen hat sich die menschliche Natur seit der Antike offenbar nicht sehr verändert. Aber Lukrez belässt es nicht dabei. Er verfeinert seine Argumentation und trifft einen Unterschied zwischen einer Liebe, die gut geht, und einer Liebe, die scheitert – einer Liebe, die normal ist, und einer abnormen Liebe. In einem allgemeineren Sinn basiert die gesamte Disziplin der Psychiatrie auf dieser Unterscheidung: der Identifizierung abnormer Menschen innerhalb der mehrheitlich »normalen« Bevölkerung.
Tatsächlich sind die Symptome, die Lukrez mit einer Liebe assoziiert, die gut geht, nur marginal weniger dramatisch als die Symptome, die er mit einer Liebe assoziiert, die scheitert. Dies deutet eher auf ein Kontinuum mit ansteigendem Schweregrad hin als auf einen tatsächlichen Unterschied zwischen normal und abnorm. Ich bezweifle, dass Lukrez sich zu diesem Thema wirklich tiefer gehende Gedanken gemacht hat, und die Unterscheidung, die er trifft, verfolgte in seinem Gedicht vielleicht nur den Zweck, seinen Späßen die Pointe zu sichern.
Lukrez beschrieb die Menschen, die unter Liebeskummer leiden, als Narren. Tatsächlich ist der Ton seiner Lyrik ziemlich despektierlich. Er ermuntert uns, gemeinsam mit ihm über deren Torheit zu lachen. Das ist eine Einstellung, die vielleicht viele Menschen teilen. Es mag ein gewisses fragwürdiges Vergnügen bereiten, Leute zu beobachten, wenn sie sich zum Narren machen. Doch wenn wir uns über den Liebeskummer von anderen lustig machen, sind wir entweder Heuchler oder gefühllose Roboter. Wer von uns hat sich nicht selbst schon zum Narren gemacht – oder zumindest auffallend untypisch verhalten –, wenn er verliebt war? Nur diejenigen sind immun, die sich aus der Gesellschaft ausklinken oder ihre Emotionen unterdrücken.
Wir wissen fast nichts über Lukrez. Der heilige Hieronymus berichtet uns, dass er in der Mitte seines Lebens Selbstmord begangen hat. Man vermutet, dass er durch einen Liebestrank den Verstand verloren hat. Vielleicht hätte er Liebeskummer ernster nehmen sollen.
Sie war clever, erfolgreich und schrecklich depressiv – eine Opernsängerin mit durchaus beeindruckendem Talent. Und wie es bei depressiven Menschen oft der Fall ist, war sie auch extrem reizbar. Sie erzählte mir, wie es mit ihrem Ehemann im Bett war: »Ich komme mir wie eine Gummipuppe vor«, sagte sie, machte ein »O« mit dem Mund und versteifte die Gliedmaßen. Dann sah sie mich entgeistert an, als hätte sie erst jetzt bemerkt, dass ich vor ihr saß. Ihre Augen verengten sich. »Warum machen Sie das?«, wollte sie wissen. Meine Antwort war gedankenlos und abgedroschen. »Es ist mein Beruf …« Ich hätte es wissen müssen und bekam keine Gelegenheit, weiter auszuholen. Sie hatte etwas Aufschlussreicheres von einem Psychologen erwartet. »Ständig nur Elend und unglückliche Menschen«, ereiferte sie sich, »sich Tag für Tag immer die gleiche Scheiße anhören – meine Scheiße anhören! Wer sucht sich so einen Beruf aus?« Dann erlosch das Feuer in ihren Augen, und ich sah ihr an, dass sie in einem Sumpf von Selbstverachtung versank. Sie machte eine schwache, entschuldigende Geste. »Schon gut«, sagte ich. Und ich gab ihr eine bessere Antwort – auch wenn sie noch immer lückenhaft und nicht ganz ehrlich war.
Warum bin ich tatsächlich Psychotherapeut geworden?
Die zuckersüße und sichere Antwort ist die, dass ich den Menschen helfen wollte. Und das entspräche sogar der Wahrheit. Aber das ist ebenso offensichtlich wie banal. Fast so, als gäbe ein Feuermann auf die Frage, warum er bei der Feuerwehr ist, die platte Antwort: »Um Brände zu löschen.«
So weit ich zurückdenken kann, hat mich das Abseitige, haben mich Randgebiete, zwielichtige Orte und Skurrilität fasziniert. Als Jugendlicher habe ich tonnenweise Schauerromane und Gruselgeschichten verschlungen – vor allem deshalb, weil diese Genres üblicherweise die dunkleren Nischen der Seele und bizarre Verhaltensweisen bedienen. Als ich dann erwachsen wurde, entwickelte sich diese etwas sensationslüsterne Faszination für das Sonderbare (speziell wenn es psychologischer Natur war) zu einer eher intellektuellen Neugier. Aber im Wesentlichen geht es mir heute noch so.
Ich habe in vielen verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, darunter in einigen sehr großen, weitläufigen Krankenhäusern. Immer wenn sich die Gelegenheit dazu ergab, flüchtete ich vor den betriebsamen, makellosen Bereichen im »Rampenlicht« – Aufnahme, Ambulanz, Stationen –, ließ die betriebsamen Passagen hinter mir und wanderte durch Keller, verlassene Korridore und leere Büros. Manchmal schlenderte ich eine ganze Weile durch unheimliche, stille Orte, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Auf einem meiner Ausflüge entdeckte ich einen Raum, dessen Decke aus Glasscheiben bestand und der sich als aufgelassener Operationssaal herausstellte. Viele der Scheiben waren zerbrochen, und Herbstblätter waren auf dem Fliesenboden verstreut. In der Mitte des Raums stand eine altertümliche Maschine mit weißen, emaillierten Oberflächen. Sie erinnerte vage an ein Teleskop, jedenfalls ankerte das ganze Ding auf einem runden Fundament und war mit Hebeln versehen. Irgendwie fühlte ich mich in einen Roman von H.G. Wells oder Jules Verne versetzt. Ein anderes Mal entdeckte ich ein Zimmer mit verstaubten Regalen. Auf jedem Regalbrett standen rechteckige Plexiglasbehälter mit in Formaldehyd konservierten menschlichen Hirnscheiben. Es war ein gespenstischer Anblick – wie eine Bibliothek von Erinnerungen. Auf dem Gelände eines viktorianischen Irrenhauses stieß ich auf ein winziges Museum mit einer Sammlung von Kunstwerken ehemaliger Patienten. Ich war der einzige Besucher. Als eine Aufseherin auftauchte – eine kleinwüchsige, hellwache Frau –, wollte sie sofort wissen, was ich von den Auswirkungen hoher Außentemperaturen auf das menschliche Verhalten hielt.
Symptome müssen Ursachen haben. Diese können durch Abnormitäten im Gehirn hervorgerufen werden, etwa eine Störung im Neurotransmitterhaushalt, unterdrückte Erinnerungen oder verzerrtes Denken. Aber Symptome sind auch der Endpunkt von Geschichten. Für mich ist bei der Psychotherapie das Erzählte ebenso wichtig wie Wissenschaft oder Mitgefühl, wenn nicht sogar wichtiger. Die etwas peinliche Wahrheit – die ich der depressiven Opernsängerin allerdings nicht verraten konnte – war, dass ich die täglichen Leidensgeschichten in der Psychotherapie deshalb ertragen konnte, weil ich sie mir gern anhörte. Ganz besonders galt das für solche, die irgendwie befremdlich waren und eine Erklärung für das Auftreten ungewöhnlicher klinischer Phänomene lieferten. Mein schlechtes Gewissen wird allerdings durch die Tatsache beruhigt, dass ich mich in dieser Hinsicht in der Gesellschaft durchaus illustrer Leute bewege.
Die Praxis der Psychotherapie war über lange Zeit mit Geschichtenerzählen verbunden. Anna O., die allererste Patientin, die mit einem Verfahren behandelt wurde, aus dem sich irgendwann die Psychoanalyse entwickelte, trat in eine andere Bewusstseinsebene ein, in der sie Josef Breuer (Freuds väterlichem Gönner und Mitarbeiter) Geschichten erzählte, die ihn an Märchen von Hans Christian Andersen erinnerten. Diese Geschichten bildeten einen integralen Teil ihrer Behandlung und brachten sie dazu, Breuers Ansatz als »Gesprächstherapie« zu bezeichnen.
Menschen sind lebende Geschichtenbücher. Gesprächstherapien schlagen die Bücher auf und lassen die Geschichten heraus.
Den Kern des vorliegenden Buches bildet eine Reihe wahrer Geschichten über Menschen aus Fleisch und Blut, die, dadurch, dass sie sich verliebt hatten oder liebten, unter einem beachtlichen Leidensdruck standen und deshalb von mir psychotherapeutisch behandelt wurden. Ihre Probleme waren überwiegend emotionaler oder sexueller Natur oder eine Kombination aus beidem. Wie schon Lukrez angeführt hat, ist eine Liebesbeziehung fast immer mit physischem Begehren verbunden. Die klinischen Phänomene, die ich beschreibe (Symptome, Gefühle und Verhalten), sind authentisch; die Daten meiner Patienten habe ich jedoch verschleiert, um ihre Anonymität zu bewahren.
Die allerersten Gedichte wurden vor mehr als dreieinhalbtausend Jahren in Ägypten geschrieben – erlesene Liebeslieder, die die Verzweiflung von Liebenden als eine Art Krankheit beschreiben. Frühe medizinische Texte bezeichnen Verliebtheit als ein Leiden. Im zweiten Jahrhundert berichtete der griechische Arzt Galen über eine verheiratete Frau, die nicht schlafen konnte und seltsame Verhaltensweisen an den Tag legte, nachdem sie sich in einen Tänzer verliebt hatte. Liebeskummer galt von der Antike bis ins 18. Jahrhundert hinein als legitime Diagnose, verschwand aber im 19. Jahrhundert fast völlig von der Bildfläche. Heutzutage ist der Begriff »Liebeskummer« eher eine Metapher denn eine Diagnose.
Wenn verliebte Leute ihre Beschwerden vorbringen, können sie bestenfalls auf ein wenig Mitgefühl und ein ironisches, wissendes Lächeln hoffen. Necken und Spötteln sind ebenfalls übliche Reaktionen.
Aber Liebeskummer ist keine triviale Angelegenheit. Unerwiderte Liebe ist häufig Anlass zu Selbstmord (besonders unter Jugendlichen), und etwa zehn Prozent aller Morde hängen mit sexueller Eifersucht zusammen. Darüber hinaus hat sich mittlerweile eine Ansicht in der Psychotherapie und der Psychologie etabliert, dass gestörte enge Beziehungen nicht nur mit seelischen Krankheiten in Zusammenhang stehen, sondern sogar deren Hauptursache sind.
Oft saß ich Patienten gegenüber, die Liebeskummer hatten und deren psychologische Qualen und Verhaltensstörungen ebenso ernst waren wie ein beliebiges Kardinalsymptom einer schweren psychiatrischen Krankheit. Solchen Patienten ist es normalerweise peinlich, ihre Gedanken und Gefühle zu offenbaren: Sie haben die weit verbreitete Ansicht verinnerlicht, dass Liebeskummer wieder vergeht, dass er pubertär, belanglos oder lächerlich ist. Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit. Wenn man sich verliebt, können die emotionalen und verhaltensbezogenen Konsequenzen lange andauern und tiefgreifend sein. Immer wieder habe ich ganz normale Lebensläufe auseinanderbrechen sehen, weil wilde Leidenschaften im Spiel waren; ich habe Menschen erlebt, die lange Zeit unter einer Zurückweisung litten; ich habe Patienten bis an den Rand psychologischer Abgründe begleitet – dunkle, beängstigende Orte – und gespürt, dass ein unglücklich gewähltes Wort oder eine ungeschickte Redewendung ausreichen konnte, um sie über die Kante zu treiben. Ich habe Patienten behandelt, die sich dem Sirenengesang des Vergessens ergaben, auf dessen Versprechungen von Erlösung und ewigem Frieden hörten, auch wenn ich sie noch so sehr, manchmal geradezu verzweifelt, zu überzeugen versuchte, einen Schritt zurückzutreten. Ich habe von Sehnsucht und Begierde ausgehöhlte Menschen gesehen, die reduziert waren auf ein schwaches Abbild ihres früheren Selbst. Bei keinem dieser Vorfälle war ich auch nur andeutungsweise versucht, ihnen ein ironisches, wissendes Lächeln zu schenken.
Der Begriff »unheilbarer Romantiker« ist mehr als nur eine witzige Formulierung – er bestätigt eine unbequeme klinische Realität. Einer der inbrünstigen Poeten des antiken Ägypten schrieb zutreffenderweise, dass Ärzte mit all ihren Arzneien nicht imstande wären, sein Herz zu heilen. Er könnte Recht gehabt haben.
Die Liebe ist eine große Gleichmacherin. Jeder will geliebt werden, jeder verliebt sich, jeder verliert die Liebe, und jeder weiß, wie verrückt die Liebe sein kann. Und wenn die Liebe scheitert, dann sind auch unser relativer Wohlstand, unsere Bildung und unser Status nichts mehr wert. Der sitzengelassene Lord ist genauso verletzlich wie der sitzengelassene Busfahrer. So gut wie alle bedeutenden Theoretiker der Psychotherapie seit Freud sind sich einig, dass die Liebe für das Glück der Menschen eine entscheidende Rolle spielt.
Ich bin überzeugt, dass die Probleme, die aus Liebe entstehen – Verblendung, Eifersucht, Liebeskummer, Trauma, unangemessene Bindung und Abhängigkeit, um nur einige zu nennen –, eine ernsthafte Zuwendung verdienen und dass die Grenze, die normale von abnormer Liebe trennt, häufig schwer zu ziehen ist. Ich hoffe, dass diese Position von den folgenden, manchmal ziemlich beunruhigenden Enthüllungen gestützt wird – beunruhigend deshalb, weil sie letztendlich das Vorhandensein tief verwurzelter und universeller Verletzlichkeiten zeigen, die durch evolutionäre Prozesse in unserem Nervensystem verankert sind. Schon der kleinste Funke einer sexuellen Anziehung kann einen Brand entfachen, der das Potenzial hat, uns zu verschlingen. Wir alle tragen diese schlummernde Gefahr in uns, weshalb Beispiele ihrer vollen Ausprägung im klinischen Alltag so fesselnd und zugleich so alarmierend sind. Sie liefern uns einen guten Grund, über unsere eigenen intimen Erfahrungen nachzudenken, und warnen uns vor möglicherweise vor uns lauernden Gefahren.
Die Psychotherapie ist eine bekanntermaßen gespaltene Disziplin. Es gibt viele unterschiedliche Denkschulen (z. B. Psychoanalyse, Gestalt- und rational-emotive Therapie), und jede dieser Schulen wird von Galionsfiguren vertreten, deren spezieller Ansatz – auch wenn bestimmte fest umrissene Werte und Normen akzeptiert werden – vom Mainstream abweicht. Dieses Abweichen von der Orthodoxie reicht von kleineren Veränderungen der Theorie bis hin zu großen inhaltlichen Überarbeitungen. Die Geschichte der Psychotherapie ist gekennzeichnet durch interne Grabenkämpfe, Schismen, Abspaltungen und intellektuelle Feindseligkeit. Man kann sie sich als ein komplexes Baumdiagramm mit mehreren Stämmen vorstellen, in welchem jeder Stamm zahlreiche Äste und Verzweigungen hervorbringt. Dieser Prozess von Wachstum und immer neuen Verzweigungen erstreckt sich über einen Zeitraum von etwas mehr als hundert Jahren und setzt sich bis heute fort.
Für ein Buch dieser Art ist es üblich, dass es die theoretische Orientierung des Autors widerspiegelt. Normalerweise werden Symptome im Kontext der bevorzugten theoretischen Ausrichtung des Autors verstanden und interpretiert. Mir erscheint es jedoch unnötig limitierend, sich zu einer einzelnen Psychotherapieform zu bekennen, denn ich glaube, dass selbst die periphersten Innovatoren in der Geschichte dieser Fachrichtung etwas Wichtiges oder Nützliches über den Ursprung sowie den Umgang mit den Symptomen und deren Heilung zu sagen hatten. Daher werden die klinischen Beschreibungen in diesem Buch von Kommentaren begleitet, die sich auf viele unterschiedliche Perspektiven berufen.
Neben dem Umstand, dass Psychotherapeuten immer schon lebhaft ihre Meinungsverschiedenheiten untereinander ausgetragen haben, beteiligen sie sich jedoch auch als homogenere Gruppe an einem viel größeren, fortwährenden Streit mit Vertretern einer neurobiologisch orientierten Psychiatrie. Dabei geht es um die unterschiedliche Auffassung zum eigentlichen Ursprung von psychischen Erkrankungen. Die neurobiologische Perspektive basiert auf der Annahme, dass alle mentalen Erkrankungen von strukturellen oder chemischen Abnormitäten im Gehirn verursacht werden. Eine Begleiterscheinung dieser Annahme ist die Überzeugung, dass die Biologie als fundamentalere Wissenschaft die Psychologie übertrumpfe. Der unterschiedliche Stellenwert, der biologischen und psychologischen Erklärungsmodellen psychischer Erkrankungen beigemessen wird, polarisiert häufig die Sichtweisen, und die Kontrahenten beider Lager streiten üblicherweise engagiert und lautstark. Um es noch einmal zu sagen: Ich halte diese Debatte – in ihrer extremen Form – für ziemlich fruchtlos.
Selbst wenn jemand meint, dass alle Seelenzustände auf Zustände des Gehirns zurückzuführen sind, heißt das nicht, dass die Psychologie außer Kraft gesetzt wird, genauso wenig wie die Chemie von der Physik außer Kraft gesetzt wird. Fast alles auf der Welt kann auf verschiedene Art und Weise und auf verschiedenen Ebenen beschrieben werden, und das Seelenleben des Menschen macht da keine Ausnahme. Eine Vielzahl von Blickwinkeln ist aufschlussreich und liefert eine komplettere und zufriedenstellendere Betrachtung von Phänomenen. Folglich beinhalten meine Fallkommentare auch Referenzen zur biologischen Psychiatrie und zu den Neurowissenschaften.
Er war neunzehn, Philosophiestudent und erschien mit ungewaschenen Haaren und einem spärlich sprießenden Bart. Seine dunklen Ringe unter den Augen deuteten auf schlaflose Nächte hin, seine Kleidung roch nach Zigarettenrauch. Seine Freundin hatte ihn abserviert, und er zeigte viele der Symptome von Liebeskummer, wie sie seit Menschengedenken von Dichtern beschrieben werden. Seine Verzweiflung und seine Wut strömten in immer stärkeren Wellen aus seinem Körper.
»Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich verstehe es einfach nicht.« Ich registrierte, dass er mit dem Fuß ungeduldig auf und ab wippte. »Können Sie mir irgendeine Erklärung dafür geben?« Diese Betonung verwandelte eine unschuldige Frage in eine Kampfansage, die zudem leicht schnoddrig daherkam, so als hielte er mich für unfähig.
»Das hängt eher von Ihren Fragen ab«, gab ich zur Antwort.
Seine blassen Wangen bekamen etwas Farbe. »Worum geht es eigentlich? Ich meine … im Leben, in der Liebe. Worum geht es eigentlich?«
Die Liebe und das Leben sind eng miteinander verknüpft, denn es ist fast unmöglich, sich ein Leben ohne Liebe vorzustellen. Tatsächlich stellen wir, wenn wir Fragen zum Wesen der Liebe haben, auch sehr tiefgründige Fragen dazu, was es heißt, menschlich zu sein und wie man leben soll.
Mein junger Patient breitete die Arme aus und ließ sie in der Luft hängen: »Nun?«
Kapitel 1 Die Anwaltsgehilfin Liebe, die kein Nein akzeptiert
Wir hatten an den gegenüberliegenden Seiten eines kleinen Tisches auf zwei hochlehnigen Armsesseln Platz genommen. In Reichweite stand das unentbehrliche Accessoire des professionellen Psychotherapeuten: eine Box mit Zellstofftüchern – vielleicht das am wenigsten beeindruckende aller berufstypischen Utensilien. Ich habe unendlich viele Stunden meines Lebens damit zugebracht, Leuten beim Weinen zuzusehen.
Megan war Mitte vierzig, konservativ gekleidet, mit weichen, runden Gesichtszügen. Ihr Haar war dunkelbraun und zu einem akkuraten Bob geschnitten – die glatten Seiten rollten sich unter ihrem Kinn nach innen. Ihr Gesicht war freundlich. Im Ruhezustand bewahrten ihre Gesichtszüge ein leises, unterwürfiges, unsicheres Lächeln. Ihr Rocksaum reichte ein gutes Stück weit unter die Knie, und ihre Schuhe gehörten zur Sorte »zweckmäßig«. Eine lieblose Person hätte Megan vielleicht als graue Maus bezeichnet.
Ihr Hausarzt hatte mir eine Überweisung geschickt und die Eckdaten ihres Falles zusammengefasst. Überweisungen (normalerweise auf Band diktiert und dann von einer Sekretärin abgetippt) sind neutral gehalten. Die kurzen, knappen Sätze ersticken oftmals die Tragik, die sich dahinter verbirgt. Name, Alter, Adresse, Sachverhalt. Megans Geschichte hatte allerdings ihre theatralische Glut bewahrt. Dem stichpunktartigen Bericht des Hausarztes war es nicht gelungen, die wichtigen Elemente einer tragischen Liebesgeschichte einzufrieren: emotionale Extremsituation, rücksichtslose Hingabe, Leidenschaft und Begehren.
Bevor Megan mein Sprechzimmer betrat, hatte ich die Überweisung gelesen und mich natürlich gefragt, wie sie wohl aussehen würde. Vor meinem geistigen Auge entstand augenblicklich die passende Heldin für einen Liebesroman. Ich hatte mir eine schlanke, hochgewachsene Frau mit wilder Mähne und gehetztem Blick vorgestellt. Ich muss zugeben, ich war ein wenig enttäuscht, als Megan hereinkam.
Auf gewisse Art und Weise treffen alle Klischees zu, und die äußere Erscheinung kann ausgesprochen trügerisch sein. Wenn wir uns das erste Mal begegnen, sehen wir einander nicht wirklich. Es bedarf schon eines sehr genauen Blickes, um zu erkennen, mit wem wir es tatsächlich zu tun haben. An diesem ersten Treffen sah ich nur eine Anwaltsgehilfin. In Wirklichkeit war die Frau, die da vor mir saß, viel exotischer, aber ich war nicht in der Lage, über die Barriere meiner eigenen Vorurteile hinwegzusehen.
Nach ein paar einleitenden Bemerkungen erklärte ich, dass ich die Überweisung ihres Arztes gelesen hatte, aber trotzdem ihre eigene Version der Dinge hören wollte.
»Das ist schwierig«, sagte sie.
»Ja«, nickte ich. »Bestimmt haben Sie Recht.«
»Ich kann Ihnen Begebenheiten erzählen«, fuhr sie fort. »Ich kann Ihnen erzählen, was geschehen ist, aber es ist so schwierig auszudrücken, wie es in mir aussieht.«
»Wir haben es nicht eilig«, gab ich zur Antwort. »Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.«
Abgesehen von einigen leichten depressiven Episoden hatte Megan noch nie an irgendwelchen signifikanten psychologischen Problemen gelitten. »Meine Depressionen waren nie sehr schwer«, sagte sie. »Ich meine, nicht so schwer wie bei einigen Leuten, die ich kenne. Nur manchmal hatte ich so meine Mucken, aber das ist auch schon alles. Und nach ein paar Wochen war alles wie weggeblasen, und es ging mir wieder gut.«
»Können Sie sagen, was das ausgelöst haben könnte?«
»Die Anwälte, für die ich arbeite, verlangen oft viel von einem. Vielleicht war es der Stress.«
Ich nickte mitfühlend und machte mir ein paar Notizen.
Megan war seit zwanzig Jahren verheiratet. Ihr Mann Philip war Buchhalter, und sie waren immer glücklich miteinander gewesen. »Wir haben keine Kinder«, sagte sie unaufgefordert. »Es ist nicht so, dass wir von vornherein keine Kinder haben wollten – nur war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Wir haben es immer wieder zurückgestellt, bis es irgendwann kein Thema mehr war. Manchmal frage ich mich, wie es wohl gewesen wäre, Kinder zu haben, eine Mama zu sein. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich mir deshalb ein Leben lang Vorwürfe machen würde. Ich glaube nicht, dass ich etwas verpasst habe. Und ich bin sicher, dass Phil das genauso sieht.«
Zwei Jahre zuvor hatte Megan einen Zahnarzt aufsuchen müssen, der auf komplizierte Eingriffe spezialisiert war.
»Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Zusammentreffen mit ihm?«
»Mit Daman?« Dass sie den Vornamen ihres Zahnarztes nannte, war ein wenig ungewöhnlich. An und für sich war es nicht weiter von Bedeutung, aber in ihrem Fall schon.
»Mit Mr Verma.« Ich korrigierte sie nicht, sondern stellte nur sicher, dass wir über dieselbe Person sprachen.
Sie sah mich fragend an, und ich ermunterte sie mit einer kleinen Geste, fortzufahren. »Er untersuchte mich, sagte, dass ich mir den Zahn ziehen lassen sollte – und ich ging nach Hause.«
»Fanden Sie ihn attraktiv? Haben Sie irgendetwas gefühlt?«
»Ich fand, dass er ziemlich gut aussah. Er hatte eine angenehme Art. Aber …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Sehen Sie, genau deshalb ist es so schwierig. Diese Dinge sind so schwer zu beschreiben. Vielleicht habe ich etwas gefühlt – gleich von Anfang an. Ja. Vermutlich schon. Ich wusste einfach nicht, was da passierte. Ich war durcheinander.«
Ich registrierte eine gewisse Anspannung in ihrer Stimme. »Schon gut …«
Daman Verma führte die Operation durch. Es gab keine Probleme, und alles lief nach Plan. Als die Vollnarkose nachließ und Megan aufwachte, hatten sich ihre Gefühle verändert. »Ich registrierte, dass Menschen um mich herum waren – die beiden Assistentinnen … Es gab Geräusche, Stimmen. Ich öffnete die Augen, schaute in ein Licht an der Zimmerdecke, und ich weiß noch, dass ich dachte: ›Ich muss ihn sehen.‹ Ich hatte keine Angst und war auch nicht besorgt. Ich wollte nicht wissen, wie die Operation gelaufen war. Alles, was ich wollte, war, ihn zu sehen.«
»Warum?«
»Ich hatte nur einfach dieses … Bedürfnis. Es kam mir – keine Ahnung – notwendig vor.«
»Wollten Sie ihm etwas sagen?«
»Nein. Ich wollte ihn einfach nur sehen.«
»Ja, aber warum?« Ich wollte ihr eine präzisere Antwort entlocken, aber entweder wollte oder konnte sie mir keine geben.
Der Zahnarzt wurde geholt, und er kam in den Aufwachraum. Er nahm Megans Hand und sagte ihr vermutlich ein paar beruhigende Worte. Daran konnte sie sich nicht erinnern, weil sie nicht wirklich zuhörte. Sie war vollkommen hingerissen von seinem Gesicht, das sie als unnatürlich schön empfand, ein Gesicht, das in ihren Augen die edelsten Tugenden von Männlichkeit ausdrückte – Stärke, Kompetenz, Leistung –, und sie entdeckte in seinen Augen etwas ganz Außergewöhnliches, etwas, das so unerwartet war, dass sie fast nach Luft schnappen musste: Gemeinsamkeit, Wechselseitigkeit. Er begehrte sie ebenso sehr, wie sie ihn begehrte. Das war offensichtlich. Warum hatte sie es nicht früher bemerkt? Als er sich verabschieden wollte, packte sie seine Hand ein wenig fester. Er wirkte verlegen. Natürlich musste er verlegen sein. Er konnte seine Gefühle nicht zeigen, nicht dort, nicht vor den Assistentinnen. Er konnte ihr im Aufwachraum doch keine Liebeserklärung machen! Er musste an seinen Ruf denken, er war schließlich der Chef. Es rührte sie, wie er schauspielerte und linkisch versuchte, die Wahrheit zu verbergen. Sie ließ seine Finger los. Sie wusste mit absoluter Gewissheit, dass die Liebe, die sie füreinander empfanden, so stark, so absolut überwältigend war, dass sie ihr restliches Leben zusammen verbringen und sehr wahrscheinlich gemeinsam sterben würden.
Eine verzauberte Prinzessin wacht aus einem tiefen Schlaf auf und blickt in die Augen ihres Märchenprinzen. Diese Szene spielt im Märchen Dornröschen der Brüder Grimm; allerdings hatten die Brüder Grimm schon hundert Jahre zuvor mit Charles Perrault und seinem Märchen Die schlafende Schöne im Walde einen Vorgänger.
Ist es möglich, sich so schnell so heftig zu verlieben? Oder gibt es das nur im Märchen? Attraktivität wird innerhalb von Millisekunden beurteilt, und wenn die Beurteilung positiv ausfällt, setzen wir automatisch weitere Merkmale voraus. So gehen wir etwa davon aus, dass schöne Menschen liebenswerter, freundlicher und interessanter sind. Das ist ein gut dokumentiertes Phänomen, das Psychologen den Halo-Effekt nennen. Megan hatte jedoch etwas viel Tiefgreifenderes erlebt. Es ist wohl wenig wahrscheinlich, dass Fremde unmittelbar eine bedeutungsvolle und dauerhafte Bindung aufbauen können. Wie soll das überhaupt funktionieren? Die Partner kennen einander nicht. Und dennoch behauptet ein großer Teil der Durchschnittsbevölkerung, Liebe auf den ersten Blick schon erlebt zu haben, und viele liebestrunkene Paare bleiben auch tatsächlich zusammen. Einige Psychologen behaupten, dass es gewisse evolutionäre Vorteile bringt, wenn man sich sofort zueinander hingezogen fühlt. So findet etwa ein sexueller Kontakt früher statt, was bewirkt, dass weniger Gelegenheiten zur Reproduktion vergeudet werden. Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene an die nächste Generation weitergegeben werden, was gut für den Betreffenden (oder zumindest für seine Gene) ist und letztendlich der Spezies zugutekommt. Für Liebe auf den ersten Blick anfällig zu sein, könnte eine sehr fundamentale biologische Disposition darstellen.
Die Tatsache, dass Megan sich in dem Augenblick, als sie Verma kennen lernte, in ihn verliebte, mag nicht besonders bemerkenswert sein. Doch ihr starres Festhalten daran, dass ihre Gefühle erwidert würden, war etwas ganz anderes, und ihre Gewissheit ebenfalls. Menschen sprechen oft darüber, dass sie mit jemandem auf einer Wellenlänge liegen und die Gedanken des anderen kennen, doch nur wenige würden behaupten, dass sie insbesondere so kurz nach dem Kennenlernen genau über die Gedanken und Gefühle des Partners Bescheid wissen.
»Woher wussten Sie, dass Daman Verma sich in Sie verliebt hatte?«
»Ich wusste es einfach.«
»Ja, aber woher?«
»Ich wusste es einfach.«
Die Wiederholung dieses einfachen Satzes brachte das Gespräch ins Stocken. Bevor ich weitersprach, überlegte ich, wie ich am besten aus dieser Sackgasse rauskommen konnte. Seit Freuds Zeiten bedienen sich Psychotherapeuten gern einer Technik, die als sokratischer Dialog bekannt ist. Sie dient dazu, Vermutungen zu hinterfragen und Patienten anzuregen, kritischer zu denken. Der Dialog ist am erfolgreichsten, wenn er nicht interrogativ eingesetzt wird, sondern behutsam und indirekt. Der Ansatz entspricht einem Kleinod östlicher Weisheit, die empfiehlt: »Umschiffe Hindernisse, stelle dich ihnen nicht entgegen.«
»Wie kommt es wohl«, fragte ich, »dass wir manches glauben und anderes nicht?«
Megan sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, als wäre ich etwas begriffsstutzig. »Weil wir Gründe dafür haben …«
»Nun, welche Gründe hatten Sie? Welche Gründe hatten Sie zu glauben, dass Daman Verma sich in Sie verliebt hatte?«
»Das kann man nicht analysieren.«
»Vielleicht haben Sie Recht. Aber ich würde trotzdem gern ein wenig darüber sprechen. Nur um festzustellen, ob wir etwas daraus lernen können.«
Megan schwieg. Manchmal senkt sich eine Stille über eine Therapiestunde, die die Zeit anzuhalten scheint. Alles wird still. So still, dass schon eine Frage zu stellen, plump und zwanghaft erscheint. Ich setzte mich zurecht. Dieses einfache Mittel brach den Bann, und die Erde drehte sich weiter.
»Ich konnte es in seinen Augen sehen.«
»Was konnten Sie sehen?«
»Diese Not. Die Augen eines Menschen verraten einiges, ist es nicht so?« Aus der Defensive heraus klang ihre Stimme spröde.
»Wir interpretieren ständig den Gesichtsausdruck anderer Menschen. Aber können wir wirklich erkennen, was jemand denkt, wenn wir ihn nur ansehen?«
»Nicht immer.«
»Sie waren Daman Vermas Patientin, und Sie haben ihn holen lassen. Ist es möglich, dass Sie seinen Gesichtsausdruck falsch interpretiert haben? Dass das, was Sie gesehen haben, eher Fürsorglichkeit oder Sorge ausgedrückt hat?«
»Was ich gesehen habe, war viel bedeutungsvoller. Es heißt ja, dass es einen ganz speziellen Blick gibt – wenn Sie wissen, was ich meine – den Blick der Liebe …«
Es stimmt, dass vom Blick der Liebe gesprochen wird. Was damit aber eigentlich gemeint ist, nennen Wissenschaftler den »kopulatorischen Blick«. Man schaut sich ein paar Sekunden lang tief in die Augen, bis einer der Partner den Blick abwendet. Das passiert, wenn potenzielle Liebespaare einander zum ersten Mal treffen, und dieser intensive, forschende Blick signalisiert üblicherweise sexuelles Interesse. Menschenaffen verhalten sich ähnlich.
»Und da sind Sie sich sicher.«
»Ja.«
»Es gibt keine andere Erklärung?«
»Nein, eigentlich nicht …«
»Es war in seinen Augen.«
»Ich weiß, was ich gesehen habe.« Sie hob die Hände, drehte die Handflächen nach außen und schenkte mir ein bedauerndes Lächeln. Was sollte sie auch sagen?
Tatsächlich lag in Vermas Augen nichts Außergewöhnliches. Nicht einmal der leiseste Schimmer von Verlangen. Megan war nur eine Patientin von vielen. Er war ein vielbeschäftigter Zahnarzt, der mit mehreren medizinischen Einrichtungen kooperierte und eine große Privatpraxis leitete. Er sah es so: Sie hatten einander kennen gelernt, er hatte sie operiert, und nun würden sich ihre Wege trennen. Als er den Aufwachraum verließ, war er vermutlich vernünftigerweise davon ausgegangen, dass er sie abgesehen von ein paar Nachsorgeterminen nicht mehr wiedersehen würde. Aber falls er das tatsächlich gedacht hatte, sollte sich seine Annahme zu gegebener Zeit als falsch herausstellen. Als sehr falsch.
»Ich musste ständig an ihn denken. Und ich spürte, dass er auch an mich dachte.«
»Was meinen Sie mit spürte …?«
Megan ignorierte meine Frage. »Es war so unfair. Wir beide wollten zusammen sein, aber er fand keine Lösung, wie er mit seiner Situation umgehen sollte.«
»Wenn er wirklich mit Ihnen hätte zusammen sein wollen, hätte er da nicht seine Frau verlassen?«
»Nein. Er ist ein guter Mensch – ein wirklich guter Mensch. Er wollte ihre Gefühle nicht verletzen.«
»Hat er Ihnen das jemals gesagt?«
»Das brauchte er gar nicht.« Sie sah mich erschöpft an. Es war offensichtlich, dass sie sich nicht abermals rechtfertigen wollte. Selbst der sokratische Dialog kann ermüdend sein.
Nach ihrer Operation war Megan wie besessen von Verma, Tag und Nacht. Sie schlief schlecht, und wenn sie zur Arbeit ging, konnte sie sich nicht konzentrieren. Sie verzehrte sich danach, in seiner Nähe zu sein.
»War es eine sexuelle Anziehung?«
»Nein«, protestierte sie. Dann seufzte sie. »Ja, auch. Das gehörte auch dazu. Aber nur zu einem kleinen Teil. Sex, das ist irreführend. Ich meine, wenn es uns möglich gewesen wäre, zusammen zu sein, und körperlich wäre nichts passiert, hätte das keine Rolle gespielt. Nicht wirklich. Wir wären dennoch verrückt nacheinander gewesen.«
Ihr Mann hatte registriert, dass sich ihre Stimmung eintrübte. Es gab keinen offensichtlichen Grund. Er versuchte mit ihr zu reden, doch sie war distanziert und zog sich zurück.
Wochen vergingen.
Megans Verlangen, mit Verma in Verbindung zu treten, wurde mit jedem Tag größer. Die Trennung von ihm wurde unerträglich, und das empfand sie als Folter. Sie brachte den Mut auf, ihn anzurufen. »Es war eine seltsame Unterhaltung. Ich gab ihm die Möglichkeit, mir zu sagen, was er für mich fühlte, aber er hatte offensichtlich Angst. Dieses Erlebnis war zu überwältigend für ihn.«
»Worüber haben Sie gesprochen?«
»Zuerst sprachen wir über meine Genesung – wie es damit stand. Irgendwann musste ich dann etwas direkter werden. Ich schlug ihm vor, sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen, damit wir uns darüber unterhalten konnten, wie es weitergehen soll. Temple ist ja nicht allzu weit von der Harley Street entfernt. Ich sagte, dass ich mir ein Taxi nehme.«
»Und wie hat er reagiert?«
»Er tat so, als hätte er nicht verstanden. Ich ließ nicht locker, aber er wich ständig aus. Dann erfand er irgendeine Ausrede und legte auf.«
»Er hatte Angst vor seinen eigenen Gefühlen und musste das Gespräch beenden.«
»Genau …«
»Ist das die einzige Interpretation?«
Sie zuckte die Achseln.
Megan ließ sich nicht entmutigen. Sie rief Verma wiederholt an, manchmal mehrmals am Tag. Die Zahnarzthelferinnen reagierten immer frostiger und forderten sie auf, dies zu unterlassen. Nachdem sie ein wenig Detektiv gespielt hatte, gelang es ihr, an seine private Telefonnummer zu kommen. Als seine Frau Angee das Gespräch annahm, tat Megan ihr Bestes, ihr die Situation so mitfühlend wie möglich zu erläutern – denn das hätte Daman so gewollt –, aber die Frau des Zahnarztes reagierte gereizt.
»Sie sagte, ich sollte mir Hilfe holen.«
»Wie haben Sie das aufgenommen?«
»Ich hatte es erwartet.«
»Sie konnten also erkennen, wie Ihr Verhalten auf andere wirkte.«
»Verrückt, meinen Sie?«
»Das habe ich nicht gesagt.« Ich war nicht aufrichtig. Tatsächlich hatte ich es genau so gemeint.
»Ja«, nickte sie. »Ich habe erkannt …«
»Hat Sie das nicht doch zum Nachdenken gebracht – darüber, was Sie da eigentlich tun?«
»Für mich war es nicht wichtig, was andere Leute denken.«
»Und wie ist es jetzt? Ist es Ihnen jetzt wichtig?«
Wir starrten uns über den kleinen Tisch hinweg an.
Megan schrieb täglich Briefe an Verma; lange, ausschweifende Briefe, in denen sie Lösungsmöglichkeiten vorschlug, ihn inständig bat einzusehen, dass ihre Liebe weder ignoriert noch verraten werden könnte. Er würde erst glücklich werden, wenn er die Wahrheit akzeptierte. Welchen Sinn sollte es haben, sich etwas anderes vorzumachen? Ihn träfe keine Schuld, keinen von ihnen traf eine Schuld, wie denn auch? Etwas Bedeutungsvolles sei geschehen, etwas Wunderbares und Wundersames, und nun gebe es kein Zurück mehr. Sie müssten den Mut haben und ihre gemeinsame Zukunft in die Hand nehmen. Ihr Leben würde nicht mehr so sein wie vorher. Und sollten sie versuchen, voneinander getrennt weiterzuleben, wären sie nur noch Schatten ihrer selbst, elend und unvollständig. Und nicht nur ihrer beider Zukunft stünde auf dem Spiel. Sie müssten auch an die Zukunft ihrer Ehepartner denken. Es sei nicht richtig, Philip und Angee zu hintergehen und immer weiterzulügen. Die beiden wären gute Menschen und hätten etwas Besseres als eine Scheinehe verdient.
»Ich habe vor seiner Praxis gewartet. Stundenlang. Und wenn er herauskam, lief ich zu ihm hinüber.«
Sie unterbrach sich und biss sich auf die Unterlippe.
»Was ist passiert?«
»Er wollte nicht reden. Ich sagte ihm, dass ich verstehe, dass alles so schnell passiert ist, dass er vielleicht mehr Zeit braucht. Aber schließlich sagte ich zu ihm: Du wirst dich damit abfinden müssen, dass es einfach so ist.«
Dr. Verma setzte sich mit Megans Hausarzt in Verbindung, der noch am selben Tag mit Megans Ehemann Kontakt aufnahm.
»Was hat Philip gesagt, als er erfahren hat, was Sie da machen?«
Megan schaute zur Zimmerdecke und legte ihre Finger über den Mund. Ihre Worte kamen gedämpft, aber immer noch hörbar: »Er war nicht sehr glücklich.«
Was war mit Megan los? Bevor sie Daman Verma kennen lernte, war ihr Leben ziemlich ereignislos verlaufen – eine feste Anstellung, Urlaub und Hobbys, das geregelte Zusammenleben mit ihrem Ehemann. All das hatte sich plötzlich verändert.
Megan litt an einer seltenen, aber gut dokumentierten Geisteskrankheit, an dem De-Clérambault-Syndrom, das 1921 zum ersten Mal vom französischen Psychiater Gaëtan de Clérambault ausführlich beschrieben wurde. Typischerweise verliebt sich die betroffene Person, meistens eine Frau, in einen Mann (mit dem sie wenig oder keinen vorherigen Kontakt hatte) und gelangt zu der Überzeugung, dass auch er leidenschaftlich in sie verliebt sei. In vielen Fällen behauptet die Kranke, dass es der Mann sei, der sich als Erster verliebt hätte. Diese Wahrnehmung tritt in Abwesenheit irgendeines tatsächlichen Stimulus oder einer Ermunterung auf. Der Mann – manchmal auch als Opfer oder Objekt bezeichnet – ist oft älter, von höherem gesellschaftlichem Status oder eine berühmte Persönlichkeit. Seine Unerreichbarkeit kann als Ansporn dienen. Im Folgenden setzt eine unglückselige Verfolgung ein, die vom Opfer als extrem belastend erlebt wird. Das De-Clérambault-Syndrom kann auch bei Männern auftreten, obwohl Frauen sehr viel anfälliger dafür sind. Das genaue Verhältnis ist nicht bekannt, doch vermutlich liegt es bei drei zu eins.
Das De-Clérambault-Syndrom (oder etwas, was ihm sehr ähnelt) wird seit Jahrhunderten beschrieben; vergleichbare Fälle sind in Werken zu finden, die bis in die Zeit der Antike zurückreichen. Im engeren Sinne beschritt de Clérambault, als er 1921 darüber schrieb, also keine neuen Wege, sondern widmete sich einem Leiden, das seit alters her als Liebeswahn bekannt war. Dennoch ist es sein Name, der insbesondere in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders eng mit der unumstritten führenden Erkrankung auf dem Gebiet der Liebe verknüpft wird. Vielleicht liegt es daran, dass seine Beschreibung umfassender war, zumal er sowohl emotionale wie auch sexuelle Aspekte dieses Zustands hervorhob. So wurden im 18. Jahrhundert Erotomanen beispielsweise als Menschen bezeichnet »die ungehemmt einem freizügigen oder verbotenen Lustgewinn frönen«.
Heutzutage werden die Begriffe De-Clérambault-Syndrom und Liebeswahn beliebig verwendet. Irgendwann wurde diesem Zustand die wenig schmeichelhafte Benennung »Old maid’s insanity« (»Alte-Jungfern-Wahnsinn«) aufgedrückt. In modernen Diagnoseklassifikationen wird es nun Wahnhafte Störung: Erotomanie genannt. Dennoch spukt de Clérambault immer noch in den Randbereichen der Psychiatrie herum, und viele nennen die Krankheit statt der korrekteren modernen Form weiterhin das »De-Clérambault-Syndrom«, vielleicht auch deshalb, weil es sich angenehmer und irgendwie dramatischer anhört. Es erinnert an eine aufregende Zeit in der Vergangenheit, als die Seele noch ein dunkler Kontinent und großteils unerforscht war.
De Clérambaults berühmtester Fall war eine 53-jährige französische Kleidermacherin, die überzeugt war, dass König Georg V. sie liebte. Mehrmals reiste sie nach England, um ihm nachzustellen, und wartete vor dem Buckingham Palast. Wenn sich dort ein Vorhang bewegte, schloss sie daraus, dass der König ihr Signale sandte. Die Tatsache, dass der König nicht sehr entgegenkommend war, konnte den Glauben der Kleidermacherin nicht erschüttern. Sie erklärte es so, dass er sich in einem Zustand der Verleugnung befand: »Der König mag mich hassen, aber er kann niemals vergessen. Ich könnte ihm niemals gleichgültig sein, und er mir auch nicht.«
Abgesehen davon litt die Kleidermacherin an einer Zweiterkrankung, einer paranoiden Psychose. So glaubte sie, dass der König sich manchmal in ihre Angelegenheiten einmischte. Das De-Clérambault-Syndrom hängt oft mit Zuständen wie Schizophrenie oder einer bipolaren Störung zusammen. Was Megan so interessant machte, war ihre Durchschnittlichkeit. Weder ihr Leben, noch ihr Charakter oder ihre Vergangenheit ließen auch nur andeutungsweise auf das schließen, was folgen sollte. Sie war ein Beweis dafür, dass wir alle auf einem Drahtseil balancieren, wenn es um geistige Gesundheit geht, und dass es nicht allzu viel braucht, um das Gleichgewicht zu verlieren und abzustürzen.
Abgesehen davon, dass de Clérambault für seine Verdienste im Ersten Weltkrieg mit verschiedenen militärischen Orden ausgezeichnet wurde, war er auch ein gefeierter Künstler. Einige seiner Gemälde hängen in französischen Museen. Seine originellste Arbeit ist eine Reihe fotografischer Studien mit verschleierten Frauen. Während seines Einsatzes in einem Militärkrankenhaus in Nordafrika entdeckte er die traditionelle marokkanische Kleidung und begeisterte sich für Stoffe als künstlerische Ausdrucksform. Für einen traditionellen Freudianer wären die symbolischen Implikationen eines solchen Interesses bestimmt aufschlussreich: Verhüllung, Verlockung, Auspacken und das Versprechen der Enthüllung. Es sind fremdartige, frappierende Bilder, die entfernt an die viktorianische Post-mortem-Fotografie erinnern und bis vor Kurzem von Kulturhistorikern kaum wahrgenommen wurden.
Nach zwei erfolglosen Operationen am Grauen Star setzte sich de Clérambault 1934 vor einen Spiegel und erschoss sich mit seinem alten Armeerevolver. Die Kamera war auf sein Spiegelbild gerichtet.
Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er sein Verhalten zu erklären versuchte. Es gab Vermutungen, ein Gemälde, das er dem Louvre vermachen wollte, sei in betrügerischer Absicht veräußert worden. Er sei entehrt worden und infolgedessen in eine Depression gefallen. Tatsächlich war eine mögliche Erblindung der wahrscheinlichste Auslöser. Jahrelang hatte er Menschen aus zwei Perspektiven studiert – mit dem Blick eines Künstlers und dem eines Psychiaters. Er war in der Lage, jede Bahn, jede Falte und jeden Knitter des gesellschaftlichen Gewebes zu bemerken und zu bestimmen, was darunter verborgen lag. Ein Leben ohne diese besonders ausgeprägte Fähigkeit der Wahrnehmung war für ihn nicht lebenswert. Er muss sich sehr genau betrachtet haben, als er abdrückte. Ich wüsste gern, was er gesehen hat.
»Wie hat Philip reagiert?«
»Er war verärgert. Aber er beschimpfte mich nicht – er warf mir nicht vor, ihn betrogen zu haben. Wir redeten, und ich versuchte es zu erklären, aber er verstand es nicht. Nicht wirklich. Er sagte mir, dass er mich liebe – und dass er immer für mich da sein würde. Es war traurig.«
»Weil Sie ihn nicht mehr liebten …«
Megan starrte mich entgeistert an. »Nein, nein. Ich habe Phil immer geliebt. Es ist nur das, was ich für Daman fühle …« Ihre Stimme verlor sich, und sie schaute sich im Zimmer um, als wäre ihr etwas abhandengekommen. Dann verhärteten sich ihre Gesichtszüge, und sie starrte mich mit einem direkten, irritierenden Blick an. »Es ist etwas anderes – etwas Höheres.«
»Eher Spirituelles?«
»Ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich zu Gott stehe. Aber was ich weiß, ist, dass es sich anders anfühlt als die Liebe zu Phil: stärker, tiefer, so etwas wie eine Vorsehung.«
»Schicksalhaft?«
»Ja, das ist das Wort. Schicksalhaft …«
Megans Mann ging mit ihr zu einem Psychiater, der sie auf Pimozid setzte, ein Antipsychotikum, das die Dopaminrezeptoren im Gehirn blockiert und so zur Reduzierung von Wahngedanken führt. Die Aktivität des Neurotransmitters Dopamin wird mit zahlreichen Verhaltensaspekten in Verbindung gebracht, vom Erinnern bis zum Erbrechen, doch gibt es auch eine starke Beweislage, die zeigt, dass Dopamin auch für Vergnügen und die Sucht nach Vergnügen verantwortlich ist. Es überrascht nicht, dass es vermutlich eine wichtige Rolle beim Entstehen von Suchtkrankheiten spielt. Der dopaminerge Kreislauf des Gehirns wird auch mit biologischen Vorgängen in Zusammenhang gebracht, mit dem, was wir Liebe nennen.
Megan nahm ihr Medikament wie vorgeschrieben ein, obwohl sie nicht überzeugt war, dass ihre Liebe zu Verma das Symptom einer Krankheit sei, wie der Psychiater angedeutet hatte. Das Medikament zeigte keinerlei Wirkung. Sie fühlte sich unverändert. Also wurde die Dosis erhöht – und eine Wirkung blieb weiterhin aus. Es war sogar so, dass Megans Verlangen eher noch zunahm. Sie wartete noch häufiger vor der Praxis des Zahnarztes. Manchmal sah er sie und schickte seine Assistentin mit einer Botschaft hinaus: Gehen Sie nach Hause. Megan diskutierte nicht mit ihr. Warum auch? Sie lächelte, nickte und machte sich wieder auf den Weg zur U-Bahn. Es spielte keine Rolle, nicht, wenn man das Große und Ganze betrachtete: Am Ende würde ihre Geduld belohnt werden. Oft entzog sie sich Vermas Entdeckung dadurch, dass sie sich in einer Toreinfahrt verbarg oder sich hinter einen geparkten Kombi stellte. Dann konnte ihre Wache den ganzen Tag andauern. In den Wintermonaten, auch bei einem Kälteeinbruch, spendete ihr schon allein das Wissen, dass sie Verma in der Nähe wusste, Wärme.
Einmal beobachtete sie an einem Spätnachmittag gegen fünf Uhr, dass er die Praxis verließ, und folgte ihm nach Hause. Sie stand unter einem Laternenpfahl auf der anderen Straßenseite und stellte sich ihn im Haus vor. Als seine Frau Megan entdeckte, als sie zufällig aus einem Fenster im oberen Stockwerk gesehen hatte, stürmte Daman aus dem Haus und stellte Megan zur Rede. Er war wütend und drohte damit, die Polizei zu holen. Megan hielt sein Auftreten für nicht authentisch. »Er tat das nur seiner Frau zuliebe. Tief in seinem Herzen wollte er aber, dass ich da war.« Megan leistete keinen Widerstand. Immer wenn sie nach Hause geschickt wurde, gehorchte sie, doch mittlerweile machte ihr Verhalten alle – und ganz besonders Vermas Frau Angee – nervös. Sie hatten zwei Kinder, einen Jungen von acht und ein Mädchen von zehn Jahren, und Angee sorgte sich um deren Sicherheit. Es ist Daman Verma besonders hoch anzurechnen, dass er nie die Polizei rief. Er erkannte, dass Megan krank war und sich entsprechend verhielt. Seine Frau zeigte allerdings weniger Verständnis.