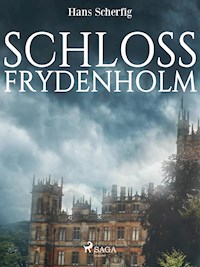Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Der verschwundene Kanzleirat" schildert Scherfig das unerfüllte Leben des Kanzleirates Teodor Amsted, der nach außen hin ein Vorbild an Fleiß und Pflichterfüllung abgibt, heimlich aber alles versucht, um dem regelgebundenen Alltag als Beamter und Familienvater zu entfliehen. Durch die dramatische Flucht Amsteds beschreibt der Autor dessen unterdrückte Wünsche, die im Unterbewusstsein wachsen und wuchern und sich im Treffen mit der Natur und den Menschen, die in ihr leben, langsam aber sicher an die Oberfläche graben.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Scherfig
Der verschwundene Kanzleirat
Saga
Der verschwundene Kanzleirat Übersetzt vonRuth Stöbling Originaltitel Den forsvundne fuldmægtigCopyright © 1992, 2019 Hans Scherfig and und SAGA EgmontAll rights reservedISBN: 9788711842812
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Der Autor:
Der dänische Schriftsteller und Maler Hans Scherfig (1905-1979) erfreut sich in einer Heimat großer Popularität. Das liegt zum einen an seinen satirischen Kriminalromanen - die auch in mehrere Sprachen übersetzt wurden –, zum anderen an den großen Zeitromanen "Idealisten" und "Schloß Frydenholm", in denen Scherfig schonungslos die schmähliche Kapitulation der dänischen bürgerlichen Gesellschaft vor den deutschen Nazis beschreibt.
Bei GRAFIT sind außer dem vorliegenden Buch von Hans Scherfig bisher erschienen:
"Der versäumte Frühling", Krimi; "Schloß Frydenholm", Politthriller.
In Vorbereitung: "Der tote Mann", Kriminalroman.
Erster Teil
1
Anfang Oktober vorigen Jahres verschwanden in Kopenhagen zwei Männer. Ihr Verschwinden wurde der Polizei im Abstand von wenigen Tagen gemeldet. Sonst gab es zwischen den beiden Vermißten offensichtlich keinen Zusammenhang.
Der eine war ein Einsiedler und Sonderling, der in äußerst schwierigen finanziellen Verhältnissen lebte. Der andere ein Familienvater und Beamter, in jeder Beziehung gesichert und versorgt. Lebensweise und Charakter der beiden waren so verschieden wie nur denkbar.
Wenn die Polizei die beiden Fälle dennoch miteinander in Verbindung brachte, lag dies vor allem daran, daß es hier wie dort nicht möglich war, auch nur den geringsten Grund für das Verschwinden zu ermitteln. Ein anderer Umstand, der der Polizei auffällig erschien, war die Gleichaltrigkeit der beiden. Sie waren im selben Jahr geboren. Daß man dieser Kleinigkeit Beachtung geschenkt hatte, mochte wie ein Zufall aussehen, trug jedoch zur Aufklärung bei.
Es konnte ziemlich schnell ermittelt werden, daß zumindest einer der beiden Männer auf eine unheimliche und befremdende Weise Selbstmord begangen hatte. Aber es dauerte eine Zeitlang, bevor man herausbekam, welcher der beiden es war. Erst als der Abschiedsbrief des Selbstmörders eintraf, ließ sich die Identität des Toten feststellen, der auf dem Amager fælled gefunden worden war.
Daß die Polizei erst etliche Tage nach dem Selbstmord von diesem Abschiedsbrief Kenntnis erhielt, lag ausschließlich an dem Ordnungssinn und dem Pflichtgefühl eines Ministerialrats im Kriegsministerium. Man kann einem Beamten seinen Ordnungssinn nicht zum Vorwurf machen. Doch im vorliegenden Fall wurde aus diesem ungewöhnlichen Grund die Arbeit der Polizei und die Aufklärung der Affäre verzögert und erschwert.
Aber auch nachdem der erwähnte Abschiedsbrief bekannt war, blieb vieles dunkel und unerklärlich. Die Polizei brauchte fast ein ganzes Jahr, bis der Fall als endgültig geklärt betrachtet werden konnte. Man arbeitete in aller Stille mit dem vorliegenden, sehr dürftigen Material. Es war eine äußerst gewissenhafte und sorgfältige Arbeit, bei der kein noch so geringfügiger Umstand außer acht gelassen wurde. Einige anscheinend völlig bedeutungslose Hinweise, die die Polizei von Privatpersonen erhielt – vor allem von einem Friseur aus Nordseeland und von einem ehemaligen Oberstudienrat der Metropolitanschule –, erwiesen sich als von entscheidender Bedeutung.
Es war eine der schwierigsten Aufgaben, vor der die Polizei je gestanden hatte. Als das Ergebnis vorlag, rief es sowohl eine Sensation als auch allgemeine Bewunderung hervor. Und es hatte sicherlich seine Richtigkeit, wenn die Zeitungen schrieben, die Aufklärung dieses höchst sonderbaren Falles sei der vorbildlichen Organisation und der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen der Polizei zu verdanken.
In diesem Zusammenhang war sicherlich auch der neugeschaffene einheitliche Polizeiapparat von entscheidender Bedeutung.
2
Die erste Anzeige erhielt die Polizei von Frau Amsted.
Sie rief abends gegen acht im Polizeipräsidium an. Ihr Mann, Kanzleirat Teodor Amsted, war noch nicht aus dem Büro zurückgekehrt. Er pflegte sonst immer genau zwanzig Minuten nach fünf nach Hause zu kommen. Er war ein sehr pünktlicher Mann. Er verließ das Büro in dem roten Ministerialgebäude um fünf Uhr. Und für den Nachhauseweg bis zu seiner Wohnung auf Gammelholm brauchte er genau zwanzig Minuten. Er nahm stets den kürzesten Weg und behielt ein zügiges, gleichbleibendes Tempo bei.
Er legte darauf Wert, mitten auf die Gehwegplatten zu treten und die dazwischenliegenden Fugen zu meiden. Es war auch wichtig, daß er auf bestimmte Gullydeckel trat, die es auf seinem Weg gab. Und wenn es doch einmal vorkam, daß er, in Gedanken versunken, diese Pflicht vergaß, konnte er sich umdrehen, zurückgehen und fest auf den Gullydeckel treten. Er war ein Pflichtmensch und fühlte sich nicht wohl, wenn er versäumte, was er zu tun hatte.
Nur wenn das Wetter sehr schlecht war, fuhr er mit der Straßenbahn. Zeitlich gesehen machte das jedoch keinen Unterschied. Die Straßenbahnlinien lagen so unpraktisch. Er konnte nur zwei Haltestellen weit fahren. Er stieg bei dem Standbild Niels Juels aus und mußte dann die ganze Niels-Juelsgade und auch noch ein Stück die Herluf-Trollesgade hinuntergehen.
Frau Amsted hatte natürlich auch in der Dienststelle ihres Mannes angerufen. Und ein Regierungsassessor, der Überstunden machte, konnte ihr mitteilen, daß Kanzleirat Amsted bereits gegen zwei Uhr gegangen war. Er hatte einen Brief erhalten, der ihn offensichtlich stark beeindruckte. Der Kanzleirat war sehr nervös gewesen und hatte seine braune Aktenmappe und seinen Spazierstock vergessen.
Diese Auskunft verängstigte Frau Amsted sehr. Und nachdem Stunde um Stunde verging, wußte sie sich keinen anderen Rat, als die Polizei anzurufen.
Selbst wenn etwas Außergewöhnliches passiert war, hätte ihr Mann doch zu Hause anrufen können. Er hatte niemals Geheimnisse vor ihr gehabt. Ihre Ehe war vollkommen glücklich. Es war ganz undenkbar, daß einer von ihnen allein ausging. In den achtzehn Jahren ihrer Ehe waren sie unzertrennlich gewesen. Sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wer ihrem Mann geschrieben haben mochte und warum der Brief an das Ministerium statt an die Adresse in der Herluf-Trollesgade gerichtet worden war.
Daß es eine andere Frau geben sollte, die er kannte und mit der er im Briefwechsel stand, ohne daß Frau Amsted etwas davon wußte, war völlig ausgeschlossen. Sie wußte alles über ihren Mann. In seinem Leben, in seiner Seele und an seinem Körper gab es nichts, was sie nicht kannte und kontrollierte.
»Ja, ja, warten wir erst einmal ab«, sagte man im Polizeipräsidium. Wenn er überfahren oder anderswie zu Schaden gekommen wäre, hätte man davon durch die Feuerwehr oder den Rettungsdienst Falck erfahren. Weder in den Krankenhäusern der Stadt noch der Umgebung war ein Verletzter eingeliefert worden, der Teodor Amsted hieß, oder irgend jemand, dessen Name unbekannt war.
Das beruhigte Frau Amsted jedoch ganz und gar nicht. Seit achtzehn Jahren war ihr Mann niemals später als zwanzig Minuten nach fünf zu Hause gewesen. Nur ein einziges Mal hatte er das Büro vorzeitig verlassen. Das war damals, als er ein Zahngeschwür bekam und die Schmerzen plötzlich so heftig wurden, daß er es nicht aushielt. Doch bevor er zum Zahnarzt ging, hatte er selbstverständlich zu Hause angerufen.
Der Brief an die Dienststelle war einfach unbegreiflich. Wer in aller Welt sollte ihm wohl schreiben?
Frau Amsted wußte, daß ihr Mann als sechzehnjähriger Gymnasiast höchst platonisch in eine Kioskverkäuferin verliebt gewesen war. Sie kannte sogar das Gedicht, das er für das junge Mädchen geschrieben hatte:
Dort sitzt du in des Kiosk engem Raum und bist durchs
Fenster frühlingshold anzuschaun.
Doch ich muß stehn in Schnee und Sturm hier draußen. Sie hatte ihm diese kleine Jugendtorheit längst verziehen. Wenn sie diese Episode ihm gegenüber dennoch einmal erwähnte, dann nur in scherzhaft neckender Weise, so daß er rot wurde und lachen mußte.
Nein. Er hatte keine Geheimnisse vor seiner Frau. Das Ganze war absolut unbegreiflich, wahnwitzig.
Frau Amsted hatte geweint. »Was mag bloß mit unserem Vati passiert sein? Was mag ihm zugestoßen sein?« wiederholte sie immer wieder.
Und ihr Sohn, der dreizehnjährige Leif, weinte ebenfalls und klapperte mit den Zähnen, als friere er. Es war ein schmächtiger, blasser Junge mit völlig weißem Haar.
Das Essen war schon mehrmals wieder aufgewärmt worden. Es gab Fleischklößchen in Selleriesoße. Für Leif gehörte Selleriesoße zum Widerwärtigsten, was er sich denken konnte. Mitten im Weinen empfand er plötzlich eine gewisse Befriedigung über den Aufschub des verhaßten Essens.
Diese Situation hatte überhaupt etwas sonderbar Wonnevolles und Prickelndes. Das Außergewöhnliche – die Sensation in einem sonst peinlich wohlgeordneten und regelmäßigen Leben.
Als das Essen endlich auf den Tisch kam, hatte die Mutter nicht die Kraft, ihn zu zwingen, seinen Teller auch leer zu essen. Sonst hieß es immer: »Wenn du nicht aufißt, wirst du nie groß und stark. Sellerie und Fleischklößchen sind das Gesündeste, was es gibt. Glaub mir, Leif der Glückliche hat seine Fleischklößchen in Selleriesoße immer aufgegessen!«
Leif der Glückliche – dieser berühmte Wiking und Seefahrer wurde ihm stets vorgehalten, wenn er seinen Teller nicht leer essen mochte oder seine Mathematikaufgaben nicht lösen konnte.
Frau Amsted räumte den Tisch ab, ohne die übriggelassenen Selleriestücke auf Leifs Tellerrand zu beachten. Sonst waren es gerade diese letzten kalten Bissen, die der Junge auf Biegen und Brechen in sich hineinzwingen mußte. Als er noch kleiner war, hatte er einmal einen ganzen Abend lang einen Essenrest im Mund behalten. Es war ihm einfach unmöglich gewesen, ihn hinunterzuschlukken. Er bewahrte ihn stundenlang in der einen Backentasche auf, und die Eltern wunderten sich über seine Schweigsamkeit. Als er den zähen Klumpen ins Taschentuch spucken wollte, wurde es entdeckt. Und dann gab es einen Heidenspektakel. Ihm wurden sowohl Leif der Glückliche als auch die vielen armen Kinder vorgehalten, die sich über das gute Essen gefreut hätten. Und wenn er sich weiter so betrage, würde man ihn einmal hungern lassen! Das muß herrlich sein, dachte Leif. Er machte sich nichts aus Essen.
An diesem Abend wurden auch die Schulaufgaben vergessen. Seine Mutter hörte ihn sonst immer in Geschichte und Geographie ab. Um Mathematik und Deutsch mußte sich der Vater kümmern.
Es waren aufreibende Kämpfe, die Abend für Abend in der Herluf-Trollesgade ausgefochten wurden. Dafür gehörte Leif jedoch zu den Besten der Klasse. Auch wenn es Tränen kostete. Sein Vater hatte ebenfalls zu den Besten der Klasse gehört. Und das hatte damals auch Tränen gekostet. Der Vater war in dieselbe alte graue Schule am Frue Plads gegangen, in die Leif ging und in die auch sein Großvater gegangen war. In der Familie Amsted hielt man auf Tradition.
Frau Amsted trat immer wieder ans Fenster und sah auf die dunkle, menschenleere Herluf-Trollesgade hinab. Dabei mied sie mit Bedacht die Stelle, wo der Teppich immer zuerst so abgetreten wurde.
Es regnete. Undes stürmte, daß das Thermometer vor dem Fenster klirrte. Man hörte die Straßenbahnen auf Kongens Nytorv. Und vom Hafen drang das Tuten der Dampfer herüber.
Es roch noch immer nach Sellerie. Und das gemusterte Linoleum hatte auch einen starken Eigengeruch. »Aber Linoleum läßt sich so leicht sauberhalten«, sagte Frau Amsted.
Die große Uhr auf dem Büfett tickte laut und deutlich. Wenn sie schlug, fuhr Frau Amsted jedesmal erschrocken zusammen. »Nein! – Und er ist noch nicht da. – Halb zehn! – Immer noch nicht . . .«
3
Die andere Vermißtenanzeige ging erst ein paar Tage später bei der Polizei ein.
Eine Dame aus der Rosengade – Frau Møller – teilte mit, ihr Untermieter Mikael Mogensen, der in einer zur Wohnung gehörenden Bodenkammer lebe, sei seit drei Tagen und Nächten nicht zu Hause gewesen. Sie vermute deshalb, daß ihm ein Unglück zugestoßen sei.
Er schulde ihr fünfzehn Kronen – die Miete des letzten Monats –, falls er flüchtig sein sollte, ersuche sie die Polizei, ihn ausfindig zu machen oder ihr zu gestatten, sich durch einen eventuellen Verkauf seiner Hinterlassenschaft schadlos zu halten.
Fünfzehn Kronen waren übrigens für die Bodenkammer, die sie Mikael Mogensen überlassen hatte, ein reichlich happiger Mietpreis. Die Kammer hatte nicht einmal eine richtige Tür, sondern nur eine aus Latten, durch die man vom Gang aus hineinsehen konnte. Und Möbel gab es auch nicht. Mogensen schlief auf dem Fußboden – auf einer Lage alter Zeitungen und mit einer alten schwarzen Mappe unter dem Kopf. In einer Ecke lag ein großer Stapel Bücher. In einer anderen ein Stapel Zeitungen. In der dritten Ecke befand sich die »Küche«, das heißt ein lebensgefährlicher Primuskocher, eine Bratpfanne, eine Kasserolle, Spiritus und Petroleum.
Mogensen war ein Original, er war im ganzen Viertel bekannt, vor allem unter den Kindern. Er hatte langes, ungeschnittenes Haar und einen Vollbart. Er trug ständig einen sehr alten, zerschlissenen Mantel und unter dem Arm eine abgegriffene schwarze Mappe. Niemand wußte, was sich in dieser Mappe befand, und man stellte deshalb die ausgefallensten Vermutungen an.
»Aber er war ein ruhiger und bescheidener Mann«, sagte Frau Møller. »Er konnte nicht mal einer Katze ein Haar krümmen.« Sie wollte wissen, daß er aus gutem Hause stamme und studiert habe. Aber irgend etwas müsse in ihm zerbrochen sein, und deshalb habe er es auch nie zu etwas gebracht. Er sei kein Trinker und triebe sich auch nicht mit Frauen herum. Er sei in keiner Beziehung ausschweifend. Ganz im Gegenteil, er sei der reinste Asket.
Er lese immer in dicken Büchern. Auch ausländischen, die sie, Frau Møller, nicht verstehe. Und er drücke sich gewählt und gebildet aus. Er hätte es weit bringen können, wenn er nur gewollt hätte. Aber irgend etwas müsse ihm zugestoßen sein, wodurch er so wunderlich geworden sei.
Bei den Bewohnern der Straße war er beliebt. Wenn er einem von ihnen begegnete, zog er höflich den Hut. Die kurze Straße glich einem Provinzstädtchen, wo jeder jeden kennt. Es war eine kleine, in sich abgeschlossene Gesellschaft. Die Leute hielten sich an ihre Straße und gingen nur selten und ungern in andere Gegenden.
Es waren meist kleinbürgerliche Menschen, die Pech gehabt hatten. Gescheiterte Existenzen. Schiffbrüchige, die in dieser Straße gestrandet waren. Sie war gleichsam eine Insel der toten Schiffe. In der Rosengade gingen jedoch auch dunkle und nicht ganz geheure Dinge vor sich. Sie war zwar kurz, hatte dafür aber viele Hinterhäuser, Seitenflügel und dunkle Höfe.
Dort gab es vier, fünf heimliche Kneipen, wo man auch noch nach der Polizeistunde Rotwein trinken konnte. Es gab ein Bordell, in dem die Paare in Kojen übereinander lagen. Es gab eine weise Frau, die unheimliche und verbotene Eingriffe vornahm. Und dort wohnte die Frau mit dem schwarzen Regenumhang, die ganz für sich allein mit einem großen Hund lebte.
Dort gab es auch mehrere Prostituierte unterschiedlichen Alters. Die blonde Dame aus dem Eisladen war um die Sechzig. Sie stammte noch aus der alten Zeit, als die öffentliche Prostitution noch nicht verboten war. Die kleine Maja dagegen war erst neun Jahre. Aber sie verdiente mehr als die dicke blonde Dame. »Ein nettes und wohlerzogenes kleines Mädchen«, sagten alle in der Straße. Sie knickste höflich und hielt jedem, der hineinoder hinausging, die Haustür auf. Sie hatte sehr blanke Augen. Und manchmal bekam sie epileptische Anfälle.
Mogensen grüßte sie höflich. Er hielt sich für sich und kümmerte sich nicht um das, was in der Straße vor sich ging. Er war ein Gentleman. Die geheimnisvolle Mappe unter dem Arm, schritt er in seinem alten, zerschlissenen Mantel und mit löchrigen Stiefeln würdevoll durch die Straße. Etwas vornübergebeugt, ein bißchen kurzsichtig und reichlich schmutzig, doch voller Ruhe und Würde. Und wenn er jemandem begegnete, zog er feierlich seine alte, schmierige Mütze.
Er redete zwar so merkwürdig und gebrauchte Worte, die Frau Møller und die anderen Bewohner der Straße nicht recht verstanden, doch dahinter steckte bestimmt nichts Schlechtes.
Deshalb war Frau Møller auch nicht der Meinung, Mogensen könne etwas Ungesetzliches getan haben und müsse sich aus diesem Grund versteckt halten. Und die fünfzehn Kronen, die er ihr für Miete schuldete, konnten gewiß auch nicht der Grund für sein Verschwinden sein. Er war ihr schon öfter für einen oder auch für zwei Monate die Miete schuldig geblieben. Aber nicht des Geldes wegen hatte sie der Polizei sein Verschwinden angezeigt. »So eine bin ich nicht. Ich bin doch kein Unmensch. Aber natürlich muß alles seine Ordnung haben, und unsereiner muß ja auch leben. Fünfzehn Kronen sind schließlich viel Geld.
Aber ich hab zu Mogensen gesagt: ›Ich weiß, daß Sie ein ordentlicher Mensch sind, Mogensen. Sie wollen mich nicht betrügen. Mir ist um meine fünfzehn Kronen nicht bange. ‹«
Und Mogensen hatte erwidert: »Das haben Sie auch nicht nötig. Dieser Betrag wird Ihnen im Laufe der nächsten Woche gezahlt werden, Frau Møller.«
Wenn es dann doch noch zu einem kleinen Streit zwischen ihnen gekommen sei, dann nur deshalb, weil sich herausstellte, daß Mogensen viel Geld hatte. Und damit, so meinte Frau Møller, sei ja wohl die Voraussetzung für die Mietstundung hinfällig geworden. Besonders, da Mogensen das Geld auf eine so unvernünftige und sinnlose Weise ausgab. Wenn man an einem einzigen Abend über tausend Kronen buchstäblich nur so rausschmeißt, kann man es sich nicht erlauben, die Miete schuldig zu bleiben. Das hatte ihm Frau Møller vorgehalten, und das hatte ihn gekränkt.
»Es ist außerordentlich bedauerlich«, hatte er entgegnet, »daß man offenbar nicht mehr auf eine Absprache bauen kann, Frau Møller. Ich habe ausdrücklich gesagt: nächste Woche. Und damit waren Sie einverstanden. Inzwischen gedenke ich das Geld für Zwecke zu verwenden, die ich für passend erachte.«
Und als sie ihm weitere Vorwürfe über das viele Geld gemacht hatte, das er so sinnlos vergeudet habe, hatte er die harten und verletzenden Worte fallen lassen: »Sie sind eine ungebildete Person, Frau Møller! Ein Mann wie ich kann sich mit Ihnen in kein Streitgespräch einlassen. Ich hege in hohem Maße Geringschätzung für Sie!«
Und das hatten viele Fremde mit angehört und darüber gelacht. Fau Olsen aus dem Eiskeller hatte ihm sogar zugerufen: »Das ist richtig, Mogensen! Geben Sie es ihr!« Und das in Frau Møllers eigener Stube! Das waren die letzten Worte, die sie von Mikael Mogensen gehört hatte.
Am nächsten Tag war er verschwunden. Das merkwürdige Fest, das so viel Geld gekostet hatte, war gleichsam sein Abschiedsfest gewesen.
4
Am 10. Oktober – einen Tag nachdem Frau Amsted das Verschwinden ihres Mannes angezeigt hatte, wurde auf dem Amager fælled ein entsetzlicher Fund gemacht.
Ein Soldat, der an dem Scharfschießen der Armee auf dem Fælled teilgenommen hatte, stieß auf die grauenvoll verstümmelten Reste eines Menschen, der buchstäblich in tausend Stücke gesprengt worden war.
Der Soldat hatte zusammen mit anderen den Befehl erhalten, nach einer Granate zu suchen, die beim Aufschlag nicht detoniert war und außerordentlich gefährlich werden konnte, wenn sie Kindern oder anderen Unkundigen in die Hände fiel.
Nicht weit von der Stelle entfernt, wo der Wall des Kalvebod-Strandes Amager erreicht, bemerkte er in der Erde einen Trichter wie nach einer Explosion. Und zu seinem Entsetzen entdeckte er Stoffetzen und die blutigen Überreste eines Menschen, den es gleichsam weitum zerspritzt hatte.
Selbstverständlich wurde sofort die Polizei alarmiert und gemeinsam mit Sprengstoffexperten der Armee eine umfassende Untersuchung eingeleitet.
Die Explosion mußte von außergewöhnlicher Gewalt gewesen sein. Wenn niemand sie gehört oder gesehen hatte, dann wohl nur, weil die Armee gerade zu diesem Zeitpunkt ein Scharfschießen mit schwerer Artillerie durchführte. Und das Krachen der Explosion war deshalb vermutlich mit einem Kanonenschuß verwechselt oder für die Detonation einer Granate gehalten worden.
Der Anblick, der sich den Polizisten bot, war so grauenvoll, daß sich selbst die Mittagszeitungen einer ausführlichen Beschreibung enthalten mußten.
Die Experten stellten fest, daß der Verunglückte überall am Körper mit Dynamit gespickt gewesen sein mußte. Die Taschen, der Hut, die Schuhe – alles schien voller Sprengstoff gewesen zu sein. Ja, sogar im Mund mußte er Dynamit gehabt haben.
Unter diesen Umständen konnte von einer Identifizierung des Toten überhaupt keine Rede sein. Ein paar winzige graue Stoffetzen wurden zwecks gründlicher chemischer Analyse eingeschickt. Auch die Reste einer Taschenuhr wurden genau untersucht.
Merkwürdigerweise war diese Uhr nicht völlig pulverisiert, sondern nur beschädigt, als habe sie jemand gegen einen Stein geschleudert oder darauf getreten. Sie wurde in ein paar Meter Entfernung von dem Trichter gefunden, den die Explosion in die Erde gerissen hatte.
Es war sogar noch möglich, auf der Außenseite der Uhrkapsel einen Fingerabdruck zu erkennen. Und es ließ sich auch mit Sicherheit nachweisen, daß die Uhr Vier Minuten nach halb drei stehengeblieben war. Doch all das konnte natürlich nicht darüber Aufschluß geben, um wen es sich bei dem Verunglückten handelte.
Die Polizei ging mit bewundernswürdiger Gründlichkeit vor. Rings um den Unglücksort wurde die Erde umgegraben und durchgesiebt. Es wurden Gipsabdrücke von Fußspuren angefertigt. Es wurde Pulver verstreut, und es wurde fotografiert. Jedes Überbleibsel von Knöpfen und Münzen, Lederstückchen und ähnlichem – selbst das winzigste Teilchen wurde gesammelt und einer systematischen Untersuchung unterzogen. Alle Methoden der modernen Technik kamen zur Anwendung.
Es dauerte fast eine Woche, bevor das Ergebnis dieser Untersuchungen vorlag. Was die gefundenen Stoffreste anging, so wurde ermittelt, daß sie aus grauem, reinwollenem, doppelfädigem Kammgarn eines englischen Fabrikats bestanden. Es gelang sogar, auf der linken Seite des Stoffes die Reste eines Stempels als ein C. D. zu rekonstruieren, was als Chestertown-Deverill – jene bekannte englische Tuchfabrik – ausgelegt wurde. Es traf sich so glücklich, daß in Kopenhagen nur ein Schneidermeister den Alleinvertrieb dieses Qualitätserzeugnisses besaß. Und die Polizei unterzog seine Kundenkartei einer eingehenden Überprüfung.
Zu den festen Kunden des Schneidermeisters gehörte der verschwundene Kanzleirat Teodor Amsted.
Aber bevor die Polizei die Wohnung des verschwundenen Kanzleirats aufsuchen und einen Vergleich zwischen dem Fingerabdruck auf der Uhr und eventuellen Fingerabdrükken in seiner Wohnung oder im Büro vornehmen konnte, wurde sie von einem Brief des Vermißten unterrichtet. Einem Brief, den die XIV. Abteilung des Kriegsministeriums erhalten hatte.
Dieser Brief war ein Abschiedsbrief, in dem Teodor Amsted seinen unglückseligen Entschluß mitteilte.
Insofern war alles klar. Es sollte sich jedoch später zeigen, daß der Selbstmord des unglücklichen Kanzleirates noch von vielen dunklen Punkten umgeben war.
5
Wenn in der XIV. Abteilung des Kriegsministeriums gegen elf Uhr die Mittagszeitung eintraf, las sie als erster, ohne daß die anderen im Büro etwas dagegen einzuwenden hatten, der junge Assessor Hougaard, dessen Vater seinerzeit Ministerratssekretär gewesen war.
Nach beendeter Lektüre reichte er die Zeitung an Fräulein Lilienfeldt weiter, denn ihr Vater war Oberst, und damit kam sie in der Rangfolge gleich nach Herrn Hougaard. Und so ging dann die Zeitung weiter und wurde von allen in der Reihenfolge und Ordnung gelesen, die der Herkunft und dem Rang jedes einzelnen entsprach.
Die Post, die in der XIV. Abteilung des Kriegsministeriums einlief, wurde nach überkommenen und unantastbaren Regeln behandelt. Es waren Briefe sehr unterschiedlicher Art und Beschaffenheit. Und diese Briefe wurden nach einem ganz bestimmten System und in vorgeschriebener Reihenfolge geöffnet, sortiert, in das Posteingangsbuch eingetragen, mit einem Sichtvermerk versehen, gestempelt und dann gelesen. Manche Briefe betrafen die Verteidigung des Landes. Es waren Schreiben, die für die Sicherheit der Nation von Lebenswichtigkeit waren. Andere wiederum waren von untergeordneter Bedeutung, wie beispielsweise die Rechnung eines Glasermeisters, eine heueingesetzte Scheibe betreffend, da auf Grund mangelhafter Sorgfalt von seiten des Büropersonals beim Einhängen eines Fensterhakens bedauerlicherweise eine Fensterscheibe des Ministeriums zerbrochen war, als durch den Wind erwähntes Fenster zugeschlagen wurde.
Da waren Briefe und Bewerbungen sowie Vorschläge und Projekte, die an den Ministerialdirektor oder an den Verteidigungsminister weitergeleitet werden mußten. Da waren Schreiben, die vom Ministerialrat beantwortet werden konnten. Und dann gab es Briefe, die überhaupt nicht beantwortet zu werden brauchten, sondern die, nachdem sie einen entsprechenden Vermerk erhalten hatten und ihre laufende Nummer und ihre Posteingangsbezeichnung festgehalten worden waren, an den Absender zurückgingen.
Es gab ein besonderes Alphabet, ein System bestimmter Zeichen und Hieroglyphen, die der Ministerialrat mit rotem oder blauem Stift auf die Briefe schrieb und die dem Eingeweihten verrieten, wie mit dem betreffenden Schreiben weiter zu verfahren sei.
Deshalb ist es verständlich, daß ein Brief, der an die XIV. Abteilung des Kriegsministeriums adressiert ist, unvermeidlich eine Zeitlang liegenbleiben und einen gewissen Prozeß durchlaufen muß, bevor er gelesen und beantwortet werden kann.
Einen Tag nach Kanzleirat Amsteds Verschwinden kam mit der Morgenpost ein Brief, der an den Ministerialrat persönlich gerichtet war. Dank dieses Umstandes erhielt er ihn bedeutend früher als andere Briefe, die zur gleichen Zeit eingegangen waren. Aber auf Grund des speziellen und fest eingefahrenen Systems bei der Durchsicht der Post verging dennoch fast eine Woche, bevor ihn der Ministerialrat las.
Offenbar mußte ihn der Inhalt dieses Briefes ungewöhnlich stark beeindruckt haben. Seine Stimme war ganz heiser, als er Regierungsrat Degerstrøm in sein Privatbüro rief und ihn bat, Platz zu nehmen.
»Es ist etwas passiert. Etwas Unerhörtes und Ungebührliches – etwas, was die Ehre unserer Dienststelle, ja sogar . . . des Ministeriums betrifft.«
Regierungsrat Degerstrøm spitzte die Ohren.
»Ich betrachte es als meine Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Um so mehr, da ich überzeugt bin, daß es auf die Dauer einer breiteren Öffentlichkeit doch nicht verborgen bleiben wird. ― ― Kanzleirat Amsted ist tot!«
»Ist er tot?« Regierungsrat Degerstrøms erster Gedanke war zwangsläufig, daß nun er der nächste sei, der aufrückte, wenn der Chef einmal das entsprechende Alter erreicht haben würde. Hier im Büro warteten alle geduldig darauf, daß die Zeit verging. Nur mit Hilfe der Zeit konnte man auf der Rangleiter höher klettern.
»Er ist auf eine entehrende Weise gestorben. Er hat sich das Leben genommen. Ich halte hier einen Brief in der Hand, den er an mich persönlich gerichtet hat und worin er es für erforderlich hält, mir die Beweggründe für den Schritt, den er getan hat, mitzuteilen.
Zuerst schreibt er, daß man unter diesen Umständen nicht erwarten könne, ihn im Büro wiederzusehen. Die Schlüssel zu seinem Schrank und seiner Schreibtischschublade würde man in seiner Wohnung in der Herluf-Trollesgade vorfinden. Wenn er es dennoch für erforderlich halte, uns seinen Selbstmord mitzuteilen, liege das in dem besonderen Verfahren begründet, das er anzuwenden gedenke und das, wie er vermute, die Möglichkeit ausschließe, seine Leiche zu identifizieren. – Er hat sich selbst in die Luft gesprengt, indem er sich nicht nur die Taschen voll Dynamit gesteckt hat, sondern auch den Hut und den Mund.«
»Also ist er das ― der auf dem Amager fælled . . .«
»Ja, das ist er. Er ist derjenige, über den die Zeitungen so viel geschrieben haben. Und nun wird auch das Büro in Verbindung mit diesem Skandal genannt werden.«
»Du lieber Himmel!«
»Ja, das können Sie wohl sagen.«
»Das ist entsetzlich!«
»Ja.«
»Seine arme Familie!«
»Ja.«
»Das ist ja furchtbar!«
»Ja. Aber hören Sie weiter! Er beauftragt mich, das Geschehene so schonend wie möglich seiner Frau beizubringen. Was das Motiv seiner Tat betreffe, so könne er nur mitteilen, daß es nicht in seinen ehelichen Verhältnissen begründet liege noch in irgendwelchen erotischen Umständen überhaupt. Ein rein persönliches Unbefriedigtsein von seinem Wirken und seiner Leistung veranlaßten ihn . . .«
»Seinem Wirken? Seinem Wirken hier im Büro? – Aber wie ist es denn möglich, daß ihn das nicht befriedigt haben sollte?«
»Ja, das ist in hohem Maße unverständlich. Man hatte nicht den Eindruck, daß er für seine Arbeit hier ungeeignet oder daß er in irgendeiner Weise damit unzufrieden gewesen wäre. Aber er schreibt also in diesem – wenn man so sagen darf – Abschiedsbrief, daß seine Erwartungen an das Leben nicht befriedigt worden seien.«
»Das klingt völlig unbegreiflich.«
»Ja.«
»Vielleicht ist er plötzlich geisteskrank geworden?«
»Ja. Es gibt triftige Gründe für die Vermutung, daß Kanzleirat Amsted seine Verzweiflungstat in einem Anfall von geistiger Umnachtung begangen hat.«
»Ja . . . natürlich. Das ist die einzige Erklärung. Er ist krank gewesen.«
»Aber es ist eine peinliche Form von geistiger Umnachtung. Eine äußerst peinliche Form. Es wird nun meine traurige Pflicht sein, die Kriminalpolizei vom Empfang dieses Schreibens in Kenntnis zu setzen. Ich erachte es für notwendig, das telefonisch zu tun. Was danach unternommen werden muß, ist Sache der Polizei. Man darf jedoch leider nicht darauf hoffen, daß die Presse die wünschenswerte Diskretion an den Tag legen wird. Wir müssen befürchten, daß das Ministerium und unser Büro in Verbindung mit dieser peinlichen und bedauerlichen Angelegenheit genannt werden. Und ich betrachte es als meine Pflicht, Sie darauf vorzubereiten.«
»Das ist sehr bedauerlich.«
Regierangsrat Degerstrøm machte Miene, sich zurückzuziehen und die sensationelle Mitteilung des Chefs an das übrige Personal der Dienststelle weitergehen zu lassen. Der Ministerialrat hielt ihn jedoch zurück.
»Da ist noch etwas, von dem ich wünsche, daß das Personal davon Kenntnis erhält. In Anbetracht der vorliegenden Umstände kann von einer offiziellen Teilnahme an Regierungsrat Amsteds Beisetzung von seiten der Dienststelle selbstverständlich keine Rede sein. Falls einer der Angestellten den Wunsch haben sollte, gegenüber dessen hinterlassener Familie Anteilnahme oder Sympathie in Form von Kränzen, Blumen oder ähnlichem zu bekunden, hat das rein privat zu geschehen. Das Büro als solches sieht sich nicht zu Sympathiekundgebungen in der Lage, ebensowenig wie hier eine offizielle Sammlung oder dergleichen stattfinden kann.«
6
Ein Mann klingelt an Frau Amsteds Wohnungstür. Ein Mann mit Windjacke und mit Fahrradklemmen an den Hosenbeinen. Man erkennt in ihm gleich den Kriminalbeamten.
»Sie müssen schon entschuldigen, gnädige Frau. Ich bin leider gezwungen, Ihnen auf Grund des Vorgefallenen ein paar Fragen zu stellen.«
»Ja, bitte . . . ja . . . treten Sie ein. Aber Sie werden verstehen . . . ich bin sehr mitgenommen. Was uns widerfahren ist, das ist mehr, als ein Mensch ertragen kann. Und nun kommt auch noch die Polizei!«
»Ich bin mir natürlich im klaren, daß es für Sie peinlich ist. Aber ich werde mich so kurz fassen wie nur möglich.«
Sie gehen durch den sehr langen, dunklen Korridor.
»Bitte, nehmen Sie Platz. Sie dürfen sich nicht umsehen. Hier ist heute nicht aufgeräumt worden. Ich habe dem Mädchen freigegeben. Alles ist aus dem gewohnten Gleis geraten. Es ist einfach zuviel gewesen. Wenn ich gewußt hätte, daß Sie kommen würden . . . Sie müssen mir versprechen, sich in dieser Unordnung nicht umzusehen.«
»Daran dürfen Sie nicht denken. Ich werde mich schon nicht umsehen«, sagte der Kriminalist und sah sich im Wohnzimmer um, in dem peinlichste Ordnung herrschte.
Die Möbel waren altmodisch. Es waren Erbstücke aus Teodor Amsteds Elternhaus. Dinge, die er in den sechsundvierzig Jahren seines Lebens ständig vor Augen gehabt hatte.
Ein kleiner Mahagonisekretär. Ein Spieltisch mit doppelter, polierter Tischplatte, die aufgeklappt war, so daß sich die Figuren aus Meißner Porzellan darin zweifach spiegeln konnten. Ein ovaler Tisch mit einem weißen Deckchen und einer Kristallschale in der Mitte und eine kleinformatige Gedichtsammlung in Ledereinband. Das Klavier stand offen, wie in Dänemark so üblich, die Noten waren aufgeschlagen, als hätte gerade jemand gespielt.
»Oh, es ist grauenvoll. Grauenvoll! Wie konnte das bloß passieren! Ich kann es einfach nicht fassen. Mir ist, als würde ich träumen und bald aus diesem furchtbaren Traum erwachen. Wir waren ja so glücklich. Das kann ich Ihnen versichern. Wir waren so unendlich glücklich. In den achtzehn Jahren unserer Ehe sind wir nie auch nur einen einzigen Tag voneinander getrennt gewesen. Mein Mann konnte sich nicht einmal vorstellen, ohne mich irgendwohin zu gehen . . . darum ist das Ganze auch so unbegreiflich . . . er muß krank gewesen sein. Es muß ganz einfach in einer Art plötzlicher Geistesverwirrung geschehen sein! Glauben Sie das nicht auch? Ist die Polizei nicht ebenfalls dieser Meinung?«
»Ja. Ja, gewiß. Ist Ihnen an Ihrem Mann irgend etwas aufgefallen? War er nervös?«
»Nein, nein. Ganz und gar nicht. Er war immer so ruhig und ausgeglichen. Wir führten ein sehr regelmäßiges Leben. Ich sorgte stets dafür, daß alles um ihn her ordentlich und gemütlich war.«
»Und Sie haben auch nicht in allerletzter Zeit irgend etwas Auffälliges oder eine Veränderung an Ihrem Mann bemerkt?«
»Nein. Wie können Sie so etwas bloß annehmen! Sie hätten ihn kennen sollen. Er war sich stets gleich. Er war die Ordentlichkeit und Regelmäßigkeit selbst. Man kann wohl sagen, daß er ein Gewohnheitsmensch war. Von Veränderungen hielt er nichts. Alles mußte so stehen, wie es immer gestanden hatte. So geht es mir selbst auch. Wir waren uns immer einig.
Ach, er war so gut – unser lieber Vati. Er war stets so aufmerksam zu mir. Wie konnte er das bloß tun! Wie konnte er mich nur in diese Situation bringen! Was werden unsere Bekannten sagen! Und überhaupt die Leute! Die Zeitungen haben auch darüber geschrieben. Ich wage es beinahe nicht mehr, eine Zeitung aufzuschlagen.«
Frau Amsted hielt die Hände vor die Augen und weinte. Der Kriminalist wartete taktvoll, bis sie sich wieder gefaßt hatte.
»Es ist so unbegreiflich . . .so wahnwitzig! Wenn ich nur wüßte, warum! Und dann auf diese Weise . . .«
»Ja. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Aus diesem Grund bin ich auch hier. Der Polizei ist manches unerklärlich. Da ist so vieles, was überprüft werden muß. Wir haben ja in Wirklichkeit nur sehr wenige Anhaltspunkte. Sie glauben also, die Reste seiner Uhr wiederzuerkennen? Und der Anzug, den der Tote anhatte, stammt von Schneidermeister Holm, bei dem Ihr Mann seine Sachen nähen ließ. Und dann gibt es schließlich noch diesen Brief. Sind Sie ganz sicher, daß er ihn auch tatsächlich selbst geschrieben hat? Daß es seine Schrift ist?«
»Ja, das bin ich. Den Brief hat er geschrieben. Das ist seine Schrift. Seine schöne, regelmäßige Schrift. Wer sollte ihn sonst geschrieben haben? Glauben Sie etwa, daß es ein anderer gewesen sein könnte? Ist die Polizei der Auffassung, daß er vielleicht gar nicht derjenige ist, der sich . . . der auf diese furchtbare Weise umgekommen ist?«
»Daran besteht leider kein Zweifel. Sie müssen ja seine Handschrift kennen. Und sie läßt sich ja letzten Endes mit anderen Briefen von ihm vergleichen. Wer sollte auch an einem gefälschten Brief Interesse haben? Merkwürdig ist nur, daß darin kein triftiger Grund angegeben wird. Es ist einfach unmöglich, für diese Tat ein Motiv zu finden.«