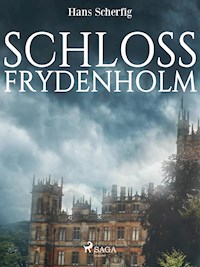
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Scherfigs satirischer Geniestreich spielt sich während der deutschen Besetzung Dänemarks ab. Der seeländische Landsitz Frydenholm ist Schauplatz verdächtiger Vorgänge, und eine illustre Gesellschaft geht dort ein und aus: so geben sich der dänische Polizeichef, Geheimdienstagenten und Gestapobeamte aus Berlin, samt Mitglieder eines geheimnisvollen "Schmetterlingsvereins", angeführt durch den neuen Schlossherrn, Graf Preben, die Klinke in die Hand. Solch mysteriöse Ereignisse wecken natürlich die Neugierde der Nachbarn.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 864
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Scherfig
Schloss Frydenholm
Roman
Aus dem Dänischen von Jutta Jeppesen Nachwort von Hanns Grössel
Saga
Schloss FrydenholmÜbersetzt von Jutta Jeppesen OriginaltitelFrydenholmCopyright © 1990, 2019 Hans Scherfig and und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711842782
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
Im Frühjahr 1939 verkaufte Frau Julie Skjern-Svendsen den Herrenhof Frydenholm im Landkreis Præstø an ihren jüngeren Bruder Preben Flemming Fido Graf Rosenkop-Frydenskjold.
Frau Julie Skjern-Svendsen, geborene Komtesse Rosenkop-Frydenskjold, war die Witwe des Gutsbesitzers und Fabrikanten C. C. Skjern-Svendsen, an dessen Namen sich vielleicht noch einige erinnern. Jedenfalls hat man ihm, um sein Wirken für das Reich Gottes und für das dänische Wirtschaftsleben zu würdigen, in der kleinen Anlage vor dem Missionshaus ein Denkmal errichtet. Später setzte man neben das Denkmal Skjern-Svendsen ein weiteres. Es wurde zu Ehren eines einfachen Arbeiters errichtet, der in einer merkwürdigen Zeit ungewöhnliche Taten vollbracht hatte. Wenn heute Touristen diesen Ort besuchen und die beiden Monumente Seite an Seite stehen sehen, kann es vorkommen, daß sie sagen: „So demokratisch geht es hier zu! Hier macht man keinen Unterschied zwischen einem Arbeiter und einem Gutsbesitzer!“
Auf dem Friedhof, unweit der kleinen Anlage, findet man das geräumige und unvergängliche Mausoleum, das noch der Gutsbesitzer selbst in Form eines – sehr modernen – altnordischen Grabhügels erbauen ließ; mit seiner kostbaren Einrichtung und seinen bombensicheren Gewölben muß es teurer gewesen sein als die Kirche. Kurz nach der Vollendung und der kirchlichen Weihe dieses eigenartigen Grabmals starb Gutsbesitzer Skjern-Svendsen; unter großer Beteiligung wurde er in seinem Grabhügel beigesetzt. Bekanntlich hatte man ihn ermordet. Ein Mann, der als Schloßgärtner auf Frydenholm angestellt war, hatte ihn in seinem Schlafzimmer in einem Anfall von Wahnsinn erwürgt. Und weil ein Mord damals noch etwas Ungewöhnliches war, erregte dieses Ereignis sehr viel Aufsehen und war Gegenstand ausführlicher Erörterungen in allen Zeitungen des Landes.
Der Arbeiter, dessen Monument heute neben dem des Gutsbesitzers steht, wurde hingegen nicht auf dem Friedhof von Frydenholm begraben. Er wurde überhaupt nicht begraben. Denn von ihm war nichts zu bestatten. Dieser Umstand gab bei einer bestimmten Gelegenheit Anlaß zu peinlichen und unerfreulichen Auftritten.
Der Herrenhof Frydenholm war viele Generationen hindurch im Besitz des Geschlechtes Rosenkop-Frydenskjold gewesen, und in weitem Umkreis wurde mit Zufriedenheit begrüßt, daß wieder ein richtiger Graf auf dem alten Schloß Einzug hielt. Das gab dem Ganzen mehr Stil, wie Bäcker Andersens Frau sagte. Die älteren Leute erinnerten sich noch an die gute alte Zeit mit vierspännigen Kutschen und großartigen Treibjagden, bevor der bürgerliche Skjern-Svendsen sich hier niedergelassen hatte. Nun saß wieder ein richtiger Graf auf dem Schloß, und damit war gleichsam etwas wiedererstanden.
Nicht, daß Gutsbesitzer Skjern-Svendsen das alte Schloß vernachlässigt hätte. Er hatte viel Geld geopfert, um das Schloß restaurieren zu lassen und es wieder altertümlich zu machen. Ritterrüstungen, Henkersbeile und Hellebarden hatte er in der billigen Zeit in Deutschland zusammengekauft und auf Treppen und Gängen aufgehängt. Historische Gobelins aus der Textilfabrik in Præstø bedeckten die Wände des Rittersaals. Neue, solide Ketten aus der Schmiede des Ortes schmückten den Kerker, in dem man zuvor Kartoffeln aufbewahrt hatte. Über den gereinigten Festungsgraben ließ er eine richtige Zugbrücke schlagen. Das hölzerne Pferd, das pietätlose Bauern vor anderthalb Jahrhunderten gedankenlos verbrannt hatten, mußte der Zimmermann des Dorfes originalgetreu nachbauen. An seinem historischen Platz im Burghof neben der Steintreppe stand es nun wieder als würdige Erinnerung an das romantische Landleben in der guten alten Zeit.
Sonst aber war nichts Außergewöhnliches oder Glanzvolles an dem kleinen, unansehnlichen, religiösen Fabrikanten gewesen, der trotz großer öffentlicher Mildtätigkeit bescheidene Gewohnheiten hatte und von einfachen Leuten abstammte. Bei all der Macht, die von dem Gutsherrn, Fabrikbesitzer und Bankier Skjern-Svendsen ausging, und bei aller Abhängigkeit, die die ganze Gegend fühlte – und sich mit ihr abfand –, wußte man doch, daß er ein gewöhnlicher Mensch ohne blaues Blut und ohne richtige Ahnen war. Er hatte zwar eine adlige Dame geheiratet und sich ein Wappen anfertigen lassen, mit einem Spinnrad und dem Bruchstück eines Patentwebstuhles als Symbol, doch das konnte nichts daran ändern, daß er ein einfacher Mensch gewesen war, der mit Wollwaren hausieren ging, bevor er Industrieherr, Direktor des Kreditvereins und Gutsbesitzer wurde.
An dem Tage, da der junge Graf in das alte Schloß des Geschlechtes Einzug hielt, wurde im Dorf geflaggt. Und es gab doppelten Anlaß zu flaggen, weil dies am fünften Juni geschah, dem Tag, an dem die Verfassung des dänischen Reiches neunzig Jahre alt wurde. Ob man nun aus dem einen oder dem anderen Anlaß flaggte, war Sache jedes einzelnen. Den Fahnen konnte man nicht ansehen, ob sie für den Grafen oder für die Verfassung oder für beides wehten. Es war ein herrlicher Tag mit Sonnenschein und hellblauem Himmel, mit Lerchengesang und einer leichten, südlichen Brise, die Wärme brachte und den Sommer und kommende Freuden verhieß. Die rotweißen Fahnen bauschten sich feierlich im Wind und leuchteten über den grünen Gärten.
Im Pfarrgarten hißte Pfarrer Nørregaard-Olsen eigenhändig den großen Danebrog, während Frau und Kinder, die Mädchen und der Gast des Hauses, Dr. Harald Horn, wie eine Ehrenkompanie in Reih und Glied standen. Dr. Horn nahm stramme Haltung ein und hob grüßend die rechte Hand, als die Fahne emporstieg und sich im Südwind entfaltete. „Nichts mahnt so sehr wie eine Fahne, die am Mast empor sich schwingt!“ sagte Pfarrer Nørregaard-Olsen, und Dr. Horn, der ein Mann der Literatur war und Zitate sehr schätzte, nickte anerkennend.
In der langen Dorfstraße wehte Fahne neben Fahne, von Bäcker Andersens neuer Villa genau wie vom Hause des Doktors. Der Doktor flaggte nur für die Freiheit und die Verfassung, denn er war ein alter Radikaler und hegte vor Grafen keinen Respekt. Auf Niels Madsens gepflegtem Hof, den er mit Hilfe von Fürsorgekindern tüchtig und ertragreich betrieb, wehte der Danebrog schon morgens um vier Uhr. Und Niels Madsen ließ bestimmt nicht für die Verfassung flaggen, denn er gehörte nicht zu den Anhängern dieses „Systems“ der Demokratie und des Judentums. Er ließ die Fahne allein zu Ehren des Grafen hissen, der – wie man sagte – ein Herrenmensch mit Verständnis für die Forderungen der Zeit sei und willens, Ordnung in die Verhältnisse zu bringen: ein Mann zu Pferde mit Schaftstiefeln und Führergaben.
Auch Gemeinderatsmitglied Rasmus Larsen, den man früher einmal „Roter Ras“ genannt hatte – er war in seiner Jugend roter Sozialist und somit ein gefährlicher Mensch gewesen –, hatte den alten Danebrog an der neuen Fahnenstange vor seiner roten Ziegelvilla gehißt. Und seine Fahne wehte sowohl für den Grafen als auch für die Verfassung, denn Larsen war von großzügiger Gesinnung. „Wir sitzen doch alle im selben Boot“, pflegte er zu sagen. Die Entwicklung hatte Rasmus besonnen gemacht, und mit der Besonnenheit war er zu seiner Villa gekommen und zu dem Fahnenmast mit der vergoldeten Glasspitze, war er Gewerkschaftsvorsitzender geworden und Arbeitervertreter im Gemeinderat.
Sogar Höschen-Marius zeigte eine kleine, verblichene Fahne. Der wunderliche Höschen-Marius, der diesen Spitznamen bekommen hatte, weil er Damenwäsche, die zum Trocknen aufgehängt war, nicht in Ruhe ließ. Die Polizei war wegen dieser Leidenschaft hinter ihm her gewesen. Sie war auch hinter ihm her gewesen, als Gutsbesitzer Skjern-Svendsen ermordet worden war, und sie hatte eine Zeitlang geglaubt, Höschen-Marius sei der Mörder, denn man hatte ihn in der Mordnacht gesehen, wie er durch das Dunkel schlich, weiblichen Wäschestücken nachstellend. Aber Höschen-Marius war wirklich nicht der einzige gewesen, den man verdächtigt und verhaftet hatte, und hätte sich der verrückte Gärtner nicht selbst gestellt, wäre vielleicht ein unschuldiger Mensch verurteilt worden.
Der Kaufmann flaggte und die Hebamme und die Molkerei und das Gemeindebüro. Und eine Fahne wehte vor dem „Historischen Krug“, wo der Gøngehøvding 1 einstmals Schinken und Ei gegessen hatte und Rasmus Larsen am Abend des fünften Juni vor den Mitgliedern des Wählervereins über die freieste Verfassung und Demokratie der Welt und über die Volksgemeinschaft sprechen wollte; danach würde ein Zauberkünstler auftreten, und dann sollte getanzt werden.
Nur der Gutshof flaggte nicht, als der junge Graf Preben Flemming Fido Rosenkop-Frydenskjold seinen Einzug hielt. Das große rote Gebäude lag düster und zurückgezogen zwischen uralten, hohen Lindenbäumen hinter Wällen und grünen Gräben. Ein seltsam fremdartiges Bauwerk inmitten der lieblichen seeländischen Landschaft, errichtet von ausländischen Junkern als Feste gegen die Einwohner, groß und massiv und anmaßend, mit Ecktürmen und Schießscharten und schmalen Fenstern in den meterdicken Mauern. Ein geheimnisumwobener Ort mit verborgenen Gängen, mit vermoderten Leichen hinter der hölzernen Täfelung, mit Skeletten unter den Steinfliesen des Fußbodens und voller dunkler Erinnerungen an Jahrhunderte währenden Mord.
Erst vor einem Jahr war der vorige Besitzer in seinem historischen Himmelbett erwürgt worden, ein Ereignis, das sich gut in die Tradition des Hauses einfügte.
Frydenholm sollte auch in Zukunft eine Heimstatt des Verbrechens sein.
2
Die erste Spazierfahrt, die Graf Rosenkop-Frydenskjold durch das Dorf unternahm, ging nicht in einer vierspännigen Kutsche vor sich, wie viele es zu sehen erwartet hatten, sobald wieder ein Graf auf Frydenholm wohnen würde.
Der junge Graf kam auf einem Traktor mit hoher Geschwindigkeit im Zickzack angefahren. Darunter litten die kleinen Zäune vor den Häusern, erst auf der einen Seite der Straße, dann auf der anderen. Höschen-Marius’ weißgestrichener Zaun zersplitterte, die Ligusterhecke der alten Emma schräg gegenüber wurde flachgedrückt, und ihr Grünkohl und die roten Bete und der Porree wurden tief in die gutgedüngte Erde gepreßt. Danach wurde die Gartentür des Doktors abgerissen und Rasmus Larsens Steinmauer umgeworfen, und schließlich landete das gräfliche Fahrzeug in Bäcker Andersens neuer Spiegelglasscheibe zwischen Kuchen und Schokoladenfiguren.
Höschen-Marius kam zum Vorschein, groß, schwer, mit hängendem Schnurrbart und feuchter Nase, starrte verwundert auf die seltsame Fahrspur und fühlte trotz des Erschreckens eine Art Wohlbehagen in seinem langen Körper, weil ein Graf ihm so nahe gewesen. Doch die alte Emma war wütend, sie schimpfte und wetterte über die Zerstörung der Ligusterhecke und der Gemüsepflanzen, die sie so sorgsam mit dem Latrineneimer gepflegt hatte. „Ist das eine Art, so zu fahren?“ schrie sie. „Ist denn auf der Straße nicht genügend Platz? Da hat man den Porree gegossen und gedüngt, und dann kommt so ein Affe und macht alles kaputt! Und meine schöne Ligusterhecke!“
„Das war der Graf“, sagte Höschen-Marius.
„Ich scheiß was auf den Grafen! Er soll mit seinem elenden Schlitten nicht anderer Leute Ligusterhecken kaputt fahren“, antwortete Emma respektlos; sie war wütend und vergaß, daß sie einmal dem Nähzirkel der Damen angehört und im Pfarrhaus verkehrt hatte.
Der Doktor war nicht zu Hause, dafür eilten Bäcker Andersen und Frau Andersen herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Aber dem Grafen war nichts zugestoßen, und als man ihn stützen und ihm das in solchen Fällen übliche Glas Wasser aufdrängen wollte, verlangte er ein Bier. Man holte rasch ein paar Flaschen und trank zwischen Glasscherben und zerdrücktem Butterkuchen, und der Graf war natürlich und jovial, trank aus der Flasche, stieß mit dem Bäcker an und duzte ihn, als wäre er seinesgleichen. Der Graf war nicht hochmütig, und es wurde mehr Bier geholt, und der Graf pißte demokratisch in den Bäckerladen, bevor er beschloß, aufzubrechen und sich zurück ins Schloß zu begeben, ehrerbietig von Andersen gestützt.
Alles wäre friedlich und ruhig verlaufen, wäre nicht Landpolizist Hansen zufällig auf dem Rad vorbeigekommen, der sich über den Traktor im Schaufenster, die umgeworfenen Zäune und die breitgetretenen Torten dann doch reichlich wunderte. Er hörte sich Emmas heftige Klagen an und hielt es für notwendig, Anzeige über die Sache zu erstatten. Dadurch wurde der kleine Spaß in weiteren Kreisen bekannt. Einige Lokalzeitungen schrieben darüber, und der Graf mußte später eine Geldstrafe von einhundert Kronen an die Staatskasse zahlen.
„Was da für Papier verbraucht wird!“ sagte Niels Madsen. „Papier und Anzeigen und Schreibereien: Das ist das System‘! Dafür verschwendet man das Geld der Steuerzahler! Und die Juden müssen schließlich etwas haben, worüber sie in ihren Zeitungen schreiben können!“
„Aber Redakteur Jörgensen vom Kreisblatt ist ja nun wirklich kein Jude“, wandte seine Frau ein.
„Er wird wohl doch einer sein!“ erwiderte Niels Madsen.
„Hast du eigentlich jemals einen Juden gesehen?“ fragte seine Frau verdrossen.
„Was heißt gesehen? Ich habe sie nicht direkt gesehen. Aber man fühlt sie doch immerzu. Sie haben sich überall eingeschlichen. Der eine hilft dem anderen hinein. Sie sitzen in ihren Geschäftshäusern dort in Kopenhagen und bestimmen alles. Sie beherrschen die Hochfinanz und die Zeitungen und die Banken und alles!“
„Skjern-Svendsen war doch auch kein Jude“, sagte Frau Madsen. „Er war nur Jüte. Und er besaß Güter, Webereien, die Knopffabrik und die Textilfabrik und was weiß ich noch alles.“
„Skjern-Svendsen vielleicht nicht. Aber die anderen. An wen, glaubst du, zahlen wir Zinsen, wenn nicht an die Juden? Und wer, glaubst du, regiert die Gewerkschaften und macht den Sozialismus?“
„Hier regiert ja Rasmus die Gewerkschaft“, sagte Frau Madsen stur. „Ich habe nie gehört, daß er Jude sein soll. Er geht in die Kirche und ißt Schweinebraten, und Juden dürfen kein Schweinefleisch essen.“
„Du kannst Gift darauf nehmen, daß sie Schweinefleisch essen“, sagte Niels Madsen. „Sie sitzen auf Schweinefleisch und fressen es auch. Es sind gerade die Juden da drüben in England, die unseren feinen Schinken fressen, ohne etwas dafür zu bezahlen!“
Rasmus Larsen brachte seine Mauer wieder in Ordnung und die herausgerissenen Steingartenpflanzen und immergrünen Gewächse wieder in die Erde. „Hierzulande sind alle vor dem Gesetz gleich“, sagte er. „Bei uns herrscht Demokratie. Auch ein Graf wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er die Verkehrsregeln verletzt. Wir sitzen doch alle im selben Boot, ohne Ansehen der Person. Da werden keine Unterschiede gemacht.“
Und Bäcker Andersen bekam seine Scheibe erstattet, und Höschen-Marius seinen Zaun und der Doktor seine Gartentür. Aber die Ligusterhecke der alten Emma wurde nicht für so wertvoll befunden, daß man dafür eine Entschädigungssumme festsetzte. Sie würde wohl auch von selbst nachwachsen.
„Es gibt kein Recht für die Armen!“ jammerte Emma. „Und der schöne Porree, der bis zum Herbst so dick wie ein Arm werden sollte! Der soll nichts wert sein, wo ich ihn so gedüngt habe! Nein, es ist schon so, wie im Psalm geschrieben steht: Unrecht spricht man jetzt statt Recht!“
„Bist du vielleicht Bolschewik geworden, Emma, wie Martin Olsen?“ fragte Rasmus. „Ist es Margrete, die es dir eingibt?“
„Nein, das bin ich nicht! Und ich habe auch keine Ahnung, wovon du sprichst. Und du sollst nicht grob werden, Rasmus, und anderen irgend etwas nachsagen! Denn ich habe dich schon gekannt, als du noch so klein warst, daß du deine Hosen nicht alleine zuknöpfen konntest!“
Obwohl der Graf bescheiden und natürlich sein konnte, auf dem Traktor fuhr und mit den Leuten Bier trank: er hatte Stil. Als natürlicher Abkömmling eines oldenburgischen Königs stand ihm das Recht zu, seine Lakaien rote Livree tragen zu lassen. Ein neuer, aristokratischer Geist war auf dem alten Herrenhof eingezogen. Die kleinliche Knauserei und die Schnüffelei in der Speisekammer, der sich der verstorbene bürgerliche Gutsbesitzer hingegeben hatte, war vorbei. Der Graf überwachte die Arbeit auf dem Gut, er ritt auf die Felder hinaus und munterte die Leute auf, doch er mischte sich nicht in die Haushaltsführung ein und zählte nicht die Zuckerstücke in der Tüte.
Zu Skjern-Svendsens Zeiten hatte es nur einen einzigen Diener im ganzen Schloß gegeben, einen wortkargen, bleichen Mann namens Lukas. Er durfte bleiben, obwohl er eine undurchsichtige Vergangenheit und ein schlechtes Führungszeugnis hatte. Aber mit Graf Preben kamen mehrere neue Diener nach Frydenholm, kam ein neuer Verwalter, der in Deutschland ausgebildet worden war, kamen ein neuer Großknecht und eine Anzahl neuer Knechte. Es waren besonders ausgesuchte Leute, die der Graf eingestellt hatte, Leute mit Schneid; sie schlugen die Hacken zusammen, daß es knallte, und grüßten militärisch, wenn ihr Herr seine tägliche Runde ritt.
Es kam auch vor, daß der Graf die Leute im Hof antreten ließ, mit weißen Hemden, schwarzem Schlips und Mützen und blankgewienerten Schaftstiefeln. Sie machten unter dem Kommando des Verwalters Freiübungen und marschierten und exerzierten mit Spaten, als seien es Gewehre. Sie machten „rechtsum“ und „linksum“, formierten sich zur Kolonne und sangen: „In allen Reichen und Ländern ...“ Der Graf sah von der Schloßtreppe aus zu und grüßte seine Leute mit erhobener rechter Hand, wenn sie den Spaten präsentierten.
Graf Preben war nicht verheiratet. Er nahm seine Mahlzeiten gewöhnlich ganz allein im großen Speisesaal des Schlosses ein, wo altersdunkle Ahnen von den Wänden auf ihn niedersahen. Dabei ging es ganz feierlich zu. Jeden Abend setzte er sich in braunem Smoking und weißem Seidenhemd zu Tisch und ließ sich das Essen auf silbernen Tellern servieren. Wenn der junge Mann von einer Speise genug hatte, klatschte er in die Hände, und der Diener, der mit dem nächsten Gang bereitstand, kam eilends herein und richtete an. Neben dem Stuhl des Grafen lagen zwei große Schäferhunde; sie bekamen die gleichen Speisen auf den gleichen silbernen Tellern serviert und wurden vom dienenden Personal mit der gleichen Ehrerbietung behandelt.
Der Graf war ein großer, hellblonder junger Mann, fast weißblond, mit hellblauen Augen und ohne Brauen. „In dem Mann steckt Rasse!“ sagte Niels Madsen, der dunkel war und wie ein Zigeuner aussah. „Das ist echt nordische Gestalt. Das ist die Sorte Mann, die berufen ist, Männer zu führen!“
Der junge Führer sprach den weichen fünischen Dialekt, der zu Hause im Stall des Familiengutes in der Nähe von Assens gesprochen wurde. Den größten Teil seines Wissens hatte er im Pferdestall erworben, und er liebte Pferdegeschirr und Reitstiefel und Wichse. Dienende Geister hatten sich um seine Erziehung gekümmert und ihn gelehrt, Tabak zu schnupfen und Karten zu spielen. Von seinen Eltern hatte er nie viel gemerkt; sie waren ständig beschäftigt gewesen; Reisen und Gesellschaften, der Hofdienst und die rätselhaften Pflichten eines Kammerherrn hatten ihre Zeit in Anspruch genommen. Der Junge wurde vernachlässigt und war einsam, er war groß und stark für sein Alter, aber unbeholfen und bemitleidenswert. Er fürchtete sich vor den Gänsen des Gutes und hatte das Pech, bei allem, was er tat, zu Schaden zu kommen.
Nachdem sich eine Anzahl ehrerbietiger und geduldiger Hauslehrer mit ihm beschäftigt hatte, gelang es, den Jungen im Internat Herlufsholm unterzubringen, aber schon nach zwei Jahren mußte man ihn auf eindringliches Ersuchen des Rektors von dort wieder wegnehmen, da ihn die anderen Jungen schrecklich mißhandelten. Danach blieb er als Eleve zu Hause auf dem Gut, war aber vor allem damit beschäftigt, einen Truthahn zu ärgern und einen im Schloß angestellten Jungen zu tyrannisieren, der nicht zurückzuschlagen wagte. Auf diese Art bereitete er sich darauf vor, einmal den Gewinn, den einige der größten Güter des Landes abwarfen, zu vereinnahmen.
Nach einigen kleineren, inzwischen vergessenen Skandalen beschloß der alte Kammerherr, seinen Sohn nach England zu schicken, damit er sich dort bei den adligen Verwandten gute Manieren und britisches Benehmen aneigne, das ihm das Stallpersonal zu Hause auf Fünen nicht so recht beizubringen vermocht hatte. Graf Preben war neunzehn Jahre alt, als er nach England fuhr, ein großer, blonder Bauernjunge mit einem stets verwunderten Gesicht und unberechenbaren Armbewegungen.
Er verbrachte gut zwei Jahre unter Britanniens Nobilität und wurde in aller Eile zum Gentleman ausgebildet. Als er zum fünischen Stall zurückkehrte, war er volljährig und somit berechtigt, über sehr bedeutende Mittel zu verfügen. Er empfand daher bald den Stall als zu eng und den Umgang mit dem Stallknecht als unzureichend. In den folgenden Jahren hielt er sich meistens in der Hauptstadt auf, wo er viele Dinge studierte und die verschiedenartigsten Freunde fand.
In einem konservativen Jugendkorps bildete er sich seine politische Meinung. Der alte Kammerherr unterstützte die Organisation idealistisch. Ihre Mitglieder trugen grüne Hemden und schwarze Schaftstiefel–nach dem Vorbild der rumänischen Eisernen Garde – und grüßten einander römischgermanisch. Da diese Organisation ihr Hauptquartier in der Store Kannikestræde in der Altstadt hatte, geschah es häufig, daß die jungen uniformierten Herren nach ihren Zusammenkünften auf die jüdischen Bewohner des Krystalgade-Viertels trafen und jugendliche Späße mit ernsthaften alten Männern trieben. Diese abendlichen Zerstreuungen gaben Anlaß zu Klagen und Leserbriefen und zu kritischen Artikeln in der radikalen Presse.
Der Grafentitel und die außergewöhnliche Blondheit verliehen ihm im Kreise der kecken „KUer“, wie die Grünhemden sich nannten, großes Ansehen. Aber auch unter den Zivilisten in den Weinstuben des Viertels wurde der junge Graf populär; er lernte eine ganze Reihe interessanter Persönlichkeiten kennen, die später in der Öffentlichkeit und im verborgenen eine Rolle spielen sollten.
3
Der verstorbene Gutsbesitzer Skjern-Svendsen hatte ursprünglich beabsichtigt, das restaurierte Hauptgebäude von Frydenholm – mit den eingemauerten Skeletten und der Sammlung deutscher feudalgeschichtlicher Denkmäler – nach seinem Tode in ein nationales Museum unter staatlicher Verwaltung umwandeln zu lassen, in ein machtvolles Monument zu Ehren der schöpferischen Tätigkeit der Gutsherren und ihres Einsatzes für die dänische Kultur.
Das alte Schloß hatte in der Geschichte des Landes eine Rolle gespielt. Während des Schwedenkrieges im Jahre 1658 hatte Frydenholm Offiziere des schwedischen Heeres als Gäste in seinen Mauern gesehen. Der berühmte Oberst Sparre und seine Dragoner hatten längere Zeit hier in Quartier gelegen, und der damalige Herr des Gutes war ihnen ein heiterer und hilfreicher Wirt gewesen. Das Haus hatte Traditionen. Sogar der Schwedenkönig Karl X. Gustav hatte eine Nacht auf Frydenholm verbracht und im selben Himmelbett geschlafen, in dem Skjern-Svendsen nun erwürgt worden war.
Der verstorbene Gutsbesitzer hatte sein Vermögen nicht nur für sich selbst angehäuft. Er war ein Idealist gewesen. Erst nach seinem Tode wurde bekannt, daß Skjern-Svendsen die mystische Person war, die unter dem Decknamen Danielsen den wohltätigen Institutionen große Summen hatte zukommen lassen. Anonym hatte er die Errichtung der beliebten mittelalterlichen Wegkruzifixe finanziert, die vor allem von amerikanischen Touristen bewundert werden und die, wie man sagt, so gut in die dänische Landschaft passen. Der Gutsbesitzer hatte auch geplant, in einem anderen Besitz, dem Gut Halling in Nordjütland, eine Internatsschule für Jungen einzurichten, denen seine besondere Aufmerksamkeit galt. Auf diese Weise wollte er sich – wie seinerzeit Herluf Trolle – selbst ein Denkmal setzen. Die Internatsschule auf Halling sollte selbstverständlich christlich sein. Die Innere Mission hatte Skjern-Svendsen sehr am Herzen gelegen. Er war Pastor Nørregaard-Olsen ein guter Helfer im Kampf für das Reich Gottes in dieser Gegend gewesen. Das neue Missionshaus war ganz und gar sein Werk, und bei der Instandsetzung der Kirche hatte er über die Hälfte der Unkosten getragen.
Skjern-Svendsen hatte viele Pläne betreffs seines sehr großen Vermögens gehabt, das er hier auf Erden einmal hinterlassen mußte. Er wollte auch nach seinem Tode noch darüber verfügen. Einiges hatte für den Bau und die Ausstattung des Grabhügels Verwendung gefunden und wurde nun durch bombensicheren Beton vor der Vergänglichkeit bewahrt. Anderes sollte in die Ewigkeit hinein wirken. Er hatte Legate und Schenkungen für gute Zwecke vorgesehen und nicht einen Augenblick lang vergessen, daß die Ewigkeit länger währt als das Erdenleben und daß ein kluger Geschäftsmann auf lange Sicht disponieren muß. Und wenn ein Ordnungsmensch wie Skjern-Svendsen es nicht geschafft hatte, alles zu einem rechtsgültigen Testament zusammenzustellen und sichere, unzweideutige Bestimmungen zu treffen, dann nur, weil das Verhältnis zu seiner um zwanzig Jahre jüngeren Frau Julie zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht zufriedenstellend geordnet war.
Bevor das Testament endgültig formuliert werden konnte, mußte die Abfindung von Frau Julie geregelt sein. In der Gegend war allgemein bekannt, daß der Gutsbesitzer und die gnädige Frau seit Jahren jeder in seinem Teil des Schlosses gewohnt und einander nicht besucht hatten. Der Gutsbesitzer hatte seinen bleichen Diener; was die gnädige Frau hatte, mochten die Götter wissen. Man erzählte, sie habe in den letzten Jahren stark unter dem Einfluß eines rätselhaften Doktors in Kopenhagen gestanden und ihn jeden Montag und Mittwoch besucht, um sich einer eigentümlichen Behandlung zu unterziehen. Durch einen Beobachter hatte der Gutsbesitzer von der Art dieser Behandlung erfahren; unmittelbar vor seinem Tode war er damit beschäftigt gewesen, Maßnahmen gegen seine Frau einzuleiten, die seiner Überzeugung nach unzurechnungsfähig war. Bei der polizeilichen Untersuchung anläßlich seines Todes stellte es sich heraus, daß er ernsthaft versucht hatte, sie als allgemeingefährlich in eine Nervenheilanstalt einliefern zu lassen. Vielleicht wäre ihm das geglückt, wenn nicht der verrückte Gärtner Holm seinem tätigen Leben vorzeitig ein Ende gesetzt hätte.
So war es gekommen, daß es keine testamentarischen Bestimmungen gab, und Frau Julie Skjern-Svendsen wurde Alleinerbin, ohne daß man sie entmündigt oder ihre Bewegungsfreiheit auch nur eingeschränkt hatte. Da die junge Witwe unter gar keinen Umständen das düstere Schloß, in dem so unheimliche Dinge geschehen waren, weiterhin bewohnen wollte, übertrug sie das Gut ihrem jüngeren Bruder, der so dazu kam, noch zu Lebzeiten des alten Kammerherrn seine Fähigkeiten zum Führen und Administrieren unter Beweis stellen zu können. Wenn der Kammerherr verschied, würde Graf Prebens Besitz um drei Familiengüter erweitert werden, eins auf Fünen und zwei in Jütland. Eine schwere Bürde und eine große Verantwortung lasteten auf den hängenden Schultern des jungen Grafen.
Zur Bürde des Besitzes gesellten sich Vertrauensposten in politischen Organisationen und landwirtschaftlichen Interessengemeinschaften. Von der Konservativen Jugend war er ganz selbstverständlich in die neugegründete DNSAP hinübergeglitten, wo man braune Hemden statt der grünen trug, im übrigen aber auf die gleiche römisch-germanische Art grüßte. Und nachdem der Graf Frydenholm übernommen hatte, übernahm er auch den Posten des Gauleiters seiner Partei von Süd-Seeland. Als praktischer Landwirt war er Mitglied der „Vereinigung der Landwirte“ oder „VdL“, in der viele große und einige kleine Landwirte damals Beistand in landwirtschaftlichen Fragen suchten und in der auch der kleine Nachbar des Grafen, Bauer Niels Madsen, seit einigen Jahren tätig war.
Dazu kam ein neuer Vertrauensposten als Kreisleiter in einer eben gegründeten geheimnisvollen Organisation, deren Namen – „Zivilorganisation“ oder „ZO“ – nur einigen Eingeweihten geläufig war, über deren Umfang und Beschaffenheit aber nicht einmal die Kreisleiter Bescheid wußten und deren Mitglieder einander nicht kannten.
Andere Kreisleiter waren biedere Wasserbaumeister, Hafenaufseher, Dünenaufseher und Oberförster, die in ihrer Unschuld glaubten, sie dienten Alt-Dänemark, wenn sie Meldungen über mystische Vorkommnisse innerhalb ihrer Dienstbereiche an Polizeianwalt Drössaa sandten, der vor kurzem von einem Studienaufenthalt in Deutschland zurückgekehrt war, oder an den geheimnisvollen Schriftsteller François von Hahn, der für alle Fälle als Verlagslektor getarnt war und seine Karteien in einem schönen, alten Büro in der Købmagergade, unweit des Runden Turmes, betreute.
Die guten Wasserbaumeister, Hafenaufseher, Dünenaufseher und Oberförster samt einem weniger guten Bischof gehörten zum sogenannten äußeren Kreis und wußten nicht, daß es einen geheimeren inneren Kreis und einen sehr robusten Mobilkreis gab. Sie alle waren zum Schein Mitglieder eines Schmetterlingsvereins und trugen zuweilen ein Abzeichen, auf dem ein Ligusterschwärmer zu sehen war, das gegebenenfalls als Erkennungszeichen dienen und sie bei ihrer patriotischen Tätigkeit vor dem Zugriff der Polizei des Landes schützen würde. Die Polizeimeister hatten den Befehl erhalten, den Ligusterschwärmer zu respektieren, auch wenn sie sich hin und wieder versucht fühlen sollten, einige zu verhaften, die das hübsche kleine Abzeichen trugen.
Es war eine Enttäuschung für Pastor Nørregaard-Olsen, daß der Graf sich nicht wie sein Vorgänger auf Frydenholm für die Innere Mission und das Wachsen des Reiches Gottes in der Gegend interessierte. Sonntag für Sonntag stand der gräfliche Stuhl in der Kirche leer, und das war ein schlechtes Beispiel für die Gemeinde. Die Arbeit, der sich der Pfarrer mit so großer Energie und mit viel Organisationstalent widmete, seit er sein Amt angetreten hatte, ging in der letzten Zeit nicht mehr so recht voran. Der frische Windhauch wehte nicht mehr über dem Kirchspiel.
Das Hinscheiden des Gutsbesitzers Skjern-Svendsen war ein harter Schlag gewesen. Man vermißte nicht nur das Vorbild, die Autorität und die ökonomische Hilfe des Gutsbesitzers; der Umstand, daß sein Mörder einer der ergebensten Diener der Mission gewesen war, säte Zweifel und Unwillen in viele Herzen. Hier hatte der Teufel einen persönlichen Sieg errungen. Zwar war bei der Verhandlung festgestellt worden, Gärtner Holm habe sein entsetzliches Verbrechen in einem Anfall von religiösem Wahnsinn begangen, aber das machte die Lage nicht besser. So etwas konnte also auch geschehen. Auch die Religion konnte man übertreiben. Viele Eltern zögerten nun, ihre Töchter Mitglied der Jugendabteilung werden und an den ekstatischen Abendgottesdiensten teilnehmen zu lassen. Die JA-Gymnastik ging zurück, und die JA-Handballmannschaft löste sich auf.
Die Reihen lichteten sich. Die Frau des Gärtners war nach der Urteilsverkündung – ihr Mann wurde in eine Irrenanstalt eingeliefert – weggezogen. Auch ihre Tochter Johanne gehörte nicht mehr zum Reich Gottes, seit sie mit Oscar von der Molkerei verheiratet war und schon vier Monate nach der Hochzeit einen kleinen, sommersprossigen Sohn bekommen hatte. Dieser Oscar, er stammte aus Kopenhagen und war neu in der Gegend, also fast ein Ausländer, gehörte ja zu den Roten. Und was die Eltern Johanne an christlichem Gehorsam gelehrt hatten, kam nun dem Antichrist zugute. Früher hatte Johanne Pastor Norregaard-Olsens kleines Kirchenblatt ausgetragen, jetzt fuhr sie am Sonntagvormittag mit dem Rad von Haus zu Haus und verkaufte das „Arbejderbladet“. Sie war ein fügsames Wesen, das tat, was man ihm sagte.
Der Nähzirkel der Damen wurde immer kleiner. Frau Bäcker Andersen und Frau Hofbesitzer Madsen waren unter den letzten, die standhielten. „Frau Andersen und Frau Madsen sind der feste Stamm“, sagte der Pfarrer mit müdem Lächeln. Frau Andersen brachte noch immer Kranzkuchen zu den Abenden des Nähzirkels im Pfarrhaus mit und die anderen Damen abwechselnd die Kaffeebohnen, doch die reichten meistens geradeso aus, und für den Haushalt des Pfarrers blieb keine Bohne mehr übrig.
Auch Höschen-Marius’ Haushälterin hielt dem Zirkel die Treue und brachte eingeweckte Erdbeeren und Johannisbeergelee mit ins Pfarrhaus; doch die Zeit würde bald kommen, wo sie nicht mehr Haushälterin war, denn das Aufgebot für sie und Marius war bereits bestellt. Die Damen betrachteten ihre Figur, doch die sah unverändert aus; wie sollte wohl auch ein fruchtbares Zusammenleben mit Marius möglich sein, der sich nicht für den Menschen zu interessieren schien, sondern nur für die äußere Hülle, der des Nachts herumschlich und weibliche Unterbekleidung anfaßte, die zum Trocknen aufgehängt war. Und ob die Haushälterin wohl dem Reich Gottes und dem Nähzirkel treu bliebe, wenn sie erst einmal Frau Petersen war?
Marius, den man für gerettet hielt, war nämlich abtrünnig geworden; er kam nicht mehr zur Bibellesung und saß sonntags nicht mehr Bonbons lutschend in der Kirche. Er hatte plötzlich die Überlegenheit und historische Bestimmung der arischen Rasse erkannt, um Aufnahme in Dänemarks Nationalsozialistische Arbeiterpartei gebeten und kämpfte nun aktiv für die moralische Wiedergeburt des dänischen Volkes und für die nationalsozialistische Weltanschauung. Im Gegensatz zu Niels Madsen, der es fertigbrachte, zugleich Nationalsozialist und Christ zu sein, wurde Höschen-Marius eine Art Heide, allein vom Bewußtsein der Vorzüglichkeit seiner Rasse erfüllt. Die Haushälterin behauptete zwar, er sage noch immer sein Abendgebet mit so lauter Stimme her, daß man es nebenan hören könne, aber wer wußte, ob er nicht zu Odin und Thor betete.
Vielleicht hatte es Marius erschüttert, daß er verhaftet und eines Mordes verdächtigt worden war, den der fromme Gärtner begangen hatte, vielleicht hatte das ihn zum Feind der Religion gemacht. Im übrigen fiel es Marius wohl schwer, sich mit mehr als einem großen Gedanken auf einmal zu beschäftigen. Der Gedanke der Volksgemeinschaft und der Bedeutung seiner Rasse erfüllte ihn ganz und gar und ließ keinen Raum für christliche Demut.
Außer Marius war damals ein anderer unschuldiger Mann im Zusammenhang mit dem Mord an Gutsbesitzer Skjern-Svendsen verhaftet worden. Er hieß Olsen, war einmal Diener auf Frydenholm gewesen und ebenso wie Lukas vorbestraft. Der Gutsbesitzer hatte es vorgezogen, vorbestrafte Personen in Lohn und Brot zu haben. Zwischen Olsen und Skjern-Svendsen hatte ein merkwürdiges freundschaftliches Verhältnis bestanden, und in den letzten Lebensjahren des Gutsbesitzers hatte Olsen gewisse geheime Geschäfte zu erledigen gehabt. Olsen verfügte über viele Verbindungen und kannte alle Winkel und Geheimnisse des weitläufigen Schlosses.
Die Mordnacht hatte Olsen auf Frydenholm verbracht, und die Umstände seines Tuns in dieser Nacht waren so verdächtig gewesen, daß die Polizei überzeugt war, niemand anderes könne der Täter sein. Kommissar Odense hatte keine Bedenken gehabt, der Presse die Mitteilung zugehen zu lassen, das Rätsel sei gelöst und der Beweis völlig klar und unumstößlich, obwohl der halsstarrige und verstockte Täter mit dem Geständnis noch zögere. Hätte sich Gärtner Holm nicht selbst dem Ortspolizisten gestellt, wäre möglicherweise Olsen als Mörder verurteilt worden.
Nachdem der Gutshof seinen Besitzer gewechselt hatte, gab es wohl keinen, der noch damit rechnete, Olsen in dieser Gegend wiederzusehen. Eines Tages aber fand er sich mit einem besonderen Anliegen wieder in Frydenholm ein.
4
Für Egon Charles Olsen hatte sich die anfängliche Gefahr auf wunderbare Weise in einen dauerhaften Vorteil verwandelt.
Aus seiner Zelle im Vestre Fængsel wurde er, wie schon so oft, zum Polizeipräsidium gebracht. Das geschah Ende November 1938 – fast drei Wochen nachdem man Gutsbesitzer Skjern-Svendsen erwürgt in seinem Himmelbett aufgefunden hatte –, und die Frist für die Untersuchungshaft war nahezu abgelaufen. Olsen kannte die Route, und obwohl die Grüne Minna keine Fenster hatte und Luft nur durch eine kleine Luke hereindrang, konnte er nach den Straßengeräuschen genau bestimmen, auf welchem Abschnitt der Strecke sie sich gerade befanden.
Er trug Zivilkleidung; wattierte Schultern, scharfe Bügelfalten, großgestreifter Schlips, ein farbiges Seidentuch, dekorativ in der Brusttasche arrangiert. Sein Haar war pomadisiert, es duftete angenehm und glänzte. Die Untersuchungshaft hatte ihn ein wenig blaß gemacht, ein beleidigtes Lächeln lag auf seinen Zügen. Er ging wie einer, der sich auskennt, neben seinem Begleiter über die gewundenen Sandsteintreppen und durch die langen, mit Fliesen belegten Korridore, die von antiken Bronzeampeln erhellt wurden. Der Begleiter schien ein wenig im Zweifel zu sein über den Weg, sie schritten langsam durch die öden Flure, die an die Katakomben unter dem alten Rom erinnerten und wie Stollen wirkten, die in die Steinmasse des Gebäudes gehauen waren. Als sie in einen kleinen Seitengang einbogen, war sich Olsen im klaren, daß sie nicht den üblichen Weg zu Kommissar Odenses Vorzimmer wanderten, in dem die Verhöre sonst immer stattfanden.
Das Innere des Polizeipräsidiums ist ja bekanntlich kompliziert und geheimnisvoll, und nicht einmal der Reichspolizeichef kennt die Geheimnisse dieses Bauwerkes bis ins letzte. Olsen wußte zwar dort drinnen auf Grund seiner dunklen Vergangenheit recht gut Bescheid, ja, er fühlte sich in dem klassischen Labyrinth beinahe heimisch, auf dieser Wanderung jedoch bemerkte er mit einem gewissen Unbehagen, daß er sich auf fremdem Grund befand.
Sie waren in einem Teil des Polizeipräsidiums angelangt, zu dem gewöhnliche Häftlinge keinen Zutritt hatten. Die Wanderung endete schließlich vor einer hohen, kretischen Tempeltür, auf der mit schmalen patinierten Buchstaben stand:
ABTEILUNG D
2. Inspektorat der Kopenhagener Polizei
Kriminalpolizei
Olsen hatte im Laufe der Jahre ziemlich viel mit der Kriminalpolizei zu tun gehabt, doch diese Abteilung kannte er nicht. Nun ja, Olsen war bei weitem nicht der einzige Bürger des Landes, der von dem stillen Dasein der Abteilung D nichts wußte. Das war keine nach außen glänzende und prahlende Abteilung. Sie führte ein zurückgezogenes Dasein und widmete sich besonderen Angelegenheiten, die nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen sollten.
Kurz zuvor hatte der Chef der Abteilung zurücktreten müssen, da ein Unglück bei der Entführung eines deutschen Emigranten das Schweigen um seine Tätigkeit gebrochen hatte; dieser sprachbegabte Detektiv beschäftigte sich zur Zeit mit einigen alten chinesischen Handschriften, die zu untersuchen eigentlich gar nicht Aufgabe der Polizei war. Seitdem verwaltete der beliebte Kommissar Horsens die Karteien der kleinen Abteilung.
Kommissar Horsens war ein warmherziger Jüte mit einem vertrauenerweckenden Dialekt und freundlichen blauen Augen. Ein solider, breiter, sonnengebräunter Mann von ländlich-ehrlichem Aussehen, derb und geradezu. Diesem treuherzigen Jüten gegenüber lechzte sogar der verstockteste Verbrecher danach, sein Gewissen zu erleichtern und seine Sünden zu gestehen. Aber der Kommissar wünschte von Olsen gar keine Geständnisse.
Als Olsens Begleiter, nachdem er angeklopft hatte, die Tempeltür öffnete, verabschiedete sich gerade ein kleiner Mann von dem Kommissar. Er begegnete Olsen in der Tür, die beiden sahen einander einen Augenblick an, ließen sich aber nicht anmerken, daß sie sich kannten. Der Mann, der hinausging, war ein schmächtiges Kerlchen mit unsteten Augen und beinahe schwachsinnigem Gesichtsausdruck. Er ging frei und ohne Begleiter und schien den Weg durch das Labyrinth des Gebäudes allein finden zu können.
Kommissar Horsens betrachtete Olsen gütig und bat ihn mit einer väterlichen Handbewegung, auf einem pompejanischen Stuhl Platz zu nehmen.
„Na, den Mann kannten Sie wohl?“ fragte er.
„Ich glaube, ich habe ihn schon einmal gesehen“, mur melte Olsen.
„Kennen Sie ihn gut? Hatten Sie etwas mit ihm zu tun?“ fragte der Kommissar bekümmert.
„Nein“, sagte Olsen rasch. „Ich habe nie mit ihm zu tun gehabt. Ich habe ihn in einer Kneipe getroffen.“
„Im ,Fidusen‘ vielleicht?“
Olsen meinte, es könne im „Fidusen“ gewesen sein, und wunderte sich, daß die Polizei sein Stammlokal kannte.
„Aber Sie wissen, wer es ist?“
„Ich glaube, man nennt ihn ,die Banane‘. Oder ,die kleine Banane‘.“
„Das ist wohl ein recht übler Kerl, diese Banane“, sagte der Kommissar betrübt. „Aber Böses soll mit Bösem vertrieben werden, wie das alte Sprichwort sagt.“
Olsen verstand nicht ganz der dunklen Bede Sinn. Er sah sich im Zimmer um. Es war recht gemütlich. Auf dem Fensterbrett standen zwei leere Bierflaschen. Und auf dem Schreibtisch des Kommissars stand eine Vase mit kleinen gelben Blumen neben der eingerahmten Fotografie einer Frau und zweier süßer Knirpse, denn der Kommissar war ein guter Familienvater und ein Kinderfreund. Es war schön warm im Zimmer und duftete nach gutem Tabak. Der Kommissar hatte seine blaue Jacke auf einen Bügel gehängt und saß in Weste und Hemdsärmeln mit Ärmelhaltern da. Er trug einen maschinengebundenen schwarzen Schlips mit Gummizug.
„Ja, Sie können gehen“, sagte er zu Olsens Begleiter. „Herr Olsen und ich wollen ganz vertraulich ein bißchen über verschiedene Dinge sprechen. Haben Sie übrigens heute schon Kaffee getrunken, Olsen?“
Bei dem Wort Kaffee wurde Olsen wachsam. Er wußte aus Erfahrung, daß Kaffee und Zigaretten im Polizeipräsidium zu den primitiveren Lockmitteln gehörten. Der Kommissar sah sofort, daß sich das Gesicht des Häftlings verschloß, und er beruhigte ihn mit seinem herzlichen, jütischen Lächeln.
„Nein, nein, vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben! Ich will Ihnen nichts tun. Auf mich können Sie sich verlassen, Olsen, und es tut doch gut, wenn ein Mensch dem anderen vertrauen kann! So etwas wärmt hier drinnen“, sagte der freundliche Jüte und legte die Hand auf die Westentasche.
Da Olsen ihn alles andere als vertrauensvoll anblickte, lehnte sich Kommissar Horsens zu ihm hinüber und sagte: „Schauen Sie, Olsen, ich glaube, ich habe Ihnen etwas sehr Angenehmes mitzuteilen.“
„Soso“, brummte Olsen.
„Ja, hören Sie. Vor wenigen Stunden hat ein Mann in Præstø im Verhör gestanden, den Gutsbesitzer Skjern-Svendsen ermordet zu haben. Was sagen Sie dazu, Olsen?“
„Wer war es?“ fragte Olsen sofort. „War es Lukas?“
„Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Olsen. Sie können es ja selbst hier lesen, es steht schon in der Zeitung.“ Der Kommissar reichte ihm ein Nachmittagsblatt. „Bitte schön.“
Olsen las: Heute um elf Uhr wurde Gärtner Holm dem Untersuchungsrichter vorgeführt, wobei er sein Geständnis wiederholte . . .
„Gärtner Holm! Da soll doch der Teu . . . Das ist merkwürdig. Gärtner Holm . . .“
„Ja, es ist merkwürdig, wie die Menschen sein können“, sagte Kommissar Horsens traurig. „Der Mann scheint verrückt zu sein. Die Religion ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Man kann ja alles übertreiben. Kannten Sie ihn?“
Olsens Gefängnisblässe war plötzlich verschwunden. Seine Wangen bekamen Farbe. „Ich verlange, sofort freigelassen zu werden! Ich habe hier drei Wochen unschuldig gesessen! Ich habe ja von Anfang an gesagt, daß ich unschuldig bin! Kann man einen Menschen so behandeln? Gibt es Recht und Gesetz hier im Lande? Ich werde an meinem Arbeitsplatz vor den Augen meines Chefs verhaftet und als Mörder ins Gefängnis geschleppt! Ich verlange Schadenersatz! Ich will das hier bezahlt haben! Für unverschuldete Untersuchungshaft und verlorengegangenen Verdienst! Und Schmerzensgeld! Ich muß sofort mit meinem Verteidiger sprechen!“ Der Kommissar lächelte wohlwollend. „Selbstverständlich dürfen Sie mit Ihrem Verteidiger sprechen, Olsen. Das Recht dazu hatten Sie übrigens die ganze Zeit über. Und jetzt dürfen Sie ja sprechen, mit wem Sic wollen. Ja, ob Sie nun Schadenersatz bekommen? Kann sein. Davon verstehe ich nichts, das muß der Verteidiger wissen. Damit habe ich nichts zu tun. Aber – könnte die Polizei nicht der Meinung sein, daß Ihre Verhaftung gar nicht so ganz unberechtigt war? Es gibt da doch verschiedene Dinge, Olsen, die nicht ganz in Ordnung sind, nicht wahr? Das reicht doch für mehr als nur für diese drei Wochen?“
Olsen antwortete nicht. Er hatte wieder sein beleidigtes Lächeln aufgesetzt. Natürlich! Wenn man ihm etwas anhängen wollte, konnte man immer etwas finden. Er hatte viele Eisen im Feuer gehabt.
„Wir haben hier einen häßlichen Stapel Papiere.“ Kommissar Horsens klopfte auf einen dicken rosa Aktendeckel, der auf seinem Schreibtisch lag. „Hier ist sowohl Altes als auch Neues. Ich habe, ehrlich gesagt, Angst, daß eine Menge Sachen dabei sind, die sich Kommissar Odense gern ein bißchen näher angucken würde. Glauben Sie das nicht auch, Olsen?“
Olsen lächelte bitter.
„Aber ich gehöre nicht zu denen, die Ihnen Böses wollen, Olsen. Meiner ganz privaten Meinung nach können Sie gut und gern als freier Mann von hier weggehen, wenn wir uns ausgesprochen haben. Aber wollen wir nicht erst ein Täßchen Kaffee trinken, Olsen? Ich habe furchtbaren Kaffeedurst. Was meinen Sie?“
Unter diesen Umständen wagte Olsen, den Polizeikaffee zu trinken, und Kommissar Horsens bestellte in der Kantine telefonisch Kranzkuchen und Kaffee.
„Ich finde, so ein Tröpfchen Kaffee tut gut an so einem kalten Tag“, sagte er in seinem herzlichen, jütischen Dialekt. Olsen nickte, denn er wußte, daß der Kaffee der Polizei stark und gut war.
Der Kaffee kam, und Olsen konnte auch den Kuchen essen, ohne durch zudringliche Fragen gestört zu werden.
„Eine Zigarre, Olsen?“
„Danke.“
„Hier ist Feuer! Sie haben wohl keine Streichhölzer bei sich? Behalten Sie die Schachtel nur.“
„Danke“, sagte Olsen wieder und fühlte sich recht wohl als freier Bürger, der das Recht hat, eigene Streichhölzer zu besitzen.
„Ja, Olsen, hier liegen also Ihre Papiere! Man hat viel über Sie niedergeschrieben, Olsen. Viel zuviel. Sie sind wirklich ein böser Bube gewesen!“ Kommissar Horsens blätterte betrübt in den Akten.
„Sie haben ordentliche Eltern gehabt, Olsen.“
„Wie man es nimmt.“
„Ein gutes Zuhause, bescheiden, aber sauber und geborgen. Fleißige, ehrenhafte Eltern“, fuhr der Kommissar nicht ohne Bewegung fort. Es sah wirklich so aus, als würden seine Augen feucht. „Sie haben Ihren lieben Eltern viel Kummer gemacht. Ihre Mutter hat häufig um Sie geweint.“ „Davon weiß ich nichts“, sagte Olsen. „Sie war sehr zänkisch. Sie verprügelte mich oft.“
Kommissar Horsens blätterte unbeirrt weiter.
„Viel zu viele Vorstrafen, Olsen!“ Er schob die Brille auf die Nasenspitze und hielt das Papier von sich weg. „Schon 1928, warten Sie . . . Bestraft vom Stadtgericht Kopenhagen am 21. 11. nach Paragraph 285, Absatz I des Strafgesetzbuches, vergleiche Paragraph 279 . . . Und dann schon wieder 1930: Paragraph 285, Absatz I, vergleiche Paragraph 278, Nummer 3, vergleiche zum Teil Paragraph 89 des Strafgesetzbuches . . . und wieder 1932 beim Amtsgericht Frederiksberg: Paragraph 285, Absatz I, vergleiche Paragraph 276 . . . Und 1935 wieder beim Amtsgericht Nord: Paragraph 285 Absatz I, vergleiche Paragraph 279 und zum Teil Paragraph . . . Ja, das ist viel. Mal sehen, Olsen, wann wurden Sie denn . . . Hier ist es ja. Das letzte Mal wurden Sie am 19. 12. 1937 entlassen – das war ja gerade zu Weihnachten. Dann waren Sie ja Weihnachten zu Hause, Olsen!“
Es war wirklich, als tröste es den Kommissar ein wenig, daß Egon Charles Olsen das Weihnachtsfest 1937 zu Hause verlebt hatte.
„Sehen Sie, vom Staatsgefängnis schreibt man ja wirklich gut über Sie, Olsen. Eigentlich habe ich gar nicht das Recht, Sie das wissen zu lassen. Jetzt tue ich etwas Ungesetzliches. Aber Sie erzählen es ja wohl niemandem, nicht wahr? Und ich möchte Ihnen doch gerne mein Vertrauen beweisen, Olsen. Hören Sie:
19. 12. . . . Erklärung des Staatsgefängnisses . . . Fraglichem Egon Charles Olsen wird bescheinigt, normal begabt zu sein. Er scheint aber etwas schwach und charakterlos . . . Keine Anpassungsschwierigkeiten, arbeitswillig . . . Mit vertraulicher Arbeit beschäftigt . . . Führte sie zufriedenstellend aus, keine disziplinarischen Schwierigkeiten . . . Im Hinblick auf seine Rückfälligkeit wurde Egon Charles Olsen nicht zur Begnadigung empfohlen . . . Unterschrieben: F. A. Henningsen, Unterinspektor.
Sehen Sie, Olsen, wenn man an einem Menschen interessiert ist, möchte man ja gern etwas mehr über ihn wissen. Und ich will auch gern zugeben, daß ich mit Unterinspektor Henningsen über Sie gesprochen habe. Sie verstanden sich doch recht gut mit dem Unterinspektor, nicht wahr?“
„Ich glaube schon.“
„Ja, er konnte Sie wirklich gut leiden. Das darf ich Ihnen eigentlich nicht erzählen, aber es stimmt. Und über diese vertrauliche Arbeit hat er mir auch ein bißchen was erzählt. Ich freue mich, wenn man einem Menschen etwas anvertrauen kann.“
Langsam begann Olsen zu begreifen, was der Kommissar wollte.
5
Der Tempel der Polizei mit seinen Gängen und Katakomben und klassischen Peristylen lag ruhig und friedvoll. Es herrschten Ordnung und Symmetrie, edle Einfachheit und stille Größe, belebt durch verschiedene, einfallsreich und überraschend arrangierte Steinarten. Auf einem viereckigen Hof stand die grüne Statue eines nackten Mannes, der einen ganz kleinen Kopf hatte und in ein Gewirr von Nattern trat; er symbolisierte die Gerechtigkeit. Und einen runden Hof umstanden achtundachtzig schwere Säulen, die einträchtig ein Gesims mit einer Dachrinne trugen. Eine Szenerie, geeignet für die Oper, für die Freimaurer oder für allerlei Mondscheinzeremonien. Ein Tempel des Friedens, wo jedermann behutsam auftrat und wo man kein lautes Wort hörte.
Und dennoch herrschte in diesem Haus kein Frieden.
Zwischen dem Polizeipräsidenten der Hauptstadt, Baum, und dem Reichspolizeichef Rane gab es nichts als Haß und Feindschaft, deren Ursachen nur wenige kannten, deren Auswirkungen aber in allen Gängen, Peristylen und geheimen Räumen zu spüren waren. Überall wurde ein stiller, erbitterter Krieg geführt. Überall wurde intrigiert und konspiriert, überall wurden Fallen und Fußangeln gestellt. Überall wurde geflüstert, gelauscht, spioniert.
Die geheimnisvolle Abteilung D gehörte offiziell zur Kriminalpolizei der Hauptstadt, obwohl die Agenten der Abteilung auch Informationen über Leute in der Provinz sammelten. Sie selbst glaubten tadellos zu arbeiten, doch auf Veranlassung des Reichspolizeichefs war neuerdings eine konkurrierende „Sicherheitspolizei“, von den Eingeweihten kurz „Sipo“ genannt, aufgebaut worden. Und während die Abteilung D vorläufig dem herzenswarmen Jüten unterstand, hatte der Reichspolizeichef Polizeianwalt Drössaa zum Leiter der Sipo berufen. Im Zusammenhang mit dieser geheimnisvollen Neubildung war die noch geheimnisvollere Zivilorganisation oder ZO mit ihrem inneren Kreis, ihrem äußeren Kreis, ihrem Mobilkreis und mit ihren Verbindungen zu den entferntesten Häfen, Wäldern und Dünen des Landes erfunden worden.
Das merkwürdige Polizeipräsidium war mit Geheimnissen gesättigt. Gewöhnliche, unbescholtene Bürger erfuhren nie, was in den Katakomben des Hauses vor sich ging. Aber Egon Charles Olsen sollte es beschieden sein, hinter die Kulissen zu sehen.
In der Abteilung D begann es zu dunkeln. Kommissar Horsens erhob sich und knipste eine elektrische Lampe an; sie hatte die Form einer altgriechischen Fackel, wie man sie von den Reliefs der Grabmäler her kennt. Dann ging er zum Fenster, zog die Gardinen zu und stellte die beiden leeren Bierflaschen in eine Ecke. Er klopfte seine Pfeife in einen klassischen Aschenbecher aus und ordnete die Papiere auf dem Schreibtisch. Danach rieb er sich die Hände, daß es knackte. Alles wirkte so, als wollte er es seinem Gast gemütlich machen. In ihm herrschte Weihnachtsstimmung. Sein wettergebräuntes Gesicht leuchtete förmlich vor lauter Ehrlichkeit und Zuneigung.
Der Regen schlug an die Scheiben. Vom Hafen her hörte man die Dampfschiffe tuten und von der Langen Brücke her das Klingeln, wenn sie für ein Schiff hochgezogen wurde. Es war schön, drinnen zu sein. In der Abteilung D war es gemütlich, man fühlte sich geborgen.
Der Kommissar machte sich an der Heizung zu schaffen und meinte seufzend: „Ach ja, es wird jetzt zeitig dunkel. Es ist erst vier Uhr. Aber wir haben ja auch bald Weihnachten. Warten Sie, da ist sicher noch etwas in der Kanne, Olsen!“ Er goß Olsen Kaffee ein. „Stellen Sie die Tasse ruhig auf den Tisch! Machen Sie es sich bequem, Olsen!“ Er wollte gerade sagen: Fühlen Sie sich wie zu Hause!, doch er besann sich rechtzeitig. Noch war die Abteilung D nicht Olsens Zuhause.
Olsen betrachtete mißmutig den kalten Kaffee.
„Vielleicht möchten Sie lieber eine Flasche Bier? Wie ist es, Olsen? Bestimmt sind noch ein paar im Schrank.“ Der Kommissar holte sie, den Öffner fand er auf dem Schreibtisch. „Zum Wohl, Olsen! Und Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!“ Sie tranken gleich aus der Flasche. Kommissar Horsens wischte sich den Mund ab, stopfte sich die Pfeife, Olsen reichte ihm Feuer.
„Danke schön, Olsen, vielen Dank!“ Der Kommissar lächelte milde. „Ja, Unterinspektor Henningsen sagte also, daß er Sie gut leiden könne. Er sagte auch, Sie seien tüchtig gewesen, wenn es galt, ihm kleine Auskünfte zu beschaffen, die für die Ordnung und Disziplin dort im Staatsgefängnis von Nutzen sein konnten. An so einem Ort muß ja Disziplin herrschen! Sie berichteten ihm also über die Gespräche der Gefangenen?“
„Ja“, sagte Olsen.
„Und über die Verletzungen der Vorschriften?“
„Ja.“
„An so einem Ort wird selbstverständlich viel Böses geredet. Die Leute sind ja nicht freiwillig dort. Konnten die Gefangenen Unterinspektor Henningsen gut leiden?“
„Nein.“
„Der Unterinspektor ist doch sonst ein sehr netter Mann?“
„Er wurde ,Apfelmörder‘ genannt.“
„ ,Apfelmörder‘? Na so was – ein sonderbarer Spitzname! Weshalb nannte man ihn denn ,Apfelmörder‘?“
„Im Staatsgefängnis stehen ein paar große Apfelbäume, und einer davon ragt ein wenig über die Hofmauer. Manchmal waren ein paar Äpfel runtergefallen, wenn wir zu unserer Runde auf den Hof kamen. Man war ganz wild nach so einem Apfel, mochte er auch noch so grün und sauer sein. Aber sobald der Unterinspektor sah, daß ein Apfel runtergefallen war, ging er hin und trampelte ihn richtig breit. Das ärgerte die Gefangenen natürlich. Deshalb haben sie ihn ,Apfelmörder‘ genannt.“
„Nicht doch! So etwas tat er? Hat er die Äpfel wirklich zertrampelt? Nun ja, dort gibt es natürlich eine bestimmte Verpflegungsordnung. Und der eine soll nicht mehr haben als der andere. Haben Sie dem Unterinspektor erzählt, daß er ,Apfelmörder‘ genannt wurde?“
„Ja.“
„Und das mochte er wohl nicht, was?“
„Nein.“
„Und die anderen Gefangenen? Hatten Sie mit denen nie Unannehmlichkeiten? War da keiner, der Sie verdächtigte, ein Zuträger zu sein?“
„Nein“, sagte Olsen und lächelte.
„Sie waren wohl routiniert und gaben sich keine Blöße?“
Olsen lächelte bescheiden, aber der Kommissar bemerkte in diesem Lächeln einen gewissen Berufsstolz. Horsens schob die Brille wieder nach oben und blätterte erneut in den Papieren. „Sehen Sie, Olsen, da war doch auch etwas zwischen Ihnen und dem Gutsbesitzer Skjern-Svendsen? Sie haben ja bereits etwas darüber zu Protokoll gegeben. Sie bekamen also eine Art Gehalt von ihm. Hundertfünfzig Kronen im Monat, wenn ich mich recht erinnere?“
„Ja, das war alles.“
„Und dafür sollten Sie sicherlich ein kleines Stückchen Arbeit leisten?“
„Ja.“
„Und das war keine schwere Arbeit. Der Gutsbesitzer wollte nur über etwas Bescheid wissen, nicht wahr?“
„Das war verdammt schwer. Er wollte etwas über seine Frau wissen.”
„Richtig. Er wollte wissen, was sie bei diesem Doktor Riege machte. Und das fanden Sie heraus?“
„Ich lieferte dem Gutsbesitzer regelmäßig Berichte. Ich hatte bei Riege zu tun und war deshalb häufig dort.“
„Sie dienten ihm als Versuchsperson für seine Experimente, nicht wahr? Jaja, die Polizei mußte sich auch ein wenig mit Dr. Riege beschäftigen, als sie diesen Mord untersuchte. Dr. Riege war schließlich in der Mordnacht bei der gnädigen Frau auf Frydenholm gewesen. Man hatte also auch ihn im Verdacht. Sie waren durchaus nicht der einzige, Olsen! Dieser Doktor ist ein sehr merkwürdiger Mann. Eine sonderbare Menagerie hat er in seiner Klinik da draußen, was?“
„Ja, das kann man behaupten.“
„Sie sahen da draußen wohl schreckliche Dinge vor sich gehen? Und Sie waren so etwas wie ein Privatdetektiv für den Gutsbesitzer?“
„Ja. In gewisser Weise.“
„Genau wie für Unterinspektor Henningsen?“
„Das kann man sagen.“
„Ja, Olsen, Sie besitzen recht brauchbare Fähigkeiten, das wissen wir.“ Der Kommissar warf über die Brille hinweg einen gütigen Blick auf Egon Charles Olsen. „Ausgezeichnete Fähigkeiten sogar! Nun frage ich mich nur, ob es nicht möglich wäre, diese Fähigkeiten zukünftig in den Dienst des Guten zu stellen.”
6
„Vati, warum schreit der Mann denn so?“
„Weil er böse ist.“
„Auf wen ist er böse, Vati?“
„Er ist böse auf Polen.“
„Vati, wer ist Polen?“
„Das ist ein Land, mein Kleiner. Es ist weit weg.“
„Ist er auch böse auf uns?“
„Das kann sein. Er ist überhaupt böse.“
„Was schreit er denn?“
„Das kann ich nicht verstehen, wenn du sprichst, Niels. Spiel jetzt mit deiner Kuh“, sagte Martin Olsen.
„Das ist keine Kuh, das ist ein Auto!“ stellte Niels fest. Er fuhr mit einer schwarzscheckigen Holzkuh über den Fußboden, ließ sie tuten, rückwärts fahren und schaltete die Gänge.
„Stell doch das ekelhafte Radio ab“, rief Margrete. „Die Kinder kriegen ja Angst. Du verstehst ja sowieso nicht, was der redet.“ Sie trug einen Säugling auf dem Arm. Niels spielte auf dem Fußboden Auto, zwei größere Mädchen schnitten Anziehpuppen aus alten Illustrierten. Sie hießen Rosa und Gerda.
„Es wird nachher übersetzt“, antwortete Martin. „Und ein bißchen verstehe ich ja auch.“
„Aber es ist widerlich anzuhören“, sagte Margrete.
Das Radio spielte in Martin Olsens Wohnzimmer. Es spielte in den Wohnzimmern der Menschen im ganzen Land. Ein Unbehagen war in allen Häusern. Und noch unbehaglicher als die Stimme des Führers war der brüllende Beifall seines Volkes. „Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!“ brüllten Tausende im Chor.
Der Abend war warm und hell. Die Jugend vergnügte sich auf der Straße. An der Ecke beim Kaufmann standen sie, über ihre Fahrräder gelehnt, die jungen Mädchen kreischten ab und zu, man klingelte mit den Fahrradglokken, man zog etwas aus dem Automaten. Ein Flugzeug brummte oben am Himmel, glänzte silbern im Sonnenlicht. Keine einzige Wolke war zu sehen. Von Niels Madsens Hof drang Eimerrasseln herüber und das Quietschen einer Pumpe. Irgendwo heulte ein Hund, hartnäckig und anhaltend. Und aus den Häusern hörte man die Lautsprecher.
Adolf Hitler schrie in die Häuser hinein. So hatte man ihn in den letzten Jahren in kurzen Abständen schreien hören. Und jedesmal, wenn er im Radio geschrien hatte, bedeutete es Unglück. Diesmal galt es Polen, dessen Provokationen unerträglich geworden wären und zum Himmel schrien! Zuvor hatte es anderen Ländern gegolten.
An dem milden Sommerabend hörte man den schreienden Mann. Aus jedem Haus am Wege hörte man ihn, wenn man durch das Dorf ging. Höschen-Marius hatte die Fenster weit geöffnet und das Radio ganz laut gestellt, damit seine Landsleute draußen seinen Führer hören konnten. Er selbst verstand zwar die Sprache des Führers nicht, doch er saß gehorsam mit offenem Mund vor dem Gerät, und wenn Beifall gebrüllt wurde, murmelte er anerkennend. Auch bei Niels Madsen lauschte man andächtig. Die Fürsorgejungen, die bei ihm ihr Brot verdienten, waren ins Zimmer gekommen und durften die stärkenden Worte hören. Sie saßen da und verstanden kein Wort, sie waren müde von der Arbeit des Tages und konnten sich nur mit Mühe wach halten. Der eine von ihnen, er hieß Harry, hatte eine gebrochene Nase; es hatte da einen Unfall gegeben im vorigen Jahr, als er während einer Züchtigung törichterweise den Kopf zur Seite gedreht hatte. Er war nicht schöner geworden dadurch, unheimlich sah er aus und abstoßend mit seiner schiefen Nase. Aber vielleicht würde man auch ihn einmal gebrauchen, wenn die Zeit der großen Taten kam.
Das Land lauschte. Der Arzt, der Lehrer, der Pfarrer, der Graf, die Alten im Altersheim, die Bauern, die Ziegeleiarbeiter. Und Rasmus Larsen, Vorsitzender der Gewerkschaft und der Wählervereinigung, der politische Einsicht besaß und sich durch den in diesem Jahr unterzeichneten Vertrag gesichert fühlte, in dem sich das Königreich Dänemark und das Deutsche Reich verpflichtet hatten, auf keinen Fall gegeneinander Krieg zu führen oder irgendeine andere Art von Gewalt anzuwenden. Sie lauschten mit Wohlbehagen oder Ekel, je nach Neigung, die meisten mit Ekel. Einige fanden es lächerlich und gleichgültig, auf einigen lastete das Unbehagen wie ein Alp; vielleicht wäre es eine Erleichterung, wenn der Krieg wirklich käme.
Nur die alte Emma weigerte sich zu lauschen. Sie hatte ihr Radio ausgeschaltet. „Ich will den widerlichen Hitler nicht in meinem Hause haben!“
In der Villa des Doktors war das Radio auf eine erträgliche Lautstärke gedämpft. Dr. Damsø hatte den schreienden Führer schon längst als einen Kranken mit ausgeprägt paranoiden und manio-depressiven Zügen eingeschätzt. Die Karriere eines solchen Menschen konnte nicht von Dauer sein. Am besten wäre es, den Verrückten auf Rußland zu hetzen. „Sollen sich die beiden Länder doch im Krieg gegeneinander verbluten!“ sagte Dr. Damsø. „Wenn die beiden ausgestritten haben, wird sich England schon um den Nachlaß kümmern.“ Der Doktor hatte seine Pläne, und er nahm an, daß sie Englands und Frankreichs Beifall finden würden. Er unterbreitete seine Gedanken den wenigen Freunden, mit denen er zusammenkam. Es bekümmerte den liberalen Arzt, daß er in der dörflichen Abgeschiedenheit ebenbürtigen Umgang entbehren mußte. Er liebte geistreiche Gespräche. Er liebte es, auffallende und überraschende Ansichten zu äußern; aber die waren wohl kaum merkwürdiger und ungewöhnlicher als die Ansichten anderer Zeitungsleser.
Er war geschieden und vorurteilsfrei. Er lebte, umsorgt von wechselnden Haushälterinnen, in seiner großen Villa, doch ihm fehlten Gespräche und Menschen mit Sinn für witzige Sätze. Mit dem Missionspfarrer und dem alten Lehrer verband ihn nichts. Es gab einen jüngeren Lehrer, mit dem er Schach spielte, und einige vernünftige Leute unter den Hofbesitzern, mit denen er verkehren konnte. Es gab auch ein paar radikale Kleinbauern, mit denen es sich lohnte, freimütig zu sprechen. Und es machte ihm Spaß, mit dem Kommunisten Martin Olsen zu diskutieren, wenn sie sich zufällig trafen, obwohl der ihn oft geärgert hatte, wenn er sich zur Unzeit in die Angelegenheiten anderer eingemischt hatte, wie damals bei der Sache mit dem Fürsorgejungen, dem die Nase gebrochen wurde. Der Doktor war sehr radikal und offenherzig – aber er würde sich doch nicht wegen einer Nase mit einem Nachbarn entzweien.
„In Wirklichkeit sind Sie ja religiös“, sagte er zu Martin Olsen. „Sie sind gläubig! Sie sind gläubiger als die Missionsleute!“ Und wenn er sich zum Spaß mit Martin Olsen stritt, bekam er zuweilen Antworten, die er dann später benutzte, um seine Bekannten in Erstaunen zu versetzen.
Wenn Johanne sonntagvormittags die „Arbeiterzeitung“ austrug, konnte sie immer damit rechnen, eine davon an Dr. Damsø zu verkaufen. „Du mußt nicht glauben, daß ich sie lese, Mädchen“, sagte er zu Johanne, die kein Mädchen mehr war, sondern eine Frau und mit Oscar Poulsen von der Molkerei verheiratet. „Ich kaufe sie nur deinetwegen. Das ist ja nicht lesbar, zum Teufel. Das ist so furchtbar talentlos!“
„Aber was drin steht, ist wahr!“ antwortete Johanne dreist.
„Das mag sein, meine Kleine. Doch es soll lieber erlogen, dafür aber ein wenig amüsant sein. Es ist ein Verbrechen, langweilig zu sein! Die Kommunisten in Deutschland haben ihr Schicksal verdient, denn sie waren langweilig!“
Vielleicht las der Doktor trotzdem die Zeitung, die er nun mal gekauft hatte. Vielleicht fand er darin etwas, womit er seine Freunde aufziehen konnte. Und einige waren ganz bestimmt verärgert, daß er die kommunistische Zeitung im Hause hatte und sie offen mit allen anderen Blättern im Wartezimmer auslegte.
Einmal hatte etwas über Pastor Nørregaard-Olsen in der Zeitung gestanden, und der Doktor hatte es ausgeschnitten, um die Missionsleute unter den Patienten in Verlegenheit zu bringen. Das war, als der Pfarrer einen seiner Vorträge im Rundfunk gehalten hatte. Denn was Pastor Nørregaard-Olsen in der Gemeinde an Boden verloren hatte, hatte er im Äther gewonnen. Mit Hilfe seines Freundes Harald Horn war er Rundfunkpfarrer geworden. Er formte seine Sonntagspredigt in einen volkstümlichen Vortrag um, machte sie ein wenig literarisch und politisch aktuell, ohne deshalb weltlich zu werden. Seine Verkündung erreichte nun Tausende Heime, während seine Kirchengemeinde kleiner und kleiner wurde. Es waren Freitagspredigten in unterhaltender Form, unbefangene Ermahnungen, das Leben im Jenseits jetzt schon vorzubereiten, statt Forderungen an das materielle Dasein zu stellen. Dr. Horn, der Mitglied des Rundfunkrates war, hatte ihm diese Tätigkeit vermittelt, und der Vorsitzende des Rundfunkrates, Kaspar Bobbel – selbst Theologe und ein kleiner Dichter –, war von Pastor Nørregaard-Olsens frischer, volkstümlicher Art begeistert.
Der Literat Dr. Horn war ein häufiger Gast im Pfarrhaus – ein alter Freund, Schulkamerad von der Metropolitanschule, wo die angeborenen Talente unter gesunder Zucht geformt wurden. Er war Junggeselle, unabhängig, ohne Amt und feste Arbeitszeit, er konnte im Inland und Ausland reisen, wie es ihm paßte. Auf dem Pfarrhof Frydenholm war er stets gern gesehen. Er durfte ohne vorherige Anmeldung kommen, das Gästezimmer im Giebel war stets für ihn bereit. Die Kinder nannten ihn „Onkel“.
Jetzt saßen die Herren im Gartenzimmer des Pfarrhauses und hörten Hitlers Geschrei aus dem Lautsprecher. „Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!“ brüllten die Deutschen.
„Das soll die Welt zur Kenntnis nehmen!“ schrie der deutsche Führer. „Sie mögen Pakte schließen, Erklärungen abgeben, soviel sie wollen. Ich vertraue nicht auf Papiere, sondern ich vertraue auf euch, meine Volksgenossen!“
„Ich verneige mich vor seinem Idealismus“, sagte Pastor Nørregaard-Olsen. „Und ich bewundere seine Fähigkeiten, die Menschen zu begeistern. Aber – entschuldige, daß ich es so rundheraus sage – mich stößt seine Brutalität ab. Es ist doch beinahe etwas Vulgäres an seiner Art.“





























