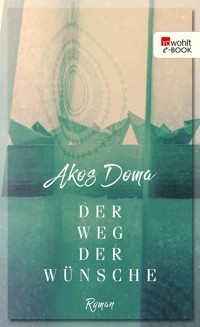
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Vier Menschen, eine Hoffnung: Akos Domas bewegender Roman über eine Familie auf der Flucht Es beginnt mit einem Kindergeburtstag im Kreis der Familie, doch nicht nur die Kirschbäume werfen ihre Schatten: Für die Eltern Teréz und Károly ist das Leben im sozialistischen Ungarn unerträglich geworden. Niemand darf von ihren Fluchtplänen erfahren – schon gar nicht die Kinder Misi und Borbála, die einem Urlaub am Plattensee entgegenfiebern und sich bald wundern müssen, als der geliebte See am Fenster vorbeifliegt. Mit viel Wagemut schaffen es die vier über die Grenze nach Italien – dort stellt sie der sich endlos dehnende Sommer im desolaten Auffanglager auf eine Probe, die keinen von ihnen unberührt lässt: Károly und Teréz werden sich fremd; der achtjährige Misi erfährt die volle Härte der Erwachsenenwelt; Borbála verliebt sich zum ersten Mal. Auch längst Vergangenes bricht auf: Teréz musste als junges Mädchen vor der heranrückenden Ostfront fliehen, Károly wurde mit seiner Mutter zwangsausgesiedelt. Die Familie droht zu zerbrechen, noch bevor sie ihr Ziel – Deutschland – erreicht … Akos Doma, der selbst als Jugendlicher mit seiner Familie Ungarn verließ, erzählt die Geschichte einer dramatischen Flucht. Hellsichtig und mit großer sprachlicher Kraft zeigt sein Roman, was Heimatlosigkeit und Ungewissheit im Menschen anrichten können – und wie sie ihn verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Sammlungen
Ähnliche
Akos Doma
Der Weg der Wünsche
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Vier Menschen, eine Hoffnung: Akos Domas bewegender Roman über eine Familie auf der Flucht
Es beginnt mit einem Kindergeburtstag im Kreis der Familie, doch nicht nur die Kirschbäume werfen ihre Schatten: Für die Eltern Teréz und Károly ist das Leben im sozialistischen Ungarn unerträglich geworden. Niemand darf von ihren Fluchtplänen erfahren – schon gar nicht die Kinder Misi und Borbála, die einem Urlaub am Plattensee entgegenfiebern und sich bald wundern müssen, als der geliebte See am Fenster vorbeifliegt. Mit viel Wagemut schaffen es die vier über die Grenze nach Italien – dort stellt sie der sich endlos dehnende Sommer im desolaten Auffanglager auf eine Probe, die keinen von ihnen unberührt lässt: Károly und Teréz werden sich fremd; der achtjährige Misi erfährt die volle Härte der Erwachsenenwelt; Borbála verliebt sich zum ersten Mal. Auch längst Vergangenes bricht auf: Teréz musste als junges Mädchen vor der heranrückenden Ostfront fliehen, Károly wurde mit seiner Mutter zwangsausgesiedelt. Die Familie droht zu zerbrechen, noch bevor sie ihr Ziel – Deutschland – erreicht …
Akos Doma, der selbst als Jugendlicher mit seiner Familie Ungarn verließ, erzählt die Geschichte einer dramatischen Flucht. Hellsichtig und mit großer sprachlicher Kraft zeigt sein Roman, was Heimatlosigkeit und Ungewissheit im Menschen anrichten können – und wie sie ihn verändern.
Über Akos Doma
Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.
Teil eins
Ein Sonntag
1.
An jenem dösigen Sonntagnachmittag, während die Sonne hinter der efeugrünen Mauer der benachbarten Villa verschwand und die Torten auf dem Tisch Stück um Stück kleiner wurden und ihre Mutter Arm in Arm mit der Tante Runden auf dem Sandsteinpfad durch den Garten drehte, warteten Misi und Bori ungeduldig auf die Rückkehr ihres Vaters, wegen der Überraschung, die er ihnen versprochen hatte.
Es sollte Misis Geburtstagsgeschenk werden, aber beiden zugleich gehören, hatte ihr Vater gesagt. Bori konnte sich das nicht vorstellen, sie war schon vierzehn und Misi gerade sieben geworden, noch ein richtiges Kind, sie interessierte sich schon für ganz andere Dinge als er.
Es war warm an diesem Geburtstagssonntag. Bori hatte am Mittag ihrer Mutter geholfen, den Tisch unter dem alten Kirschbaum zu decken. Dann waren sie gekommen, Großpapa Béla und Großmama Róza, die Eltern ihrer Mutter, deren Schwester Tante Jolán mit Onkel Géza, der, obwohl Sonntag, von einem Geschäftsessen kam, selbst Onkel Barnabás, Großpapa Bélas Bruder, war da, der seine Wohnung im Budaer Burgviertel sonst kaum verließ. Allesamt Verwandte ihrer Mutter, ihr Vater hatte schon lange niemanden mehr.
Man erkundigte sich nach Károly. Er werde gleich da sein, erwiderte ihre Mutter jedes Mal und flüsterte etwas und zwinkerte. Bori lauschte, beobachtete alles genau, sie spürte, dass ein Geheimnis in der Luft lag. Die Gäste spazierten durch den Garten und unterhielten sich, anfangs ein wenig höflich, fast steif, wie Menschen, die ihre Eltern siezen, und atmeten die gute Budaer Luft, die vom Pilisgebirge herwehte, aber nach einer Weile beschlossen sie, nicht länger auf Károly zu warten, sondern anzufangen. Misi durfte am Kopfende des Tisches sitzen. Er wusste nicht, wen er anschauen sollte, dann blieb sein Blick an seiner Mutter hängen, die ihn anlächelte, wie immer, wenn sie ihn unbemerkt betrachtete, fast andächtig, als wäre es ein Wunder, dass es ihn gab.
Sie ließen Misi hochleben, und als das Geburtstagslied zu Ende war, bestaunte man den schön gedeckten Tisch, die Kristallgläser und das Silberbesteck, die Obstschalen und Tortenplatten, die auf der zerfransten alten, früher einmal tiefblauen Tischdecke standen. Dann schob jemand die Torte mit den sieben Kerzen näher zu Misi, er solle sie ausblasen, riefen sie, alle sieben auf einmal, als hätte er das nicht gewusst. Misi holte Luft und schaffte drei Kerzen, blies noch einmal, schaffte die anderen vier, aber eine Kerze erholte sich, und er musste ein drittes Mal blasen. Onkel Géza fand, dass das noch steigerungswürdig sei, und Misi gab ihm im Stillen recht. Rauchfäden stiegen hoch, hingen zwischen ihnen und dem Himmel, und endlich durfte Misi die Geschenke öffnen. An Misis Geburtstag war es immer warm, dachte Bori, an ihrem im November gab es meist Regen, ihr war das nur recht.
Als Misi mit dem Auspacken fertig war, schenkte ihre Mutter Kaffee ein, und Tante Jolán schnitt die Torten an. Seite an Seite servierten die Schwestern auf dem Herender Porzellan und redeten gleichzeitig, sahen einander auf den ersten Blick gar nicht ähnlich, fand Bori, erst auf den zweiten, und auf den dritten sogar sehr. Tante Jolán trug einen braunen Wildlederminirock und passende Stiefel mit langem Schaft, in ihrem schwarzen, lockigen Haar steckte eine italienische Sonnenbrille, die ihr Onkel Géza auf der Hochzeitsreise in Moskau gekauft hatte. Ihre Mutter trug einen knielangen, dunkelgrünen Faltenrock, eine Strickweste mit grün-rotem «Tirolermuster», wie sie es nannte, und schlichte Sommerschuhe. Ihr Haar war so schwarz wie Joláns, aber länger, und sie trug es hochgesteckt wie die Großmama, nur war deren Knoten viel größer, «der Turm von Babel», wie ihr Vater zu sagen pflegte. Tante Jolán war sechsunddreißig, fünf Jahre jünger als ihre Schwester und einen halben Kopf kleiner. Alles an ihr war klein und flott und fesch, und ihr Zastava war das winzigste Auto, das Bori je gesehen hatte. Ihre Mutter war auch fesch, aber irgendwie anders. Sie sei klassisch, sagte sie selbst, Jolán modisch.
Endlich nahmen auch die Mutter und Tante Jolán Platz, worum Großmama Róza sie schon inständig bat, und Boris Blick schweifte von Gesicht zu Gesicht. Rechts von Misi saß ihre Mutter, dann Tante Jolán und Onkel Géza, am anderen Tischende stand der leere Stuhl ihres Vaters, auf der anderen Längsseite saßen die Großeltern, Onkel Barnabás und sie selbst links neben Misi. Es war aufregend, die ganze Familie versammelt zu sehen, sie konnte sich nicht erinnern, das schon einmal erlebt zu haben, immer hatte jemand gefehlt, und auch jetzt fehlte ihr Vater, aber er würde bald da sein, und dann wären sie alle vereint, zum ersten Mal.
2.
Teréz hatte in der Nacht schlecht geschlafen.
Es gab so viel zu bedenken, damit alles klappte und es ein schönes Fest wurde. Am Morgen trug sie mit Károly den aufklappbaren Tisch vom Dachboden in den Garten, dann liefen sie alle wie jeden Sonntag, wenn sie nicht verschliefen, den Berg hinunter zur Stadtteilkirche von Városmajor. Károly ging jedoch nicht mit in die Messe, sondern eilte weiter zum Moszkva-Platz, um in der Konditorei Auguszt die bestellten Geburtstagstorten abzuholen.
Die Messe war noch nicht zu Ende, als er zurückkam. Er wartete unter den Kastanien vor dem Portal. Er hatte dem Alten Bärtigen schon lange den Rücken gekehrt, wie es der auch ihm gegenüber getan hatte, eines Juninachmittags 51, als sein Leben für immer entgleiste und ihm klarwurde, dass der Himmel leer und er mutterseelenallein in der Welt war. Genau zwanzig Jahre war das her. Aber er behielt sein Wissen über den leeren Himmel für sich, um die Kinder nicht zu verunsichern, Teréz wollte sie so lange wie möglich im Glauben an eine heile Welt aufwachsen lassen, und das war ihr bisher auch gelungen.
Am Heimweg sah Károly immer wieder nach den Torten, ob die Schokolade nicht zu schmelzen begonnen hatte. Sie waren unversehrt, die Bäume in der Csabastraße schirmten die ärgste Hitze ab. Károly war schweigsam, Teréz wusste, dass er etwas verheimlichte. Sie hatte schon am Freitag nach der Arbeit einen merkwürdigen Ausdruck in seinem Gesicht bemerkt, aber da er nichts gesagt hatte, hatte sie es auch nicht getan.
Auch sie verschwieg ihre Neuigkeiten, um die Stimmung vor dem Geburtstag nicht zu verderben.
Zu Hause stellte Károly die Torten auf den Kühlschrank in der Kochnische hinter der Tür und brach wieder in die Stadt auf. Misi lief zum schmiedeeisernen Zaun und sah ihm hinterher, bis er am Ende der Straße verschwunden war. Ein ganz besonderes Geschenk hatte er versprochen, sie sollten schon einmal überlegen, was es sein könnte.
Sie hatten auf schönes Wetter gehofft, damit sie draußen sein konnten, im Zimmer war es zu eng für so viele Gäste, schon für sie vier war es zu eng, viel zu eng. Sie warf die Decke über den Tisch, deckte den Schatten auf dem Tisch zu, doch schon war der Schatten wieder obenauf, Teréz musste unwillkürlich an all die Opportunisten in Politik und Gesellschaft denken, die es auch so machten, auf unerklärliche Weise immer nach oben kamen.
Sie schnitt Tulpen und Flieder und ordnete sie in zwei Vasen, rot und gelb die eine, violett und weiß die andere, stellte Kirschen, Erdbeeren und Johannisbeeren, Milch und Zucker und geschlagene Sahne hin. Das Service war nur für sechs Personen und dazu unvollständig, sie musste es mit anderem Geschirr ergänzen. Sie rückte alles hin und her, um die Löcher im Tischtuch zu verdecken. Ihre Eltern, die in der Innenstadt wohnten und vielleicht auch wegen der Enge der Einzimmerwohnung nur selten zu Besuch kamen, sollten sich wohl fühlen. Unter dem Kirschbaum war es angenehm mild und luftig.
Teréz besah den Tisch und war zufrieden. Ihr Vater würde es auch sein, das hoffte sie jedenfalls. Er legte Wert auf Ordnung und hatte Jolán und ihr bei allem, was sie unternahmen, stets Sorgfalt und Hingabe ans Herz gelegt und es ihnen auch vorgelebt, und danach zu handeln, war mit der Zeit auch ihnen zur Selbstverständlichkeit geworden.
Teréz setzte sich. Es war Mittag und still, so still war es sogar hier in den Hügeln vor der lärmenden Innenstadt nur selten. Der Schatten der Kirschzweige spielte auf der Tischdecke, dem Gedeck. Der Baum trug schon seit Jahren keine Früchte mehr, aber er konnte an heißen Tagen Kühle spenden, auch er hatte seinen Sinn und Zweck.
Teréz lehnte sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Sie überließ sich der dösigen Stimmung, dem Säuseln der Blätter, dem Fliederduft, ihre innere Anspannung legte sich allmählich, für einen Moment vergaß sie sogar, dass sie am Freitag entlassen worden war und nicht die geringste Ahnung hatte, wie es weitergehen sollte.
3.
Misi kniete im Sandkasten, die Arme bis zu den Ellbogen voll Sand, und baute eine Burg. Oder einen Turm, er war sich noch nicht sicher, das würde sich zeigen, wenn es fertig war. Er schleppte in einem löchrigen Blecheimer Wasser vom Planschbecken heran, goss es behutsam über die runde Außenwand seines Baus, festigte und glättete sie.
Auf einmal hielt er inne. Auf der breiten, steinernen Einfassung des Sandkastens sonnte sich eine Eidechse. Misi näherte sich ihr vorsichtig. Seit ihm einmal ein abgeworfener Eidechsenschwanz zwischen den Fingern geblieben war, wollte er die Tiere lieber nicht mehr fangen, nur noch anschauen. Ihr Rücken und Schwanz waren goldbraun, die Flanken hellgrün, ihre Füße sahen wie winzige Zweige aus. Sie reckte den Kopf starr empor, starr auch die Augen, die vielleicht alles sahen, vielleicht nichts. Der kleine Körper glänzte in der Sonne, das Herz pochte, aber dann machte er wohl eine zu rasche Bewegung, und sie huschte davon, und Teréz, die ihn schon eine Weile beobachtete, stand auf und ging zum Haus, aber ein paar Meter vor der Eingangstür traf ihr Blick ein anderes Augenpaar, und der Zauber des Nachmittags zerriss mit einem Schlag.
Teréz gab sich immer Mühe, das vergitterte Fenster über dem Beet, das Gesicht Frau Galambérs darin zu ignorieren, aber es fiel ihr schwer. Den ganzen Tag saß die gelähmte alte Frau dort und bewachte das Beet. Wenn Bori und Misi ihm zu nahe kamen, spritzte sie sie durch das Fenster aus einem Schlauch mit kaltem Wasser ab.
Bori lachte sie aus und drehte ihr eine lange Nase, aber Misi hatte Angst vor ihr, weil sie böse war.
Teréz tat die einsame Frau leid. Sie behandelte sie genauso freundlich wie alle anderen, sie wollte keinen Streit, keine Missstimmung im Haus, schon aus Trotz. Ihre Augen mieden das dunkle Fenster, aber aus ihrem Kopf konnte sie es nicht verbannen, das graue Gesicht hinter den Gittern, den unglücklichen, finsteren Blick, die bittere Einsicht, dass es in jedem Garten Eden eine Schlange gab.
Sie ging wortlos am Fenster vorbei und die Treppe hinauf, und plötzlich fiel ihr wieder ein, wie sie zwei Tage zuvor, am Freitagvormittag, die Treppe zum Institutsleiter hinaufgestiegen war. Er hatte sie einbestellt und ihr knapp, wenn auch ohne erkennbare Schadenfreude, vielleicht sogar mit leichtem Bedauern mitgeteilt, dass sie ab September aufs Land nach Gödöllő versetzt und ihre Stelle im Institut von einem jüngeren, in Moskau diplomierten Kollegen eingenommen würde.
Teréz hatte ihm mit durchgedrücktem Rücken und regungsloser Miene zugehört und dann nur gefragt, ob sie nun gehen dürfe. Falls er sich insgeheim auf eine kleine Szene, einen Wutausbruch oder tränenreiches Flehen gefreut hatte, musste sie ihn enttäuschen.
Sie durfte.
Erhobenen Hauptes verließ sie das Zimmer.
Er war nicht einmal aufgestanden, nicht als sie gekommen war, nicht als sie ging.
Das Ende von dreizehn Jahren Zusammenarbeit.
Auf der Heimfahrt am Abend wurde ihr in der U-Bahn schwindelig. Sie stieg aus und irrte ziellos am Donauufer entlang. Die frische Luft brachte sie wieder zu sich. Sie wollte es sich nicht eingestehen, aber sie war verletzt, tief enttäuscht. Noch im Winter hatte die Institutsleitung die «allergrößte Zufriedenheit» mit ihrer Arbeit bekundet, in Form einer lobenden Erwähnung vor der versammelten Kollegenschar sowie eines Bonbons auf ihrem Tisch am Tag nach den Weihnachtsferien, eine Gabe, die Teréz in ihrer schieren Mickrigkeit erstaunt, aber eben auch erfreut hatte, war es doch ein Zeichen der Anerkennung und somit genauso viel wert, als wenn man ihr einen Nerz in die Garderobe gehängt hätte.
Jetzt war mit einem Schlag alles vorbei.
Sie war entlassen. Denn nichts anderes war diese Versetzung, eine Entlassung mit anschließender Wiedereinstellung in einem Provinzableger des Instituts. Eine Degradierung. Einfach so, mir nichts, dir nichts, ohne jede Begründung. Ein Ausdruck fehlender Wertschätzung. Sie war erschüttert. Sie konnte keinen anderen Grund für ihre Entlassung finden als ihre politische Einstellung, ihre Weigerung, der Partei beizutreten, ihre in religiösen Fragen «unentschiedene» Haltung, wie es in ihrer internen Beurteilung zweideutig hieß.
Als sie das Zimmer betrat, hörte Teréz Boris Stimme durch den Garten, die Gäste seien da. Schnell zog sie sich um, damit es nicht wieder hieß, sie würde nie fertig.
Sie verspätete sich dann doch, wie immer, aber Bori fand, dass sie sehr hübsch aussah.
4.
Sie saßen im Schatten der alten Kirsche, aßen Torte und Obst, tranken Kaffee und Wein und genossen den blauen Nachmittag. Großmama Róza erkundigte sich noch einmal nach Károly. Er werde gleich kommen, sagte Teréz wieder und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Man hatte sich viel zu erzählen und redete durcheinander, Bori hörte ruhig zu. Schon länger fühlte sie sich unter Erwachsenen wohler als mit ihren Altersgenossen.
In einem Augenblick zufälliger Stille blickte Großpapa Béla in die Runde.
«Ein Ungar spricht beim Essen nicht, hieß es einst», bemerkte er mit leichtem Kopfschütteln.
«Man hört ja, was die Ungarn beim Essen tun, Bélus», sagte Onkel Barnabás, der bis dahin als Einziger geschwiegen hatte. «Sie reden sich die Köpfe heiß.»
«Wir sind eben keine richtigen Ungarn mehr.»
«Ich bitte dich!»
Onkel Barnabás leerte sein Glas.
«Man müsste nur endlich diese elenden Sprüche aus der Welt schaffen», murmelte er.
Onkel Géza, der eine Grundsatzdebatte befürchtete, nahm Misi schnell bei der Hand und führte ihn zu seinem neuen Auto. Er liebte die Harmonie und suchte das Weite, sobald Streit drohte. Er war nicht leicht aus der Fassung zu bringen, Konflikte und Diskussionen waren in seinen Augen überflüssig wie ein Kropf und alle Probleme lösbar, wenn man sie nur ruhig und sachlich anging. Immerhin war es ihm mit dieser Einstellung im Frühjahr gelungen, zu außerordentlich günstigen Konditionen einen fast fabrikneuen Schiguli zu ergattern, obwohl man in der Regel Jahre auf einen Neuwagen warten musste.
Misi kniete auf dem Fahrersitz, ergriff das Lenkrad und machte Fahrgeräusche. Er brummte lauter, wenn er Gas gab, stockte kurz, wenn er die Gangschaltung betätigte.
«Wohin soll’s gehen?», fragte Onkel Géza.
«An den Plattensee.»
«Da bin ich dabei!»
Géza liebte den See, das flache, warme Wasser im Sommer, die sanfte Landschaft im Norden, die Weinhänge, die Hügel des Bakony, nicht zu hoch und nicht zu wild, nicht zu kalt und nicht zu heiß, gerade richtig, dort wollte er später einmal Wein anbauen, bloß ein Joch Land, davon träumte er.
Nach Misis Rückfahrt vom See nahm Géza eine große Schachtel aus dem Kofferraum.
«Wenn du errätst, was drin ist, gehört es dir!»
Misi lief ihm hinterher. Am Tisch wog er die Schachtel in den Armen, auch Bori hob sie an. Sie war schwer, schwer wie ihr Inhalt zu erraten war. Sie hatten keine Ahnung.
Die Erwachsenen versuchten es gar nicht erst.
Schließlich durfte Misi hineingreifen und das Etwas im Innern betasten.
Es war glatt, rund, groß. Misi runzelte die Stirn, dann wusste er es.
«Ich hab’s! Eine Wassermelone!»
Onkel Géza öffnete den Deckel, hob die Melone auf den Tisch, schlitzte die dunkelgrüne Schale an, und die Melone platzte, ging auf wie ein roter Blumenkelch. Er schnitt sie auf, stellte die Stücke auf einen Teller und reichte sie herum. Misi stürzte sich auf seine Scheibe und tropfte schon beim ersten Bissen die Tischdecke voll. Tante Jolán half ihm, halbierte seine Scheibe, damit er die Tischdecke nicht weiter befleckte, und ermahnte ihn, sich über seinen Teller zu beugen.
«Ach, die blöde Tischdecke», winkte Teréz ab. «Soll er doch seine Melone genießen.»
«Ja, ja, aber irgendwann hat man dann keine ordentlichen Tischdecken mehr, Teréz.»
«Mein Gott, dann hat man eben keine mehr!»
Teréz hatte den Vorwurf gehört, aber ihr fehlte einfach der Sinn für Dinge, die sie für Äußerlichkeiten hielt, und sie wischte sie rigoros vom Tisch. Sie liebte es, wenn Misi oder Bori sich selbstvergessen einer Sache hingaben, und wenn es nur ein tiefer Schlaf war. Das waren für sie Momente heiligen Ernstes, Momente der Unschuld, die sie um nichts in der Welt gestört hätte.
«Wo ist Barnabás?», fragte Géza, der ihm ein Stück Melone geben wollte.
Onkel Barnabás’ Stuhl war leer. Niemand hatte ihn gehen sehen.
«Trinkt er noch immer keinen Wein?»
«Er verträgt doch keinen Wein», sagte Béla.
«Er will immer extravagant sein.»
«Rózsika, wie kannst du so was sagen? Seine Migräne, du weißt doch …»
«Seine Migräne, seine Migräne, seit vierzig Jahren höre ich nichts anderes!»
«Ich suche ihn», rief Bori aus und sprang auf.
5.
Der Garten war nicht groß, aber er hatte verborgene Winkel. Bori entdeckte Onkel Barnabás hinter dem ausladenden Holunderstrauch am Zaun. Dort stand ein Gartenstuhl, der sonst nicht hier war, an der Rückenlehne hing eine leere Einkaufstasche. Onkel Barnabás ging langsam um den Strauch herum und schnitt mit einer Nagelschere Blüten ab. Das Gras war schon übersät mit cremefarbenen Dolden, den letzten des Jahres. Viele Blüten waren bereits dabei, sich in kleine, grüne Beeren zu verwandeln.
Bori begann, die Dolden aufzuklauben und in die Tasche zu werfen.
«Das ist lieb von dir, Teri …» Onkel Barnabás ließ die Arme sinken und starrte Bori an. «Ach, Bori … jetzt habe ich dich doch tatsächlich mit deiner Mutter verwechselt. Du siehst ihr aber auch heruntergerissen ähnlich. Also, verglichen mit damals, als sie in deinem Alter war.»
Bori nickte.
Ihre Mutter hatte die ersten Jahre nach dem Krieg, kurz nachdem Onkel Barnabás’ Frau bei einem Luftangriff umgekommen war, bei ihm in der Várfokstraße gelebt. Bori wusste nicht viel darüber, nur dass ihre Mutter sehr krank gewesen war. Die Eltern sprachen nie darüber.
Onkel Barnabás schnippte die nächste Dolde ab.
Bori hob sie auf, warf sie in die Tasche.
«Was hatte Mama eigentlich, als sie bei dir gewohnt hat?»
«Ach, es war einfach der Krieg, Bori, der verdammte Krieg, er hat uns alle kaputt gemacht, alle, die Verlierer wie die Sieger. Wir hatten nichts mehr, alles war zerstört, die Häuser, die Brücken, Teile der Stadt in Trümmern und auch wir. Aber es half nichts, das Leben musste weitergehen. Und das Leben ist geheimnisvoll, Bori, der Sieg trägt die Saat der Niederlage in sich, er korrumpiert die Sieger, macht sie träge und überheblich, nimmt ihnen die Kraft und gibt sie heimlich den Besiegten, damit sie wiederauferstehen … verstehst du?»
«Hm.»
«Und wenn man einmal in der Hölle war, wie deine Mutter und ich, hat man plötzlich keine Angst mehr vor dem, was da noch kommen mag, man hat einfach keine Angst mehr. Man leckt noch seine Wunden, aber tief drinnen weiß man, dass das Schlimmste schon überstanden ist. Deine Mutter und ich, wir beschlossen, das Beste daraus zu machen, die Trümmer, die wir geworden waren, wieder zusammenzusetzen, behutsam, Brocken für Brocken. Wir mussten nichts tun, nur da sein, und alles geschah von selbst. Weil wir uns so gut verstanden, einander trösteten. Na ja, das nahm unsere ganze Kraft in Anspruch, zum Nachdenken blieb keine Zeit. Das ist wohl der Grund, weshalb wir überlebt haben …»
Bori lauschte mit offenem Mund, nickte ab und zu, als hätte sie verstanden. Sie ging hinter Onkel Barnabás her, warf Dolde um Dolde in die Tasche, als würde sie verlorene Münzen auflesen.
«Aber warum wohnte Mama nicht zu Hause, bei Großpapa und Großmama?»
«Sie wollte lieber bei mir bleiben. Sie war einmal bei mir auf der Couch eingeschlafen, und als sie aufwachte, das war zwei Tage später, wollte sie nicht mehr nach Hause zurück. Erst als sie genesen war, kehrte sie heim. Zwei Jahre blieb sie bei mir. Wir hatten es lustig miteinander, sie und ich … So, ich glaube, das sollte reichen. Das wird einen guten Saft geben, Bori. Die ersten Flaschen bekommt ihr, weil du mir so lieb geholfen hast.»
Onkel Barnabás sank auf den Stuhl, als hätte ihn das bisschen Arbeit oder das Sprechen erschöpft, schenkte sich aus einem Fläschchen in ein kleines Glas und kippte es hinunter. Bori wusste, dass es Pálinka war, er brannte ihn selbst und trug immer eine Flasche bei sich. Er trank gern, und doch hatte ihn noch nie jemand betrunken oder auch nur beschwipst gesehen, im Gegenteil, er trinke, um auszunüchtern, sagte er immer, aber das verstand Bori nicht.
Onkel Barnabás wandte sich zum Haus.
«Siehst du, Bori, früher lebte eine einzige Familie in einer solchen Villa, heute lebt in jedem Zimmer eine. Die Welt ist gerechter geworden … nur ein wenig enger. Die vielen Hauseingänge, da und da und da, wie in einem Ameisenbau, nicht wahr? Und was wohnt in einem Ameisenbau?»
«Ameisen!»
Onkel Barnabás nickte, drehte sich wieder zur Straße, schenkte sich noch ein Glas ein. Ein Motorrad fuhr knatternd die Ráth-György-Straße hinunter, dann war es wieder ruhig. Dort im Osten, am Fuß des Hügels, hinter den Bäumen und Villen vor ihnen, lag die Stadt.
«Und doch kann ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben als in diesem riesigen Ameisenbau», sagte er leise. «Allerdings kann ich mir in letzter Zeit nicht einmal das mehr vorstellen.»
«Wo denn dann?»
«Wenn ich das wüsste, Bori. Ich kenne so wenig von der Welt. Mit meinen sechsundsechzig Jahren bin ich noch nie aus dieser Stadt herausgekommen.»
«Warst du nicht im Krieg? Wie Großpapa?»
«Ich war nicht wehrdiensttauglich, so hieß das. Nicht einmal zum Sterben war ich ihnen gut genug, stell dir das vor! Eines Tages werde ich sie eines Besseren belehren …»
«Wegen deiner Migräne, nicht wahr?»
Onkel Barnabás sah sie an. Ein kleines und schmächtiges Mädchen, mit dünnen, hellen Haaren, das da zu seinen Füßen hockte.
«Wie alt bist du jetzt, Bori?»
«Vierzehn.»
«Und was glaubst du, was ist das Wichtigste im Leben?»
«Geld!»
Onkel Barnabás riss die Augen auf.
«Hast du das von deinen Eltern?»
«Das habe ich mir selbst ausgedacht. Mama sagt immer, Geld ist unwichtig. Aber das glaube ich nicht, denn wenn man kein Geld hat, verhungert man. Oder bekommt keine größere Wohnung, wie wir.»
«Na gut, dann das Zweitwichtigste, was ist das Zweitwichtigste im Leben?»
Bori überlegte, zuckte mit den Schultern.
Onkel Barnabás lehnte sich vor.
«Das Wichtigste, ich meine das Zweitwichtigste», flüsterte er, «ist normal zu bleiben.»
«Wie normal?»
«Normal. Gesund. Hier im Kopf …»
Er deutete mit dem Finger auf seine Stirn.
«… und hier in der Seele …»
Er deutete auf sein Herz.
«… und hier unten, im Körper.»
Er zeigte auf seine Hose.
Bori errötete.
«Wenn du gesund bist, bist du stark, bist du mutig, frei, dann bist du ein schlechter Untertan. Und du hast die Chance, ab und zu im Leben glücklich zu sein. Aber da ist er ja endlich!»
Bori sprang auf. Ihr Vater kam die Straße herauf, schlank und schlaksig, trotz der Steigung mit ausholenden Schritten, in dem abgetragenen Anzug, den er fast immer trug. Er hatte eine Kiste unter dem Arm. Bori winkte. Onkel Barnabás raffte sich auf und winkte auch, kurz und kräftig, als salutiere er.
«Na, Bori …»
Bori hörte ihn schon nicht mehr. Sie lief durch den Garten die geschotterte Auffahrt hinunter, sie wollte als Erste am Tor sein, das immer klemmte, um ihrem Vater zu öffnen.
6.
Károly stellte die Kiste ins Gras und wischte sich die Stirn. Er begrüßte Róza mit einem Handkuss, umarmte alle anderen. Sie standen erwartungsvoll um ihn und die Kiste herum.
Wenn es nur nicht wieder eine Wassermelone war, dachte Bori.
Ihr Vater klappte den Deckel auf, griff mit beiden Händen hinein und hob ein schwarzes Bündel heraus.
«Das ist Krapek», sagte er.
«Mein Gott, ein Puli!»
Die Großmama schlug mit einer Mischung aus Staunen und Entsetzen die Hände zusammen.
«Und nicht irgendeiner, sondern ein echter, reinrassiger Aristokrat mit Stammbaum! Templomkerti Retyezáti Basahalmi Krapek mit vollem Namen.»
Károly sah Misi und Bori an und setzte den Hund auf den Boden. «Achtet gut auf ihn, von jetzt an gehört er euch.»
Sie starrten ihn an. Der Hund war von filzigen, kohlschwarzen Schnüren bedeckt, die bis zur Erde hingen. An einem Ende kam eine hechelnde, rosarote Zunge zum Vorschein.
Misi, dessen Gesicht plötzlich eingefallen war, drehte sich weg und wollte sich zwischen den Beinen hindurchdrängen. Tante Jolán hielt ihn auf.
«Misi, was hast du?»
Er presste seine Lippen zusammen und verbarg sein Gesicht im Rock seiner Mutter.
«Lass ihn, Jolán», sagte Teréz.
«Er muss lernen, sich klar zu äußern, wenn ihm etwas nicht passt», sagte Tante Jolán.
«Was ist denn? Was hat er?», sagte jemand.
Teréz hob hinter seinem Rücken beschwichtigend die Hand, sie sollten ihn in Ruhe lassen. Sie beugte sich zu ihm hinunter. Es dauerte eine Weile, bis sie ihn verstanden hatte. Er hatte sich nicht einen kleinen schwarzen, sondern einen großen weißen Hund gewünscht, einen, der aussah wie Belle in «Belle und Sebastian».
«Wir haben nun mal keinen Platz für einen Pyrenäenberghund im Zimmer», platzte es Károly heraus, «es ist nicht einmal für uns genug Platz.»
Sie trösteten Misi, redeten von allen Seiten auf ihn ein, auch Krapek würde groß werden, sogar weiß könne er noch werden, das wisse man nie, so was habe es schon gegeben. Ein Schäferhund sei er ja schon, genauso wie Belle in der Serie, die spanischen hießen eben Pyrenäenberghunde, die ungarischen Pulis.
Misi tat, als würde er nichts hören. Onkel Géza legte ihm die Hand auf die Schulter, aber er drehte die Schulter weg. Teréz und Károly blickten einander ratlos an. Teréz nahm Bori beiseite und schickte sie zu den Nachbarn, sie solle schnell Andrea holen, Misis Spielkameradin. Bori schlüpfte durch das Loch im Zaun. Die Erwachsenen kehrten zu ihren Gesprächen zurück, und ein paar Minuten später war Bori wieder da, mit Andrea.
Andrea wolle Krapek in den Arm nehmen.
«Immer vorsichtig», rief Károly, «er schnappt gern zu!» Er hielt ihnen seine Hand hin und wies auf einen Zahnabdruck im Daumen. «Das müssen wir ihm aberziehen.»
«Ein Puli lässt sich nicht erziehen», warf Großpapa Béla ein, der Krapek streichelte und tätschelte. «Er hat seine angeborene Intelligenz, geprägt von den Jahrhunderten in den Weiten der Puszta, etwas anderes versteht er nicht.»
«Eben ein echter Ungar», murmelte Onkel Barnabás. «Ich wette, er spricht beim Essen nicht.»
Krapek rannte schnüffelnd durchs Gras und markierte alle Bäume, Ecken und Kanten. Andrea folgte ihm, erst in einigem Abstand, dann näher, mutiger, sie klatschte vor Vergnügen auf ihre Schenkel, und Krapek sprang an ihr hoch. Misi beobachtete sie, und plötzlich lief er mit, hinter dem schwarzen Hund her, und Teréz kehrte zu den Gästen am Tisch zurück.
7.
Die gute Laune war wieder da, wie der blaue Himmel nach einem Sommerschauer. Teréz lief ins Haus und kochte frischen Kaffee, die Gäste schoben einander erleichtert die letzten Tortenstücke zu. Károly hängte sich seine Praktina um und begann zu fotografieren, auf das weiche, vorabendliche Licht hatte er gewartet. Er schlich umher, blieb mal hier, mal dort stehen, wartete unauffällig auf den spontanen, besonderen Gesichtsausdruck, auf den unbeobachteten Moment, Misi und seine Freundin im Gras mit Krapek, Großpapa Béla und Onkel Barnabás im tiefen Gespräch, Teréz und Jolán Arm in Arm durch den Garten schlendernd.
Bori musste sich mitten ins Rosenbeet stellen.
Ihr Vater zog die dornigen, undurchdringlichen Zweige zur Seite, die wie eine kleine Mauer wuchsen, damit sie durchschlüpfen konnte. In der Mitte stand eine feuerrote, schon leicht verwelkte Rose, daran sollte sie schnuppern und dabei lächeln. Bori hasste es, immer lächeln zu müssen, wenn ihr Vater fotografierte, aber er bestand darauf, es war eine fixe Idee von ihm, und wenn jemand es nicht tat, brachte er einen durch komische Gesten und Zischlaute doch zum Lachen, das schaffte er jedes Mal, deshalb wollte sie lieber von sich aus lächeln.
Ihre Mutter und Tante Jolán waren beim Flieder stehen geblieben, Bori konnte Fetzen ihres Gesprächs hören. Wie immer in letzter Zeit ging es um die Wohnung, sie hätte die Klagen ihrer Mutter schon auswendig nachsprechen können. Dass es so nicht weitergehen könne, dass man zu viert auf sechzehn Quadratmetern, in einem Mansardenzimmer mit Rabitzwänden, ohne Küche, mit einem winzigen Badezimmer, das man mit dem Nachbarn teilen musste, nicht leben könne.
Ihre Mutter zündete sich eine Zigarette an. Tante Jolán betrachtete ihre Stiefelspitzen, redete ihr zu. Géza habe sich schon bei der Bezirksverwaltung für sie eingesetzt, sie müssten sich noch ein bisschen gedulden. Sie solle lieber Károly einen Tritt in den Hintern geben, damit er endlich auch aktiv werde.
Bori lächelte, sah zu ihrem Vater, der schüttelte den Kopf: «Nein, nein, nicht so, locker, ganz natürlich … ja … so … genau so …»
Er knipste.
«Bleibt stehen!», rief er plötzlich Teréz und Jolán zu.
Er ging in die Knie.
«Sehr gut, stillhalten! Und jetzt lächeln! Teréz, lass doch die Zigarette verschwinden!»
Jolán setzte ein Lächeln auf, Teréz brachte es nur zu einem halben.
Die Kamera klickte.
Bori sah, wie hinter dem Kopf ihres Vaters eine große dunkle Wolke heraufzog.
«Es ist nicht nur die Wohnung, Jolán, es ist alles, einfach alles …»
«Nur du bist es, Teréz, nichts anderes, deine ewige Unzufriedenheit, dein Idealismus.»
«Aber ich bin doch zufrieden! Wir sind glücklich, sogar hier, in diesem Zimmer, in dem es andere keine zwei Wochen aushalten würden.»
Károly machte einen Schritt vor.
«Und noch mal! Lächeln, Teréz, du auch …»
«Es ist … ich weiß nicht … die Lügen, die Verdrehungen, die Halbwahrheiten, diese Niedertracht, die schon ganz normal geworden ist. Du hast dich mit alledem eingerichtet, ich kann das nicht.»
«Jede Wahrheit ist eine halbe, Teréz.»
«Nicht für mich.»
«Ich weiß, ich weiß, der gestirnte Himmel und das moralische Gesetz – aber entschuldige mal, wir sind doch keine Kinder mehr. Du musst lernen, Kompromisse zu schließen, die Welt zu nehmen, wie sie ist, das ist alles. Mit deinem Idealismus wirst du früher oder später in der Klapse landen.»
«Und noch mal! Rückt zusammen … halt … genau so! Phantastisch!»
Károly schob seine Brille hoch, um zu prüfen, wie viele Bilder ihm noch blieben.
«Darf ich endlich wieder raus?»
Károly hob überrascht den Kopf. Bori stand inmitten der Rosensträucher wie eine Maus in der Falle. Wie konnte er sie nur vergessen haben?
Schnell schob sich die schwarze Wolke hinter ihrem Vater über den Himmel, ihr Schatten hatte schon das Haus verschluckt. Jetzt sollte sie vielleicht etwas sagen, dachte Bori, doch außer ihr schien niemand das aufziehende Gewitter zu bemerken, sie wollte gerade den Mund öffnen, da ertönte ein Schrei vom Haus her.
Mit Krapek in den Armen preschte Misi aus dem Beet, seine Kleider und Haare waren triefend nass. Er setzte Krapek auf den Boden und nieste, Krapek schüttelte sich, die schwarzen Schnüre wirbelten, das Wasser spritzte, und irgendwo über ihnen entlud sich ein Blitz.
8.
Jolán stemmte die Arme in die Hüften. «Also, alles hat seine Grenzen!»
«Schon vorbei», sagte Teréz, die mit einem Geschirrtuch Misis Gesicht und Haar abtupfte.
«Man sollte der alten Hexe den Hals umdrehen!»
«Beachtet sie nicht, sie ist eine unglückliche Frau.»
«Das gibt ihr nicht das Recht, andere unglücklich zu machen. Ich werde …»
Teréz hielt Jolán am Arm fest.
«Lass sie, Jolán! Versetz dich mal in ihre Lage.»
«Sie sollte sich mal in das Kind hineinversetzen!»
«Streit führt zu nichts.»
«Du musst dich doch mal wehren!»
«Du fährst nachher heim und hast deine Ruhe, aber ich muss mit ihr leben. Es hat keinen Sinn.»
«Du kannst nicht ein Leben lang kuschen und alles hinnehmen, Teréz, du musst dich endlich deinen Problemen stellen!»
«Ich habe keine Probleme.»
«Natürlich nicht, das wäre unter deiner Würde!»
«Soll ich in die Partei hineinheiraten, wie du? Du hast leicht reden.»
«Teréz! Du solltest dich schämen!»
Bori stand der Mund offen. Großpapa Bélas Stimme war wie ein Peitschenknall gewesen. Seine Hand hatte gezuckt, eine winzige Bewegung nur, aber voller Zorn, Bori hatte es gesehen, alle hatten es gesehen, und jetzt war es ganz still.
Ihre Mutter senkte den Kopf. Wortlos, wie versteinert stand sie vor ihnen.
Ein Wind fegte durch den Garten und schlug die Rosen gegen Boris Arme und Beine, sie zuckte zusammen. Abgerissene Blätter wirbelten, Servietten flatterten vom Tisch, erste Regentropfen klatschten auf die Teller. Gleich würde es gießen, sie ließen alles stehen und liegen und liefen zum Haus, jeder, wie er konnte. Bori sah noch, wie ihr Vater im Laufen mühsam seine Kamera in die Fototasche schob.
Das Treppenhaus war eng, die Stufen knarrten, sie stiegen hintereinander hinauf, noch immer peinlich berührt und froh, nicht sprechen, niemandem ins Gesicht sehen zu müssen.
Das kleine Zimmer im zweiten Stock war sauber und aufgeräumt, die Möbel glänzten, die Dielen rochen frisch gebohnert. Ein Tisch, eine Kommode, ein Diwan, das Kinderbett, ein Fernseher, eine geblümte Ausziehcouch, an den Wänden ein paar Bilder und zwei Perserteppiche, auf der Kommode ein großer Strauß Rosen. Károly lief zum Erker und schloss das Fenster, der Regen hatte schon ins Zimmer gesprüht, außerdem hätte im Prasseln niemand die Nachricht gehört, die er noch mitzuteilen hatte.
Man drängte ins Zimmer, Béla blieb auf der Schwelle stehen und drehte sich zu Teréz um, die als Letzte kam.
«Verzeih mir, Teréz, ich habe die Beherrschung verloren, ich habe es nicht so gemeint …»
«‹Ein Sebestyén muss stets der Beste sein›, hast du immer gesagt», flüsterte Teréz mit zitternder Stimme, «und dann hast du zwei in die Welt gesetzt …»
«Verzeih mir, Teréz!»
«Es gibt nichts zu verzeihen, ich bitte dich um Verzeihung, weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte.»
«Du bist genauso …»
«So leben wir also, wir Idioten!», rief Teréz plötzlich.
«Teréz, du musst deine Nerven schonen.»
Róza sank auf die Couch, betastete ihre nass gewordene Frisur und seufzte.
«Und wie soll das erst mit dem Hund werden.»
«Es ist noch Platz für viele Hunde hier, Großmama», sagte Géza jovial.
Károly stand immer noch am Fenster, die Hand am Griff, und starrte hinaus. Mitten im Garten hatte er Onkel Barnabás erblickt. Er schritt auf die Rosensträucher zu, blieb stehen und griff hinein, als hätte er just jetzt im strömenden Regen Lust bekommen, Rosen zu schneiden. Da bemerkte Károly inmitten der roten Blüten Boris Gesicht. Onkel Barnabás half ihr heraus, sie huschte durch den Regenvorhang, und Károly fasste sich an die Stirn, entsetzt darüber, dass er sie wieder vergessen, sprichwörtlich im Regen stehengelassen hatte.
Onkel Barnabás trottete zu seinem Platz am verwüsteten Tisch und setzte sich. Seelenruhig saß er im Regen, unter dem toten Kirschbaum, den grell aufleuchtenden Wolken, und Károly kam plötzlich der Gedanke, dass er vielleicht nur darauf wartete, dass auch ihn, wie einst Vilma während der Luftangriffe im Sommer 44, ein Blitz vom Himmel treffen möge.
Károly rief nicht, Barnabás hätte ihn ohnehin nicht gehört. Sein Augenblick war gekommen, er räusperte sich. Die anderen verstummten, alle Blicke lagen auf ihm, überrascht, dass er eine Rede halten wolle.
«Ich habe eine gute Nachricht», sagte er, ein schüchternes Lächeln im Gesicht. «Ich habe über das Institut ein Stipendium bekommen. Ein Stipendium der Vereinten Nationen. Von September an werde ich ein Jahr an einem Institut in Deutschland arbeiten … in Westdeutschland.»
Er sprach ruhig. Bori, die in dem Augenblick ins Zimmer kam, fand, dass ihr Vater mit seinem nassen Hemd, den zerzausten Haaren und der beschlagenen Brille reichlich komisch aussah, und musste auflachen, genau wie ihr Vater es sich wünschte, wenn er sie fotografierte.
9.
Das Gewitter zog schnell wieder ab, das Zimmer hellte sich auf. Sie saßen eng beieinander, erst sprachlos, dann immer aufgeregter. Das waren wahrlich große Nachrichten. Westdeutschland sei weit weg, nicht geographisch, aber politisch, was für eine Ehre für Károly, in ein deutsches Institut eingeladen zu werden, eine solche Auszeichnung würde nur den Talentiertesten zuteil. Dass Károly talentiert war, darin war man sich einig, nur ein bisschen lebensfähiger, kämpferischer könnte er sein, er war viel zu gutmütig für diese Welt, dachten sie.
«Aber die arme Teréz, wie soll sie das bloß schaffen! Die beiden Kinder und die Arbeit, so ganz allein.»
Róza seufzte, schüttelte den Kopf.
Wie sollte das nur werden? Sie würden auf jeden Fall alle zusammen helfen müssen.
Während sie redeten, legte Károly immer wieder den Finger auf die Lippen und deutete zur Wand, und sofort senkten sie die Stimmen. Károly und Teréz vermuteten, dass Ferenc, der Nachbar, der beim Innenministerium arbeitete und als Erweiterung seiner eigenen Wohnung schon lange ein Auge auf ihr Zimmer geworfen hatte, lauschte und Berichte über sie schrieb.
Teréz stand am Fenster. Nur vage drangen die Worte an ihr Ohr. Die Sonne schien wieder, schien ihr warm ins Gesicht, und plötzlich erfasste sie eine heftige Sehnsucht, mit Károly zu gehen, wegzugehen, die Kinder mitzunehmen und nie mehr zurückzukommen, alles hinter sich zu lassen, die Lügen und die Lügner, die Opportunisten und die Karrieristen, die Feiglinge, dieses ganze System von Gefälligkeiten und Gegengefälligkeiten und irgendwo weit, weit weg ein neues Leben zu beginnen.
Sie starrte auf die leuchtenden Tropfen auf der Fensterscheibe, erschrocken über sich selbst. Sie hatte bisher nie überlegt, Ungarn, die Heimat, zu verlassen, wie es so viele, die sie gekannt hatte, getan hatten, um im Überfluss des Westens besser zu leben. Sie war nicht so wie sie, hatte derlei nie gebraucht, um glücklich zu sein, ihre private Zufriedenheit hatte ihre Unzufriedenheit mit der Gesellschaft ringsum stets überdeckt, das, worauf es ihr wirklich ankam, hatte sie.
Sie riss das Fenster auf, taumelte fast. Ein neues Leben. Sie wünschte, sie könnte den Gedanken, der plötzlich als reale Möglichkeit vor ihren Augen stand, wieder ungedacht machen, jetzt, sofort, doch ahnte sie schon, dass die Idee nun in ihr war und wachsen und reifen würde wie eine Frucht am Baum.
10.
Bori verschwand auf den Dachboden, um sich trockene Kleider anzuziehen. Sie mochte den finsteren, staubigen Boden nicht, seit sie im Frühjahr auf den aufgequollenen Kadaver einer vergifteten Ratte gestoßen war, und weil sie wusste, dass die Ratten immer noch da waren, aber daran dachte sie in diesem Moment, da die Gäste sich gerade auf den Heimweg machten, nicht.
Der Dachboden war wie ein Schiffsbauch, dachte Bori immer, obwohl sie noch nie in einem Schiff gewesen war, ein schattiges, muffiges Gewölbe voller schwarzer Balken, im Winter eiskalt, im Sommer schwülwarm, nur am frühen Morgen und späten Abend erträglich.
Sie beeilte sich, die Schritte der Gäste hallten schon durch das Treppenhaus.
«Ach, da bist du, Bori!»
Ihre Großmama zog die Tür hinter sich zu.
«Ich habe etwas für dich», flüsterte sie.
Sie stellten sich unter das winzige Dachfenster, Bori war sofort neugierig. Ihre Großmama öffnete ihre Handtasche und nahm etwas heraus, Bori betrachtete aber nur ihre gichtigen Finger, immer musste sie, wenn sie an die Großmama dachte, an ihre Finger mit den schiefen Kuppen denken. Sie fand sie nicht hässlich, sie mochte sie, weil sie zu ihrer Großmama gehörten.
«Vor ein paar Tagen hat mich in der Stadt wieder mal eine Zigeunerin angesprochen …»
«Wollte sie dir wieder dein Seidentuch abkaufen?»
«Was soll ich tun, sie sind versessen auf diese Tücher! Na ja, es war ja auch ein wirklich schönes Stück. Diesmal habe ich es verkauft.
«Du hast es verkauft? Für wie viel?»
«Nicht für Geld, ich habe es getauscht. Hierfür.»
Sie öffnete ein Etui, das sie aus der Tasche gezogen hatte. Bori erblickte ein Medaillon, es schimmerte in tiefem Grün, Blau und Lila.
«Was ist das?»
«Erkennst du es nicht?»
Bori schüttelte den Kopf.
«Das Auge einer Pfauenfeder.»
«Ach ja!»
«Aber das ist nicht alles. Es ist ein Talisman.»
«Ein Glücksbringer? Ein echter?»
«Es soll einer Zigeunerprinzessin gehört haben. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber wir wissen auch nicht, dass es nicht stimmt. Eigentlich wollte ich es dir erst zu deinem fünfzehnten Geburtstag schenken, aber mit dem Glück braucht man nicht zu warten, nicht wahr? Wenn du darauf achtgibst, wird er auf dich achtgeben.»
Bori bedankte sich, sie strahlte über das ganze Gesicht.
«So, und jetzt gehen wir, sonst fahren sie ohne mich ab, und dann müsste ich hier übernachten, obwohl es bei euch auch ohne mich schon eng genug ist.»
Im Treppenhaus reichte Bori der Großmama den Arm, obwohl es ihr lieber gewesen wäre, wenn sie über Nacht geblieben wäre.
Ein Luftzug knallte hinter ihnen die Tür zu.
11.
Sie gingen in den Garten. Die Luft war prickelnd klar. Teréz brachte Onkel Barnabás trockene Sachen, aber er schüttelte den Kopf, die Sonne werde ihn schon trocknen. Onkel Géza öffnete die Autotüren, Tante Jolán breitete auf dem Beifahrersitz eine Decke für Onkel Barnabás aus, aber auch das wollte er nicht, er wollte lieber gleich zum Friedhof fahren.
Bori betastete sein nasses Hemd.
«Warum bist du nicht ins Haus gekommen?»
«Ich wollte nicht, dass du allein nass wirst, Bori.»
«Ich bin aber längst wieder trocken.»
«Ich auch, nur sieht man es bei mir nicht.»
Er lächelte geheimnisvoll.
Die Gäste nahmen Abschied, bedankten sich für den schönen Tag und beglückwünschten Károly noch einmal zu seinem großartigen Erfolg. Als die stoppelige Wange ihres Vaters die ihre streifte, hörte Teréz, wie er sie leise noch einmal um Verzeihung bat, und drückte ihn fest. Seine Reue, seine Scham, sein flehender Blick machten sie verlegen, und sie war ihm ja nicht böse. Nur vergessen – vergessen, dass er vor den anderen Partei gegen sie und für ihre Schwester ergriffen hatte, das würde sie nicht können.
«Das mit der Wohnung deichseln wir schon», sagte Jolán aufmunternd, als sie Teréz umarmte. «Nur das», zeigte sie auf die Zigarette in Teréz’ Hand, «das musst du allein in den Griff kriegen.»
Noch vor kurzem hatte sie selbst geraucht, schon als Mädchen hatte sie sich ein Vorbild an ihrer älteren Schwester genommen, die sich das Rauchen im letzten Kriegsjahr angewöhnt hatte, doch eines Tages hatte sie den Entschluss gefasst, damit aufzuhören, und ihren Entschluss innerhalb weniger Wochen auch in die Tat umgesetzt. Seitdem war sie überzeugt, dass auch Teréz es schaffen könnte, wenn sie nur wirklich wollte. Aber sie versuchte es gar nicht erst, fand Jolán.
Man stieg ins Auto, der Motor brummte auf, der Kies knirschte, sie rollten hinunter. Károly, Bori und Misi waren schon bis zum Tor gegangen, und als das Auto in die Székácsstraße einbog und die vielen Hände in den Fenstern und über dem Dach zu winken begannen, winkten sie zurück.
Misi schaute zum Himmel. Er war blau, stahlblau, nicht eine Wolke zu sehen. Der Schiguli hatte ihm gefallen, aber wenn er groß war, würde er sich trotzdem einen Porsche kaufen, das stand fest.
12.
«Was hast du, Teréz?»
Sie und Onkel Barnabás waren oben geblieben. Er lehnte sich gegen die Mauer der Auffahrt und ließ sich von der Sonne trocknen. Teréz sah ihn an. Er kannte sie zu gut, als dass sie ihm etwas hätte verheimlichen können.
«Sie haben mich entlassen, Onkel. Versetzt, aufs Land, nach Gödöllő. Ab September.»
«Ist das wahr?»
Barnabás kratzte sich am Hinterkopf, wühlte mit seinen Schuhspitzen im Schotter.
«Sie sollten sich schämen», flüsterte er ungläubig, «sie sollten sich wirklich schämen. Sie hätten dem Himmel dankbar sein sollen, jemanden wie dich zu haben.»
Teréz warf ihren Zigarettenstummel weg.
«Ich scheine es im Moment keinem recht machen zu können. Was ich auch tue, ich werde nur bekrittelt, belehrt, beschimpft, beurlaubt, alle wissen alles besser, alle machen alles besser …»
«Nimm dir das nicht so zu Herzen, Teréz. Dein Vater macht sich Sorgen, wie es bei euch weitergehen soll, das ist alles. Er hat zu viel Liebe in sich, zu viel Fürsorge, zu viel Zuviel, es gibt ein Maß an Liebe und Sorge, das nicht mehr auszuhalten ist. Aber er meint es gut mit dir.»
«Umso schlimmer.»





























