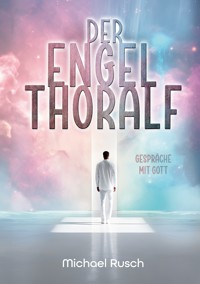Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit wird von einer Pandemie befallen. Ein geringer Teil der Menschen kann in einem Höhlensystem Zuflucht finden. Wer darin nicht schnell genug einen Platz findet, muss sterben. Um sich vor den tödlichen Viren zu schützen, schotten sich die Höhlenbewohner von der Außenwelt ab und bauen sich eine riesige unterirdische Stadt auf. Nach über 50 Jahren leben die Menschen bereits in der dritten Generation in den Höhlen. Nach einem Erdbeben entdecken Ian und Jessica, die Kinder von Emily und Oliver Mooth, in ihrer Kindernische unter einem Bett ein Loch in der Wand. Dahinter befindet sich ein Tunnel, der in die Außenwelt führt. Die Kinder wagen einen Ausflug in die Natur. Die Eltern bemerken das und Emily folgt den Kindern. Als seine Familie wider Erwarten nicht krank wird und stirbt, versucht Oliver Mooth die Gründe dafür zu erfahren und entdeckt, dass die Höhlenbewohner Sklaven ihrer Regierung sind. Gemeinsam mit seinen Freunden organisiert er einen Aufstand zur Befreiung und erhält überraschend Hilfe von Menschen, die in einem Wald Schutz vor der Pandemie gefunden hatten. Doch dann werden die Rebellen verraten. Der Aufstand ist in Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Lars Peters
Der Autor
Michael Rusch, 1959 in Rostock geboren, ist von Beruf Rettungsassistent und lebte von 2013 bis 2017 in Hamburg, wo die ersten Bände der Fantasy-Reihe „Die Legende von Wasgo“ entstanden. Heute lebt er in Lutterbek, in der Nähe von Kiel. Nach einer kreativen Schreibpause veröffentlichte er 2012 seinen autobiografischen Roman „Ein falsches Leben“ beim Selfmade-Verlag Lulu.
Danach wandte sich Rusch dem Genre Fantasy zu. „Die ewige Nacht“ aus der Reihe „Die Legende von Wasgo“ erschien im Januar 2014. Im September desselben Jahres folgte die Fortsetzung „Luzifers Krieg“. Es folgten „Angriff aus dem Himmel“ (2015) und „Bossus´ Rache“ (2017). Mit dem fünften Band „Wasgos Großvater“ endete 2018 „Die Legende von Wasgo“.
2014 veröffentlichte Rusch beim AAVAA Verlag eine überarbeitete Version seines Romans „Ein falsches Leben“ in zwei Bänden, den er im Juli 2020 nochmals überarbeitet mit BoD unter dem Titel „Das Leben des Thomas Schneider“ herausgab.
Im Jahre 2015 gründete er seinen Verlag „Die Blindschleiche“ und veröffentlichte mit ihm seinen Roman „Die drei Freunde“. Im Sommer 2019 entschloss er sich, aus gesundheitlichen Gründen den Verlag aufzulösen, diesen Roman zu überarbeiten und ihn als Selfmade-Autor mit BoD neu zu veröffentlichen.
Im gleichen Jahr beendete Rusch die Zusammenarbeit mit dem AAVAA Verlag und überarbeitete „Die Legende von Wasgo“, die er bereits im Januar 2020 mit BoD in zwei Bänden erneut veröffentlichte. Band 1 enthält die ersten drei und Band 2 den vierten und fünften der ehemaligen 5 Bände.
Nach den Genres Wahre Geschichten und Fantasy wendete sich Rusch einem neuen Bereich der Literatur zu, dem Horror. 2020 veröffentlichte er den ersten Band seines Romans „Das Hochhaus“. Zurzeit arbeitet er an dem 2. Band dieses Romans.
Inhalt
Prolog
In der Höhle
Das Erdbeben
Der Spitzel
Der Ausflug
Das Böse im Menschen
Das ist Aufruhr
Unerwartete Verbündete
Vorsichtige und brutale Kontakte
Vereinbarungen
Gefahren
Ein Plan
Der Aufstand
Das neue Leben
Danksagung
Prolog
Jacob Smith verließ sein Büro. Er lebte in Kalifornien in einer Stadt am Pazifischen Ozean. Für heute hatte er einen Kinoabend mit seiner Frau geplant. Ein neuer amerikanischer Film mit Starbesetzung. Doch die Lust war ihm vergangen. Andrew Howard, ein fünfundzwanzig jähriger Kollege war plötzlich gestorben. Gestern noch hatten sie zusammen gearbeitet und heute hinterließ er seine junge Ehefrau, die obendrein schwanger war.
Jacob Smith verstand die Welt nicht mehr. Andrew war ein lebenslustiger und kräftiger junger Mann gewesen, ein Kerl wie ein Baum. In den letzten Tagen hatte er sich einen Schnupfen und einen leichten Husten eingehandelt. Es war nichts Besorgniserregendes. Das nahmen er und seine Kollegen wenigstens an. Trotzdem war er heute tot. Aber niemand starb so einfach an Husten und Schnupfen!
Als er die Bushaltestelle erreichte, hatte er noch fünf Minuten Zeit, bis der Bus, der ihn beinahe vor die Haustür seiner Wohnung brachte, fahrplanmäßig abfahren sollte. Das Wetter war hervorragend, an einem strahlendblauen Himmel schien die Sonne, 28 Grad Wärme ließen ihn leicht schwitzen. Er setzte sich ins Wartehäuschen auf die Bank.
Neben ihm nahm eine junge Frau Platz. Sie hätte seine Tochter sein können. Aus ihrer Handtasche entnahm sie ein Buch und begann darin zu lesen. Plötzlich nieste sie dreimal hintereinander. Dafür entschuldigte sie sich bei ihm und vertiefte sich danach erneut in ihren Roman, bis der Bus vorfuhr.
Sie stiegen beide ein. Fünfzehn Minuten später verließ er den Bus wieder. Noch wusste er nicht, dass die junge Frau, die während der Fahrt noch drei weitere Male nieste, die Mehrheit der Fahrgäste mit ihrem „Schnupfen“ angesteckt hatte. Alle diese Menschen starben in den nächsten sechs Tagen. Aber auch das wusste Jacob Smith nicht.
*****
Sieben Tage später. Viele Menschen starben auf den Straßen. Was war nur geschehen. Jacob Smith und seine Frau Isabella saßen beim Abendessen. Jacobs Bruder James war ihr Gast. Die Stimmung am Tisch war sehr bedrückt. Es gab kaum noch einen Menschen, der nicht ein Familienmitglied in der letzten Woche verloren hatte. Wer das große Glück hatte, alle seine Familienmitglieder am Leben und gesund zu wissen, hatte jedoch einen toten Freund oder eine tote Freundin zu beklagen. Die Welt stand auf dem Kopf. Die Menschen starben wie die Fliegen. Und nicht nur in dieser Stadt, sondern im ganzen Land, ja, sogar auf der ganzen Welt.
„James, ich werde mit meiner Familie die Stadt verlassen. Du siehst doch auch, was überall los ist. Endlich geben sie in den Nachrichten zu, dass uns ein Virus bedroht. Eine Epidemie ist ausgebrochen. Es hat schon tausende Tote gegeben. Die Sterblichkeit liegt bei fast hundert Prozent. Ich hoffe, dass du dich mit deiner Familie uns anschließt“, sagte Jacob Smith, indem er seinen Bruder eindringlich in die Augen sah.
„Was soll das schon wieder, Jacob“, erwiderte James Smith verächtlich, „ein paar Menschen sterben und schon bekommst du es mit der Angst zu tun. Dass du auch immer so sehr übertreiben musst. Epidemie, so ein Quatsch! Ich kann nichts sehen, das uns bedroht. Die Bedrohung findet nur in deinem Kopf statt.“
Isabella war entsetzt. „Wie kannst du nur so etwas sagen, James. Hast du denn gar kein Verantwortungsgefühl für deine Familie?“
„Rede du nicht von Verantwortungsgefühl, wenn es um meine Familie geht. Niemand sorgt sich so sehr um seine Familie wie ich. Ich kümmere mich doch wohl um alles, gehe schuften, damit es meiner Frau und meinen Kindern gut geht.“ James Smith war wütend.
Sein Bruder versuchte, ihn zu beschwichtigen. „James, so hat Isabella das doch gar nicht gemeint. Sie wollte dich nicht angreifen. Natürlich wissen wir, dass du dein letztes Hemd für deine Familie gibst. Aber du regierst sie manchmal wie ein Diktator. Deine Frau hat es mit dir nicht immer leicht, auch wenn du ihr jeden Wunsch von den Augen abliest. Jedenfalls fast jeden. Nur ihren wichtigsten Wunsch willst du nicht erkennen. Nämlich den nach Mitbestimmung. Du entscheidest stets für die gesamte Familie!“
„Ist ja klar, dass du Isabella in Schutz nimmst. Bisher haben sich meine Kinder noch nicht beschwert, wenn ich ihnen etwas aufgetragen habe. Isabella hat sich schon lange nicht mehr beschwert. Also mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein!“ Er machte eine kleine Pause. Mit Unverständnis über die Worte seiner Schwägerin und seines Bruders schüttelte er den Kopf. Aber dann fragte er doch noch: „Wo willst du denn überhaupt hin?“
„Harold Mooth hat uns angeboten, mit ihm in die Höhlen am Meer zu den alten Goldminen zu gehen. Sie befinden sich nur eine halbe Stunde von der Stadt entfernt und auch die Regierung hat sich dort bereits niedergelassen“, erklärte Jacob Smith.
„Papperlapapp, es gibt keine Epidemie, und ich bleibe mit meiner Familie, wo wir sind. Basta“, beschied James Smith seinen Bruder Jacob. Nach dem Abendessen verließ er ihn und seine Familie, die sich am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem Freund Harold Mooth und dessen Lieben in die nahegelegenen Höhlen am Meer begaben. Mehrere Tausend Menschen sollten dort für viele Jahre ihr Zuhause finden. Aber James sah seinen Bruder Jacob in seinem restlichen Leben nie wieder.
*****
Genau eine Woche später glich die Stadt einer Geisterstadt. 75 Prozent ihrer Einwohner waren gestorben. Überall spielten sich Dramen ab. Auch James Smith konnte nicht mehr über die Tatsache hinwegsehen, dass es sich nicht nur um eine Epidemie, sondern sogar um eine Pandemie handelte, die überall auf der Welt wütete. Der Gesundheitszustand der infizierten Menschen verschlechterte sich am Ende ihrer Krankheit in nur wenigen Stunden so sehr, dass sie auf dem Weg zur oder von der Arbeit starben. Die Rettungsdienste schafften es nicht mehr, in Not geratene Menschen in die Krankenhäuser zu bringen. Arztpraxen mussten schließen, weil auch die Ärzte der Pandemie zum Opfer fielen. Die Bestattungsunternehmen schafften es nicht mehr, die Toten zu bergen. Leichengestank breitete sich allmählich überall in den Straßen aus. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, blieb den Stadtreinigungsfirmen nichts anderes übrig, als tiefe Gruben zu buddeln, die Leichen hineinzuschieben und dort zu verbrennen.
Medikamente gegen die Pandemie waren noch nicht entwickelt worden. Ohne wirksame Schutzmasken fühlten sich die Menschen verloren.
Endlich musste auch James Smith es einsehen, dass er seine Frau und seine Kinder nicht länger der unsichtbaren Gefahr aussetzen durfte. Gemeinsam mit ihnen packte er die wichtigsten Sachen in einige Koffer und Kartons. Hierbei handelte es sich um Dinge, von denen sie glaubten, dass sie diese in den Höhlen der Goldminen am Meer, die ihr Ziel waren, gebrauchen konnten. Dort würde er sicherlich auf seinen Bruder treffen. Doch als sie dort eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Höhlen zugemauert worden waren!
In der Höhle
Der alte Mann war verzweifelt und hatte Hunger. Der Hunger bereitete ihm Schmerzen und riss an seinen Eingeweiden. Leider war er nicht im Stande, sich selbst aus dieser misslichen Lage zu befreien. Schon viel zu lange lebte er unter der Erde in den alten Goldminen. Die meisten Menschen nannten diese Minen Höhlen und ihre Wohnungen Wohngrotten, wenn man überhaupt von einer Wohnung sprechen konnte. Es war heute eben alles anders, als er es aus seinen jungen Jahren kannte. Damals lebte er noch in der Stadt. Heute war das unmöglich. Das jedenfalls behauptete die Regierung. Aber der alte Mann hatte daran deutliche Zweifel. Gerne hätte er dagegen aufbegehrt, aber wie hätte er es allein und ohne Unterstützung tun sollen? Und immer wieder erinnerte er sich daran, dass es ihn in den Höhlen offiziell gar nicht gab.
Diese Wohngrotten waren zwar tatsächlich abgeschlossene Bereiche, in denen Familien lebten, deren Vorfahren hier einen Zufluchtsort fanden, aber mit einer herkömmlichen Wohnung konnte man sie nicht vergleichen. Die Wände waren schief und krumm, der Boden uneben und mit vielen Dellen versehen. Die Räume, die durch den Abbau des Goldes in vielen Jahren entstanden waren, hatte man einfach abgetrennt, sodass die Menschen eine Bleibe für sich gefunden hatten.
Nur der alte Mann hatte keine solche Wohngrotte erhalten. Als er vor über fünfzig Jahren diese Höhlen besuchte, um sie sich anzusehen, waren sie offen. Doch als er sie wieder verlassen wollte, waren die Zugänge bereits zugemauert.
Er hatte sich damals nicht für eine Wohngrotte angemeldet, denn erst wollte er sehen, wie man in ihnen lebte. Dann erst wollte er die Entscheidung treffen, ob er den anderen folgte oder nicht. Als er begriff, dass er die Höhlen nicht mehr verlassen konnte, versteckte er sich. Verzweiflung machte sich in ihm breit, denn ohne Wohngrotte, durfte er nicht in den Höhlen leben.
Nur wer eine Wohngrotte beziehen und eine Arbeit aufnehmen wollte, war willkommen. Seitdem war er von den Aufsehern unentdeckt geblieben, weil er es verstanden hatte, allen Kontrollen zu entgehen.
Um sich ernähren zu können, brauchte er eine Arbeit und eine Wohngrotte. Sonst hätte er betteln müssen, was streng verboten war. Bettler wurden verhaftet und zur Zwangsarbeit verurteilt. Tatsächlich fand er in einem Baubetrieb eine Anstellung, weil er fälschlicherweise angegeben hatte, eine Wohngrotte bezogen zu haben. Bauarbeiter wurden dringend gebraucht, denn in den Höhlen entstand eine richtige Stadt. Deshalb nahm man es in seinem Vorstellungsgespräch mit der Anschrift seiner Wohngrotte nicht sehr genau.
Dann gab es noch einen zweiten Weg, wie er sich Nahrung beschaffen konnte. Wenn die Verkäufer in den Lebensmittelläden unaufmerksam waren, hätte er stehlen können. Aber diese Möglichkeit schied für ihn sofort aus, denn er wollte niemanden etwas wegnehmen. Er war kein Dieb und wollte nicht, dass die unschuldigen Mitarbeiter der Geschäfte dafür bestraft werden.
Wenigstens wurde er mit Lebensmittelmarken entlohnt und konnte sich mit den wenigen Dingen, die er dafür bekam, notdürftig versorgen. Jedoch war damit keine ausgewogene Ernährung möglich. Er hatte nie genug zu essen gehabt, trotzdem hatte er es über mehrere Jahrzehnte geschafft, seine schwere körperliche Arbeit zu verrichten. Doch hatte die Firma ihm vor wenigen Wochen gekündigt, weil er seine Arbeitsaufgaben nicht mehr erfüllen konnte, denn er war schon beinahe achtzig Jahre alt.
Damit wurde ihm seine Nahrungsgrundlage entzogen. Jetzt war er dazu gezwungen, entweder zu stehlen oder zu betteln. Der alte Mann wusste, dass er mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes dem Verderben ausgeliefert war. Irgendwann würde man ihn verhaften. Davor fürchtete er sich, denn aus dem Gefängnis hatte er noch nie positive Nachrichten vernommen. Folter und Nahrungsentzug waren dort an der Tagesordnung. Aber was sollte er tun?
Er setzte sich mit seinem knurrendem Magen und seinem ausgemergelten und ungepflegten Körper vor einen Lebensmittelladen, um zu betteln. Eine Frau kam mit ihren Kindern aus dem Laden heraus. Die Kinder waren gut erzogen und grüßten ihn.
„Hallo“, erwiderte er ihren Gruß und sah ihnen nacheinander ins Gesicht.
Der Junge blieb stehen und fragte: „Waren Sie schon da drin? Heute gibt es nichts mehr.“
„Ich bekomme im Laden sowieso nichts und muss deshalb dort nicht reingehen. Aber ich habe Hunger. Habt ihr nicht etwas zu essen für mich? Es muss nicht viel sein, nur ein kleines Stückchen Brot vielleicht, oder den Rest eines kleinen Wurstzipfels. Egal was“, antwortete der alte Mann.
Nun schaltete sich die Frau in das Gespräch ein. „Leider haben wir auch nichts. Wir hatten gehofft, dass wir unsere Lebensmittelmarken gegen etwas zu Essen eintauschen können. Die Kinder müssen heute leider auch hungern.“
„Das ist eine Schande, die armen Kinder“, antwortete der Alte, „egal ob alt oder jung, die Regierung lässt uns hungern. Wenigstens die Kinder sollten satt zu Essen haben!“
Die Frau drehte sich um und schaute, ob jemand die Worte des Mannes gehört hatte und sagte: „Nicht so laut, wenn das jemand hört, werden Sie verhaftet!“
„Das werde ich sowieso bald“, antwortete der alte Mann.
„Warum sagen Sie das?“, fragte die junge Frau.
„Weil ich nicht mehr arbeiten kann“, sagte der Alte mit einem traurigen Lächeln.
„Oh, Sie Ärmster! Heute kann ich Ihnen leider nicht helfen, aber vielleicht morgen. Wollen Sie morgen auch um diese Zeit hier sein. Dann kann ich Ihnen vielleicht etwas abgeben.“ Die Frau hatte mit dem Alten Mitleid.
„Vielen Dank, junge Frau, das kann ich nicht annehmen, bitte geben Sie Ihren Kindern Ihr weniges Essen, das Sie haben. Kinder dürfen nicht hungern!“ Bei seinen Worten ließ der alte Mann traurig seinen Kopf hängen. Jedoch blickte er der Frau doch noch einmal ins Gesicht und nickte ihr zu. „Sie sind eine gute und liebenswerte Frau. Passen Sie bitte auf ihre Kinder auf!“
*****
„Mama, warst du schon einmal draußen im Freien?“, fragte der neunjährige Ian einige Tage später seine Mutter.
„Nein, Ian, du weißt doch, dass wir nur in unseren Tunneln und Höhlen sicher sind. Ich bin genauso wie du hier geboren.“ Die Familie wohnte in den Stollen der alten Goldminen. Als die Pandemie vor über fünfzig Jahren ausbrach, wurde der Familie Mooth dort eine Wohngrotte zugewiesen. Damals lebten die Großeltern noch. Von denen wurde die Grotte auf die Kinder und danach auf die Enkelkinder übertragen. Die Wohngrotte teilte sich in drei Bereiche auf. Im Wohnbereich wurde gekocht und spielte sich das Familienleben ab. Für die Eltern gab es eine Schlafnische und für die Kinder eine Kindernische, in der Ian mit seiner jüngeren Schwester schlief und in der sie gemeinsam spielten.
„Schade, dann weißt du gar nicht, wie es da oben aussieht!“ Mit traurigen Augen sah Ian seine Mutter an, die im Wohnbereich neben ihm auf einem Sofa saß. Diese streichelte ihm über das Haar und sprach: „Weißt du mein Junge, uns geht es doch gut. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, euer Vater und ich arbeiten, du gehst zur Schule, deine Schwester in den Kindergarten. Ihr lernt alles, was ihr später zum Leben braucht. Was willst du mehr?“
„Aber manchmal könnte es schon etwas mehr zu essen geben. Erst gestern Abend sind wir hungrig ins Bett gegangen. Jessicas Bauch hat noch geknurrt, das habe ich genau gehört!“ Ian war aufgebracht.
Die Mutter sah ihn mahnend an, hatte aber Verständnis für ihn. „Nicht so laut, Ian, so etwas solltest du besser für dich behalten. Sage nur nichts außerhalb unserer Grotte davon, sonst können wir Ärger bekommen.“
„Aber wenn es doch wahr ist!“
„Ich, weiß, mein Schatz. Aber den anderen geht es auch nicht besser. Es ist eben alles etwas knapp. Wir müssen unserer Regierung dankbar sein, dass sie so gut für uns sorgt. Die Erde ist verseucht. Gefährliche Viren bringen jeden Menschen um, der sich auf der Erdoberfläche aufhält. Wir können froh sein, dass damals die Menschen so klug waren und die ehemaligen Goldminen, in denen wir jetzt leben, abgedichtet haben. So konnten unsere Eltern, also deine und Jessicas Großeltern, überleben. Dein Großvater war es übrigens, der mit einem Spaten und einem Hammer begonnen hatte, die Höhle zu erweitern. So entstand hier eine riesige unterirdische Stadt. Ich kenne die Städte, wie sie früher aussahen auch nicht, aber unsere Stadt hier ist ganz anders aufgebaut. Sie entwickelt sich immer weiter. Angefangen hat es natürlich damit, dass die Wohnräume für die Menschen hergerichtet wurden. Die Menschen wollten ja ihr eigenes Reich haben. So entstanden die Wohngemeinschaften, in denen wir jetzt Leben. Später wurden sie zu Blöcken zusammengefasst. Es wurden Nahrungsmittelgeschäfte eingerichtet und überhaupt Läden mit Bekleidung und allem anderen, was man so im täglichen Leben braucht. Die Wohngemeinschaften mussten miteinander verbunden werden, also wurden einige Tunnel angelegt. Aus den Polizisten wurden Aufseher, weil man glaubte, dass es keine Verbrechen mehr geben würde. Und doch gab es welche. Also baute man kleine Gefängnisse, die mit der Zeit immer größer wurden. Und so entwickelte sich unsere unterirdische Stadt immer weiter.“
„Ja, Mama, das weiß ich doch alles schon. Wie oft willst du mir das denn noch erzählen? Jede Woche dreimal?“
„Du sollst nicht immer so frech sein, junger Mann!“
„Ja, ja, Mama. Aber trotzdem weiß ich noch nicht, warum wir den anderen nicht erzählen dürfen, dass wir manchmal Hunger haben.“
Emily Mooth legte ihm einen Arm um die Schulter und sah ihm mit ernsten Augen ins Gesicht. „Ich weiß, mein Engel, das alles ist nicht leicht für dich und deine Schwester zu verstehen. Wenn ein Aufseher hört, was du mir eben erzählt hast, glaubt er, wir sind unzufrieden und wollen Unruhe stiften. Du weißt doch, was mit Unruhestiftern passiert?“
In genau diesem Moment platzte Jessica in den Raum. Als sie ihre Mutter und ihren Bruder sah, plapperte sie aufgeregt drauflos: „Mama, Ian, die Aufseher haben den alten Mann weggebracht. Sie haben ihn einfach verhauen und auf einen Handwagen geworfen und ihn damit weggebracht! Ich habe es gesehen!“
„Scht, Jessica, nicht so laut, wenn dich jemand hört!“, versuchte Emily Mooth, ihre Tochter zu beruhigen. Aber neugierig fragte sie: „Welchen alten Mann meinst du denn?“
„Na, den, der immer vor dem Laden sitzt und die Leute anbettelt. Der hat uns neulich auch gefragt, ob wir etwas zu essen für ihn haben, aber hatten wir ja nicht. Harry hat behauptet, der alte Mann hat gesagt, dass die Regierung uns hungern lässt!“
„Siehst du, mein Junge, wie gefährlich solche Reden sind?“, ermahnte Emily Mooth ihren Sohn.
„Ja, Mama, aber was soll ich machen? Manchmal ist es nämlich so: Ich will gar nichts sagen, und doch ist es mir dann plötzlich rausgerutscht. Ich kann gar nichts dagegen machen!“ Ian sah seine Mutter mit Schalk in den Augen an.
„Ich werde dir gleich helfen, Ian, und das willst du bestimmt nicht“, scherzte die Mutter.
Die Kinder begannen zu lachen. „Und jetzt, Kinder, ab ins Bett“, forderte Emily Mooth ihren Nachwuchs auf.
„Aber wir haben doch noch gar kein Abendbrot gegessen!“ Die Entrüstung der Geschwister war echt und ihre Worte wurden wie aus einem Munde ausgesprochen.
Emily Mooth verspürte einen Stich in ihrem Herzen. Aber was sollte sie machen. Nahrungsmittel wurden nur auf Lebensmittelmarken ausgegeben. Und die waren oft sehr knapp, sodass die Vorräte keine Woche reichten. Mit Tränen in den Augen sagte sie: „Ach, meine Lieblinge, wir haben aber leider nichts mehr zu essen. Ich kann euch höchstens die letzte Milch geben und hoffen, dass der Papa uns etwas mitbringt. Sonst habe ich morgen früh nichts für euch.“
Sie ging zum Küchenschrank und entnahm ihm eine kleine Flasche. Ihren Inhalt teilte sie auf zwei Gläser auf und gab jedem Kind eins. Gierig tranken sie die Milch in einem Zuge aus.
Danach brachte Emily Mooth die Kinder ins Bett. Dabei sagte sie: „Es tut mir wirklich leid, dass ich euch hungrig ins Bett gehen lassen muss, aber die verdammte Regierung lässt sogar euch Kinder hungern!“
Die Kindernische lag etwas abseits vom Wohnbereich. Deshalb hörten sie nicht, dass Oliver Mooth von der Arbeit nach Hause zurückkehrte. Heute war er spät dran.
Als Mikrobiologe arbeitete er in einem Labor in der Forschung. Wie alles andere auch, wurde es in einem eigenen Bereich, dem biologischen Bereich, eingerichtet. Das geschah, als die Menschen in den Höhlen vor der Pandemie einen Zufluchtsort fanden. Es gab verschiedene Fachgebiete. Neben dem Biologischen gab es den Sicherheitsbereich, in dem die Menschen der systemrelevanten Berufe nicht nur ihren Arbeitsplatz hatten, sondern dort auch wohnten. Dann gab es den Bereich der Ernährungsschaffenden. In ihm arbeiteten und wohnten alle Menschen, die Nahrungsmittel produzierten. Es gab weitere Distrikte wie den Handelsdistrikt und andere. Lebten Paare zusammen, die in zwei verschiedenen Bereichen arbeiteten, wohnten sie in einem dieser beiden.
Als Jessica ihren Vater bemerkte, rief sie aufgeregt: „Papi, endlich bist du wieder zuhause.“ Sie streckte ihre kleinen Ärmchen nach ihm aus.
Oliver Mooth ging zu ihr, hob sie aus ihrem Bett heraus und nahm sie auf seinen Arm. Er drückte das Kind sanft an sich. „Ja, Mäuschen, heute hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt bin ich ja da.“ Er setzte seine Tochter ab, ging zu Ian, setzte sich auf seine Bettkante und zauste ihm die Haare. „Na, mein Großer, ist alles in Ordnung bei dir?“
„Bei mir schon, aber bei Mama nicht“, antwortete der Junge.
Oliver Mooth sah seiner Frau ins Gesicht. „Was ist denn los, mein Schatz? Kann ich dir vielleicht helfen?“
„Ach, wie willst du mir schon helfen?“ Wieder stiegen Emily Mooth die Tränen in die Augen.
Oliver nahm sie in seine Arme und flüsterte ihr eindringlich ins Ohr: „Du musst dich zusammenreißen. Vor den Kindern kannst du die Regierung nicht kritisieren. Du weißt, wie lebhaft Jessica ist. Sie soll dich doch nicht unbewusst an einen Aufseher verraten.“ Danach nahm er ihren Kopf in seine Hände und küsste sie auf den Mund. Von den Kindern unbemerkt wischte er mit seinen Daumen ihre Tränen fort.
Ian warf sich in seinem Bett theatralisch in die Kissen, verdrehte seine Augen und sagte mit Pathos in der Stimme: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie sich noch heute!“ Sein Mund war dabei zu einem schelmischen Grinsen verzogen.
Die Eltern mussten lachen, aber Oliver Mooth wurde schnell wieder ernst und sah seinem Sohn ins Gesicht. „Ian, ich habe dir schon oft gesagt, dass du nicht immer so frech sein sollst. Du hast erst vor ein paar Tagen gesehen, dass in der Schule ein Junge aus deiner Lerngruppe zur Bestrafung abgeholt wurde. Du weißt, dass ihm der Hintern versohlt wurde.“
Der Junge schlug beschämt die Augen nieder und senkte den Kopf. „Entschuldige Papa, ich meinte das doch gar nicht böse!“
Oliver Mooth ging zu Ian herüber, setzte sich erneut auf seine Bettkante und fasste dem Knaben, der sich wieder aufgesetzt hatte, an die Schultern. „Ian, ich meine es auch nicht böse, aber ich habe Angst, dass auch du einmal so verprügelt werden könntest. Ich kann dich dann nicht beschützen, wenn du in der Schule oder mit deinen Freunden unterwegs bist. Selbst wenn ich das könnte, würden wir Probleme bekommen. Verstehst du das?“
Ian sah seinem Vater für einen kurzen Augenblick ins Gesicht, konnte dessen Blick jedoch nicht standhalten. Nun hörte Oliver Mooth von seinem Sohn beinahe die gleichen Worte wie wenige Minuten vor ihm seine Frau. „Ich will das ja auch nicht. Aber solche Dinge rutschen mir einfach raus. Hinterher weiß ich dann, was ich falsch gemacht habe“.
Oliver Mooth zauste seinem Sohn die Haare. „Ach, Junge, ich liebe euch doch so und habe einfach nur Angst um euch!“
Danach ging Oliver Mooth erneut zu seiner Frau, um sie nochmals in seine Arme zu nehmen. „Du musst mir schon sagen, was dich bedrückt. Wie soll ich das erraten? Und helfen kann ich dir sonst auch nicht“, meinte er liebevoll, obwohl er ahnte, was seine Emily für Sorgen hatte.
„Wir haben nichts mehr zu essen, ich konnte den Kindern nur etwas Milch geben. Sie haben Hunger, wie sollen sie in der Nacht schlafen können?“
„Das habe ich mir schon gedacht.“ Abwechselnd schaute er die Kinder an. „Deshalb komme ich so spät, weil ich euch Mäuse nicht hungern sehen will.“
„Weil wir schon im Bett sind?“, fragte Jessica.
„Nein, Jessica, deshalb nicht. Dafür, dass ich länger gearbeitet habe, habe ich für euch etwas zu Essen mitbringen können. Na los, raus aus den Federn und ab mit euch an den Essenstisch. Er ist schon gedeckt!“
Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Jubelnd krabbelten sie schnell aus den Betten und liefen fröhlich kreischend zum Wohnbereich. Eilig setzten sie sich an den gedeckten Tisch. Reich gedeckt war er nicht, aber die Kinder waren das gewohnt. Wenigstens konnten sie ihren Hunger mit einer Scheibe Brot, die mit Leberwurst bestrichen war, stillen.
Danach brachten die Eltern ihre Kinder wieder ins Bett zurück. Als Oliver Mooth zum Wohnbereich zurückging, drehte er sich noch einmal um. „Mama liest euch jetzt noch eine Geschichte vor und danach wird gleich geschlafen. Ihr müsst morgen wieder früh aufstehen. Schlaft gut, ihr zwei.“
Eine halbe Stunde später saßen sich Emily und Oliver im Wohnbereich am Tisch gegenüber, auf dem ihre Arme ausgestreckt lagen, sodass Oliver die Hände seiner Frau in seine nehmen konnte. „Dich bedrückt doch noch etwas, mein Schatz, willst du es mir erzählen?“, fragte er.
Sie nickte und meinte: „Ja, ich mache mir Sorgen um die Kinder. Ian ist ein lieber, netter und hilfsbereiter Junge, aber manchmal auch etwas vorlaut. Er braucht nur mal am falschen Ort etwas Falsches zu sagen, dann nehmen sie ihn mit. Und du weißt, was das bedeutet. Dann kann er nicht mehr sitzen, wenn er abends nach Hause gebracht wird und wir müssen dafür auch noch bezahlen.“
„Ja, ich weiß das, aber was soll ich denn tun?“
„Bist du nicht manchmal zu nachsichtig mit ihm?“
„Wie, zu nachsichtig?“, fragte Oliver.
„Andere Kinder werden auch von ihren Eltern bestraft!“
„Nein, Emily, das tue ich nicht. Ich werde unsere Kinder nicht schlagen. Ich möchte, dass sie uns vertrauen. Und mit Schlägen wird das nichts. Wir können sie nur beschützen, indem wir sie ermahnen, nicht so leichtsinnig und vorlaut zu sein. Sollten sie tatsächlich einmal mitgenommen werden, sollen sie sich bei uns in Sicherheit wissen und sich geborgen fühlen.“
„Aber sie werden älter und unvorsichtiger, Oliver!“, wurde Emily eine Spur lauter.
„Ja, ich weiß das, aber ich weiß auch, dass die Kinder meiner Kollegen das Vertrauen in ihre Eltern verloren haben, weil sie sie geschlagen haben. Und das nur, weil sie ihnen härtere Strafen durch die Aufseher ersparen wollten.“
Einige Sekunden schwiegen sie! Endlich ergriff Oliver wieder das Wort: „Weißt du Emily, wir können sie nicht vor allem und jedem beschützen. Aber wir können immer für sie da sein. Manchmal ist es besser, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln, auch wenn es schmerzhaft sein sollte. Aber wir als ihre Eltern werden immer für sie da sein, und sie beschützen, so gut wie wir es können. Und wir werden ihr Vertrauen nicht verspielen. Das ist mir sehr wichtig. Aber ich verspreche dir, dass ich morgen mit ihnen ein ausgiebiges und ernsthaftes Gespräch führen werde.“
Emily nickte zustimmend. „Da ist noch etwas: Ich habe für die Kinder morgen früh nichts mehr zu essen.“
„Doch, schau mal dort hinein!“ Oliver zeigte zum Geschirrschrank, in dem auch ihre kargen Vorräte lagerten. Da hinein hatte er eine große Tüte Weizenmehl, eine Ein-Liter-Flasche Milch und vier mittelgroße Kartoffeln gelegt.
Die Milch wurde in den Höhlen synthetisch hergestellt. Aus Platzgründen war es nicht möglich, Kühe oder Ziegen zu halten. Die Kartoffeln und das Getreide wurden in jeder Wohngemeinschaft in einem extra dafür angelegten, biologischen Bereich produziert. Das dafür benötigte Licht wurde künstlich erzeugt. Da es in den Höhlen keinen Humusboden gab, musste die Muttererde von den umliegenden Äckern oder aus dem nahe gelegenen Wald herbeigeschafft werden. Danach wurden die Höhlen verschlossen. Somit konnte die Pandemie von den Bewohnern der Höhlen erfolgreich ferngehalten werden.
Freudig sah Emily ihren Oliver an. „Hast du heute schon deine Zuteilung bekommen?“
„Nein, das habe ich von George Smith für einen Gefallen bekommen. Ich frage mich bloß, woher er das hat? Er wird doch nicht etwa Ava und Harry hungern lassen?“ Oliver sah Emily ins Gesicht.
„Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sehen viel zu gut dafür aus. Niemand von unseren Freunden und Kollegen sieht so gut genährt aus wie die Smith’s.“
„Egal, wir kochen den Kindern morgen früh eine schöne Mehlsuppe mit Zucker, von der können sie sich satt essen und abends braten wir die Kartoffeln und vielleicht kann ich auch noch ein halbes Huhn mitbringen. Wenigstens gehen die Kinder morgen Abend nicht hungrig schlafen und du kannst dich auch mal wieder satt essen.“
Emily strahlte ihren Mann an. „Nein, das hebe ich lieber für die Kinder auf.“
Energischer, als er es beabsichtigt hatte, erwiderte Oliver: „Doch Emily, auch du isst davon. Es ist zusätzlich und auch du musst essen. Du bist schon ganz dünn geworden, weil du immer wegen der Kinder verzichtest. Du wirst dich morgen satt essen, basta!“
„Aber die Kinder …“
Oliver stand auf, ging um den Tisch herum, zog Emily vom Stuhl hoch und nahm sie in seine Arme. Liebevoll drückte er sie sanft an sich. „Sieh, mein Engel, wir können beide nichts dafür, dass die Rationen so knapp geworden sind. Im Lautsprecher haben sie heute durchgegeben, dass die Rationen bald wieder heraufgesetzt werden können. Du musst arbeiten und für die Kinder da sein. Es nützt uns nichts, wenn du irgendwann nicht mehr kannst. Ich bekomme im Institut genug zu essen, aber du in deiner Firma nicht. Und in drei Tagen bekommen wir unsere nächsten Rationen. Die werden hoffentlich für eine Woche reichen.“
Plötzlich hörten sie eines der Kinder schluchzen. Emily löste sich von Oliver und lief zu ihnen. Als sie die Kindernische erreichte, bemerkte sie, dass beide Kinder in ihrem Bett lagen und weinten. Jessica lag schluchzend auf der Seite und Ian schaute seine Schwester traurig an. Oliver erreichte nach Emily die Kindernische.
Emily ging zu ihrer Tochter und drückte sie an ihre Brust. Oliver streichelte Ian über die Haare und sagte liebevoll: „Na, komm zu mir, mein Junge.“ Auch er nahm das Kind in seine Arme.
Plötzlich fragte Jessica schluchzend: „Mama, du hungerst wegen uns?“
„Wie kommst du darauf?“, fragte Emily.
Ian kam seiner Schwester zuvor: „Wir haben es gehört.“
„Was habt ihr denn gehört?“, fragte Oliver.
„Alles“, sagte Ian.
Emily hatte Jessica beruhigt und mit fester Stimme sagte das Mädchen: „Dass du wegen uns hungerst und dass Papa Ian bestrafen soll, weil er so vorlaut ist.“
„Ich bin nicht vorlaut!“, protestierte Ian.
Oliver sah ihm in die Augen und sagte sanft: „Nun ist es aber gut, mein Großer.“
„Aber du hast gesagt, dass du das nicht tust“, sagte Ian schnell.
„Okay, Kinder“, erwiderte Oliver und blickte zu Emily hinüber, „ich glaube, wir kommen nicht umhin, schon jetzt mit euch ein ernstes Gespräch zu führen.“
Das Erdbeben
Am nächsten Morgen saß die Familie um ihren großen Esstisch herum und frühstückte. Emily hatte, wie es ihr Mann vorschlug, eine nahrhafte Mehlsuppe mit Zucker gekocht. Die Kinder konnten so viel essen, dass sie satt wurden. Die Stimmung am Tisch war gelöst, Jessica, die fünfjährige Tochter alberte umher und schäkerte mit ihrem Vater. Mehrmals musste ihre Mutter sie auffordern, zu essen.
„Ich esse doch schon, Mama!“, erwiderte die Kleine nach einer Ermahnung Emilys und schob sich einen Löffel mit Suppe in den Mund. Die Suppe war schon etwas nachgedickt und hatte die Konsistenz eines Puddings. Aber sie war gut gesüßt, sodass die Kinder sie gerne aßen.
„Siehst du Mama, ich habe alles aufgegesst.“ Das Mädchen lächelte nach wenigen Minuten ihre Mutter an.
„Das hast du aber schön gemacht, Jessica. Aber es heißt: ich habe alles aufgegessen.“
„Ja, Mama, ich habe alles aufgegessen.“ Die Kleine kicherte vor sich hin und streckte einen Arm zu Ian aus. Der Junge mochte seine Schwester, auch wenn sie ihn manchmal ärgerte. Er nahm ihr kleines Händchen in seine Hand.
In diesem Moment erzitterte der Boden unter ihren Füßen. Die Familie erstarrte. Lautes Poltern war zu hören.
Emily reagierte als erste und sprang von ihrem Stuhl auf. Sie stürzte zu Jessica hin, die ihr am nächsten saß. Oliver reagierte nur eine Zehntelsekunde später und war mit einem Satz bei Ian. Mit ihren Körpern schützten die Eltern ihre Kinder. In einer Wand entstand ein Riss. Der Boden hob und senkte sich in kleinen Wellen. Das Poltern wurde lauter. Staub rieselte auf Emily und Oliver herab. An einem nicht auszumachenden Ort rieben Steine laut aneinander und verursachten ein knirschendes Geräusch. Draußen vom Stollen her vernahm die Familie Schreie. Auch Jessica und Ian schrien.
„Mama, ich habe Angst!“, rief Jessica ihrer Mutter zu.
„Ich weiß, mein Kind, ich weiß.“ Die Mutter drückte ihr Kind fest an sich.
Ian fragte: „Papa, was ist das plötzlich?“
„Ruhig, mein Junge, ich passe auf dich auf!“ Oliver versuchte, seinen neunjährigen Jungen zu beruhigen.
Plötzlich ein lautes Krachen. Irgendwo stürzte eine Wohngrotte ein.
Das knirschende Geräusch von aufeinander reibendem Gestein empfanden die Kinder als besonders bedrohlich. Das Poltern der Steine kam näher. Stürzte etwa die Höhle ein? Die Kinder schrien in Panik auf. Emily versuchte, Jessica zu beruhigen, aber das Mädchen zitterte am ganzen Körper. Emily hatte ebenfalls Angst, aber sie musste stark sein. Um Jessicas willen durfte sie ihrem kleinen Mädchen keine Angst zeigen. Ian erging es nicht anders als seiner Schwester. Oliver drückte den Jungen an sich, damit er die Nähe seines Vaters spüren konnte. Glas splitterte. Die Scheiben eines Schrankes waren der Belastung durch die bebende Erde nicht gewachsen.
Plötzlich schrie Ian auf: „Mutti, Jessica!“, Panik schwang in seiner Stimme mit, „Papa, oh, nein!“
Der Junge sah, dass seine Mutter und seine Schwester für einen Moment zusammen mit dem Erdboden in die Höhe gehoben wurden, aber sofort fielen sie wieder hinab. Das ging so schnell, dass er fürchtete, seine Schwester und seine Mama könnten sterben. Genau in dem Moment, als das geschah, war das Poltern und Bersten von Steinen am lautesten.
Oliver fürchtete, dass die Decke ihrer Grotte der Intensität des Erdbebens nicht standhalten würde. In dem Fall wären sie unrettbar verloren. Wer wäre noch übrig, um sie zu retten, wenn die Stollen einstürzten?
Als sich die Erde so plötzlich hob und senkte, verlor Emily das Gleichgewicht. Noch im Fallen versuchte sie, ihre kleine Tochter mit ihrem Körper zu schützen. Dabei riss sie das Mädchen mit sich. Auf dem Boden liegend fühlte sie Jessica unter sich. Staub und kleine Steinchen rieselten auf sie hinab.
Das Bücherregal schwankte. Es neigte sich gefährlich zur Seite und drohte zu stürzen. Die oberen Bücher fielen heraus. Sie schlugen polternd auf dem Boden auf. Jetzt schrie Jessica auf: „Papa, Hilfe, Ian!“
Schrill vor Panik tönte die Stimme des Mädchens durch die Wohngrotte. Wenn das Regal fiel, würde es Jessicas Papa und ihren Bruder verletzen. Emily hielt das zitternde Mädchen fest.
Plötzlich war es wieder still.
Noch verharrten die vier Menschen in ihren Positionen. Sie trauten der Ruhe nicht. Bald musste doch noch eine Erschütterung kommen. Der Boden musste noch einmal beben. Aber nichts geschah. Nach einigen Sekunden sagte Oliver: „Es ist wohl vorbei. Das war ein Erdbeben.“
Die Eltern gaben ihre Kinder frei, die sich nun aufrappelten. „Lasst uns sehen, ob unsere Wände noch dicht sind, wenn nicht, müssen wir sie sofort verschließen. Es darf keine verseuchte Luft in die Höhlen eindringen!“, forderte Oliver.
Die Familie folgte der Aufforderung des Vaters. Schnell suchten sie die unebenen Wände und Decken ihrer Wohngrotte auf Risse, Löcher oder anderen Öffnungen ab. Außer dem Riss in der Wand, die sie aber nicht von der Außenwelt trennte, konnten sie nichts finden. Das war beruhigend, denn Oliver Mooth wusste, dass ihre Wohngrotte nur durch eine Mauer und eine Felswand von der Außenwelt geschützt war. Beide hatten durch das Erdbeben keine Schäden erlitten. Würde die Pandemie in die Höhlen eindringen, wären ihre Bewohner verloren. Das konnte niemand wollen. Schon in Olivers Kindesalter wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Unversehrtheit der Höhle wichtiger war, als Menschenleben zu retten, wenn die Erde bebte. Das kam nicht sehr oft vor, aber Oliver hatte heute nicht zum ersten Mal ein Erdbeben erlebt. Jedoch war es das Heftigste von allen gewesen.
Dass sie heute in den Höhlen leben konnten, war nur deshalb möglich, weil die Regierung vor über fünfzig Jahren, als die Pandemie ausbrach, eine Panik unter der Bevölkerung vermieden hatte, indem sie einfach die Informationen über die Pandemie zurückhielt. Aber die damaligen Politiker waren auch dafür verantwortlich, dass das Gesundheitssystem kaputt gespart worden war. Dringend notwendige Investitionen hatten sie verhindert. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Krankenhausbetten, insbesondere Intensivbetten gab es viel zu wenige, Verbandsmaterial und Medikamente waren nicht in genügender Anzahl vorhanden. Im Gesundheitswesen wurde der absolute Mangel verwaltet, insbesondere der Mangel an Pflegepersonal.