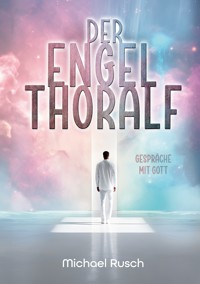Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Hochhaus
- Sprache: Deutsch
In einem Hamburger Hochhaus geschehen unglaubliche Dinge. Die Mieter erleben eine Ungezieferplage. Teilweise werden sie von schwarzen Käfern, Ratten und Insekten regelrecht tyrannisiert. Ein Mann stirbt, aber niemand bemerkt es. Ein Junge wird von Ratten angefallen und schwer verletzt. Die dreizehnjährigen Freunde Patrick und Torsten suchen nach der Ursache für diese und andere Unglücke. Dabei geraten sie in ein unterirdisches Tunnelsystem. Hier begegnet ihnen ein grauenvolles Geschöpf, das ihr Leben bedroht. Von einem Mitschüler Patricks erfahren die Eltern der vermissten Jungen von deren Abenteuerlust. Mit zwei Nachbarn und einem Wissenschaftler suchen ihre Väter, in dem unterirdischen Tunnelsystem nach ihnen. Dabei geraten auch sie in Lebensgefahr. Gelingt es ihnen, die Kinder und sich selbst zu retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Hauke Peters
Der Autor
Michael Rusch, 1959 in Rostock geboren, ist von Beruf Rettungsassistent und lebte von 2013 bis 2017 in Hamburg, wo die ersten Bände der Fantasy-Reihe Die Legende von Wasgo entstanden. Seitdem lebt er in Lutterbek, in der Nähe der Stadt Kiel. Nachdem er zwischenzeitlich das Schreiben aufgegeben hatte, stellte er fest, dass es beim Verarbeiten von Schicksalsschlägen hilft. So entstand Ein falsches Leben, das zunächst im Selfmade-Verlag Lulu veröffentlicht wurde.
Danach wandte sich Rusch der Fantasy zu. Die ewige Nacht aus der Reihe Die Legende von Wasgo erschien im Januar 2014. Im September 2014 folgte der 2. Band mit dem Titel Luzifers Krieg. Es folgten am 1. Dezember 2015 und am 1. Januar 2017 die Bände 3 und 4 mit den Titeln Angriff aus dem Himmel und Bossus‘ Rache. Der letzte Band Wasgos Großvater erschien am 01.03.2018.
Nachdem Rusch Ein falsches Leben überarbeitet hatte, veröffentlichte er diesen Roman in zwei Bänden nochmals im Juli 2014 mit dem AAVAA Verlag.
Am 28. Februar 2015 veröffentlichte Rusch seinen Roman Die drei Freunde in seinem Verlag Die Blindschleiche. Im Sommer 2019 entschloss er sich aus gesundheitlichen Gründen den Verlag aufzulösen und diesen Roman zu überarbeiten, den er mit BoD im Jahr 2020 neu veröffentlichte.
Auch Die Legende von Wasgo und Ein falsches Leben überarbeitete Rusch nochmals. Die Legende von Wasgo erschien in 2 Bänden mit BoD. Band 1 wurde am 1.01.2020 veröffentlicht und enthält die ersten drei und Band 2 die beiden letzten der ehemaligen 5 Bände. Ein falsches Leben erschien in einem Band unter dem neuen Titel Das Leben des Andreas Schneider ebenso im Jahr 2020.
Seinen ersten Horror-Roman Das Hochhaus veröffentlichte Rusch im Dezember 2020 und seinen dystopischen Roman Der Wegbereiter im Juli 2021. Zurzeit arbeitet Rusch am 2. Band seines Romans Das Hochhaus.
Inhalt
Prolog
Abfallschächte
Der Einsatz des Notarztes
Der Umzug
Der alte Mann
Der Angriff der Ratten
Erinnerungen
Der Egoist
Abenteuerlust
Ungezieferbekämpfung
Das Übersinnliche
Sorgen und Ängste
In den Stollen
Der Kampf
Unerwartete Hilfe
Der verschüttete Stollen
Die Speisekammer des Monsters
Die Jäger
Die Gejagten
Das Ende
Danksagung
Prolog
Warum, zum Teufel, war er durch die Tür des Kellers und danach die Treppe herunter gegangen? Wer hatte ihm denn diese doofe Idee in sein Gehirn eingepflanzt? War er denn so ein blöder Idiot? Das waren die Gedanken, die ihn während seiner Flucht quälten, wenn er überhaupt dabei denken konnte. Wäre er mal lieber zu Hause geblieben. Die Treppe hatte ihn direkt ins Verderben geführt. Wie sollte er hier bloß wieder heil herauskommen, fragte er sich in panischer Angst. Was hatte er sich dabei gedacht, dieser elenden Treppe und den vielen Gängen zu folgen, die sich ihr anschlossen? Nichts, einfach gar nichts! Wie es bei ihm so oft der Fall war, war er einfach nur seiner Neugierde gefolgt.
Und jetzt steckte er so richtig in der Scheiße! Plötzlich stand er einem angsteinflößenden Tier gegenüber und war vor diesem davongelaufen! Nein, das war kein Tier, sondern ein Monster. Er war davon überzeugt, dass es nicht von dieser Welt war. Nur die Umrisse dieses Ungetüms, das ihm furchtbare Angst machte, erkannte er. Es war groß und unförmig. Gefährliche grunzähnliche Laute hatte es ausgestoßen. Panik befiel ihn, als er sich dem Ungeheuer gegenüber fand. Wo war er bloß hingeraten? Das war eine von vielen Fragen, die er sich in seiner Verzweiflung stellte. In eine Unterwelt? Die Angst nagte an seinen Eingeweiden. Er rannte einen weiteren Gang entlang. Das monströse Tier verfolgte ihn. Dabei verursachte es kratzende und schabende Geräusche. Sein Grunzen, das es hin und wieder ausstieß, flößte ihm eine entsetzliche Angst ein. Doch jetzt befiel ihn eine tiefe Verzweiflung, denn er stellte fest, dass er nicht mehr wusste, wo er sich befand. Diesen Gang kannte er nicht. Das gefährliche Grunzen hinter ihm wurde lauter! Nur noch mit gewaltiger Willensanstrengung gelang es ihm, die Panik niederzuringen, die sein Denken und Handeln zu lähmen drohte. Doch was war das? Dort, etwas weiter vorn, tauchte ein erneuter Gang in den Lichtkegel seiner Taschenlampe. Vielleicht sollte er dem folgen?
Egal, er musste auf jeden Fall diesem Monster entkommen. Scheiße, der Schweiß lief ihm von der Stirn in die Augen, die davon zu brennen begannen. Auch das noch, gerade jetzt. Angstvoll blinzelte er die scharfe Körperflüssigkeit weg, aber es funktionierte nicht so, wie er sich das erhoffte. Hektisch wischte er sich mit der linken Hand die Augen aus, die aber trotzdem noch brannten. Die Stabtaschenlampe in seiner Rechten hielt zum Glück durch, deshalb konnte er noch sehen, wohin er lief. Doch das Brennen in den Augen ließ nicht nach. Umständlich zog er, während er dem nächsten Gang entgegenlief, ein Taschentuch aus der Hose und wischte sich damit erneut die Augen aus. Endlich hörte das unangenehme Brennen in ihnen auf. Aber seine Angst blieb. Sie saß ihm sprichwörtlich im Nacken. Stoßweise holte er Luft, wobei sich sein Brustkorb hektisch hob und senkte. Es war hier unten so kalt, dass er im Schein der Taschenlampe seinen kondensierenden Atem sehen konnte, der jedes Mal, wenn er die Luft aus seinen Lungen stieß, wie eine Fahne davon wehte. Aber seine Verzweiflung und die panikartige Angst wehten nicht mit fort.
Er erkannte, dass die Balken, die dieses unterirdische Labyrinth zusammenhielten, schon sehr vom Zahn der Zeit zernagt waren. Wenn eines von diesen morschen Dingern nachgab, musste hier alles einstürzen. Dann war er unrettbar verloren. Der Zustand der Stützbalken sorgte nicht dafür, dass er sich wohler fühlte. Die Verzweiflung nahm ihn in ihren Besitz.
Endlich erreichte er einen weiteren Gang, der scheinbar im Lichtkegel seiner Lampe hin- und herschwankte. Was war das nun eigentlich, ein Gang oder ein Stollen, fragte er sich. Scheißegal, für solche Gedankenspiele hatte er jetzt keine Zeit. Er musste zusehen, dass er weiterkam, und lief in den Stollen hinein. Dabei richtete er den Lichtstrahl seiner Taschenlampe nach vorn und sah, dass keine Hindernisse ihm den Weg versperrten. Jetzt hoffte er, dem Ungeheuer zu entkommen. Seine Beine wurden schneller, tatsächlich wurden die ihn verfolgenden Grunzlaute leiser. Erleichtert atmete er auf und lief Meter um Meter um sein Leben.
Wie sollte er hier wieder herauskommen? Das fragte er sich bestimmt schon zum tausendsten Male. Er musste den Weg finden, der ihn nach oben in den Keller des Hauses zurückführte. Durfte er sich noch Hoffnungen machen, seine Eltern und Geschwister wiederzusehen? Nie mehr wollte er dann hierher zurückkehren. Das Monster schien seine Verfolgung aufgegeben zu haben.
Jetzt erreichte er eine Kreuzung. Blitzschnell überlegte er, wo er entlanglaufen sollte. Welcher Gang würde ihn von dem Monster noch weiter fortbringen? Dieses Ding hatte ihn nicht mehr verfolgt, seit er rechts in den Gang geschlüpft war. Es musste also hinter ihm geradeaus dem anderen Gang gefolgt sein und sich so von ihm auf seiner linken Seite entfernen. Das glaubte er wenigstens. Deshalb nahm er wieder den rechten Stollen und folgte ihm. Er lauschte und hörte nichts weiter als seine eigenen Geräusche, die er beim Laufen verursachte. Die Kräfte begannen, ihn zu verlassen und er wurde langsamer. Er wollte nur einen Moment verschnaufen. Wieder etwas zu Kräften kommen. Sein Atem ging stoßweise und mit jedem Stoß ließ auch seine Verzweiflung und Angst etwas nach. Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe wurde schwächer. Daraus schlussfolgerte er, dass er sich beeilen musste, in einen Stollen zu kommen, der ihm bekannt war. Unbedingt wollte er hier herauskommen. Das musste ihm gelingen. Die Angst und Verzweiflung, das spürte er, befiel ihn schon wieder. Bevor er sich in vollkommener Finsternis befand, musste er weiter.
Er lief Meter um Meter. Ein Windhauch streifte sein Gesicht. Dabei dachte er sich nichts, er war ihm sogar willkommen, weil er ihm das Gesicht kühlte. Wo Wind war, musste auch eine Öffnung sein, wodurch der Luftzug entstand. Das glaubte er jedenfalls. Er musste weiter. Er musste den Menschen erzählen, was hier unten geschah, dass sich hier ein Monster aufhielt. Vielleicht war es dafür verantwortlich, dass sich im Haus so viel Ungeziefer befand und dort immer wieder einen Schaden anrichtete. Nur der Müllschlucker alleine konnte dafür die Ursache nicht sein. Obwohl auch der natürlich einiges Ungeziefer anlockte.
Die Batterien in seiner Taschenlampe ließen nach. Der Lichtstrahl wurde schon merklich dunkler. Einige Schritte vor ihm erkannte er auf seiner rechten Seite in der Wand eine Öffnung. War das etwa ein Loch? Ein Loch mitten in einer Wand? Ob das die Ursache für den leichten Wind war? Er schöpfte noch einmal Hoffnung. Schaffte er es doch noch nach oben in den Keller? Vorhin glaubte er nicht mehr daran, als ihn das Monster verfolgte und der Abstand sich zwischen ihnen verringerte. Es erschien ihm, dass er diesem furchtbaren Ding entkam. Hatte er es tatsächlich geschafft?
Endlich erreichte er das Loch in der Wand. Doch was er sah, raubte ihm den Verstand. Er konnte kaum atmen, die Luft stank nach Verwesung. Hinter diesem Loch, das konnte er im schwachen Licht seiner Taschenlampe erkennen, befand sich ein Raum mit mehreren Skeletten. Mit menschlichen Skeletten. Dann bewegte er seine Taschenlampe zur rechten Seite hin und sah halbverweste Leichen, denen einige Körperteile fehlten, der einen ein Bein, der anderen das Fleisch an der Hüfte, oder noch einer anderen ein Arm ...
„War das hier etwa ein Friedhof oder gar eine tierische oder monströse Speisekammer“, dachte er, als schlagartig erneut eine panikerfüllte Hoffnungslosigkeit mit ihren metaphorischen kalten Klauen in sein wild pochendes Herz schlug.
Augenblicklich brach ihm aus jeder Pore seines Körpers der Schweiß aus. Übelkeit überfiel ihn. Und jetzt erschien im Kegel des schwachen Lichtes seiner Taschenlampe das Monster. Es saß oder lag in einer Ecke und war durch die Dunkelheit seinem Blick entzogen, bis er es selbst ins Licht brachte. Es war schwarz. Ehe er reagieren konnte, spürte er einen scharfen Schmerz in seiner Brust. Dann wurde es dunkel.
Abfallschächte
Früher entsorgten die Bewohner von Hochhäusern den anfallenden Hausmüll über Abfallschächte oder Müllschlucker, wie sie im Volksmund heißen. In einigen Bundesländern Deutschlands ist es heute noch so. Damit wollte man den Menschen die Müllentsorgung ihres Haushaltes erleichtern. Denn oft verbringen die Bewohner, gerade wenn sie im 12., 15. oder gar 18. Stockwerk wohnen und keinen Abfallschacht nutzen können, viel Zeit damit, ihre Abfälle zu den dafür vorgesehenen Tonnen oder Containern zu bringen, die meist irgendwo in der Nähe ihres Hochhauses hinter einem Bretterverschlag stehen.
So praktisch ein Abfallschacht für die Bewohner der oberen Etagen eines Hochhauses auch sein mag, bringt er für sie nicht nur angenehme Seiten mit sich. In Zeiten des Recyclings erfüllen sie die Anforderungen einer modernen Müllentsorgung nicht mehr. Eine Mülltrennung ist nicht möglich. Außerdem entwickeln sich mit zunehmender Zeit starke unangenehme Gerüche, die sich im Haus ausbreiten. Ungeziefer wird angelockt. Außerdem entsteht durch den nicht getrennten Müll in den Containern dieser Schächte eine erhöhte Brandgefahr. Deshalb ist heute in sieben Bundesländern Deutschlands die Nutzung von Abfallschächten gesetzlich verboten.
In Hamburg jedoch sind sie immer noch erlaubt. Und das ist der Grund, warum es am Hans-Duncker-Platz einen Hochhausblock gibt, in dem bis zum heutigen Tag in jedem dieser Gebäude immer noch die existierenden Müllschlucker entsprechend ihrer Bestimmung genutzt werden. Diese Häuser waren in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts erbaut worden, und die Wohnungsgesellschaft sah keinen Grund, diese Schächte zu schließen.
Besonders im Haus 23 wird man von sehr üblen Gerüchen empfangen. Dort war der Schädlingsbekämpfer ein regelmäßiger Gast, von dem man beinahe glauben konnte, dass er von der Wohnungsgesellschaft als Mitarbeiter fest angestellt sei. Immer wieder wurde er aktiv und machte Ratten, Insekten, Spinnentiere und anderes Ungeziefer unschädlich.
Man hörte, dass in diesem Haus erst vor kurzem jemand von Ungeziefer angegriffen worden sei. Es sollte sogar schon einen Toten gegeben haben. Aber ob das der Wahrheit entsprach, wusste niemand. Auf jeden Fall hielten sich darüber in seinem Stadtteil hartnäckige Gerüchte. Und dort wurde das Haus des Hans-Duncker-Platzes mit der Nummer 23 auch „das Hochhaus des Todes“ oder „das Hochhaus des Schreckens“ genannt.
An einem heißen und sonnigen Wochenende im Sommer des Jahres 2017 wollte ein junger Mann mit seiner Frau in dieses Haus einziehen. Von seinem buchstäblich anrüchigen Ruf hatte das junge Paar nichts erfahren. Wie auch, noch wohnte es in einem anderen Stadtteil. Aber nicht mehr lange, und dann sollte ihr ruhiges Leben der Vergangenheit angehören.
Der Einsatz des Notarztes
Doktor Smollenko war ein niedergelassener Arzt, jung und gut aussehend. Er galt als Frauentyp, war groß und schlank, hatte dunkle Haare und braune Augen. Schon als Jugendlicher hatte er sehr viel Wert auf seinen Körper gelegt. Das Motto seiner Eltern – „In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist“ – hatte er sich schon als Kind zu Eigen gemacht. Wenn es seine Zeit zuließ, trainierte er noch heute täglich eine Stunde im Fitnessstudio, welches sich neben seinem Haus befand. Das Haus, das ihm gehörte, enthielt seine Praxis und eine große Vier-Zimmer-Wohnung mit Bad, Küche, Garage und Werkstatt. Freilich konnte er sein tägliches Training nur deshalb absolvieren, weil er praktisch keinen Anfahrtsweg zum Fitnessstudio hatte, denn seine Patienten beanspruchten ihn mehr, als ihm lieb sein konnte. Jedoch hatte sich der stadtbekannte Internist, der sich zum Kardiologen spezialisiert hatte, bisher täglich diese eine Stunde, zum Leidwesen seiner Frau, für die Ertüchtigung seines Körpers reserviert, um seine muskulöse Gestalt zu erhalten. Doktor Smollenko war kein Narzisst, aber morgens, wenn er nach dem Duschen vor dem großen Spiegel seines Bades stand und sich abtrocknete, betrachtete er gern sein Abbild und war mit seiner Figur zufrieden. Kräftige Arme und Beine, eine gewölbte Brust und ein flacher Bauch, schmale Hüften und breite Schultern konnte er dabei sehen. Er wusste, dass er ein schönes Gesicht besaß, das kräftige schulterlange Haare umgab. Trotz seiner äußerlichen Vorzüge blieb er stets ein einfacher Mensch und guter Arzt, der für seine Patienten alles gab.
Ein anstrengender Tag lag hinter ihm, aber trotzdem hatte er seine Arbeit noch lange nicht beendet. Ein langer kassenärztlicher Notdienst stand ihm bevor. Als Kardiologe mit einem guten Ruf - und deshalb auch einer vollen Praxis – empfand er diesen Dienst nicht immer als angenehm. Abends und nachts war er als Arzt im Auftrag der Krankenkassen zwölf Stunden unterwegs. Von einem Rettungssanitäter, der gleichzeitig als sein Gehilfe arbeitete, wurde er in dieser Zeit mindestens elf Stunden kreuz und quer durch den ganzen Stadtbezirk von einem Patienten zum nächsten gefahren. Und das in beinahe jedem Dienst, den er einmal im Monat, manchmal auch öfter, ableisten musste. Doktor Smollenko konnte sich gut vorstellen, die Zeit mit seiner Familie zu verbringen, aber auch zum Schlafen zu nutzen. Denn der kassenärztliche Notdienst begann abends um 19 Uhr und endete am nächsten Morgen um sieben Uhr. An Schlaf war in dieser Zeit kaum zu denken. Trotzdem versah Doktor Smollenko diesen Dienst relativ gerne, manchmal etwas mehr und manchmal auch etwas weniger. Die Menschen, zu denen er fuhr, waren zwar oft ernsthaft erkrankt, aber trotzdem brauchte er sich nur um deren akute Leiden zu kümmern. Die Weiterbehandlung erfolgte durch den Hausarzt. Den anschließenden bürokratischen Kleinkram brauchte er nicht zu beachten, wie er es in seiner Praxis tun musste. Die Abrechnung und die Statistiken wurden von den angestellten Schwestern des kassenärztlichen Notdienstes erledigt.
Notfälle erlebte der junge Internist in diesem Fahrdienst nur selten, eine Grippe oder auch einen Asthmaanfall erkannte er sofort, sie waren für ihn offensichtlich, und stellten sich in der Therapie meist nicht kompliziert dar wie eine Herzkrankheit.
Meist konnte er den Patienten, die ihn am späten Abend oder in der Nacht riefen, schnell helfen, nur selten war es erforderlich, dass er jemanden in ein Krankenhaus einweisen musste. Doch manchmal musste er dafür einen Rettungswagen oder gar Notarzt zur Hilfe rufen.
Der 35-jährige Arzt fuhr auf den Parkplatz des Ärztehauses und suchte sich eine freie Parkbucht. Obwohl es schon nach 18 Uhr war, fand er nur sehr schwer einen Parkplatz für seinen silberfarbenen Volvo.
Doktor Smollenko betrat das Ärztehaus, ging an der Pforte vorbei, in der ein älterer Mann saß und ihn höflich grüßte. Der junge Arzt blieb stehen und betrieb mit dem Pförtner etwas Smalltalk. Danach suchte er das Dienstzimmer auf, welches er sich mit dem Rettungssanitäter teilen musste, mit dem er seinen Dienst gemeinsam versah. Falls sie sich für einige Minuten, selten auch für einige Stunden, hinlegen konnten, weil es ausnahmsweise nichts zu tun gab, stand hier auch eine Schlafgelegenheit bereit.
Unmittelbar neben der Tür des Zimmers, das für das fahrende Personal reserviert war, stand ein junger Mann in der Uniform des Rettungsdienstes, der wie die jüngere Ausgabe des Doktors wirkte. Der Arzt war von ihm fasziniert, denn er hatte nicht damit gerechnet, hier sein 19-jähriges Ebenbild anzutreffen.
„Du wartest wohl darauf, dass dich jemand hier reinlässt?“, fragte der Doktor den jungen Mann. Dieser bestätigte seine Frage, die bereits eine Feststellung war.
„Mein Name ist Smollenko, dann fahren wir beide in dieser Nacht zusammen!“ Der Ältere reichte dem Jüngeren seine rechte Hand zum Gruß.
Der junge Mann ergriff die ihm dargebotene Hand und machte einen angedeuteten Diener. „Guten Abend, Herr Doktor, ich bin Mathias.“
„Du bist wohl neu hier?“
„Ja, ich habe heute meinen ersten Tag.“
Doktor Smollenko zeigte ihm, wo er den Zimmerschlüssel abholen konnte, wenn er als Erster zum Dienst erschien, damit er nicht auf dem Flur stehen und warten musste, bis der Arzt kam. Währenddessen erfuhr er, dass Mathias ein taufrischer Rettungssanitäter war, der erst vor drei Tagen seine Ausbildung beendet hatte und beim kassenärztlichen Notdienst erste Erfahrungen sammeln wollte, um später im Rettungsdienst seine Tätigkeit optimal ausüben zu können. Er hoffte, dass er hier von den verschiedenen Ärzten etwas lernen und somit seine Kenntnisse in der Notfallmedizin vervollkommnen konnte.
Doktor Smollenko, gefiel die Einstellung des jungen Mannes. „Ich glaube, wir werden uns bestimmt ab und an hier sehen, und wenn du möchtest, frage mir Löcher in den Bauch. Keine falsche Scheu, dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten.“
„Das ist sehr nett von Ihnen, danke schön. Gerne werde ich Ihr Angebot annehmen. Ich hoffe, dass Sie morgen früh nicht als Schweizer Käse nach Hause gehen“, meinte Mathias. Die Männer lachten über diesen Witz.
Nachdem der Arzt seinem neuen Gehilfen alles erzählt hatte, was dieser für seinen ersten Dienst wissen musste, gingen sie zu den für sie zuständigen Schwestern. Mit einem freudigen Hallo wurde der Arzt von ihnen begrüßt, auch Mathias bekam von den drei anwesenden Schwestern die Hand gereicht, die ihn freundlich Willkommen hießen.
„Aufträge sind für Sie noch nicht eingegangen“, teilte ihnen eine große, robuste Schwester mit langen blonden Haaren mit. Mathias erfuhr, dass sie für den fahrenden Arzt und seinem Rettungssanitäter verantwortlich war und nach einigen Witzchen und Neckereien zwischen den Schwestern und dem Kardiologen gingen Doktor Smollenko und Mathias in ihren Aufenthaltsbereich zurück.
Mathias staunte, weil sie beide ein eigenes Zimmer hatten, in dem sie sich ausruhen konnten. „Wenn wir über einen längeren Zeitraum keine Patienteneinsätze bekommen, können wir hier sogar schlafen. Doch das sind die absoluten Ausnahmen“, erzählte der Arzt.
Die Zimmer waren funktional eingerichtet. Jeweils vor dem Fenster stand ein Schreibtisch mit einem gemütlichen Chefsessel davor, an einer Wand befand sich ein Holzbett mit einer flauschigen, weichen Decke drauf. Ein Kleiderschrank und eine kleine Schrankwand vervollkommneten die Einrichtung. Der Fußboden war mit einem Teppichboden bedeckt.
Doktor Smollenko zog sich um, die Jeans tauschte er gegen eine weiße Leinenhose, das T-Shirt gegen ein weißes Hemd und darüber zog er sich einen weißen Kittel an. Sogar die Schuhe, die er jetzt trug, waren von weißer Farbe.
Mathias hatte Kaffee gekocht. Der Doktor erklärte dem jungen Rettungssanitäter ausführlich seine Aufgaben. „Dir ist bekannt, dass du den Arzt, mit dem du gerade Dienst hast, zu den Patienten fährst. Am Einsatzort musst du flexibel sein. Jeder Arzt oder jede Ärztin hat eine andere Auffassung davon, wie du ihnen beim Patientenbesuch helfen kannst. Ich gebe dir den guten Rat: Solange du die Ärzte nicht kennst, mit denen du Dienst hast, solltest du sie fragen, welche Hilfe sie von dir erwarten.“
„Und was darf ich tun, wenn ich mit Ihnen Dienst habe?“
„Alles, was du kannst und dir zutraust, ich bin dabei und passe auf, dass du keine Fehler machst.“
Das Telefon klingelte. Doktor Smollenko nahm den Hörer vom Apparat und wunderte sich, warum die Schwester den Auftrag nicht wie üblich, auf das Diensthandy schickte, das einen neuen Einsatz mit einem Signal ankündigte. Auf dem Display erschienen alle notwendigen Informationen, die der Arzt und sein Fahrer benötigten, unter anderem die Anschrift des Patienten, und woran er erkrankt war.
Der Arzt meldete sich mit seinem Namen. Danach hörte er der Schwester zu. Dabei veränderte sich mehrmals sein Gesichtsausdruck, von überrascht zu schockiert, von schockiert zu nachdenklich, von nachdenklich zu fassungslos und dann wieder von fassungslos zu nachdenklich. Als Mathias den Wechsel der Gefühle im Gesicht des Doktors beobachtete und dessen gelegentliche Ausrufe wie „Ach die Scheiße“, „Oh, Gott“, „Ich verstehe“ oder „Unglaublich“ vernahm, bekam er ein flaues Gefühl in der Magengegend.
Irgendwann sagte Doktor Smollenko: „Ja, das machen wir!“ Danach legte er auf, blickte zu Mathias hinüber und erklärte: „Wir haben einen etwas delikaten Einsatz. Die Polizei informierte uns darüber, dass in einem Hochhaus unter der Tür einer Wohnung schwarze Käfer hervorkriechen. Der Briefkasten, der zu der Wohnung gehört, soll voll mit Post sein. Der Mieter dieser Wohnung wurde in der letzten Zeit von keinem Nachbarn gesehen. Was genau das zu bedeuten hat, weiß niemand. Auf jeden Fall hat jemand die Polizei verständigt und die jetzt uns. Wir fahren dorthin und werden die Polizeibeamten an der Wohnung oder vor dem Haus treffen und dann sehen, was wir tun können.“
Bisher war Mathias die Ruhe in Person, aber jetzt spürte er eine große Unruhe in sich. „Wo, soll, …, sollen wir denn hinkommen?“ Sein Gesicht wurde blass.
Doktor Smollenko erinnerte sich daran, dass dieser Einsatz Mathias erster war. Selbstverständlich war der junge Mann aufgeregt und hatte vielleicht sogar Angst vor dem Unbekannten, das auf ihn zukam. Dass der erste Einsatz des jungen Rettungssanitäters so ungewiss sein musste, gefiel dem Arzt nicht. Wahrscheinlich würde der Junge mit dem Tod konfrontiert. Für solch einen jungen Mann gehörte der Tod noch nicht zum Alltag. Weil Doktor Smollenko ahnte, was in seinem Begleiter vor sich ging, wollte er ihm helfen. „Immer mit der Ruhe, mein Junge, ich bin auch noch da.“ Deutlich bemerkte er, dass sich sein junger Assistent nicht wohlfühlte. Deshalb fragte er ihn: „Ist mit dir alles in Ordnung?“
„Ja, danke, es ist alles ok.“ Der junge Mann wollte sich nicht gleich bei seinem ersten Einsatz eine Blöße geben. „Gut, dann fahren wir zum Hans-Duncker-Platz 23. Weißt du, wo der sich befindet?“
„Ja, Herr Doktor, ich kenne das Haus, es ist ein Hochhaus mit 12 Stockwerken!“
*****
Schweigend fuhren sie durch die Stadt. Beide hingen ihren Gedanken nach. Mathias fuhr zügig, aber sicher durch den immer noch dichten Verkehr der Millionenmetropole. Nach etwa einer Viertelstunde erreichte er das Ziel.
Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht fuhr ebenfalls vor, bremste scharf und zwei Uniformierte stiegen aus. Einer der Männer hatte einen Schnauzer und unter seiner Schirmmütze lugten graue Haare hervor. Er war etwas untersetzt, etwa einen Meter achtzig groß, und strahlte Ruhe und Freundlichkeit aus. Doktor Smollenko schätzte sein Alter auf etwa 55 Jahre.
Der zweite Polizist war vielleicht 25 Jahre alt. Er hatte eine sportliche Figur, war durchtrainiert und blickte mit wachsamen Augen in die Welt hinein.
Die Mediziner beobachteten, dass vor dem Hauskomplex einige Passanten in sicherer Entfernung stehen blieben und immer wieder unauffällig auffällig auf den Eingang des Hauses mit der Nummer 23 blickten. Es erschien Mathias, als wüssten sie, dass es in diesem Haus ein unbekanntes Ereignis gab, für das es sich lohnte, vor ihm in Neugierde auszuharren.
Mathias und Doktor Smollenko verließen ihr Dienstfahrzeug, gingen den Beamten entgegen und begrüßten sie, indem sie sich vorstellten.
Der ältere Polizist erwiderte: „Ich bin Polizeioberkommissar Walter und mein junger Kollege hier ist Polizeiobermeister Wagner!“ Mit einem Kopfnicken deutete er auf seinen Partner.
„Also, dann meine Herren, wollen wir?“, fragte der Oberkommissar mit einem spöttischem Gesichtsausdruck.
Docktor Smollenko nickte. „Deshalb sind wir hier!“
„Wo müssen wir hin?“, fragte Oberkommissar Walter seinen jungen Kollegen im Gehen.
Dieser antwortete: „Wir müssen mit dem Fahrstuhl in den neunten Stock hinauf fahren.“
Gemeinsam erreichten die vier Männer den Eingang des Hauses. Obermeister Wagner, der das Quartett anführte, blieb stehen und rümpfte die Nase. Sein Kollege, der dicht hinter ihm ging, prallte beinahe auf ihn und reagierte leicht verärgert. „Was ist denn los? Warum bleibst du stehen?“
„Mit Verlaub, Euer Lordschaft, aber es stinkt! Riechst du das nicht, Richard?“ Obermeister Wagner grinste schief, und verzog danach vor Ekel sein Gesicht.
Überrascht sah Mathias ihn an und dachte dabei: „Das stinkt hier wie die Pest und der Kerl macht auch noch Witze darüber.“
Der Gesichtsausdruck des Oberkommissars veränderte sich. Man sah ihm an, dass er den überwältigenden Geruch kaum ertragen konnte. Schließlich meinte er spöttisch: „Komisch, jetzt wo du es sagst… Uuh, also ich könnte hier nicht wohnen.“ Nach einer kurzen Pause wiederholte er fluchend: „Was ist das denn, so ein bestialischer Gestank! Pfui, Deiwel, in diesem Haus kann man doch nicht wohnen!“
Auch an Doktor Smollenkos und Mathias‘ Nasen drang ein sehr unangenehmer, penetranter Geruch. Trotzdem sagte der Arzt: „Es nützt ja alles nichts, wir müssen da rein.“
Die Polizisten drehten sich zu ihm um und schnitten Grimassen, die eine eindeutige Aussage machten: Oberkommissar Walter war belustigt und Obermeister Wagner wäre viel lieber von hier verschwunden.
Schweigend gingen sie ins Haus, deren Eingangstür offenstand. Als sie es betraten, verstärkte sich der unangenehme Geruch. Der junge Obermeister verzog angewidert sein Gesicht. Mathias hielt sich für einen Augenblick die Nase zu und stöhnte leise auf. Als sie die Briefkästen erreichten, fiel ihnen einer davon besonders auf. Er war überfüllt, sodass die Post daraus hervor quoll. Einige Zeitungen und Zeitschriften waren zu erkennen, aber auch Briefe und Benachrichtigungskarten schauten daraus hervor. Es schien, als seien noch mehr Postsendungen hinein gestopft worden, die aber zwangsläufig auf dem Fußboden ihren Platz fanden. Falten im Papier und Eselsohren zeugten davon.
Der Obermeister schaute auf das Namensschild des übervollen Briefkastens und sagte: „Willhöfft, zu dem sind wir unterwegs.“ Nach einer kurzen Pause meinte er: „Na, da werden wir doch eine unangenehme Überraschung erleben! Der volle Briefkasten, die Käfer, die unter der Tür aus seiner Wohnung kommen sollen! Das stinkt nach Arbeit!“
Mathias verzog sein Gesicht und stöhnte erneut auf. Doktor Smollenko klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter und sagte: „Nur keine Sorge, ich glaube, deine Hilfe benötige ich hier nicht.“
Dankbar sah Mathias den Kardiologen an.
Je weiter sie ins Hausinnere kamen, desto schlimmer wurde der Gestank. Doktor Smollenko drückte den Knopf für den Fahrstuhl, dessen Türen sich danach einladend öffneten. Die schäbige und abgenutzte Kunststoffverkleidung der Innenwände war früher ein Holzdekor, nun aber waren die Wände mit unschönen Wandmalereien versehen, oder mit fettigem Schmutz bedeckt. Die Fahrstuhltür schloss sich mit einem gefährlichen Ruckeln und unangenehmen, metallisch quietschenden Geräuschen. Der Gestank wurde intensiver. Die vier Männer sahen sich bestürzt und angewidert an.
Endlich setzte sich dieses ehemalige Wunderwerk der Technik in Bewegung. Ein ebenso metallisches nun aber dumpfes Geräusch, das nicht definiert werden konnte, ertönte und ließ den Obermeister blass werden. Er stöhnte auf, lauter als er es beabsichtigt hatte. „Hoffentlich bleiben wir mit dem Ding nicht stecken!“, wagte er, seine Angst zum Ausdruck zu bringen.
„Nur die Ruhe bewahren, Enrico“, erwiderte der ältere Polizist gutmütig und mit großer Seelenruhe, „der Fahrstuhl ist zwar alt, aber er wird uns schon noch in den neunten Stock bringen.“
„Auch wenn er das tut, werde ich nachher lieber die Treppe nehmen. Ne, da ertrage ich lieber den Gestank etwas länger, als dass ich mit diesem Scheißding stecken bleibe.“
Endlich hielt der sonderbare Fahrstuhl ächzend an. Die Tür ruckte, aber öffnete sich nicht. Der Obermeister bekam einen Anflug von Panik, als es plötzlich laut knallte und die Tür aufsprang. Nicht nur Obermeister Wagner begab sich schnell auf den Flur des neunten Stockwerkes. Dieser führte nach rechts vom Fahrstuhl weg, der sich in der Hausecke befand, und wurde von Neonlicht erhellt. Ein Fenster, das man hätte öffnen können, gab es nicht, denn auch hier stank es so sehr, dass davon die Augen tränten.
Sie gingen an drei Wohnungstüren vorbei. Jedoch stand auf keinem der Namensschilder Willhöfft. Ihr Weg führte um eine weitere Ecke. In der Wand befand sich eine offene Klappe. Smollenko fragte: „Sind Müllschlucker in Hochhäusern nicht längst verboten? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, woher dieser unsägliche Gestank kommt.“
„Wenn ich richtig liege, sind die Dinger aus hygienischen Gründen und vor allem aus Gründen des Brandschutzes in einigen Bundesländern seit langem verboten. Aber in Hamburg gibt es so ein Gesetz leider noch nicht“, antwortete der Oberkommissar.
„Dann sollte dieses Gesetz hier schnell verabschiedet werden. Fest steht, dass durch diese Müllschlucker Ratten und anderes Ungeziefer angelockt werden. Das kann sich dann im ganzen Haus verteilen. Nicht nur Ratten, auch Mäuse und Insekten werden angelockt“, äußerte Obermeister Wagner seine Meinung.
„Schaut doch mal zu dieser Wohnung in der Ecke da. Da krabbeln schwarze Käfer vor der Tür. Wo steckt denn der Hausmeister, der sollte uns doch die Tür aufmachen“, sagte Oberkommissar Walter.
Sein junger Kollege entnahm seinem Gürtel ein Funkgerät und gab diese Frage an seine Einsatzstelle weiter. Prompt bekam er aus dem Gerät die Antwort. „Moment, ich rufe gleich noch mal den Hausmeister an.“
Etwa fünf Minuten später wurden sie von der Einsatzstelle des Polizei-Kommissariats über Funk informiert: „Der Hausmeister ist bereits auf dem Weg zu euch und müsste bald eintreffen.“
Tatsächlich stieß er nach drei weiteren Minuten zu ihnen und öffnete nach einem kurzen Kopfnicken als Begrüßung die Tür zu Willhöffts Wohnung.
Was sie auf dem Fußboden des Wohnungsflures erblickten, ließ ihnen das Blut in ihren Adern gefrieren. Der Fußboden schien aus zuckenden, krabbelnden, schwarzen Käfern zu bestehen. Wohin man blickte, alles wimmelte von schwarzem, glänzendem Chitin. Der Hausmeister sah zuerst bestürzt in die Wohnung, danach den Oberkommissar fragend an. Dieser erlaubte ihm, seiner Arbeit nachzugehen. Seine Fragen würde ihm der Polizist später im Hausmeisterbüro des Nachbarhauses stellen können. Dankbar verschwand der Mann schnell hinter einer Ecke des Hausflures. Die Polizisten bemerkten sich zunickend, dass er das Treppenhaus benutzte.
„Mathias, du kannst hier auf mich warten“, sagte Smollenko zu seinem Gehilfen und wandte sich Willhöffts Wohnung zu.
Doch der junge Rettungssanitäter war neugierig darauf, was sie in der Wohnung erwartete und wollte den Doktor begleiten. Nichts konnte ihn davon abbringen.
Die beiden Mediziner fassten sich zuerst ein Herz und gingen mutig voran. Unter ihren Schuhen knackte es laut, als sie auf die Käfer traten und deren Chitinpanzer zerplatzten. Das war ihnen sehr unangenehm. Leider gab es keine andere Möglichkeit, um in die Wohnung des Herrn Willhöfft zu gelangen. Mit jedem ihrer Schritte töteten die Männer unzählige Exemplare dieser kleinen Tierchen, aber es war notwendig, weil der Mensch, der diese Wohnung gemietet hatte, wichtiger war als die Käfer. Selbst dann, wenn es sich um einen Toten handeln sollte. Die Polizisten folgten dem Beispiel des Arztes. Ein flaues Gefühl beschlich sie, denn angenehm anzuhören waren die Geräusche, die unter ihren Füßen entstanden, nicht. Bei jedem einzelnen Schritt, den sie gingen, knackte es unzählige Male.
Doktor Smollenko stieß die Tür zum Wohnzimmer auf, die nur angelehnt war. Mit einem Blick erfasste er den Zustand, in dem sich der Raum befand und gleichzeitig das Bild, welches sich ihnen bot.
Überall krabbelte und wuselte es von schwarzen Käfern. Es mussten etliche Tausend sein. Auf den Möbeln lag eine dicke Staubschicht. Auch hier waren vereinzelt Käfer zu sehen, die sich auf die Möbel verirrt hatten. Auf dem Tisch erblickte Mathias eine Zeitung. Der Raum war vollkommen überhitzt. Das lag aber nicht an der Jahreszeit, obwohl es Sommer war. Die Heizung lief auf der höchst möglichen Stufe. Die Hitze war in Verbindung mit den üblen Gerüchen aus dem Müllschacht kaum zu ertragen.
Doch das alles war nichts im Vergleich zu dem, was sie noch wahrnehmen mussten. An der Heizung lehnte mit dem Rücken eine Leiche. Ihre Beine waren auf dem Fußboden ausgestreckt und weit gespreizt. Hose und Hemd, die der Tote als lebender Mensch einmal angezogen hatte, existierten nur noch als Fragmente. Riesige Löcher befanden sich darin. Die Kleidung ließ darauf schließen, dass die Leiche ein Mensch männlichen Geschlechtes war. Die Füße steckten in Hausschuhen, auf denen sich viele Flecken verschiedenen Ursprungs befanden.
Der Kopf mit einem Haarkranz hing dem Leichnam auf die Brust hinab. Die Reste des Hemdes und der Hose ließen erkennen, dass der Mann sehr stattlich gewesen sein musste, doch jetzt war er mumifiziert. Sein ehemaliger Umfang war auf ein Minimum geschrumpft und nur noch am sehr weiten Bund der Hose und des Gürtels, der noch in ihren Schlaufen steckte, zu erahnen.
Mathias ging mit knackenden Schritten zum Couchtisch, auf dem die Zeitung lag. Er nahm sie in die Hand. „16. Februar 2015.“
„Was war am 16. Februar 2015?“, fragte der Polizeiobermeister.
„Wahrscheinlich ist der Mann an dem Tag gestorben!“, antwortet der junge Begleiter des Arztes.
„Woher willst du das denn wissen?!“, fragte Obermeister Wagner weiter, der sichtlich geschockt neben dem am Toten knieenden Doktor stand und nicht sah, dass Mathias eine Zeitung in seiner Hand hielt.
Deshalb entgegnete der junger Assistent des Internisten freundlich: „Auf der Zeitung, die auf dem Tisch lag, steht dieses Datum. Sie ist über zwei Jahre alt.“
„Das muss doch hier entsetzlich gestunken haben, hatten die Nachbarn das denn nicht gerochen?!“
Sein Kollege antwortete darauf: „Der Müllschlucker wird auch im Winter seine ekligen Gerüche im Haus verteilen. Niemandem wird der Leichengeruch aufgefallen sein. Und ein übervoller Briefkasten lässt keine Rückschlüsse auf einen Toten zu. Erst durch die Käfer sind die Nachbarn auf den armen Kerl aufmerksam geworden, oder dass hier etwas nicht stimmt.“ Dann wendete sich der Oberkommissar an Doktor Smollenko: „Und woran ist er gestorben, Doktor? Können Sie das schon sagen?“
„Soweit ich das beurteilen kann, wird er wahrscheinlich an Herzversagen gestorben sein. Er war ein alter Mann, der zudem an Übergewicht litt. Zusätzlich vielleicht auch an Diabetes, Bluthochdruck und einer Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen. Wahrscheinlich ein ganz normaler Tod. Aber Genaues kann man nur nach einer Obduktion sagen.“
„Glauben Sie nicht daran, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel?“, fragte Oberkommissar Walter.
Doktor Smollenko überlegte kurz und mit Entschiedenheit in der Stimme legte er sich fest: „Nein, das glaube ich nicht. Soweit ich das im Moment beurteilen kann, sind an der Leiche keine Spuren von äußerlicher Gewaltanwendung erkennbar. Außerdem sieht die Wohnung dafür, von den Käfern und dem Staub einmal abgesehen, zu ordentlich aus. Es gibt hier keine Spuren, die auf einen Kampf hinweisen. Oder überhaupt auf Anwendung von Gewalt. “
Als Doktor Smollenko und Mathias das Haus verließen, sah der junge Rettungssanitäter im Gesicht etwas blass aus. Der Kardiologe fragte: „Na, ist alles in Ordnung.“
„Ja, es geht mir gut, nur darf man nicht darüber nachdenken, dass der arme Kerl schon seit zwei Jahren in seiner Wohnung tot herumliegt und niemand das bemerkt hat. Es hat ihn kein Mensch vermisst! So möchte ich nicht sterben!“
„Hinzukommt, dass es auch keinen gestört hat, dass sein Briefkasten schon übervoll war. Der Postbotin hätte das doch auffallen müssen.“
„Oder seiner Wohnungsgesellschaft, er muss doch Miete bezahlen. Ebenso Strom und sicherlich noch andere Fixkosten, die jeden Monat anfallen.“