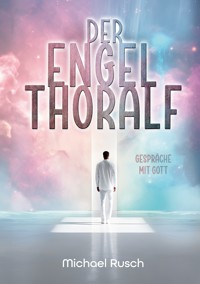Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Hochhaus
- Sprache: Deutsch
Ein Jahr nach dem vermeintlichen Tode des Monsters passieren wieder merkwürdige Dinge im Hochhaus des Schreckens. Phil Neumann folgt einem Hilferuf der Bewohner und ist dem Monster im Stollensystem erneut auf der Spur. Dabei muss er feststellen, dass es dort ein zweites Ungeheuer gibt. Durch die Explosion einer alten Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg stürzen einige Stollen ein. Die Monster entkommen und suchen Zuflucht in den U-Bahnschächten Hamburgs. Dabei hinterlassen sie eine blutige Spur. Gelingt es Phil Neumann, sie zu stoppen? In diesem 2. Band gelingt es Rusch, eine weitere spannende Geschichte über die Hamburger Monster zu erzählen, die sogar den ersten Band an Spannung übertrifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Antje Huckriede und Bianca und Lars Thamm
Inhalt
Prolog
Geräusche
Notarzteinsätze
Ein Versäumnis
Unter der Erde
Monsteralarm
Die Suche
Aufgaben
Unvorhersehbare Ereignisse
Der Tod
Monsteralarm
Plötzlich und unerwartet
Im U-Bahnschacht
Der Triebwagen
Der Zweikampf
Im U-Bahnnetz
Kampf ums Überleben
Schreckliche Verbrechen
Danksagung
Der Autor
Prolog
Das Monster wurde besiegt. Torsten und sein Freund Patrick konnten glücklicherweise gerettet werden. Damit fanden die Bewohner des Hochhauses am Hans-Duncker-Platz 23 endlich wieder ihre Ruhe. Seit damals gab es keine Angriffe mehr von Ratten, Käfern, Spinnen oder ähnlichem Getier. Andere Katastrophen blieben zum Glück für die Bewohner des Hauses ebenso aus. Überhaupt hatte der Bestand an Ungeziefer im Haus weit abgenommen und sich dem der anderen Hochhäuser dieses Wohnkomplexes, in denen ebenfalls eine Müllschluckeranlage installiert worden war, angepasst.
Die dramatische Rettungsaktion der Jungen fand im letzten Jahr in den Sommermonaten statt. Und der diesjährige Sommer hielt, was die Jahreszeit versprach. Die Tage waren sonnig und heiß.
Herr Waldbusch und Herr Weber wurden nur wenige Tage nach ihrer Bergung beerdigt, und das junge Ehepaar Michel und Natalie Bartsch zog vom Hans-Duncker-Platz in einen anderen Stadtteil. Bisher hielten Torsten und Patrick ihr Wort, sich vom unterirdischen Stollensystem fernzuhalten.
Bekanntlich stiegen die Jungen damals in das Kellergeschoss hinab, wo sie in einer Wand ein mit einer Plane abgedecktes Loch fanden, durch das sie in einen weiteren Raum gelangten. Danach passierten sie eine Stahltür. So fanden sie ihren Weg über eine Treppe direkt ins unterirdische Stollensystem.
Die Wohnungsgesellschaft, die für den Hochhauskomplex auf dem Hans-Duncker-Platz verantwortlich war, hatte nach den dramatischen Ereignissen den Hausmeister beauftragt, die Türen dieser Räume sorgfältig zu verschließen. Niemand sollte das unterirdische Tunnel- und Stollensystem jemals wieder aufsuchen können. Außerdem verfolgte Herr Fritsche, der Chef der Abteilung Vermietung, das Ziel, das Monster aus dem Stollensystem vom Haus fernzuhalten, falls es denn überhaupt noch lebte. Er bezweifelte nämlich die Aussage des Institutsdirektors für Forschung an unbekannten Lebensformen, dass das Monster den Verletzungen erlegen sei, die ihm Phil Neumann und Michel Bartsch zugefügt hatten. Mochte es vielleicht eine verschlossene Holztür bezwingen können, aber eine Stahltür bestimmt nicht.
Außerdem sollte das Loch in der Kellerwand zugemauert werden, hinter dem sich der Zugang zu den Stollen befand. Damit beauftragte Herr Fritsche eine Baufirma. Ein ihm unterstellter Mitarbeiter sollte die Ausführung des Auftrages kontrollieren.
Nachdem Michel Bartsch und seine junge Frau in einem anderen Stadtteil eine neue Wohnung fanden, zogen auch Ingrid Weber mit ihrem Sohn Torsten und die Eheleute Niebel mit ihrem Sohn Patrick aus dem Haus, das im Volksmund das Hochhaus des Schreckens genannt wurde. Der Umzug ihrer Eltern war wohl eher der wahre Grund dafür, warum es Torsten und Patrick leichtfiel, das besagte Stollensystem zu meiden.
Die Abfallschächte des Hochhauskomplexes wurden auch heute noch betrieben. Torsten und Patrick hatten bereits im letzten Jahr festgestellt, dass sich die Luken des Müllschluckers im Haus 23 nicht verschließen ließen. Und so war es auch heute noch. Deshalb verbreitete sich der intensive und ekelerregende Geruch der Abfälle auch noch in diesem Jahr im gesamten Haus. Es war eine große Schande, dass die Zugangsklappen des Abfallschachtes noch immer nicht repariert worden waren! So jedenfalls sahen das die Bewohner. Denn damit hatten Patricks und Torstens Abenteuer im letzten Jahr begonnen, die dann leider auf tragische Weise endeten und drei Menschenleben gefordert hatten.
Schnell sprach sich in der Wohnanlage herum, was damals geschehen war. Aber nachdem der Hausmeister die Tür zum unterirdischen Stollensystem verschlossen hatte und die Menschen erfuhren, dass das mit der Plane abgedeckte Loch in der Kellerwand zugemauert werden sollte, fühlten sich die Bewohner in ihrem Haus wieder sicher.
Doch wäre es zu schön, um wahr zu sein, wenn alle Maßnahmen von Erfolg gekrönt wären, die Herr Fritsche von der Wohnungsgesellschaft veranlasst hatte, um den Frieden im Haus 23 des Hans-Duncker-Platzes wieder herzustellen. Der Hausmeister hatte zwar die Türen zum Stollensystem verschlossen, aber der Chef der Baufirma ließ den Auftrag, das Loch in der Kellerwand zu zumauern, nicht erledigen. Sein Unternehmen hatte zu viele andere Aufgaben abzuarbeiten, sodass ausgerechnet dieses problembehaftete Loch in der Kellerwand in Vergessenheit geriet, durch die das Grauen des letzten Jahres erst möglich wurde. Auch Herr Fritsches Mitarbeiter vergaß, die Ausführung des Bauauftrages zu kontrollieren.
Wie wir wissen, sah das Monster damals den übrig gebliebenen Männern der Gruppe von Phil Neumann mit geiferndem Maul nach, als diese sich dem Ausgang des Stollensystems näherten. Das Untier war mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen, die ihm seine Kräfte geraubt hatten, nicht mehr fähig, Menschen zu jagen. Außerdem erlitt es kaum zu ertragende Schmerzen. Trotzdem erholte es sich in den darauffolgenden Wochen und Monaten. Dabei ernährte es sich von seinen Vorräten, die noch aus der Zeit vorhanden waren, bevor das Stollensystem verschlossen wurde. Bis dahin gab es immer wieder neugierige Kinder und Jugendliche, die leichtsinnigerweise die Stollen erkundeten und dem Monster dabei teilweise in die Falle gerieten.
Doch jetzt waren die Verletzungen des Ungeheuers verheilt. Es war wieder gesund. Und es hatte Hunger! Seine Vorräte hatte es aufgebraucht! Das ist der Beginn einer weiteren Geschichte um das Monster aus dem Stollensystem des Hans-Duncker-Platzes.
Geräusche
Erwin Fischer, ein Mann in den besten Jahren, hatte sich in seinem Keller eine kleine Werkstatt eingerichtet, weil er in seiner Freizeit gern bastelte. Besonders hatte es ihm der Modellbau von Segelschiffen angetan. Fernsehen mochte er nicht, weil ihn die viele Werbung störte. Aber am Abend sah er sich gemeinsam mit seiner Frau gerne mal einen Film an, den sie werbefrei online als Stream abrufen konnten. Aber in seiner kleinen Werkstatt fühlte er sich immer noch am wohlsten. Hier hatte er einen Kühlschrank, in dem er seine Getränke verwahrte und die er, wie er stets sagte, beim Basteln und Herumwerkeln benötigte. Auch seinen Gästen bot er großzügig davon an, wenn sie ihn in seiner kleinen privaten Werkstatt besuchten. Das hatte sich im Haus herumgesprochen und deshalb ergab es sich oft, dass ihm eine helfende Hand zur Verfügung stand, wenn er sie beim Zusammensetzen seiner Schiffsmodelle benötigte.
Wie jeden anderen Tag in der Woche ging Erwin Fischer auch heute am frühen Nachmittag in den Keller zu seinem neuesten Projekt. Er arbeitete an einem Modell des russischen Großseglers „Mir“, das er beinahe fertiggestellt hatte. Heute wollte er die Arbeit daran beenden. Außerhalb des Hauses herrschten schon seit mehreren Tagen hochsommerliche Temperaturen, denen er entfliehen wollte. Im Kellergeschoss war es noch angenehm kühl, hier ließ es sich gut aushalten.
Er trug eine bequeme alte Trainingshose aus grauem Baumwollstoff und ein blau-rot kariertes Flanellhemd, das ihm locker über die Hose hing. Das waren seine Lieblingssachen, die er stets anzog, wenn er im Haus blieb, und wenn seine Frau sie ihm nicht weggenommen hatte, weil sie dringend gewaschen werden mussten. Die Ärmel seines Hemdes hatte er hochgekrempelt, weil er glaubte, so mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Seine Füße steckten in alten ausgelatschten gelben Schlappen mit einem schwarzkarierten Muster. Diese Leisetreter hatten früher einmal kräftige Farben besessen, wurden aber heute von einem fleckigen Grau überdeckt. Sie waren in den letzten Jahren von ihrem Besitzer während seiner Bastelarbeiten einigem Schmutz ausgesetzt worden. Ihre Sohlen hatten bereits erste kleine Löcher. Erwin Fischer nahm sich vor, neue Hausschuhe zu kaufen, wenn sich die Temperaturen im Freien wieder etwas normalisierten. Doch noch sollte es in den nächsten Tagen hochsommerlich warm bleiben.
„Gustav, halte das doch bitte mal fest, damit ich den Rumpf des Schiffes ordentlich bemalen kann“, sagte er zu Gustav Holz. Der Angesprochene war einer seiner Freunde, die ihn immer wieder gern in seiner Werkstatt besuchten.
Am heutigen Tage war er sein einziger Gast. Sie waren nicht nur Freunde, sondern auch Nachbarn auf der gleichen Etage. Die beiden Männer rauchten eine Zigarette. Erwin Fischer legte sein Modellschiff auf die Seite, und wartete darauf, dass Gustav Holz es endlich festhielt. „Komm, Gustav, nun mach doch mal!“, forderte er seinen Gast nochmals ungeduldig auf.
Gustav Holz drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und murrte: „Immer mit der Ruhe, alter Freund.“
„Wenn ich für die Bilder zu viel Zeit verbrauche, dann trocknet die Farbe doch aus. Dann war die ganze Arbeit umsonst.“
„Ja, ja, ich weiß, Erwin.“ Mit diesen Worten ergriff Gustav Holz das Schiff. Mit ruhiger Hand, die er gut unter Kontrolle hatte, hielt er das Modell fest, sodass es sich nicht einen Millimeter bewegte. Überhaupt besaß Gustav Holz eine große Selbstbeherrschung, von der andere Menschen nur träumen konnten.
Stets war er korrekt angezogen. In solch abgetragenen Sachen wie Erwin Fischer, auch wenn dieser sie nur in seiner Kellerwerkstatt oder in seiner Wohnung trug, würde Gustav Holz nie herumlaufen. Er trug gerne Hemden, die stets gebügelt sein mussten. Heute hatte er ein einfarbiges, beiges Hemd angezogen. Seine Bluejeans saß wie angegossen. Solch schlabbrige Hosen wie sie viele Jugendliche in der heutigen Zeit trugen, mochte er überhaupt nicht. Darüber machte er sich oft genug lustig, wenn er mit seiner Frau oder Freunden spazieren ging und einen Teenie in einer, wie er fand, solchen unmöglichen Hose sah. Dann sagte er: „Nun guck dir doch den mal an. Der hat auch so eine blöde Hose an. Diese Dinger finde ich einfach nur zum Kotzen. Dem willst du in den Arsch treten und der knickt in den Knien ein. Ganz klar warum. Hast dem auf den Arsch gezielt, aber du triffst nur die Kniekehlen!“
Da er sich zurzeit nicht in seinem Wohnzimmer aufhielt, sondern im Keller seines Kumpels, trug er ordentliche schwarze Schnürschuhe.
Erwin Fischer hatte seine Zigarette in einen Mundwinkel geschoben und rauchte, während er mit seinem Freund gemeinsam das Modell der „Mir“ bemalte. Dabei bewies er ein erstaunliches Geschick. Die Farben entsprachen dem Original und die Linien am Rumpf zog er freihändig ohne Schablone so gerade, als hätte er ein Lineal benutzt. Als er damit fertig war, gönnte er sich noch einen letzten Zug von seiner Zigarette, die danach in dem halb vollen Aschenbecher landete. In der Zeit, in der er den Rumpf bemalte, rauchte er drei Zigaretten. Er war froh und auch ein bisschen stolz darauf, die Arbeiten an seinem Modellschiff noch heute beenden zu können, nahm es seinem Freund aus den Händen und hing es in zwei Schlaufen, die er an der Decke angebracht hatte. Danach überzeugte er sich davon, dass seine „Mir“ nicht herunterfallen konnte. In den nächsten Stunden würde das Modell unter der Decke zum Trocknen hängen bleiben. „So, und jetzt trinken wir ein Bier.“
Erwin Fischer öffnete die Tür des Kühlschrankes, holte daraus zwei Flaschen hervor, öffnete sie und reichte eine davon seinem Nachbarn. „Prost, Gustav.“
„Prost Erwin“.
Sie unterhielten sich und tranken dabei auch noch ein zweites Bier. Zwei Stunden später schien die Farbe des Schiffes endlich trocken zu sein. Nun stellte Erwin Fischer das Modell in den dazugehörenden Ständer und besah sich sein Kunstwerk in allen Einzelheiten. Zufrieden lächelte er vor sich hin. „Super, jetzt brauche ich nur noch die Segel anzuschlagen, die ich auch schon zusammengefügt habe, dann ist es fertig, Gustav. Wenn du morgen wieder zu mir kommst, siehst du das fertige Schiff.“
„Wie du das immer so machst, Erwin, ich hätte für so eine Fummelei keine Ausdauer und vor allem nicht die Fingerfertigkeit.“
„Na, ja, etwas Geduld muss man für so einen Kram schon haben“, meinte Erwin Fischer. Mit vor Stolz vorgewölbter Brust stand er vor seinem Freund.
Einige Augenblicke schwiegen sie. Doch dann ging Erwin Fischer zu seinem Kühlschrank. „Komm, Gustav, wir trinken noch ein schönes kühles Bierchen. Das haben wir uns redlich verdient.“
Dankbar nahm Gustav Holz eine Flasche aus der Hand seines Freundes entgegen. Sie tranken einen Schluck und suchten auf der Werkbank einen freien Platz, auf dem sie ihre Flaschen abstellen konnten. Dafür räumte Erwin Fischer einige Werkzeuge in einen Werkzeugkasten.
„Und hast du schon ein neues Projekt, Erwin?“
„Klar, du kennst mich doch. Als nächstes Schiff kommt die „Gorch Fock“ an die Reihe, und danach die „Kruzenshtern“, die auch schon in meinem Wohnzimmerschrank liegt.“
Erwin Fischer liebte die Seefahrt und ganz besonders liebte er Segelschiffe. Überall in seiner Wohnung standen Modelle der bekanntesten Segelschiffe, die er selbst gebaut hatte. Dabei handelte es sich um historische Modelle, aber auch um solche, die noch heute auf den Weltmeeren ihre verschiedenen Ziele ansteuerten. Noch nie in seinem Leben hatte er fertige Modellbausätze gekauft, die er nur noch zusammensetzen musste. Stattdessen besorgte er sich das notwendige Material in dem Baumarkt, der sich nur drei Straßen von seiner Wohnung entfernt befand. Er berechnete alle Einzelteile maßstabsgetreu und begann danach, die Bauteile sorgfältig herzustellen und zu bearbeiten. Anschließend bekamen sie ihren Farbanstrich und wurden zusammengesetzt. Am Ende wurde alles noch einmal gestrichen. Manchmal benutzte Erwin Fischer Abziehbilder, die er am Computer selbst erstellte und danach bemalte und zuschnitt. Wenn er sich für ein neues Modell interessierte, recherchierte er manchmal tage- und wochenlang im Internet, um zu erfahren, welche Bauteile er für ein neu geplantes Modell benötigte. Alle Details des Originals, die man mit bloßem Auge sehen konnte, mussten auch auf Erwin Fischers Miniaturen vorhanden sein. Es durfte keine Abweichungen geben. Kein Wunder, dass er in solch ein Modell sehr viel Zeit investierte, oft monatelang seine gesamte Freizeit.
„Das ist ja…“, Gustav Holz unterbrach sich und lauschte. Dann fragte er: „Sage mal, hast du das eben auch gehört?“
„Was soll ich gehört haben?“
„Weiß nicht, jetzt ist es weg.“ Er spürte, dass sein Körper Adrenalin ausschüttete. „Da…, da war es wieder!“
„Ja, ich habe es auch gehört. Es hat gepoltert!“
„Genau, Erwin!“
„Wo das wohl herkommen mag? Und was ist das überhaupt für ein komisches Poltern?“ Erwin Fischer sah seinem Freund fragend ins Gesicht.
„Ob wir mal nachsehen sollen?“ Wie ein kleiner Junge verspürte Gustav Holz, wie ihn auf einmal eine Abenteuerlust überkam.
Erwin Fischer sah zu seiner „Mir“ und danach wieder zu seinem Kumpel. „Schaden kann es nicht!“
Sie verließen den Keller. Auf beiden Seiten des Ganges befanden sich die Abstellräume der anderen Hausbewohner, die mit Erwin Fischer in derselben Etage wohnten. Da es im Haus zwölf Etagen gab, existierten folglich zwölf solcher Gänge im Kellergeschoss. Die Abstellkammern waren zum größten Teil mit Wänden in Leichtbauweise voneinander getrennt, nur die äußeren Kellerräume wurden teilweise von tragenden Wänden begrenzt.
Die Männer erreichten den nächsten Gang. Immer noch polterte es irgendwo. Aber sie konnten nicht herausfinden, woher die Geräusche kamen, da verschieden lange Pausen dazwischen lagen. „Hat es aufgehört oder ist es hier leiser geworden?“, fragte Gustav Holz, der sich im gleichen Alter wie Erwin Fischer befand. Plötzlich klopfte es erneut, doch das hörte schnell wieder auf.
„Nein, von hier kommt es nicht“, sagte Erwin Fischer.
Sie gingen zurück und schlugen den Weg zur anderen Seite des Hauses ein. Mehrmals riefen sie: „Hallo, ist da jemand? Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“ Aber niemand antwortete den beiden Männern. Plötzlich vernahmen sie das Geräusch erneut.
Erwin Fischer rief: „Hier, von der rechten Seite kommt das, Gustav!“
„Ja, ich höre es jetzt auch ganz deutlich. Lass uns dort mal nachsehen!“
Doch als sie den Kellergang betraten, aus dem sie das dumpfe klopfende Geräusch hörten, wurde es wieder still. Niemand befand sich darin. Da es dort keine Fenster gab und deshalb kein Tageslicht in den Raum hereinschien, schaltete Gustav Holz die Deckenbeleuchtung ein. Gemeinsam gingen sie weiter an den mit Holzlatten versehenen Verschlägen der Mitbewohner vorbei. Vor allen Kellerräumen hingen Vorhängeschlösser. Doch trotzdem hörten die Männer deutlich ein dumpfes Pochen, das nach einigen Schlägen wieder verstummte. Am Ende des Ganges fanden sie an der Wand eine Plane. Erneut klopfte es dreimal kurz hintereinander. Dieses Mal konnten es die Männer sehr deutlich hören.
„Das kommt doch von hier“, meinte Erwin Fischer.
„Wie von hier? Hier ist doch aber nichts.“ Gustav Holz‘ Gesicht drückte Unglaube aus.
„Ich glaube, es kommt von der Plane“, meinte Erwin Fischer und verbesserte sich sofort. „Also von dahinter!“
„Es hört sich so an, aber das hier ist doch eine Wand.“ Verständnislos schaute Gustav Holz’ seinen Freund an.
Erwin Fischer griff zur Plane und hob sie an. Überrascht rief er: „Das kann doch nicht wahr sein, hier ist ein Loch!“
Jetzt ahnte Gustav Holz, was das Geräusch bedeutete. „Erinnerst du dich noch an die Geschichte vom letzten Sommer? Davon hat doch fast jeder hier im Haus erzählt. Demnach verschwanden zwei Jungs. Der Alte aus der neunten Etage soll mit seinem Hund den Vätern geholfen haben, sie zu suchen. Der Vater des einen Bengels starb dabei, auch der Alte und sein Hund. Die sollen unter der Erde gewesen und dort von einem Monster gejagt worden sein.“
„Klar erinnere ich mich. Die Bengels, so sagt man, sollen durch ein Loch in der Kellerwand gegangen sein. Das Loch war mit einer Plane verhängt.“ Erwin Fischer erinnerte sich an die damaligen Geschehnisse.
„Genau!“
Mit großen Augen fragte Erwin Fischer: „Und du meinst, dass es sich dabei um dieses Loch handelt?“
„Es ist mit einer Plane verdeckt, stimmts?“ Gustav Holz suchten viele böse Vorahnungen heim.
„Ja, aber das Loch sollte doch schon längst zugemauert sein.“ Auch Erwin Fischer wurde unruhig.
„Und wenn nicht? Wenn es tatsächlich dieses Loch ist, durch das die Kinder im letzten Jahr hindurch geschlüpft sind?“ Plötzlich fühlte sich Gustav Holz nicht wohl in seiner Haut.
Erwin Fischer überlegte einige Augenblicke. Ungläubig legte er seine Stirn in Falten. Mit zunehmender Zeit wurde sein Gesicht immer länger. Schließlich erwiderte er: „Du meinst, das Klopfen hört sich so an, als wenn jemand gegen eine Stahltür klopft. Und du glaubst, dass das Monster das macht?“
„Möglich wäre es doch, oder etwa nicht?“
„Hm…, dann sollten wir die Wohnungsgesellschaft darüber informieren. Oder wenigstens den Hausmeister!“
„Genau das glaube ich auch, Erwin.“
Notarzteinsätze
Toni Kaus war ein alleinstehender Mann im Alter von fünfundvierzig Jahren. Als Lehrer hatte er einen Beruf mit einem guten Einkommen und brauchte sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Seine Freunde schätzten ihn als einen hilfsbereiten und freundlichen Menschen, der stets fröhlich wirkte und zu jeder Zeit einen Scherz auf den Lippen hatte.
Aber in der letzten Zeit glaubte er, Stimmen zu hören. Manchmal glaubte er sogar, nicht ganz richtig im Kopf zu sein. Diese Stimmen hörte er jedoch nur zu Hause. Hielt er sich außerhalb seiner Wohnung auf, egal ob in der Schule oder bei Freunden oder beim Einkaufen, schwiegen sie. Manchmal glaubte er, dass sie ihn nur in seiner Wohnung aufsuchen konnten.
Deshalb ging Toni Kaus in diesen Minuten spazieren, er hatte das dringende Bedürfnis, sich an der frischen Luft zu bewegen. Es war bereits nach zweiundzwanzig Uhr, als er sich fragte, wohin er gehen sollte. Dank der Sommerzeit war es noch recht hell, denn die Dämmerung setzte gerade erst ein, außerdem war es noch sehr warm. Ohne Ziel schlenderte er unschlüssig durch die Straßen seines Stadtteils. Dabei überlegte er, dass er sich nicht die ganze Nacht auf der Straße herumtreiben konnte. Jedoch wollte er nicht nach Hause zurückkehren, denn dort hörte er immer wieder diese hässlichen Stimmen, die von ihm verlangten, sich umzubringen.
Warum sollte er das tun? Es ging ihm doch gut! Er hatte keinen Grund sich selbst zu töten. Alles, was er sich vom Leben erhoffte, hatte er bekommen oder erreicht. Er war nicht reich, hatte aber eine finanziell gesicherte Existenz. Als verbeamteter Lehrer hatte er ausgesorgt. Zu seinen Schülern hatte er ein gutes Verhältnis. Er war fähig, seinen Unterricht interessant zu gestalten. Regelmäßig traf er sich mit seinen Freunden auf ein Bier, manchmal wurden es auch zwei oder drei. Zweimal im Jahr fuhr er in den Urlaub. Er wollte allein leben, eine Frau brauchte er nicht.
Das Einzige, was er brauchte, war eine andere Wohnung, um die Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen zu bringen. Dabei war er erst vor wenigen Wochen an den Hans-Duncker-Platz gezogen. Seine alte Wohnung existierte nicht mehr, das Haus, in dem sie sich befunden hatte, war abgerissen geworden. Es war schon sehr alt und baufällig gewesen. Da es in Hamburg so gut wie unmöglich war, in kurzer Zeit eine neue Wohnung zu finden, war er froh, dass ihm seine Wohnungsgesellschaft eine Wohnung im Haus 23 angeboten hatte, die ihm gefiel. Und der Mietpreis war mehr als angemessen. Wenn er es sich genau überlegte, war die Miete sogar ziemlich niedrig. Jetzt wusste er, warum die Mieten in dem Haus so günstig waren. Mit diesem Haus stimmte etwas nicht, das war ihm bewusst geworden.
Schon seit etwa drei Wochen hörte er diese vermaledeiten Stimmen. Sie wurden immer unverschämter und drohender. Was sollte er bloß tun? Das fragte er sich verzweifelt. Und vor einigen Tagen kam das viele Ungeziefer auch noch dazu! Spinnen und schwarze Käfer tummelten sich in seiner Wohnung, gerade so, als wäre sie ein Urwald.
Die Stimmen hörte er nicht ständig. Aber sie sprachen zu verschiedenen Zeiten zu ihm. Nie konnte er sich sicher sein, dass sie ausblieben. Immer dann, wenn er nicht mit ihnen rechnete, begannen sie, ihn zu quälen. Er hatte bereits seinen besten Freund eingeladen, ihn zu besuchen, um zu prüfen, ob sie sich meldeten, wenn er sich nicht allein in der Wohnung befand, oder ob auch andere Menschen die Stimmen hören konnten. Einen Grund für eine Einladung gab es immer. Diesmal sagte er zu seinem Freund, dass die neue Wohnung doch noch gefeiert werden müsse. Schließlich wohnte er noch nicht sehr lange in ihr.
Als sein Freund ihn an dem darauffolgenden Wochenende besuchte, unterhielten sie sich bis weit nach Mitternacht. Während der gesamten Zeit blieben die Stimmen stumm. Kaum war Toni Kaus wieder allein, verlangten sie von ihm, sich selbst zu töten.
Toni Kaus war müde. Er konnte doch nicht die ganze Nacht durch die Stadt laufen. Irgendwann musste auch er einmal schlafen. Aber wo nur konnte er das tun? Ließen die Stimmen ihn wenigstens in dieser Nacht endlich einmal in Ruhe? Resigniert ging er zurück zum Hans-Duncker-Platz. Als er das Haus betrat, in dem er wohnte, störte ihn als gesundheitsbewusster Mensch der Gestank, den der Müllschlucker im Haus verbreitete. Angenehm war etwas anderes, etwas ganz anderes. Er hatte das Gefühl, dass der Gestank sogar noch intensiver geworden war.
Mit dem Fahrstuhl fuhr er in die neunte Etage. Dort befand sich seine Wohnung. Als er die Wohnungstür öffnete, lief eine kleine Maus vor ihm davon. Sie flüchtete ins Treppenhaus. Einige schwarze Käfer krabbelten im Flur auf dem Boden und auf den Möbeln herum. Als er sie sah, packte ihn die Wut und er zertrat sie. Unter seinen Schuhen knackte es laut, sodass ihn ein unangenehmes Gefühl beschlich. Aber er wollte, dass seine Wohnung sauber blieb.
Aus der Küche holte er sich eine Flasche Bier und öffnete sie. Nachdem er es sich auf der Couch im Wohnzimmer gemütlich gemacht hatte, griff er sich die Fernbedienung und schaltete das Fernsehgerät ein. Gerade wurden die Nachrichten übertragen. Der Sprecher verlas eine Meldung, danach strahlte der Sender einen Kurzfilm aus, der den Menschen das Grauen des Krieges in Afghanistan zeigte.
„Toni Kaus, du musst dein Leben beenden!“ Eine Stimme flüsterte ihm diese Worte leise in sein linkes Ohr.
„Nein“, rief er, „Lasst mich endlich in Ruhe!“
Eine andere Stimme meldete sich. „Du hast so ein schönes Seil in deinem Schrank. Benutze es!“
Eine dritte Stimme in seinem Kopf rief: „Du hast für dein Seil einen wunderbaren, stabilen Haken in deinem Schlafzimmer, der trägt dein Gewicht!“
Toni Kaus ertrug das nicht mehr und hielt sich die Ohren zu. Wie ein kleines Kind wimmerte er. „Ich will doch nur meine Ruhe haben. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Ich will noch nicht sterben, aber so kann ich auch nicht weiterleben. Jeden Tag geht das so, ich halte das nicht mehr aus.“
*****
Mathias hatte sich in seiner Firma gut eingelebt. Er war zwanzig Jahre alt, arbeitete im Rettungsdienst und fuhr nur noch selten den Kassenärztlichen Notdienst. Er hatte sich vor einer Minute in der Mikrowelle seiner Rettungswache etwas Gemüse, einige Kartoffeln und eine Scheibe Krustenbraten aufgewärmt. Dieses Mahl hatte er von zuhause mitgebracht und sehnte sich nun nach dem Essen, um seinen knurrenden Magen endlich zu beruhigen.
Er schnitt sich ein Stück von dem Fleisch ab. Dabei freute er sich schon auf seinen Geschmack. Plötzlich sendete der Notfallpieper ein nervtötendes akustisches Signal aus.
„Ach, das kann ja gar nicht anders sein! Immer wenn wir essen wollen, piept das Scheißding“, schimpfte er laut und sprang auf.
In dieser Woche versah er seinen Dienst gemeinsam mit seinem Kollegen Ali, der nicht älter war als er selbst. Während sich die beiden jungen Männer mit eiligen Schritten zum Rettungswagen begaben, fragte dieser: „Wo geht es denn hin?“
„Zum Hans-Duncker-Platz 23. So ein Scheiß!“
„Was erwartet uns dort?“
„Eine nicht ansprechbare Person!“
Ali startete den Motor des Fahrzeugs und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhren sie zum Notfallort.
„Eine nicht ansprechbare Person! Eigentlich ist der Ausdruck blödsinnig. Jede Person ist ansprechbar. Nur einige antworten nicht, weil sie bewusstlos oder schon tot sind“, sagte Mathias.
Ali sah kurz zu ihm hin, aber dann konzentrierte er sich schnell wieder auf den Verkehr. „Wenn sie tot sind, sind es keine Personen mehr, sondern Leichen.“
„Dann sollte es vielleicht besser leblose Person heißen.“
Ali dachte kurz nach. Dann erwiderte er: „Bewusstlose sind ja nicht leblos.“
„Da hast du auch wieder recht!“ Mathias brach das Thema ab.
Trotz der späten Stunde – es war bereits gegen Mitternacht – waren die Straßen noch sehr belebt. Sie kamen trotzdem zügig voran. Dank der Sirene und des Blaulichtes hatten sie freie Fahrt. Nach nur acht Minuten erreichten sie das Hochhaus. Zeitgleich mit ihnen kam der Notarztwagen an. Doktor Smollenko stieg aus und nahm von seinem Fahrer einen Notfallkoffer entgegen. Mathias hatte seine beiden Notfallkoffer auf die fahrbare Trage gelegt und beeilte sich, mit seinem Kollegen dem Notarzt zu folgen. Als sie ihn erreichten, erkannte Mathias den Arzt und freute sich, nach langer Zeit endlich wieder mit Doktor Smollenko zusammen arbeiten zu können.
„Mathias, wir haben uns ja lange nicht gesehen“, sagte der Arzt.
„Das ist richtig, aber ich hätte es vorgezogen, Sie an einem anderen Einsatzort zu treffen“, antwortete Mathias.
„Wie meinst du das?“
„Wo sollten wir uns sonst treffen als hier im Hochhaus des Schreckens. So heißt es nämlich im Volksmund. Abgesehen davon, dass wir hier unseren ersten gemeinsamen Notfall hatten, haben wir uns hier öfter getroffen, als uns lieb sein kann.“
„Ja, da hast du tatsächlich recht.“ Der Arzt, ein Kardiologe, erinnerte sich, wie er den jungen und überaus wissbegierigen Sanitäter vor einem Jahr kennengelernt hatte. Der junge Mann hatte ihm Löcher in den Bauch gefragt. Und er hatte sich im Laufe der Zeit prächtig entwickelt. Er gehörte zu den besten Rettungssanitätern der Stadt, auf ihn war immer und zu jeder Zeit Verlass. Wenn er im Rettungsdienst blieb, würde Mathias eine großartige Zukunft vor sich haben.
Als sie den Fahrstuhl betreten hatten, schlossen sich die Türen mit einem lauten Knall. Dann ächzte, quietschte und ruckelte das altersschwache Gerät in die neunte Etage hinauf. Die Männer hatten das Gefühl, als würde der Boden beben. Mathias erkannte an Alis Gesichtsausdruck, dass er sich nicht wohlfühlte. Trotzdem blieb er ruhig. „Der Fahrstuhl ist immer noch der Alte!“
„Das Haus ist es ja auch immer noch. Ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet. Aber es ist wieder die gleiche Etage, in der wir schon so oft waren.“ Mathias ahnte Schlimmes.
Der Fahrstuhl blieb stehen. Die Tür bewegte sich zwar, blieb aber verschlossen. Plötzlich gab es nochmals einen lauten Knall und die Fahrstuhltür öffnete sich ruckartig. Schnell verließen die Männer dieses alte Wunderwerk der Technik. Als sie im Flur um eine Ecke bogen, sahen sie vor einer offenen Wohnungstür einen uniformierten Polizisten, der seinen Oberkörper nach vorn beugte. Der Mann erbrach sich.
„Brauchen Sie Hilfe?“ Doktor Smollenko sah dem Polizisten mit einem besorgten Blick in sein blasses Gesicht.
„Nein, es ist alles wieder in Ordnung, aber Sie sollten da nicht reingehen“, erwiderte der Polizist.
„Ich muss aber da rein, sonst kann ich dem Patienten nicht helfen.“
„Glauben Sie mir, der braucht ihre Hilfe nicht mehr.“
„Okay, aber dann muss ich den Totenschein ausfüllen, und dazu muss ich den Toten untersuchen.“
Der Polizist, dessen Gesichtsfarbe sich allmählich normalisierte, ging einen Schritt zur Seite. „Natürlich müssen Sie das. Guten Abend erst einmal, Herr Doktor. Ich bitte um Entschuldigung. Es ist nicht meine Art, einfach in den Hausflur zu kotzen. Ich mache das gleich wieder sauber, aber wenn Sie ins Wohnzimmer kommen, wissen Sie, warum ich es tat.“
„Ist schon gut, wir wissen ja beide, wo wir uns hier befinden. Guten Abend, Herr Kraft.“ Doktor Smollenko verstand den Polizisten, den er schon seit Jahren kannte. Die freundlichen Worte des Arztes quittierte dieser mit einem dankbaren Lächeln. Gemeinsam mit Mathias und seinem Kollegen Ali betrat der Notarzt die Wohnung. Der Fahrer des Notarztwagens folgte ihnen mit einem zweiten Notfallkoffer.
Sie erreichten das Wohnzimmer. Obwohl er erst seit einem Jahr als Rettungssanitäter arbeitete, war Mathias, auch durch die Einsätze in diesem Haus, schon ziemlich abgehärtet. Er hatte bereits viele schlimme Dinge erleben müssen, und deshalb konnte ihn kaum noch etwas aus der Fassung bringen.
Aber das, was er heute sehen musste, ließ auch ihn nicht kalt. Übelkeit überkam ihn beim Anblick des Toten, der in einem Sessel saß. Sein Kopf, oder besser: die Reste seines Kopfes, die noch übrig waren, hingen auf seine Brust herab. Vom rechten Fuß hatte er sich, bevor er sich erschoss, den Schuh und die Socke ausgezogen. Eine Schrotflinte stand zwischen seinen Beinen. Der Sessel befand sich etwa zwei Meter von der Wand entfernt. Der Mann musste sich den Lauf der Schrotflinte ungefähr dreißig Zentimeter vor das Gesicht gehalten haben, als er den Abzug mit dem großen Zeh betätigte. Mit brachialer Gewalt drang die Schrotladung in seinen Kopf ein und richtete verheerenden Schaden an. Es riss mehr als den halben Hinterkopf weg. Blut und Hirnmasse spritzten hinter ihm an die Wand, aber auch links und rechts neben dem Sessel und um ihn herum verteilten sich Blutlachen und Reste des Gehirns. Die an der Wand befindliche Hirnmasse glitt sogar noch in diesen Augenblicken an den Tapeten herab. Das Blut daneben war aufgrund seiner dünneren Konsistenz bereits bis zum Boden geflossen und trocknete nun an der Tapete. Vom Gesicht des Toten existierte so gut wie nichts mehr.
Doktor Smollenko schaute zu den Sanitätern. Aus Alis Gesicht verschwand die Farbe. Er würgte und versuchte sichtlich, sich zu beruhigen. Mathias hatte sich vom Tatort weggedreht und zitterte am gesamten Körper. Sein Gesicht konnte der Kardiologe nicht sehen. Er ging zu den beiden jungen Männern und legte jedem mitfühlend einen Arm um die Schulter. Leise fragte er: „Na, ihr zwei, geht’s oder braucht ihr meine Hilfe?“
Mathias schaute dem Notarzt in die Augen. „Danke, Doktor, ich komme schon klar.“
Ali schluckte und stöhnte auf. „Scheiße!“
Doktor Smollenko drückte sie kurz an sich, danach zog er seine Arme wieder zurück. „Hört ihr? Für euer Alter habt ihr euch gut gehalten. Das hier ist wirklich kein schöner Anblick. Wenn ihr könnt und Zeit habt, fahrt etwas durch die Gegend und schnappt frische Luft. Ich danke euch für eure Einsatzbereitschaft. Ich brauche euch hier nicht länger. Ihr könnt nach Hause fahren.“
Mathias und Ali verabschiedeten sich. Sie waren froh, diesen Ort des Grauens verlassen zu dürfen, und dankten Doktor Smollenko für sein Verständnis und sein Mitgefühl.
Als sie das Treppenhaus betraten, lief aus der angrenzenden Wohnung ein Mann heraus. Panisch warf er die Tür ins Schloss und rannte zur Treppe. Pflichtbewusst rief ihm Mathias hinterher: „Hallo, Sie, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Kann ich ihnen helfen?“
Der Mann drehte sich zu ihm um, sah ihn mit irren Augen an und antwortete nicht. Plötzlich lief er die Treppe herunter und stöhnte laut auf. Mathias sah auf das Namensschild neben dem Klingelknopf. Toni Kaus stand darauf.
„Komischer Kauz, aber das passt ins Bild dieses Hauses“, dachte Mathias.
*****
„Mann, Erwin, ist das Schiff schön geworden. Jetzt wo du die Segel daran befestigt hast, sieht es super aus. Ob du mir auch mal ein Schiff basteln könntest? Ich bezahle dir das natürlich.“ Gustav Holz besuchte Erwin Fischer auch heute wieder in der kleinen Werkstatt. Der Modellschiffbauer bemerkte die Begeisterung seines Nachbarn und Freundes.
„Du brauchst mir nur das Material zu bezahlen, denn ansonsten wäre es natürlich fast unbezahlbar. Ich sitze doch viele Stunden daran. Die kann ich dir unmöglich in Rechnung stellen. Klar Gustav, ich kann dir ein Schiff bauen, aber du musst viel Geduld haben. Das kann schon einige Monate dauern. Legst du Wert auf ein bestimmtes Schiff oder ist dir das egal?“
„Ich weiß es nicht, so ein Schönes wie dieses vielleicht.“ Gustav Holz stand immer noch vor dem Modell der „Mir“ und bestaunte es von allen Seiten. Er ging um die Werkbank herum, und bewunderte ehrfürchtig alle Details des kleinen Segelschiffes.
„Ich habe so viele Schiffe und weiß langsam nicht mehr, wohin mit ihnen“, dachte Erwin Fischer. „Willst du dieses Schiff haben? Dann brauchst du nicht so lange zu warten und kannst es dir gleich mitnehmen. Ich schenke es dir.“
„Nein, das kann ich nicht annehmen, du hast es für dich gebaut, willst es doch immer wieder einmal ansehen.“
„Quatsch, Gustav, das kann ich mir bei dir auch ansehen. Nimm es mit, damit machst du mir eine Freude. Ich weiß, bei dir ist das Schiff in guten Händen.“
Gustav Holz stand in Erwin Fischers Werkstatt wie vom Blitz getroffen. Tränen der Rührung standen ihm plötzlich in den Augen. Dagegen konnte er nichts tun. „Mann, Erwin, so ein tolles Geschenk willst du mir machen? Da fällt doch mein Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag. Aber dafür werde ich dir eine schöne Flasche Whisky kaufen. Das werde ich auf jeden Fall tun, gleich morgen, Erwin!“
„Nun ist es doch gut, beruhige dich mal wieder.“ Einerseits freute sich Erwin Fischer über die Anerkennung, die sein Freund ihm zollte. Vor allem freute es ihn, dass er ihm mit dem Modell seiner „Mir“ solch eine große Freude bereitete. Aber sein Gefühlsausbruch war ihm irgendwie peinlich. Deshalb änderte er schnell das Thema. „Sag mal, Gustav, hast du das gestern auch mitbekommen? Der Jäger aus der neunten Etage hat sich mit seinem Jagdgewehr selbst das Hirn weggeblasen. Es soll sogar an der Wand hinter ihm runtergerutscht sein!“
„Ja, ich habe den Notarzt gesehen. Den kenne ich, er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Aber warum muss so etwas immer in der neunten Etage passieren?“
„Ich muss so etwas nicht auf unserer Etage haben, Gott bewahre! Aber weißt du was, Gustav, ich glaube, das geht schon wieder so los wie im letzten Jahr. Ich sage dir, das geht nicht mit rechten Dingen zu.“
„Du meinst…“, Gustav Holz verstummte. Wenn er daran dachte, was vor einem Jahr geschah, fühlte er sich in seiner Haut nicht mehr wohl.
Erwin Fischer sah ihn an und wartete darauf, dass er weitersprach. Aber Gustav Holz schwieg. Schließlich sagte Erwin Fischer: „Ja, Gustav, das Monster ist wieder da, es wird noch mehr Tote geben.“
*****
„Töte dich, Mann, dein Leben ist doch ohnehin nichts mehr wert.“
Toni Kaus hörte schon wieder diese verdammten Stimmen. Er konnte nicht schlafen, weil sie ihn schon seit einer Stunde belästigten. Ständig forderten sie seinen sofortigen Tod. Aber Toni Kaus wollte nicht sterben. „Seid doch endlich still! Ich kann nicht mehr, ich muss schlafen!“