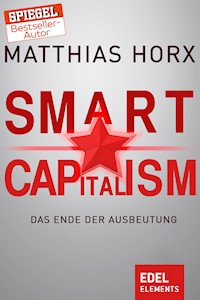15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf dem Weg in ein menschliches Morgen
Als Chronist und Wanderer zwischen den Welten von Politik, Business und Publizistik legt Matthias Horx in seinem neuen Buch eine außergewöhnliche Lebens- und Arbeitsbilanz vor: Von der Mondlandung bis in die Jetztzeit, die von Pandemien, Krieg und Polarisierungen geprägt ist, in dem die Welt rückwärts zu laufen und Zukunft undenkbar zu sein scheint.
Auf dieser Reise überprüft Matthias Horx seine Prämissen und fragt sich, welche Kräfte und Dynamiken den Zukunftsprozess steuern. Kehrt das Böse und Schlechte immer wieder? Gibt es überhaupt Fortschritt? Ist die menschliche Zivilisation zum Scheitern verurteilt? Und er prägt einen neuen Humanistischen Futurismus, der sich an die Seite des homo prospectus, des nach vorne schauenden Menschen stellt. Zukunft wird als geistige Dimension interpretiert, die zum Wesen des Menschen gehört. Dieser kann zwar irren und zweifeln, aber gerade daraus entwickeln sich jene erstaunlichen evolutionären Fähigkeiten, die unsere Spezies in die Zukunft bringt. Ein Must-read für alle Zukunftsoptimisten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Als Chronist und Wanderer zwischen den Welten von Politik, Business und Publizistik legt Matthias Horx in seinem neuen Buch eine außergewöhnliche Lebens- und Arbeitsbilanz vor: Von der Mondlandung bis in die Jetztzeit, die von Pandemien, Krieg und Polarisierungen geprägt ist, in dem die Welt rückwärtszulaufen und Zukunft undenkbar zu sein scheint.
Auf dieser Reise überprüft Matthias Horx seine Prämissen und fragt sich, welche Kräfte und Dynamiken den Zukunftsprozess steuern. Kehrt das Böse und Schlechte immer wieder? Gibt es überhaupt Fortschritt? Ist die menschliche Zivilisation zum Scheitern verurteilt? Und er prägt einen neuen »humanistischen Futurismus«, der sich an die Seite des Homo prospectus, des nach vorn schauenden Menschen stellt. Zukunft wird als geistige Dimension interpretiert, die zum Wesen des Menschen gehört. Dieser kann zwar irren und zweifeln, aber gerade daraus entwickeln sich jene erstaunlichen evolutionären Fähigkeiten, die unsere Spezies in die Zukunft bringen. Ein Must-read für alle Zukunftsoptimisten!
Autor
Schon als technikbegeisterter Junge in den Sechzigerjahren interessierte sich Matthias Horx für die Geheimnisse der Zukunft. Nach einer Laufbahn als Journalist und Publizist entwickelte er sich zum einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen Raums. Er veröffentlichte mehr als zwanzig Bücher, von denen einige zu Bestsellern wurden. Er gründete Deutschlands wichtigsten futuristischen Think-Tank, das Zukunftsinstitut mit Hauptsitz in Frankfurt und Wien. Als leidenschaftlicher Europäer pendelt er zwischen London, Frankfurt und Wien, wo er seit 2010 mit seiner Familie das Future Evolution House bewohnt.
MATTHIASHORX
DER
ZAUBER
DER
ZUKUNFT
WIEWIRDIEWELTVERÄNDERN
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
In diesem Buch wird nicht gegendert, aber alle Geschlechter sind herzlich willkommen.
Bei einigen Personen wurden die Namen und Details aufgrund von Persönlichkeitsrechten geändert.
Originalausgabe September 2024
Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
EB ∙ CF
ISBN 978-3-641-31561-0V001
www.goldmann-verlag.de
Für meine wunderbare Familie, die mich durchs Leben leitet und mir Zukunfts-Sinn gibt
Inhalt
Was bedeutet eigentlich Zukunft?
Entree
Das Kindchenschema der Zukunft
1 Zukunftserwachen
Wie die Zukunft in mein Leben kam – oder die dunkle Seite des Mondes (1960–1972)
2 Die wilden Jahre
Wie wir in den rebellischen Zeiten alles wollten und tatsächlich vieles bekamen (1973–1990)
3 Die TREND-Jahre
Wie wir mit dem magischen Wort TREND die Wirtschaft aufmischten und die Zukunft immer wieder aus den Händen glitt, kaum hatten wir sie festgehalten (die Millennium-Jahre)
4 Homo futuris
Wie die Evolution uns Menschen zu Vorhersagern und Vorausmachern formte – und was das für unsere Zukunft bedeutet (minus vier Millionen Jahre bis tendenziell unendlich)
5 Warum die Welt nicht untergeht
Wie uns die Apokalypse auf paradoxe Weise in den Bann zieht, es aber selbst mit dem Weltuntergang am Ende nicht klappen wird (die apokalyptische Dimension)
6 Die Technodizee
Wie Technologie zur neuen Religion wurde – und warum künstliche Intelligenz womöglich ein Pellkartoffel-Irrtum ist (die technische Dimension)
7 Zurück zu den Sternen
Warum der Exodus ins Weltall eine fantastische Zukunftsidee ist, aber am Ende ganz anders verlaufen wird, als wir uns das vorstellen (die kosmische Dimension)
8 Mind:Shift oder die Zukunfts-Religion
Wie wir auf dem Weg in die Zukunft eine Schleife in die Innenwelt drehen und einen neuen Pfad der Weisheit finden können (die mentale Dimension)
9Die Omnikrise oder das Ende des alten Normal
Wie eine multiple Krise uns in tiefe Verwirrung stieß und wir gerade dadurch das Wesen des Wandels erkennen können (2020 bis unbestimmt)
10 Future Contact
Wie eine gigantische Uhr in den texanischen Bergen ein neues Zeitalter der Zukunftserkenntnis einleitet (02025–22025)
11 Nachklang
Let’s Boldly Go
12 Was ist humanistischer Futurismus?
Anmerkungen
Literatur
Danksagung
An die Zukunfts-Universalisten
Was bedeutet eigentlich Zukunft?
Wie beschreibt man sie? Fast mein ganzes Leben lang habe ich darüber nachgedacht. Ist »die Zukunft« eine längst fixierte Welt, die wir mit prophetischer Kraft oder guten Daten »vorhersagen« können? Ein Raum, den wir betreten können wie ein Hotelzimmer? Ist die Zukunft nur eine fixe Idee in unserem Kopf, eine Traumblase, die sich ins nichts auflöst, sobald wir ihr näher kommen? Oder ist es andersherum, wie heute so viele Menschen glauben: Die Zukunft kommt pfeifend, rasend auf uns zu, wie eine Lokomotive, sodass wir uns nur an die nasse Wand des Tunnels drängen oder in den Abgrund stürzen können? Ist sie ein Fluss, in den wir springen und davontreiben? Ein Traum, der uns leitet? Eine naive Illusion? Eine überzählige Variante der Realität?
Wie wirkt Zukunft? In uns selbst, und in der Welt?
Eine andere Frage, die mich lebenslang beschäftigt: Wie entsteht Wandel? Was unterscheidet Wandel von Veränderung, und wie gehört beides zusammen? Verändern tut sich ja ständig etwas, rasend schnell in unserer modernen Welt, aber wandelt sich auch etwas? Daran herrschen heute große Zweifel. Alles scheint sich im Kreis zu drehen, nichts scheint sich mehr nach vorn, in irgendeinen wahren Fortschritt zu entwickeln. Wie also verwandeln sich Menschen, Systeme, Gesellschaften? Durch »dringende Kräfte« wie Megatrends oder ökonomische Gesetze? Durch Technologie, die alles überrennt und auf den Kopf stellt? Durch Krisen und Katastrophen?
Was treibt die Welt voran?
Wie wird aus der Raupe ein Schmetterling?
In diesem Buch habe ich versucht, die Wandel-Zeiten zu skizzieren, die wir, die Boomer, in unserem Leben in – aus heutiger Sicht – friedlichen und zukunftsfreudigen Zeiten durchlebten. Der magische Beginn, der große Aufbruch, das große Voran. Bis in unsere heutige Zeit, den großen Zeitenbruch, die Omnikrise, in der die Zukunft hinter dem Horizont zu verschwinden scheint. Es handelt sich um eine Expedition auf der Suche nach der wahren Zukunft. Auf dieser Reise möchte ich Sie gerne – wie heißt das so schön? – mitnehmen. Das geht nur, wenn Sie sich einlassen. Wenn Sie das Neue suchen, aber nicht auf falsche Weise neugierig sind. Neu-Gier, mit Bindestrich geschrieben, führt uns nämlich in die falsche Gier, was die Zukunft betrifft. Wir lassen uns dann von Ängsten oder Illusionen oder falschen Versprechungen in den Irrtum führen.
Dieses Buch ist auch ein Buch über den Irrtum.
Und was wir mit ihm anfangen können.
Nein, die Zukunft kommt nicht auf uns zu. Die Zukunft beginnt, wenn wir uns selbst verwandeln. Wenn wir in den Spiegel der Welt schauen, und uns in ihr neu erkennen. Wenn wir andere werden, in neuen Perspektiven.
Seid ihr bereit?
Dann lasst uns aufbrechen.
Entree
Das Kindchenschema der Zukunft
Als ich zehn oder zwölf Jahre alt war, wusste ich genau, wie die Zukunft aussehen würde. Alle tragen diese glitzernden Raumanzüge, auch auf der Erde. Männer rauchen meistens Pfeife und haben ein kantiges Kinn. Alle sind sehr fröhlich, das gehört wohl zur Zukunft. Autos fahren auf zehnspurigen Autobahnen, und fröhliche Papis mit Hut steigen, von der Arbeit kommend, aus Atomautos und umarmen wespentaillierte Muttis vor futuristisch runden Bungalows.
Ich sammelte in diesem Alter diese wunderbaren bunten Zukunftssammelbilder, die es für 50 Pfennig in jedem Zeitschriftenkiosk in Kombination mit süßen Kaugummis gab, die »amerikanisch« schmeckten, eingepackt in silbriges, knisterndes Weltraumzellophan. Oder die sich – Überraschung! – in den Packungen von Birkel-Nudeln oder Haferflocken fanden. Wir aßen bei uns zu Hause viele Nudeln und viele Haferflocken, denn das war gesund. Die Bilderserien hießen »Wunder der Zukunft«: »Mit dem Atomflugzeug um die Welt!« – »Spannendes Leben unter Wasser!« – »Mit dem Super-Raketenrucksack in den Urlaub fliegen!« Da waren sie, die schlanken weißen Raketen, die in der Abenddämmerung vor Horizonten mit drei bunten Monden standen. Die in den Himmel ragenden Wolkenkratzer, umschwirrt von Flugautos. Es gab Bilder, auf denen gezeigt wurde, wie man mit dem Raketenboot Verbrecher jagt. Oder im Weltraum Boogie-Woogie tanzt.
Future Country war jenes Land, in dem es all das nicht mehr geben würde, was einen in der Gegenwart bedrängte. Schlechte Noten, böse Buben aus der Nachbarklasse, die einem Prügel androhten, Albträume auf Klassenfahrten, Peinlichkeiten beim ersten Kuss. Oder traurige Verwandte, die zu Besuch kamen, um ihr Unglück zu verbreiten. Und einem ständig am Hemdkragen herumfummelten.
Die Zukunft war magisch. Wundervoll. Auf die Zukunft war Verlass. Sie würde groß und schön und bunt sein, es würde keine Kriege geben, dafür ständig spannende Weltraummissionen. Niemand würde an Krebs sterben wie Tante Erna. Es würde überhaupt niemand mehr sterben. Alles wäre sehr bequem. Ich würde über einen Hausaufgabenroboter, einen Aufräumroboter und einen Spielroboter verfügen, der ständig mit mir spielen würde, wenn die Eltern keine Zeit hatten. Monopoly vor allem, aber auch Mensch ärgere Dich nicht.
In der Zukunft würde man sogar das Wetter machen. So wie es einem passte. Auf einem meiner Sammelbilder standen zwei Männer in Arbeitsoveralls auf einem Lastwagen und bliesen mit einer Maschine lässig etwas in die Luft, was wie Schaum oder Schneekristalle aussah. Der Himmel war blutrot; es würde demnächst regnen.1
Diese Zukunft meiner Kindheit hatte einen spezifischen Geruch, an dem man sie mit geschlossenen Augen erkennen konnte. Sie roch nach Plastik, Öl, Metall und Styropor, das den Geschenkpaketen entströmte, die jedes Jahr unter dem Weihnachtsbaum lagen. Die Geschenke wurden jedes Jahr ein wenig größer, teurer, sensationeller. Daran erkannte man, dass die Zukunft bereit war einzutreten. Sie trat jedes Weihnachten, jeden Geburtstag etwas mehr ein. Die fernsteuerbaren Spielzeugautos, die Carrera-Autobahnen mit den schnellen Flitzern. Und dann, später, die schwarze Stereoanlage mit den wunderbaren Leuchtdioden, zweimal 60 Watt, die man schließlich den Eltern abtrotzte, zur Konfirmation. Aus ihr roch es regelrecht heraus nach Zukunft, nach Verheißungen ungeheurer Art.
1
ZUKUNFTSERWACHEN
Wie die Zukunft in mein Leben kam – oder die dunkle Seite des Mondes (1960–1972)
Also gut: Ich bin ein Boomer.
Geboren zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, im Beginn des Wohlstandswunders. Zusammen mit sehr vielen anderen – meine Alterskohorte war die zahlreichste nach dem Krieg. In meiner Erinnerung habe ich kaum noch Ruinen erlebt. Außer einer Restruine in unserem Hinterhof, in der wir als Kinder »Trümmerbomben« spielten. Wir warfen zu Schlingen verknotete Seile hinein und zerrten zersplitterte Balken aus den Trümmern, die krachend zu Boden fielen. Superspaß.
Als Kind der Sechzigerjahre bin ich von Fernsehformaten geprägt, in denen die Welt auf ganz besondere Weise in Ordnung war. So gab es eine Quizsendung, die ich als Zehnjähriger manchmal bei den Nachbarn anschauen durfte (wir selbst hatten noch keinen Fernseher; der machte angeblich »die Augen eckig« und schlechte Schulnoten). Wir saßen also bei den Nachbarn auf einem alten, staubigen Sofa in einer Wohnung, die nach Kohl roch, während auf dem damals noch eher runden Schwarz-Weiß-Bildschirm ein freundlicher älterer Herr als Showmaster auftrat. Er repräsentierte jene Art von Onkel, die immer Geschenke mitbrachten. Er hantierte mit Sparschweinen, in die er Fünfmarkstücke hineinwarf, wobei sie heftig klingelten.
Der Klingelton der Zeit.
Robert Lembke war der Sohn eines jüdischen Modehändlers, ein liberaler Journalist und Freund Erich Kästners, der den Krieg mit letzter Not in einem Versteck in Süddeutschland überstanden hatte. Er strahlte eine tiefe Gelassenheit aus, eine Gewissheit, dass alles gut werden wird. In Was bin ich? Das heitere Beruferaten musste eine Jury, die sich aus seltsamen Leuten zusammensetzte (ein Oberstaatsanwalt mit Glatze und Schnurrbart, eine Fernsehansagerin, eine Schauspielerin, ein »Unterhaltungschef«), den Beruf eines Gastes erraten. Nach einer Geste, die den Beruf beschreiben sollte. Mit reinen Ja-/Nein-Fragen:
»Sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt?«»Könnte auch ich zu Ihnen kommen?«»Können Sie diesen Dienst an mir vollbringen?«»Machen Sie Menschen glücklich/zufrieden?«Mit jedem Nein wanderte ein Fünfmarkstück ins Sparschwein. Bei zehn Fünfmarkstücken war Schluss. Dann enttarnte sich der Gast selbst, wenn die Jury es nicht geschafft hatte. »Ich bin ein Grubenarbeiter.« – »Ich bin ein Ingenieur.« – »Ich bin eine Krankenschwester.«
Einer der letzten Gäste in Was bin ich? – bevor sich das Quiz wie so viele magische Sendungen unserer Jugend vom Bildschirm verabschiedete oder mit einem anderen Moderator nur noch fade wurde – war ein riesenschnauzbärtiger Liebesbriefschreiber (man spreche laut das Wort »riesenschnauzbärtiger Liebesbriefschreiber« aus!). Als typische Handlung seines Berufs faltete er einen imaginären Brief und steckte ihn in einen ebenso imaginären Briefumschlag. Am Ende der Sendung erzählte er in kargen Worten, wie er die »Gefühle der Damen zu Papier« brachte.
Wäre so etwas heute überhaupt noch erlaubt?
Oder möglich?
Ich habe mich in meinem späteren Leben manchmal gefragt, welche Geste ich vorführen würde, wenn ich in einer Zeitschleife zu Robert Lembke in die Sendung eingeladen würde, um meinen Beruf als Zukunftsforscher erraten zu lassen.
Hätte ich ein imaginäres Fernrohr vors Auge gehalten?
Oder eine weit ausholende Zeigegeste gemacht und dann die Arme ausgebreitet: Da, der Horizont!
Alles peinlich. Alles dumm.
Ich übe immer noch.
Mit dem Liebesbriefschreiber fühle ich mich bis heute tief verbunden. Was für ein fantastischer Beruf! Gleichzeitig tut er mir leid. Das KI-Programm ChatGPT kann innerhalb von 4,3 Sekunden 2000 Liebesbriefe schreiben. Ganz individualisiert an 2000 Damen. Oder sagen wir »Personen«. Ich stelle mir vor, wie ich dem Liebesbriefschreiber meinen Laptop zeige mit den in Millisekunden erscheinenden Liebesbriefen.
Er winkt nur ab, traurig, und verschwindet wie ein geisterhafter Schatten hinter den Kulissen. Sein fantastischer Backenbart zittert ein wenig nach.
Die dunkle Seite des Mondes
Zu Weihnachten 1967 schenken mir meine Großeltern ein astronomisches Teleskop. Einen 300-mm-Spiel-Refraktor aus dem Neckermann-Katalog. Ein Riesenrohr auf einem dreibeinigen Holzständer, das mich um Kopflänge überragt.
Ich erinnere mich, wie ich zu Silvester mit meinem Fernrohr im Garten unseres Hauses am Stadtrand stehe. Es ist eiskalt und mit klammen Fingern versuche ich den Jupiter einzufangen. Drinnen läuft die Silvesterfeier meiner Familie, man hört »La Paloma«-Gesang und irgendwas mit Käse-Polonaise. Alle haben komische Hüte auf und bombardieren sich mit Konfetti.
Irgendwann gerät Jupiter mit seinen vier größten Monden – Io, Europa, Kallisto, Ganymed – in mein Okular. Es ist nur eine winzige blasse Scheibe, die mir sofort wieder entkommt und dabei zittert. Bei 400-facher Vergrößerung rast der Planet förmlich durch den Bildausschnitt, jede kleinste Bewegung, jeder Fußtritt wird verstärkt. Verzweifelt drehe ich an den Führungsschrauben, aber ich komme nicht hinterher.
Dann lieber der Mond. Das ist einfacher. Die Krater sind riesig.
Was wohl auf der Rückseite des Mondes ist?
Ein seltsamer Schwindel befällt mich. Eine abgrundtiefe Einsamkeit. In diesem riesigen Universum, in den Milliarden Jahren, die vor uns liegen, werde ich nur einen winzigen Moment erleben. Einen Wimpernschlag. Ich fühle mich gefangen in einem mikroskopischen Zeitspalt. Ich werde tot sein, bevor ich auch nur einen Hauch von Ahnung davon habe, was das alles zu bedeuten hat.
»Eingebettet in ein Weltall ohnegleichen (…) fand ich mich selbst auf einmal in einem unfassbaren Staunen wieder«, so heißt es in der Biografie von Werner Herzog.2
Ich gehe zurück ins Haus. Es ist eng in unserer Mietwohnung. Auf der Kommode stapeln sich die Mayonnaiseköstlichkeiten, Käseigel und Krabbencocktail. Es riecht nach Seife und Zigarrenrauch. Mir ist ein bisschen schlecht. Dann ist es plötzlich Mitternacht. Die Nachbarn kommen zum Begrüßen des neuen Jahres aus den Häusern und mein Vater zündet vor der Haustür Raketen, die in den Himmel zischen und die Sterne überdecken.
Das Rauschen des Alls
Juli 1969. Mein Vater hat vom Nachbarn einen kleinen orangefarbenen Schwarz-Weiß-Fernseher mit Zimmerantenne ausgeliehen, ein futuristisches Gerät im Stil des Sechzigerjahre-Popdesigns. Da steht er nun auf der Wohnzimmerkommode, der Zukunftsapparat, und zeigt ein unentwegt von oben nach unten durchlaufendes Bild, auf dem Schneegriesel und Moirémuster zu sehen sind. Fluchend dreht mein Vater immer wieder an den Knöpfen »Bilddurchlauf« und »Bildkorrektur«, worauf sich das Bild – Achtung, nicht bewegen, nicht anfassen! – einige Minuten stabilisiert. Dann geht die Rennerei von vorn los.
Unverständliche Stimmen. Murmeln aus dem All.
Spät in der Nacht, ich bin schon dreimal eingeschlafen, was ich auf keinen Fall zugeben will, schält sich aus dem Rauschen und Piepen und Knistern – Houston copy! – ein Bild heraus. Ein weißer Schatten fällt, taumelt, schwebt nach unten. Und dann der Satz von Neil Armstrong, der wie ein verschluckter Knödel klingt:
That’s – one – small – step – for – man – one – giant – leap – for mankind.
Ich verstehe irgendwas mit Mähen und Kaugummi.
Ein paar Jahre später wird über meinem Bett ein Plakat hängen, das einen großen blauen Planeten zeigt. Das erste hochauflösende Bild der Erde aus dem Weltraum, aufgenommen von der Besatzung von Apollo 17, der letzten Mondmission. Es heißt »The Blue Marble«. Die blaue Murmel erschien in den späten Sechzigerjahren auf vielen Titelbildern von Zeitschriften, in vielen Weltraumgeschichten und kosmischen Betrachtungen. Das Bild war so etwas wie die Ikone einer Zeit, in der wir die Welt mit neuen Augen zu sehen begannen.
Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag packe ich mein Teleskop zusammen und verstaue es im Keller. Ein anderer Sound liegt jetzt in der Luft, ein Klang von Aufruhr und Revolte, von harten Gitarrenriffs und aufgeregten Partys, in denen etwas passiert. Wir sind zurück auf der Erde. Statt des Weltraums interessiert mich Politik. Statt über das Unermessliche will ich jetzt etwas über das Unfassbare wissen. Die Ursache jener seltsamen Verklemmung, die in meiner ganzen Jugend über dem Küchentisch und den Sofas im Wohnzimmer lag wie ein schrecklicher Nebel. Ein Gefühl von Verlorenheit, das mich mit vielen aus meiner Generation verband.
2
DIE WILDEN JAHRE
Wie wir in den rebellischen Zeiten alles wollten und tatsächlich vieles bekamen (1973–1990)
Ich bin ein Boomer, Okay. Allerdings ein Boomer der speziellen Sorte.
Am Morgen nach meinem achtzehnten Geburtstag zog ich aus der elterlichen Wohnung aus, mitten hinein in das Univiertel der Großstadt. Vier Umzugskartons, die Bücherkisten, die mattschwarze Stereoanlage, meine Kinderzimmermatratze. Alles passte in den VW Käfer eines Freundes, der schon einen Führerschein hatte. Ich zog direkt in eine studentische WG, zwei Männer, zwei Frauen, dazu zwei rheumatische Kater. Vierter Stock in einem unrenovierten Mietshaus, in dessen Treppenhaus es nach Schimmel und Bohnerwachs roch. Die Miete war günstig und aus den Boxen dröhnte der Sound des Großen Aufbruchs.
Es begannen die wilden Jahre. Die wunderbaren Sponti-Jahre.
Die Zukunft war JETZT. Eine ungeheure Energie lag in der Luft. Die Energie von Aufruhr und Musik. Von Rebellion und Veränderung. Von alles wird anders, und zwar sofort!
Rebellische Rituale
Unser wöchentliches Ritual war die Demo. Sie fand so ziemlich jeden Samstagvormittag statt, und es war nicht ganz so wichtig, worum es eigentlich ging – Weltrevolution, Fahrpreiserhöhung, Umweltsauerei, Vietnam oder Aufstand in Nicaragua.
In den ersten Reihen marschierten die »Genossen«, die Traditionslinken, mit ihren sauber auf Spruchbänder gemalten Forderungsparolen. Irgendwas mit WEGMIT oder NIEDERMIT! – Imperialismus. Kapitalismus. Unterdrückung. Repression. Dahinter die Blöcke der verschiedenen marxistischen Gruppen in sauberen Zehnerreihen. Anfang der Siebziger gab es an meiner Universität mindestens zwanzig stramme Kaderorganisationen, kommunistische Sekten wie KPD, KBW, DKP, KPD/ML/, Trotzkisten in vier Varianten, Aufbau-ML, ML/XX …
Wir amüsierten uns etwas über die Kürzel und die strengen Genossen in Lederjacken und Kurzhaarschnitt, die jeden Abend mit abgewetzten Lederaktentaschen in die Marx-Schulung trotteten. Dabei erinnerten sie uns irgendwie an unsere Väter auf dem Weg ins Büro.
Mit einigem Abstand folgten wir. Der Schwarm. Die Langhaarigen. Die Antiautoritären. Die Undogmatischen. Die »Chaoten«, wie uns damals auch die Kommunisten nannten, deren Angebote einer durchkontrollierten Gesellschaft uns eher unattraktiv erschienen.
Wir, das waren die Träumer, Tänzer und Therapiebedürftigen. Die Zauberer und Zauberinnen mit den Trommeln und der »Indianerbemalung«. Meistens hatten wir Kinder dabei, auf der Schulter oder in Bollerwagen mit fröhlichen Blumenklecksen, dazu Clowns mit Ziehharmonika und Einrad. Wir hatten den größten Block, der allerdings immer etwas unordentlich ausfranste in die Nebenstraßen hinein, in die Parks und Cafés.
Wir zogen vorbei an den Spießern auf den Balkonen, mit der Aufforderung herunterzukommen und sich einzureihen. Manchmal brüllten sie etwas. »Geht nach Drüben!« Oder: »Früher hätte man euch ins Arbeitslager gesteckt!« Oder noch Schlimmeres. Etwas mit »KZ« oder »Vergasen«.
Wir waren die Spontis. Ein loser Haufen von Sehnsüchtigen. Eine Art Stamm mit wechselnden Häuptlingen. Eine Szene, wie wir das nannten. Wer bei diesem Wir dabei war und wer nicht, das war nie so ganz klar. Es gab keine Mitgliedsbeiträge, und wer dazugehören wollte, gehörte eben dazu. Was uns verband, war eine Art romantischer Rebellismus. Und eine Art von Notwehr, die wir aber erst in unserem späteren Leben verstehen würden.
Manchmal skandierten wir auf der Demo eine Art ironischen Rap zum Rhythmus der Reggae-Musik, die aus den Boxen unseres Lautsprecherwagens dröhnte:
Nieder mit!
Kampf dem!
Hoch der!
Weg damit!
Vor-wääärts, es leeeebe!«
Bei »Vor-wääärts, es leeeebe!« streckten wir unsere Arme nach oben. Fielen uns um den Hals. Schleuderten uns und die Kinder herum.
Großer Spaß. Entgrenzte Heiterkeit.
Und dann wieder: rebellische Rockmusik aus den Boxen, volle Kanne.
Es war eine gute Zeit, um jung und rebellisch zu sein. Man konnte sich eine Gitarre nehmen, Töne darauf produzieren und die Frauen faszinieren. Die Gesellschaft war in Bewegung. Plötzlich trugen alle Fußballstars lange Haare. Der Nachbar meiner Eltern fing an zu kiffen. Rund um den Planeten brachen »die Verhältnisse« auf. Und über allem lag der tosende Sound der Ära, der energetische Gefühlsteppich der Rock- und Popmusik. Einer Musik, die unsere Väter und Mütter noch vor Kurzem als »Lärm« bezeichnet hatten. Ruhe da hinten!
I can’t get no satisfaction!
All you need is love.
Frank Zappas himmlische Gitarrenriffs.
Und die Doors spielten: We want the world and we want it NOW!
Wir wollten die Verhältnisse zum Tanzen bringen.
Und das taten wir auch, verdammt. Und wie.
Unser Glück oder vielleicht auch unsere Fähigkeit war, dass wir ziemlich früh die Gefahr des heroischen Dogmatismus erkannten. Wir erlebten ziemlich bald, wie Befreiungsbewegungen über Nacht zu neuen Tyranneien werden konnten. Unser Codewort war nicht Revolution – obwohl wir uns durchaus als Umstürzler fühlten. »Revolution« war uns irgendwie zu groß, zu empathisch, zu – machtorientiert. Unser Codewort für den Eintritt in die Zukunft lautete Emanzipation.Emanzipation hieß, sich frei machen von der Abhängigkeit. Der Enge. Aufzubrechen. Weg vom Stumpfsinn von Fabrikarbeit und Büro, des Konsums. Den Weg ins Freie finden. Zu sich selbst. Was uns trieb, war die Sehnsucht nach einem »anderen Leben«. Wie immer das aussehen sollte.
Wir hatten eine Utopie, an der wir später immer wieder scheitern mussten: das solidarische Kollektiv, in dem wir uns entfalten konnten.
Das Sponti-Mem
Im November 1973, mein Soziologie- und Pädagogikstudium fing gerade an, machten wir eine Sponti-Aktion mitten auf einem Autobahnkreuz. Eine kleine Gruppe von drei, vier Wohngemeinschaften, bewaffnet mit Querflöten, Gitarren und einer großen Decke, ein Love-in. Es war das Sonntagsfahrverbot. »Die Araber« hatten, wie es damals so schön hieß, »den Ölhahn zugedreht«.
Wir fanden das eine gute Idee.
Sofort kamen die Journalisten mit ihren großen klickenden Kameras.
Was uns vor allzu viel Blödheit, aber auch Selbstüberschätzung rettete, war der Humor.
Mit der Sponti-Ironie verteidigten wir unsere Seele gegen die irrlichternden Dogmatiken der damaligen Zeit. Es kursierte natürlich jede Menge Blödsinn, ideologischer wie persönlicher Art. Jeder lief mit irgendeiner mehr oder minder verquasten Parole oder Theorie herum, die die ganze Welt erklärte. Einer steilen These die irgendjemand verantwortlich machte für alles. Fußpilz, Kapitalismus, Orgasmusschwierigkeiten. Immer steckte »das System« dahinter. Oder »die Gesellschaft« war schuld. Gegen diese frühe Verschwörungstendenz entwickelten wir eine eigene Sprache der ironischen Drehung. Sprüche, die wir an die Wände der großen Stadt malten.
Es ist verboten zu verbieten!
Keine Macht für Niemand!
Euch die Macht – uns die Nacht.
Egalité, Fraternité, Pfefferminztee!
Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche!
Besser arm dran als Arm ab!
Du hast keine Chance, aber nutze sie!
Wer nicht genießt, wird ungenießbar.
Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn!
Nonsens statt Konsens.
Wissen ist Macht. Wir wissen nichts. Macht nichts.
Und so weiter.
Einige meiner besten Freunde wurden später bekannte Kabarettisten. Noch heute erkenne ich schmerzhaft die Differenz eines klugen, in sich verdrehten heiligen Humors zum heute allgegenwärtigen Zynismus. Humoristische Dichter der wilden Jahre wie F. K. Waechter oder Robert Gernhardt waren Meister des Himmels, in dem sicher viel gelacht wurde, aber auch viel nachgedacht. Matthias Beltz, unser poetischer Lach-Guru, der 2002 viel zu früh an einem Herzinfarkt starb, dichtete die schönsten melancholischen Verse:
Parmesan und Partisan
Wo sind sie geblieben?
Partisan und Parmesan
Alles wird zerrieben!
Müssen wir immer tun, was wir wollen?
Mein erster Job als Pädagogikstudent war »Bezugsperson« in einem antiautoritären Kinderladen. Bei Robert Lembke hätte man diesen »Beruf« durch Clownsgrimassen visualisieren können. Die Jungen und Mädchen, eine laute Horde von sieben Wohngemeinschaftskindern im Alter von vier bis sieben, wollten immer, dass ich »Faxen mache«. Also das Gesicht verziehe in gruseligen Grimassen. Aber gerne doch!
»Müssen wir heute wieder tun, was wir wollen?«, fragten meine Kids immer wieder. Sie waren blond und wild und frech. Und immer süßigkeitenverschmiert. So sollte es sein. Und bleiben.
Viele Jahre später, als Journalist bei der Zeit in den späten Achtzigern, besuchte ich die erwachsen gewordenen Kinder aus meinem Kinderladen. Anfang zwanzig schienen sie von einer irritierenden Reife geprägt. Sehr ernst und nachdenklich. Über ihre antiautoritären Eltern sprachen sie in einer Mischung aus milder Vergebung und Ironie. Viele von ihnen wurden später Juristen. Alle »wurden« etwas.
Mein zweiter Job neben dem Studium war Redakteur bei einer legendären Alternativzeitschrift.
Die Frankfurter Sponti-Szene war ein kleiner Pressekonzern. Unzählige Flugblätter, Broschüren, Traktate wurden auf allen möglichen Kanälen produziert. Wir hatten unsere eigenen Druckereien, Setzereien, Vertriebssysteme. Eine der Sponti-Zeitschriften hieß Wir wollen alles. Eine andere Publikation Autonomie. Dort ging es um Indianerkulturen (sorry: indigene Lebensweisen), anarchistische Landkommunen und Fabrikbesetzungen in Italien. Ich wurde Redakteur des Pflasterstrand, ein Stadtmagazin, das sich erst »linksradikal« nannte und dann Zeitschrift für Rabatz und das wilde Leben.
Von Anfang an gab es dabei Missverständnisse. Romantischer Rebellismus erklärte sich nicht so leicht von selbst, vor allem nicht in seinem Verhältnis zur Gewalt. (Von der harten Straßengewalt distanzierte sich die Sponti-Szene schon 1975 nach einer Demonstration, bei der ein Polizist lebensgefährlich verletzt wurde.) Der Begriff »Pflasterstrand« stammte aus einer romantischen Parole der Pariser Mai-Revolte von 1968:
Sous les pavés, la plage.
Unter dem Pflaster liegt der Strand.
Der Pflasterstrand erschien alle vierzehn Tage und war so etwas wie ein gedrucktes Internet lange vor Erfindung des Internets. Wir diskutierten heiß und innig über alles: Politik, Alltag, Emanzipation, Gewalt, Vietnamkrieg, Imperialismus, Kolonialismus, Kochen, Umweltschutz, Spiritualität, Musik, Ernährung, Pädagogik, Feminismus. Über Liebe und Sex in allen Varianten, bis hin zur Frage, ob sexuelle Gewaltfantasien legitim seien und Frauen einen Orgasmus vortäuschen sollten. Der Pflasterstrand war tatsächlich eine Art frühes, analoges Internet. Wir lernten – zumindest über weite Strecken –, dass man die Dinge von verschiedenen Standpunkten aus sehen konnte. Und dass das produktiv war, wenn man es austrug. Und dass es Wirkung erzeugte.
Unsere Themen waren nicht selten schon am nächsten Tag nach Erscheinen von Pflasterstrand in den Zeitungen und die Woche drauf auf den Titelbildern der Meinungsmagazine.
Zu unserem Diskursstil gehörte auch der Versuch einer radikalen Selbstehrlichkeit. Zum Beispiel, als ich einmal schrieb: »Wenn ich in der Jugendzeit meines Vaters in seinem Alter gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch bei der SA oder bei der Jungschar gelandet. In einer autoritären Gesellschaft organisierten die Nazis eine Kultur des Abenteuers, die durchaus kollektive Züge trug.«
Die Pflasterstrand-Redaktion in den wilden Jahren. Hintere Reihe, Fünfter von rechts: Der Autor. Foto: Werner W. Wille
Ich kassierte den ersten Shitstorm. So was war damals noch handfester. Und harmloser zugleich. Man erhielt in den Szenekneipen die Androhung, eines auf die Fresse zu bekommen, wenn man solch einen faschistoiden Schwachsinn noch einmal schriebe. Ich ließ es dann eher sein.
Der große Aufbruch
Mitte der Siebzigerjahre zog es uns Richtung Europas Süden. Wir fuhren in den endlosen Semesterferien – Studentsein war damals eine Lebensform, keine Ausbildung – mit klapprigen Enten und rostigen VW-Bussen, deren Motoren wir noch selbst reparieren konnten (wenigstens einige von uns, die von der »Schrauberfraktion«), nach Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien. Dort, wo es warm und herzlich zuging und das Leben irgendwie noch nicht vom Konsumkapitalismus verseucht schien.
An den Stränden des Südens trafen sich die Langhaarigen. Wir blieben den ganzen Sommer und schauten in den Nachthimmel. Wir spielten Gitarre und kauften Bauernhausruinen mit geliehenem Geld unserer Eltern, die sich dann als vollkommen unreparierbar herausstellten. Befreundeten uns mit Luigi und Costas und Ella, den Nachbarn. Den wahren, den authentischen Menschen des Südens.
Im Sommer 1974 fuhr ich mit meinem Freund Maurice, der einen Vater hatte, dem »immer die Hand ausrutschte«, nach Barcelona, auf den Spuren der Anarchisten, die diese Stadt in der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs regiert hatten. Wir schliefen in Schlafsäcken im Park Güell und wurden bei Morgengrauen von der Guardia Civil verscheucht. Auf der langen Autofahrt sangen wir ein altes heroisches Lied des Kommunisten Ernst Busch, eine Hymne der Internationalen Brigaden, die an der Seite der spanischen Linken gegen den Faschismus gekämpft hatten. Wir sangen es ironisch. Aber auch sehr inbrünstig.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne
Über unsre Schützengräben aus.
Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne,
Bald geht es zu neuem Kampf hinaus.
Die Heimat ist weit,
Doch wir sind bereit.
Wir kämpfen und siegen
Für Dich: Freiheit!
Dem Faschisten werden wir nicht weichen,
Schickt er auch die Kugeln hageldicht.
Mit uns stehn Kameraden ohnegleichen,
Und ein Rückwärts gibt es für uns nicht (…)
Die Heimat ist weit
Doch wir sind bereit!
Wir kämpfen und sterben
Für Dich: Freiheit.
Das Lied hatte etwas Tieftrauriges, gerade weil es so heroisch war, verwies es doch auf die Vergeblichkeit. Wir lasen George Orwells 1984. Und lernten oder ahnten zumindest, in welcher Tragik die junge Generation Europas zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gefangen war – gerade einmal fünfzig Jahre vor unserer Zeit! In der in den Krieg und den Faschismus abrutschenden Welt der Dreißigerjahre hatte sie sicher ähnliche Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse entwickelt wie wir, die wir in die erste Wohlstandsgesellschaft der Welt hineingeboren waren. Aber sie hatte keine Chance gehabt auf die »bessere Welt«.
Farbenrevolutionen
Jetzt aber, in unserer jugendlichen Blüte, sahen wir die letzten Diktaturen Europas fallen. Im Jahr 1974 steckten wir mit schönen Hippiefrauen aus Hamburg und Rom und mit portugiesischen Arbeitern auf der Plaza de Mayo in Lissabon Nelken in Gewehrläufe von Soldaten, als der portugiesische Diktator Salazar abdankte. Die Diktatorentypen mit den schwarzen Sonnenbrillen verschwanden einer nach dem anderen von der Bildfläche. Franco, der spanische Diktator mit der schwarzen Sonnenbrille, starb im November 1975. Die Militärjunta in Griechenland dankte ab. Die harten, existenziellen Kämpfe verlagerten sich von Europa in die Peripherie der Welt, während wir mit unserer bunten Rebellion in die nächste Runde gingen.
Wir waren die Protagonisten dessen, was man heute eine Farbenrevolution nennen würde.
Unsere Fahne war nicht die rote Fahre. Auch nicht so sehr die schwarze Fahre der Anarchisten. Unser Banner war die Regenbogenfahne. Sie stand für die Idee der Vielfalt, die die Welt verändert.
Eine Farbenrevolution ist jene gesellschaftliche Transformation, in der die Gesellschaft in ihrer inneren Struktur umgekrempelt wird. Die Kultur wird vielfältig, different, offen für alle möglichen Lebensstile. Der alte autoritäre Umgangsstil, der noch unsere Elternhäuser und Schulen prägte, verschwindet zugunsten einer toleranten Vielfalt. Von Traditionen zu Vereinbarungen. Von Bindungen zu Ver-Bindungen. Von Mehrheiten zu Minderheiten. Von Pflicht zu Genuss. Von Zwängen zu Emanzipationen. Die alten Klassenverhältnisse lösen sich auf zugunsten mehrschichtiger Identitäten. Der US-amerikanische Zukunftsforscher Herman Kahn bezeichnete das Phänomen, das sich seit den späten Sechzigerjahren in den Industrienationen entfaltete, als »sensualistische Revolution«. Eine sinnliche Lebensart, ein allgemeiner Hedonismus, dem sich immer mehr auch die Mittelschichten anschlossen. Kahn sprach vom »langfristig komplexen Trend«, dem früher oder später alle Kulturen der Erde folgen würden. Anzeichen für diese Transformation sind »anwachsende sensualistische (empirische, diesseitige, humanistische, pragmatische, manipulierende, auf Verträgen beruhende, epikureische) Kulturkreise …«.3
Und wir waren mittendrin in diesem Tumult, aus dem die wahre, die reale Zukunft entsprang.
Die große Verstörung
Im Herbst des Jahres 1977 war die Leichtigkeit der Revolte plötzlich vorüber. Etwas Dunkles war plötzlich durch die Hintertür gekommen. Hatte die Tür unserer Sehnsucht nach einem anderen Leben einfach eingetreten. Aber das Dunkle kam nicht von außen. Es kam aus unserer rebellischen Gegenkultur selbst.
Wir alle stammten aus Familien, die um jeden Preis heil sein wollten. Das Heile, das Normale wurde von unserer Elterngeneration ständig behauptet, alles Störende verleugnet. Aber das machte es nur noch schlimmer. Denn nichts war normal. In jedem Elternhaus gab es einen Knacks. Ein Trauma. Ein dunkles Geheimnis. Eine Zerstörung, die mit dem Zivilisationsbruch zu tun hatte, den unsere Eltern und Großeltern nicht nur erlebt, sondern womöglich verursacht hatten. Sie hatten ihre Traumata geradewegs an uns durchgereicht. Und dort, im Untergrund unserer Träume, Ängste, Wünsche und Hoffnungen, gärte es weiter. Und gebar neue Dämonen.
1977 lebte ich in einer Groß-WG in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof im Studentenviertel unserer Großstadt. Wir hatten eine Lederwerkstatt im Haus, eine Autowerkstatt, in der Hannes, »Lolle« genannt, weil er meistens eine selbst gedrehte Kippe im Mund trug, meisterhaft VW Käfer reparierte (mit seinem verschmierten Blaumann wirkte er so wie die schwedische Comicfigur Pettersson). Wir waren zehn »Freaks« mit gemeinsamer Haushaltskasse und Kochdienst, der selten eingehalten wurde, aber wenn, wurde es ein schöner Abend. Als letztes Wohnmitglied kam Klaus dazu, ein ganz besonderer Typ.
Klaus zahlte pünktlich die Miete, machte brav seine Abwasch- und Kochdienste und hatte kurze Haare, was auffällig war. Im kleinsten Zimmer unter dem Dach hackte er den ganzen Tag auf eine alte Reiseschreibmaschine ein, mit einer Menge Durchschlägen (so nannte man damals analoge Kopien). Er schrieb, so sagte er, eine Examensarbeit, die ihn sehr stresse.
Im Sommer 1977 verschwand er. Dabei ließ er alle Möbel (alte dunkle Möbel, die von seinem früh verstorbenen Vater stammten) in seinem Zimmer zurück. Bald wurde klar, dass er auf den Fahndungslisten der RAF-Unterstützer stand.
Es begann die Zeit der Paranoia.
Der Morgen begann mit dem Gefühl, draußen im Treppenhaus die Stiefelschritte eines Einsatzkommandos der Polizei zu hören. Die RAF, die Rote Armee Fraktion, entführte Menschen in Kofferräumen. Sprengte Fahrer in die Luft. Tötete Vorstandsvorsitzende oder US-amerikanische Soldaten mit Genickschuss. Ihr »Führer« – so musste man das wohl nennen – war ein seelisch durchgeknallter Typ aus München, der seine Posen aus drittklassigen Italowestern bezog. Andreas Baader war ein gewalttätiger Narzisst, der auf unheimliche Weise Menschen in seinen Bann zog. Er war ein Heimkind gewesen, hatte sich in Münchens linker Szene den radikalen Jargon angeeignet. Er war »von einer habituellen Renitenz und kindlich-zynischen Ausnutzung, aufgewachsen in Gemeinschaft trauernder Frauen«, wie es in Gerd Koenens Baader-Ensslin-Buch heißt.4
Eine seiner Spezialitäten war das unflätigste Beschimpfen von Frauen im pseudorevolutionären Jargon: Du bist der letzte Dreck, du Fotze, mit deinem ewigen Geseiere über Angst statt Kampf …
Gudrun Ensslin, der dunkle weibliche Engel der RAF neben der depressiv-aggressiven Ulrike Meinhof, schrieb in einem Kassiber (einer geheimen Botschaft): »Der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden, und natürlich kann geschossen werden.«5
Schon damals war alles auf verquere Weise mit dem Palästina-Konflikt verknüpft. Und damit auch mit der deutschen Geschichte. Am 17. Oktober 1977, dem Höhepunkt des »Deutschen Herbstes«, in der Nacht, nachdem die Entführung eines Passagierjets durch ein palästinensisches Kommando auf dem Flughafen von Mogadischu beendet worden war, nahmen sich die vier Top-RAF-Leute (Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Irmgard Möller überlebte schwer verletzt) im Gefängnis Stammheim das Leben. Sie schossen sich mit ihren Kassiber-Pistolen von hinten in den Kopf. Damit es noch so aussah, als wären sie von der Staatsmacht ermordet worden.
Fake News, Lügen als Gewalt.
Kampf bis zuletzt.
Hass bis zum Ende.
Wahn statt Wandel.
Die Tragödie der RAF war eine Katastrophe, mit der wir sanften Rebellen nur schwer umgehen konnten. Sie riss alles auf, was wir verzweifelt zu heilen versuchten. Wir sahen, dass Rebellion auch eine dämonische Gestalt annehmen konnte. Dass eine dunkle Energie auch aus jenem Betroffenheitsmoralismus erwachsen kann, mit dem wir die Welt verändern wollten.
Die Landjahre
Nach dem Deutschen Herbst zerfielen unsere WGs. Und die alte Schlüsselfrage vom Beginn der Revolte wurde wieder laut:
Muss man sich erst selbst verändern?
Oder muss man erst das System verändern, damit eine bessere Welt entstehen kann?
Ende der Siebziger teilte sich die Szene in drei etwa gleich große Gruppen. Ein Teil ging in die große Nachholschleife: Examen, Heiraten, Kinder in die Welt setzen, vielleicht das Geschäft des Vaters übernehmen, einen »ordentlichen Beruf« annehmen.
Ein anderer Teil baute die Brückenköpfe der Alternativbewegung zu stabilen Inseln aus. In den großen Städten professionalisierte die Szene ihre Zeitungen, Kinos, Möbelläden, Cafés, die Buchhandlungen, Druckereien, Restaurants, Kindergärten, Müsli-Läden, Ledermanufakturen und Theaterwerkstätten. Autowerkstätten und Schreinereien. Es gab sogar glamouröse Varietés. Eine urbane Gegenwirtschaft entstand, die sich zunehmend etablierte und aus der schließlich jene »Kreative Klasse« (ein Begriff des US-amerikanischen Soziologen Richard Florida) entstehen sollte, die bis heute die Großstädte kulturell prägt.
Eine dritte Gruppe nenne ich die Tiefensucher. Die unruhigen Wanderer, die immer auf Achse und seelisch auf der Kippe blieben. Viele machten Drogenexperimente, hangelten sich von esoterischen zu magischen Therapien und wieder zurück. Gingen auf Weltreise und kamen – vielleicht – zurück. Einige landeten bei Hardcore-Psychosekten wie der AAO (Aktionsanalytische Organisation), die sich die Seele aus dem Leib brüllten, um »ihre faschistische Scheiße herauszubekommen«. Aber dabei immer tiefer hineingerieten in den Missbrauchssumpf einer einzelnen charismatischen Person. Die meisten der Tiefenwanderer in meinem Bekanntenkreis gingen als Sannyasin zu Bhagwan, dem indischen Guru. Sie landeten im Oregon-Projekt, wo ab 1981 eine Großkommune für 20 000 Anhänger entstand, ein spirituell-alternatives Megaprojekt, wie es bislang keines gegeben hatte. Und das, wie jede utopische Utopie, an sich selbst scheiterte.6
Ich selbst versuchte ein neues Leben auf dem Land. »Wir haben die Stadt satt«, schrieb ich 1978 im Pflasterstrand. »Der Lärm, der Dreck, die Entfremdung. Die Betonwelt verwirrt unsere Köpfe, unsere Seelen: Wir kommen nicht mehr zu uns selbst und zu dem, was wir eigentlich werden wollen. Menschen, die mit der Natur in Einklang leben, in einer neuen, hoffnungsvollen Beziehung.«
Anfang der Achtzigerjahre lebte ich mit Fred, dem Schreiner, Doris, der Gestalttherapeutin, und Rudolf, dem belesenen Bücherwurm, nicht zu vergessen Ferdinand, dem Schafsbock, und zwei Katzen in einem 250 Jahre alten Fachwerkhaus in einem deutschen Mittelgebirge. Wir renovierten das alte Haus (jeder nach seinen Fähigkeiten; meine handwerklichen waren fatal), kochten große Gelage mit Fleisch, das wir vorher als Tier gekannt und selbst geschlachtet hatten. Es war wieder eine intensive Zeit. Eine Zeit des Wandels und der Weltverwandlungen, in der wir eine Zeit lang unser kleines Glück in einer kleinen Gemeinschaft fanden.
Allerdings wurde diese Welt immer kleiner. Sie erstreckte sich immer mehr nur bis zur Dorfgrenze. Ich fuhr immer seltener in die Stadt. Die Welt drohte mit neuen Gefahren. Nachrüstung, Atomkraftwerke, der Kalte Krieg ging in eine neue Runde. Aber irgendwie war das plötzlich alles sehr weit weg.
Ich erinnere mich an Gartenarbeit in strömendem Regen, Schwielen an den Händen und in meinen quietschenden Gummistiefeln. An von Würmern zerfressene Kohlköpfe. Das Sauerkraut, das wir ansetzten, verschimmelte in den Tontöpfen, und die Schafe brachen aus und fraßen die Gladiolen des Nachbarn.
Wenn man zurückkehrte zur bäuerlichen Lebensweise, so lernte ich, geriet man schnell nicht ins Voran, sondern ins Abseits. Auch das Authentische, Ursprüngliche war nicht unbedingt die Zukunft. Es war eine Art Selbstversklavung. Aber wo lag sie dann, die Zukunft? In welcher Richtung?
Die Lifestyle-Jahre
Im Jahr 1986 bekam ich ein Angebot als Redakteur für die neu gegründete Zeitschrift Tempo. Das Hamburger Magazin wurde von einer Gruppe von sehr angesagten Wienern geleitet und vertrat einen neuen Typus von Journalismus, in dem das Rebellische mit dem Individuellen und dem Ästhetischen zusammenkam. Das magische Wort lautete »Zeitgeist«; was damit gemeint war, war nicht so ganz klar. Aber gerade darum ging es: mit dem Nichtsoklaren klarzukommen. Den Faden weiterzuspinnen, den der gesellschaftliche Aufbruch mit sich gebracht hatte. Aber mit mehr Haltung und besserer Ästhetik.
Ich machte Karriere im Journalismus, obwohl ich nie irgendwo Karriere machen wollte. Und genau deshalb gelang es.
Die Welt lässt sich nicht verändern,
wenn man zu viel will.
Aber wenn du sie laufen lässt und dabei lebendig bleibst,
Neigt sie sich dir zu.
Wir wollten alles.
Wir bekamen vieles.
Wir veränderten die Welt.
Durch die Hintertür unserer Träume.
Wir veränderten die Welt.
Immer wenn wir uns mit offenem Herzen auf sie einließen.
Wenn wir Wirklichkeiten erzeugten
Die von alleine wachsen konnten.
Bis sie reif wurden.
Die Welt wird dich fragen, wer du bist,
Und wenn du es nicht weißt, wird sie es dir erzählen.
Die letzten zwei Zeilen sind von C. G. Jung, die davor von mir. Der volle Text lautet: »Der Sinn meiner Existenz besteht darin, dass das Leben eine Frage an mich gerichtet hat. Oder umgekehrt: Ich selbst bin eine Frage, die an die Welt gerichtet ist, und ich muss meine Antwort mitteilen, denn sonst bin ich auf die Antwort der Welt angewiesen.«7
3
DIE TREND-JAHRE
Wie wir mit dem magischen Wort TREND die Wirtschaft aufmischten und die Zukunft immer wieder aus den Händen glitt, kaum hatten wir sie festgehalten (die Millennium-Jahre)
Anfang der Neunzigerjahre wurden plötzlich alle Fassaden und Oberflächen weiß. Antikweiß, Dezentweiß, Gedecktweiß, Altweiß, Sepiaweiß; vor allem Coolweiß, strahlendes, neonartiges Weiß. Die weiße Farbe löste das Braun/Orange/Grün ab, die Farben der späten Nachkriegszeit und der Tapeten unserer Eltern, aber auch unseres WG-Interieurs. In Hamburg, der Stadt, in der ich damals lebte, standen die alten Villen an der Elbchaussee plötzlich scheinwerfererleuchtet da. Überall schossen neue Bars, Shops, Restaurants und Clubs aus dem Boden. Alles cool und strahlend. Sogar die Reeperbahn, dieses Relikt einer untergehenden Spießerkultur, wurde irgendwie cool. Halogenstrahler im Hafen tauchten die Kräne in helles Licht. Das Licht einer kommenden Zeit.
Des großen Aufschwungs.
Des globalen Wandels.
Des endgültigen Fortschritts.
Als die Mauer fiel, bekam die Welt eine andere Konsistenz. Nicht nur die Landkarten wurden neu gezeichnet, auch die Lebensgefühle, die Weltkonstruktionen, die Gesellschaftsstrukturen. Wir rebellischen Boomer wachten in einer neuen Welt auf, die nun in alle Richtungen offen war. Und wir waren Teil dieser Welt. Wir hatten Wirksamkeit erlebt, und nun waren wir angekommen in einer Demokratie, die sich als ziemlich robust und integrationsfähig erwiesen hatte. Sie hatte sogar unsere großen und kleinen Aufstände verkraftet. Mehr noch: Sie hatten sich verwandelt.
Eine große Erwartung lag in der Luft. Eine elektrisierende Spannung. Eine neue Energie.
Die Spießer schwiegen auf den Balkonen.
Die Zeit des kulturellen Kapitalismus begann.
Die Tempel der Deutungsmacht
1990 arbeitete ich als Redakteur bei der Zeit. Dort fand die wöchentliche Redaktionssitzung jeden Freitag um vier Uhr nachmittags statt, an einem langen Tisch im großen Konferenzzimmer im vierten Stock. Vorn thronte der Herausgeber Helmut Schmidt, der fleißig Schnupftabak vertilgte und mit kurzen, klaren Sätzen die Weltlage diktierte. Der Chefredakteur machte politische Rundumschläge, in der er sich als besserer Bundeskanzler empfahl. Ab und zu schaute »die Gräfin« durch die Tür, die ehrfurchterregende Gründerin der liberalen Wochenzeitung, die irgendwie an die englische Königin erinnerte (jedenfalls wenn man die Netflix-Serie The Crown gesehen hat). Die Konferenz endete, wenn Feuilletonchef Fritz J. Raddatz, einer der ersten öffentlichen Schwulen der Republik, sein Flugzeug nach Sylt erreichen musste (»Ich muss leider aufbrechen, um den Schönen, Klugen und Reichen beiseitezustehen!» – Gelächter). Der große Konferenztisch stand voller Whiskey- und Cognacflaschen. Blauer Dunst lag in der Luft. Damals rauchte man sogar noch in Flugzeugen. Das sollte sich bald ändern. Erstaunlich rasch.
Die Magie der Trends
Inmitten dieses Aufwinds bekam ein schnelles Wort eine magische Bedeutung, das schon in den Tempo-Jahren ständig nervös an die Tür geklopft hatte: TREND.
Das Wort TREND, immer großgeschrieben, hatte etwas Aufdringliches. Es signalisierte, dass etwas unerhört Neues geschah, das man auf keinen Fall verpassen durfte. TREND hatte einen FOMO-Effekt: fear of missing out. Trends waren etwas, an dem man teilhaben musste, unbedingt! Aus persönlichen Gründen, um dazuzugehören, »modern« zu sein. Und aus wirtschaftlichen Gründen. Um weiterzuwachsen, Umsatz und Profit zu machen.
Das Irritierende war: Es gab niemanden, der für die Trends verantwortlich war. Sie kamen aus dem Nichts, aus dem ominösen Zeitgeist der Gesellschaft. Aber wie konnten sie plötzlich so mächtig werden, wenn keine sie kontrollierte?
Für eine Reportage über die neue Disziplin der Trendforschung besuchte ich die Niederländerin Lidewij Edelkoort, eine geheimnisumwitterte Frau, die in Paris ein Studio mit dem Namen Trend Union führte und als Pionierin dieses geheimnisvollen Genres galt. Lidewij Edelkoort wirkte wie eine antike Priesterin aus Porzellan. Sie strömte die Aura einer überirdischen Erkenntnis aus. Sie ähnelte der übersensiblen »Coolhunterin« Cayce Pollard aus dem Roman Mustererkennung des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors William Gibson, der einige Jahre später erscheinen sollte. Gibson beschreibt sie in seinem Roman so: »Wenn man Cayce googelt, findet man vielleicht noch ein paar Hinweise darauf, dass sie eine ›Sensitive‹ ist, eine Wünschelrutengängerin in der Welt des globalen Marketings. Obwohl, wie man sagt, das so etwas wie eine Allergie ist, eine krankhafte und manchmal sehr heftige Reaktion auf die Semiotik der Warenwelt (…) Was Cayce macht, ist Mustererkennung. Sie versucht, ein Muster zu erkennen, ehe jemand anderes ist tut.«8
Edelkoorts Trend-Studio erinnerte an einen archaischen Tempel. Dünne schwule Männer und noch dünnere androgyne Frauen in Schwarz wandelten in einer weiß gestrichenen Fabrikhalle umher und lasen seltsame Gegenstände auf, die den ganzen Boden bedeckten. Puppenköpfe, Kleider, Stoffe, Kulissenteile, Farbmuster, Autoscheinwerfer, Plastikblumen, Brautschleier, rostige Blechplatten, Voodoo-Puppen, Filzrollen, Holzpenisse aus Borneo. Daraus entstanden Trend-Welten mit klingenden Namen wie Technomorphia – Cocooning – Biotranscendence – Erotic Voodoo. Ästhetische Collagen, die für wahnsinnig viel Geld an große Mode- und Konsumfirmen verkauft wurden.
In Gibsons Roman wird Cayce Pollard von Headhuntern aller mächtigen Brands gejagt, dazu von CIA, KGB, Mossad und all den anderen Geheimdiensten der Zukunft, einschließlich der Chinesen und Russen. Weil sie »semiotisch gefährlich« ist. Cayce/Lidewij konnte voraussehen, ob ein Firmenlogo, ein Brand, ein Film »magisch« werden würde; viral gehen, wie man heute sagen würde. Sie war, im Wortsinn, eine Wahrsagerin. Eine mystische Gestalt, in der Magie, Wissen und Intuition zu einer enormen, ziemlich weiblichen Deutungsmacht zusammenfloss.
Anfang 1992 gründeten wir TRENDBÜROHAMBURG. »Wir«, das war eine Gruppe von Journalisten, Grafikern, Designern, die sich in der Hamburger Medienszene kennengelernt hatten. Wir mieteten ein schneeweißes Loft mit Jugendstilstuck an den Decken in bester Lage am Hafen (für Lokalisten: Hohe Brücke 1). Und widmeten uns den TRENDS.
Aus den Pionierzeiten ist mir das »Prinzip Pappkarton« in Erinnerung geblieben. Die Wände waren mit Stahlregalen vollgestellt, in den Recycling-Pappkartons, die sich darin stapelten, sammelten wir die Zeichen der Zeit – Spielzeuge, Comicfiguren, Stapel von Ausschnitten und Ausrissen aus Zeitungen, Skizzen von obskuren Gegenständen, Plakate und Magazine aus dem In- und Ausland, bis hin nach China, wohin unser Geschäftsführer gerne reiste, um seltsame Dinge mitzubringen. An einer Wand stand ein Regal aus Pressspan, in dem sich unser TRENDMUSEUM befand, mit Trendprodukten aus aller Welt. Wenn Journalisten kamen – und sie gaben sich bald die Klinke in die Hand –, fotografierten sie unentwegt dieses Regal. Besonders den transparenten Lolli mit dem echten Wurm drin (»Ekelgenuss-Trend«) und den Fernseher mit dem Gehäuse aus recyceltem Pappmaschee (»Recycling Chic«).
Die Grundidee von Trendbüro war eine Vermittlungsagentur zwischen Kultur und Wirtschaft. Wir wollten gesellschaftlichen Wandel in die Wirtschaft spiegeln – und ihn damit weitertreiben. Aus dem neuen Journalismus hatten wir eine Methode der »teilnehmenden Beobachtung« mitgebracht: die Gesellschaft dabei beobachten, wie sie sich verändert. Sehr konkret. Wir wollten Innovationen anregen, die »an der Zeit waren«. Wir dachten soziologisch, sahen aber die Konsumwelt als Teilwelt der Kultur. Als Zeichenwelt, die etwas über die Gesellschaft verriet und gleichzeitig von ihr geformt wurde.
Wir stellten Fragen wie:
Was bedeutet Individualisierung?
Was bewirkt die veränderte Rolle der Frauen?
Wie verändern sich Lebensformen, individuelle Biografien, Wertesysteme?
Welche Innovationen können in einer neuen Welt sinnvoll sein?
Was ist die Aufgabe der Technik im Gesellschaftlichen?
»Während die Gesellschaft durch ihre Grenzen geprägt wird, wird die Kultur durch ihren Horizont definiert«, so der US-amerikanische Spieletheoretiker und Ontologe James P. Carse.9 Diesen Horizont wollten wir sichtbar machen.
Männer, die auf Trends starren
Trendbüro wurde ein Riesenhype. Innerhalb eines Jahres hatten wir mehr als zwanzig Mitarbeiter und einen Schwarm von »Trendscouts«, die allen möglichen Sinn und Unsinn anschleppten. Wir machten Trend-Kongresse mit Trend-Räumen und Trend-Sessions. Immer, so möchte ich mir das zumindest rückblickend einbilden, mit einem gewissen intellektuellen Niveau. Wir sahen uns nicht als »Trendmacher«, sondern als Stilkundler, beratende Anthropologen, semiotische Soziologen. Wir produzierten Trendstudien und Trendletter und Trendberatungen für alle möglichen Branchen: Kosmetik, Autos, Essen, Reise, Handel, Mode, Speiseeis. Bald fanden wir uns auf endlosen Akquisegesprächen in Flughafenlounges wieder, für die wir sogar einen Schlips (oder ein Kostüm) anzogen. Wir fuhren plötzlich keine klapprigen Golfs mehr, sondern geleaste Turbo-Saabs.
Nicht wenige unserer Projekte waren allerdings von unfreiwilliger Komik und lustigen Missverständnissen geprägt. Ich erinnere mich an eine Präsentation im Ruhrgebiet. In einer riesigen, neonerleuchteten Einkaufshalle für Autozubehör namens Car World, direkt an einem vielbefahrenen Autobahnkreuz, roch es nach Hochoktan-Benzin und Motoröl, als Dauer-Soundtrack lief das Kreischen von Bremsen und das Wummern von Rennmotoren. Monströse Auspuffkonstruktionen stapelten sich in den Auslagen, auf Postern liebkosten Bikinidamen in lasziven Gesten die Kotflügel von Sportwagen. Die Eigentümer dieses Ladens, zwei junge Autofans mit Geschäftssinn, hatten uns eingeladen, auf einem Kunden-Event eine »Autovision 2000« vorzutragen.
Unser Vortrag über den Megatrend Frauen und die kommende Ära einer ökologischeren Mobilität, in der man gerne auch Fahrrad fuhr, PS nicht mehr so eine Rolle spielten und auch Elektroautos auf die Straßen kommen würden (die ersten Elektroautos ähnelten damals eher grotesken Blechdosen), kam nicht so recht an. Unser Ansatz gesellschaftlichen Wandels, der die Trends bestimmte, muss für die etwa 200 Gäste, tätowierte Turbofans und Mercedes-fahrende türkische Geschäftsleute nebst Ehefrauen, einigermaßen befremdlich gewirkt haben. Schweigend saßen sie da und hörten sich an, was wir zu sagen hatten. Und dachten:
Die kommen vom Mond!
Und tatsächlich: Irgendwie kamen wir tatsächlich von Outer Space.
Echt große Hunde
Dr. Schmidt stellte sich als Marketingchef eines großen Tierfutterkonzerns vor. Monatelang trafen wir uns wiederholt mit ihm in Flughafenlounges und Bahnhofhotels, um ein Projekt »Trends der Haustierhaltung« zu besprechen. Wir schlugen Themen vor wie soziografischer Wandel von Familien mit Haustieren, Single-Lifestyles, Luxus Katze, Mensch-Tier-Kommunikation. Inklusive Feldforschung und teilnehmender Beobachtung in Tierhaushalten. Aber es kam nie zu einem Auftrag. Plötzlich blieben Herrn Schmidts Anrufe aus, wir sahen ihn nie wieder.
Ein Jahrzehnt später traf ich ihn zufällig in einer Flughafenlounge wieder. Er war bereits im Ruhestand. Und erklärte sich bereit, mir zu verraten, was damals passiert war. »Wissen Sie, Herr Horx, unser Geschäft ist sehr speziell und auch äußerst profitabel, wenn man es richtig betreibt. Wir reden hier von 40 Prozent und mehr, äußerst lukrativ für die Kapitalseite. Wir leben ja von Schlachtabfällen, mit denen man erhebliche Margen erzielen kann, sie werden von uns meistens kostenlos in den Schlachthöfen abgeholt, einfach nur eine Entsorgung. Wir waren damals in einer echten Expansionsphase. Das, was Sie uns anboten, ging einfach zu sehr in Richtung – sagen wir mal – Schöngeisterei.«
Und was war dann die »richtige« Idee?