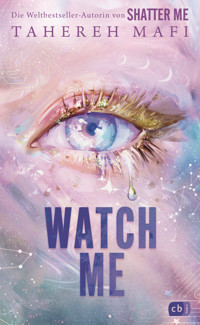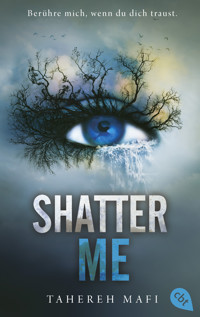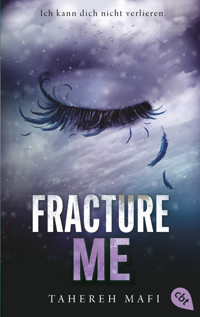0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die »Shatter Me«-Shorts
- Sprache: Deutsch
Für alle, die von Juliette und Warner nicht genug bekommen können: die E-Shorts zu der TikTok-Sensation
Juliettes Flucht hat Warner schwer verletzt und in einem inneren Aufruhr zurückgelassen. Nach außen wirkt er gefühlskalt und berechnend; und ist doch voller Zweifel, hin- und hergerissen zwischen seiner Erziehung und seinen Gefühlen für Juliette, die er unbedingt wiedersehen muss – auch wenn sie ihn offensichtlich verabscheut. Und so versucht der noch geschwächte Warner mit aller Macht, die Disziplin auf der Militärbasis aufrechtzuerhalten und Juliette zurückzuholen. Bis sein Vater, Oberbefehlshaber des Reestablishments, in Warners Basis auftaucht. Und als Warner dessen Pläne für Juliette erfährt, wird ihm klar, dass er sich endgültig entscheiden muss …
»Destroy Me« knüpft direkt an die Ereignisse von »Shatter Me« an.
Alle Bände der »Shatter Me«-Reihe:
Shatter Me (Band 1)
Destroy Me (Band 1.5, E-Short)
Unravel Me (Band 2)
Fracture Me (Band 2.5, E-Short)
Ignite Me (Band 3)
Restore Me (Band 4)
Shadow Me (Band 4.5, E-Short)
Defy Me (Band 5)
Reveal Me (Band 5.5, E-Short)
Imagine Me (Band 6)
Believe Me (Band 6.5, E-Short)
Join Me (alle Shorts in einem Sammelband)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Buch
In Tahereh Mafis »Shatter Me« ist Juliette die Flucht aus den Fängen des grausamen Reestablishment gelungen – indem sie dessen Anführer Warner eine Kugel in die Schulter jagte. Sie glaubte, ihn tot zurückzulassen, doch Warner ist nur schwer verletzt. Und nimmt den Leser in »Destroy Me« mit auf eine faszinierende Reise. Denn Warner scheint hassenswert – böse, gefühlskalt, berechnend –, und ist doch voller innerer Zweifel, hin- und hergerissen zwischen seiner Erziehung durch seinen grausamen Vater und seiner tiefen Liebe zu Juliette, die er unbedingt wiedersehen muss – auch wenn sie ihn offensichtlich verabscheut. Und so kämpft der von seiner Verletzung noch geschwächte Warner zum einen darum, die Disziplin auf der Militärbasis aufrechtzuerhalten, während er andererseits mit aller Macht darauf hinarbeitet, Juliette wieder in seine Gewalt zu bringen. Bis sein Vater, der skrupellose Oberbefehlshaber des Reestablishment, in Warners Basis auftaucht. Und als Warner dessen Pläne für Juliette erfährt, wird ihm klar, dass er sich endgültig entscheiden muss …
Tahereh Mafi
Destroy Me
Aus dem Amerikanischenvon Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
»Destroy Me« bei Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30161 Hannover.
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die deutschsprachige Erstausgabe erschien erstmals 2013 unter dem
Titel »Zerstöre mich« beim Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Lektorat: Vera Thielenhaus
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Cover art © 2013 by Colin Anderson
Cover art inspired by a photograph by Sharee Davenport
skn · Herstellung: bo
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31763-8V001
www.cbj-verlag.de
PROLOG
Ich wurde angeschossen.
Und ich muss sagen: Eine Schusswunde ist wesentlich unangenehmer, als ich vermutet hätte.
Meine Haut fühlt sich klamm an, das Atmen fällt mir übermenschlich schwer. Der Schmerz in meinem rechten Arm ist so grausam, dass ich kaum etwas anderes wahrnehmen kann. Ich kneife die Augen zu, beiße die Zähne zusammen, zwinge mich zur Konzentration.
Um mich herum herrscht ein unerträgliches Chaos.
Alle schreien durcheinander. Einige fassen mich an, man sollte ihnen die Hände amputieren. »Sir!«, schreien sie, als erwarteten sie meine Befehle, als seien sie ohne mich komplett orientierungslos. Diese Feststellung erschöpft mich.
»Können Sie mich hören, Sir?« Eine weitere Stimme, aber gegen diese eine habe ich nichts einzuwenden.
»Sir, bitte, können Sie mich hören …«
Ich zwinge mich zu sprechen. »Ich habe eine Schusswunde, Delalieu, aber ich bin nicht taub.« Ich öffne die Augen. Sehe Delalieu, der mich panisch anstarrt.
Sofort hören alle mit dem Geschrei auf. Es wird still. Delalieu sieht verstört aus.
Ich seufze.
»Bringen Sie mich zurück«, sage ich und bewege mich ein bisschen. Die Welt gerät ins Schwanken, kommt wieder zum Stillstand. »Informieren Sie die Ärzte, lassen Sie mein Bett vorbereiten. Und jetzt heben Sie meinen Arm hoch und üben weiter Druck auf die Wunde aus. Die Kugel hat irgendwas zerschlagen, man wird operieren müssen.«
Delalieu reagiert nicht; und das für einen Moment zu lange.
»Gut, dass Sie am Leben sind, Sir«, sagt er dann mit zittriger Stimme. »Gut, dass Sie am Leben sind.«
»Das war ein Befehl, Lieutenant.«
»Natürlich«, sagt er rasch. »Gewiss, Sir. Welche Instruktionen soll ich den Soldaten geben?«
»Sie sollen sie finden«, sage ich. Das Sprechen fällt mir immer schwerer. Ich atme vorsichtig ein, streiche mir über die Stirn. Es entgeht mir nicht, wie heftig ich schwitze.
»Ja, Sir.« Delalieu will mir aufhelfen, aber ich halte seinen Arm fest.
»Eines noch.«
»Sir?«
»Kent«, krächze ich. »Ich will ihn lebendig.«
Delalieu starrt mich mit aufgerissenen Augen an. »Den Gefreiten Adam Kent, Sir?«
»Ja.« Ich fixiere Delalieu. »Kent will ich mir selbst vornehmen.«
1
Delalieu steht am Fußende meines Betts, ein Klemmbrett in Händen.
Er ist mein zweiter Besuch an diesem Morgen. Zuvor waren meine Ärzte erschienen und hatten mich informiert, dass die Operation gut verlaufen sei. Sie sagten, wenn ich diese Woche noch im Bett bliebe, würden die neuen Medikamente, die ich bekommen hätte, den Heilungsprozess enorm beschleunigen. Ferner teilten sie mir mit, dass ich zwar bald wieder meine tägliche Routine aufnehmen könne, aber noch mindestens einen Monat lang eine Armschlinge tragen müsse.
Ich erwiderte, das sei eine interessante Theorie.
»Meine Hose, Delalieu.« Ich hebe den Kopf, wehre mich gegen die Übelkeit, die mit den Medikamenten einhergeht. Mein rechter Arm ist komplett unbrauchbar.
Ich schaue hoch. Delalieu starrt mich unverwandt an. Sein Adamsapfel hüpft an seinem Hals auf und ab.
Ich verkneife mir das Seufzen.
»Was ist los?« Ich stütze mich mit dem linken Arm ab und setze mich auf. Brauche dazu meine gesamte Kraft und muss mich schließlich am Bettgestell festhalten. Als Delalieu helfen will, schüttle ich den Kopf und schließe die Augen, um den Schwindel zu vertreiben. »Spucken Sie’s aus«, sage ich. »Hat keinen Sinn, schlechte Nachrichten zurückzuhalten.«
Seine Stimme ist rau und bricht zweimal, als er sagt: »Der Gefreite Adam Kent ist entkommen, Sir.«
Unter meinen Lidern scheint ein grellweißes Licht zu explodieren.
Ich hole tief Luft und streiche mir mit der unversehrten Hand durch die Haare. Sie fühlen sich verklebt an – angetrocknetes Blut und Schmutz wahrscheinlich. Ich würde gerne mit der Faust die Wand durchschlagen.
Doch ich reiße mich zusammen.
Plötzlich nehme ich alles wie mit geschärften Sinnen wahr – Gerüche, Geräusche, Schritte draußen vor der Tür. Finde die grobe Baumwollhose, die man mir angezogen hat, unerträglich. Finde es unerträglich, dass ich keine Socken trage. Ich will duschen. Ich will mich umziehen.
Ich will Adam Kent eine Kugel ins Rückgrat jagen.
»Hinweise«, fordere ich. Die Luft ist kalt, als ich mich in Richtung Badezimmer bewege, und ich fröstle, weil mein Oberkörper immer noch nackt ist. Ich versuche mich zu beruhigen. »Sie wollen mir diese Information doch wohl nicht ohne weitere Hinweise übermitteln.«
Mein Hirn ist ein Lagerhaus sorgsam geordneter Emotionen. Ich sehe förmlich vor mir, wie es Bilder und Gedanken aussortiert. Was mir nicht weiterhilft, wird weggepackt. Ich konzentriere mich auf das Notwendigste: die Hauptelemente des Überlebens und die zahlreichen Dinge, die ich an einem Tag erledigen muss.
»Natürlich«, antwortet Delalieu. Die Angst in seiner Stimme kränkt mich ein wenig, aber ich reagiere nicht darauf. »Ja, Sir«, fährt er fort, »wir glauben zu wissen, wo sie sich verstecken – und wir haben Grund zu der Annahme, dass Gefreiter Kent und das – und das Mädchen – und nun ja, dass auch Gefreiter Yamamoto geflüchtet ist – wir vermuten, dass sie alle drei zusammen sind, Sir.«
Die Schubladen in meinem Gehirn rattern und scharren, als wollten sie von selbst aufspringen. Erinnerungen. Vermutungen. Gerüchte und Geflüster.
Ich werfe sie in einen Abgrund.
»Vermutungen gibt es viele.« Ich schüttle den Kopf und bereue es sofort. Schließe wieder die Augen wegen des Schwindels. »Ich will keine Theorien, auf die ich schon selbst gekommen bin«, krächze ich. »Sondern konkrete Fakten. Einen verlässlichen Anhaltspunkt, Lieutenant. Oder Sie verschwinden so lange, bis Sie mir das liefern können.«
»Ein Auto«, sagt Delalieu rasch. »Ein Auto wurde als gestohlen gemeldet, Sir, und wir konnten es bis zu einem bislang unbekannten Ort verfolgen. Aber dann ist es spurlos verschwunden. Als hätte es sich in Luft aufgelöst, Sir.«
Ich blicke hoch. Höre aufmerksam zu.
»Wir sind den Spuren gefolgt, die wir auf dem Radar hatten«, fährt Delalieu fort, jetzt ruhiger. »Sie führen zu menschenleerem Brachland. Wir haben das gesamte Gebiet abgesucht und nichts gefunden.«
»Das ist doch zumindest etwas.« Ich reibe mir den Nacken, kämpfe gegen die lähmende Schwäche an, die meinen ganzen Körper erfasst hat. »Wir treffen uns in einer Stunde im L-Raum.«
»Aber, Sir«, erwidert Delalieu mit Blick auf meinen Arm, »Sie brauchen Hilfe – Sie sind doch verletzt – Sie können nicht ohne Pfleger …«
»Wegtreten.«
Er zögert.
Dann: »Ja, Sir.«
2
Es gelingt mir zu duschen, ohne zu kollabieren.
Eigentlich habe ich mich eher mit dem Schwamm gewaschen als geduscht, aber ich fühle mich trotzdem besser. Unordnung kann ich nicht ertragen; ich empfinde sie als persönlichen Angriff. Ich dusche regelmäßig. Ich esse sechs kleine Mahlzeiten pro Tag. Ich wende täglich zwei Stunden für Sport und Krafttraining auf. Und ich hasse es, barfuß zu sein.
Jetzt stehe ich nackt, hungrig, müde und barfuß in meinem begehbaren Kleiderschrank. Eine höchst unerfreuliche Situation.
Mein Schrank hat jeweils separate Fächer für Hemden, Krawatten, Hosen, Blazer, Stiefel, Socken, Handschuhe, Tücher und Mäntel. Alles ist nach Farbschattierungen sortiert. Jedes Kleidungsstück ist maßgeschneidert. Ich fühle mich erst wie ich selbst, wenn ich vollständig bekleidet bin. Das ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Damit beginne ich jeden Tag.
Und nun habe ich nicht die geringste Ahnung, wie ich mich anziehen soll.
Meine Hand zittert, als ich nach der kleinen blauen Flasche greife, die man mir morgens gegeben hat. Ich lege zwei der eckigen Pillen auf meine Zunge und warte, bis sie sich aufgelöst haben. Was sie bewirken, weiß ich nicht; aber sie helfen wohl dabei, den Blutverlust auszugleichen. Ich lehne mich an die Wand, bis der Schwindel nachlässt.
So eine banale Tätigkeit wie sich anzuziehen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie zu einem fast unüberwindlichen Hindernis werden könnte.
Ich fange mit den Socken an; normalerweise ein simples Vergnügen, aber jetzt ist es aufwendiger, als einen Mann zu erschießen. Einen Moment lang überlege ich, was die Ärzte wohl mit meinen Kleidern gemacht haben. Nur die Kleider, sage ich mir, nur die Kleider; ich darf nur an die Kleider denken, die ich an dem Tag trug. An nichts anderes. Nicht an andere Details.
Stiefel. Socken. Hose. Pullover. Meine Uniformjacke mit den vielen Knöpfen.
Den vielen Knöpfen, die sie aufgerissen hat.
Nur eine kleine Erinnerung, aber sie trifft mich bis ins Mark.
Ich versuche sie wegzudrängen, aber sie lässt sich nicht verscheuchen, und je mehr ich mich bemühe, sie zu vergessen, desto schneller verwandelt sie sich in ein Monster, das ich nicht mehr beherrschen kann. Erst als meine Haut sich eisig anfühlt, merke ich, dass ich an die Wand gesackt bin und viel zu hastig atme. Als mich die Scham überkommt, kneife ich die Augen fest zu.
Mir ist wohl bewusst, dass Juliette verstört und verängstigt war. Aber ich hätte nie vermutet, dass ich diese Gefühle hervorgerufen hatte. Im Laufe unserer gemeinsamen Wochen war sie entspannter geworden, hatte sogar glücklich und gelöst gewirkt. Ich hatte mir erlaubt, mir eine gemeinsame Zukunft für uns vorzustellen; hatte mich dem Glauben hingegeben, Juliette wollte mit mir zusammen sein und wüsste nur nicht, wie wir das verwirklichen könnten.
Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass Kent der Grund ihrer Zufriedenheit war.
Ich streiche mir übers Gesicht, presse die Hand auf den Mund.
Wie ich mit ihr gesprochen habe.
Ich hole tief Luft.
Wie ich sie berührt habe.
Ich beiße die Zähne zusammen.
Wenn es nur um sexuelle Anziehung ginge, würde ich mich nicht so grenzenlos gedemütigt fühlen. Doch ich wollte so viel mehr als nur ihren Körper.
Jählings flehe ich meinen Geist an, sich Wände vorzustellen. Nur Wände. Weiße Wände. Betonbauten. Leere Räume.
Ich baue Wände, bis sie zu bröckeln beginnen, und dann errichte ich neue. Ich baue und baue und rühre mich nicht von der Stelle, bis mein Geist gereinigt ist, unberührt, keimfrei. Bis er nichts mehr enthält außer einem kleinen weißen Zimmer. In dem eine einzige Glühbirne von der Decke baumelt.
Blitzsauber. Unberührt. Still.
Ich blinzle, um die Katastrophenflut fernzuhalten, die meine kleine makellose Welt bedrängt; ich schlucke heftig, um die Angst zu vertreiben, die mir die Kehle hinaufkriecht. Ich schiebe die Wände beiseite, mache den Raum groß genug, dass ich ausreichend Luft bekomme. Dass ich stehen kann.
Manchmal wünsche ich mir, ich könnte für eine Weile aus mir heraustreten. Könnte diesen abgenutzten Körper hinter mir lassen, doch zu viele Ketten fesseln mich, und die Gewichte sind zu schwer. Mehr als dieses Leben ist nicht mehr von mir übrig. Und ich weiß genau, dass ich für den Rest des Tages nicht mehr in den Spiegel schauen kann.
Schlagartig ekle ich mich vor mir selbst. Ich muss unbedingt dieses Zimmer verlassen, sonst werden meine eigenen Gedanken mir den Krieg erklären. Zum allerersten Mal überlege ich mir nicht, was ich anziehen will, sondern greife nur hastig nach einer Hose. Schlüpfe mit dem gesunden Arm in einen Blazer und lege ihn mir um die Schultern. Ich sehe lächerlich aus ohne Hemd, aber morgen wird mir schon eine Lösung einfallen.
Jetzt muss ich nur schnell raus hier.
3
Delalieu ist der einzige Mensch hier, der mich nicht hasst.