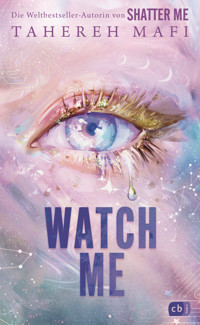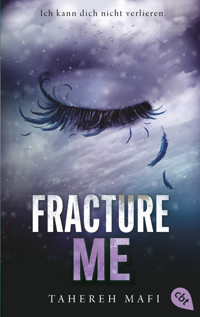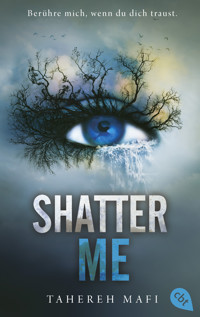
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Shatter-Me-Reihe
- Sprache: Deutsch
Für Romantasy-Fans ab 14 Jahren!
„Du darfst mich nicht anfassen“, flüstere ich. Bitte fass mich an, möchte ich in Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst, geschieht Seltsames. Schlimmes.
Ihr Leben lang war Juliette einsam, eine Ausgestoßene – ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen – gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr. Für ihre Liebe. Und für den Zauber der Berührung ...
Die TikTok Sensation – Mitreißende Young Adult Romantasy-Reihe mit Suchtfaktor für alle Fans von Leigh Bardugo, Sarah J. Maas und Victoria Aveyard.
Dieses Buch ist bereits unter dem Titel "Ich fürchte mich nicht" erschienen.
Alle Bände der »Shatter Me«-Reihe:
Shatter Me (Band 1)
Unravel Me (Band 2)
Ignite Me (Band 3)
Restore Me (Band 4)
Defy Me (Band 5)
Imagine Me (Band 6)
Watch Me (Spin-off, Band 1)
Release Me (Spin-off, Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tahereh Mafi
SHATTER ME
Aus dem amerikanischen Englischvon Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2011 Tahereh Mafi
Published by Arrangement with Tahereh Mafi
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Shatter me« bei Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die deutschsprachige Originalausgabe erschien erstmals 2014 unter dem Titel »Ich fürchte mich nicht« beim Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Lektorat: Vera Thielenhaus
Covergestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Cover art: © 2012 by Colin Anderson.
Cover art inspired by a photograph by Sharee Davenport
Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33448-2V001
www.cbj-verlag.de
Für meine Eltern und für meinen Mann, denn als ich sagte, ich wolle den Mond berühren, nahmst du meine Hand, zogst mich in deine Arme und lehrtest mich Fliegen.
Zwei Wege boten sich mir dar,Ich nahm den Weg, der weniger begangen war,Und das veränderte mein Leben.
Robert Frost, Der unbegangene Weg
1
Ich bin seit 264 Tagen eingesperrt.
Habe nur Gesellschaft von einem kleinen Notizheft, einem halbkaputten Schreibstift und den Zahlen in meinem Kopf. 1 Fenster. 4 Wände. 15 Quadratmeter. Ein Alphabet mit 26 Buchstaben, die ich seit 264 Tagen nicht mehr ausgesprochen habe.
6336 Stunden, seit ich zum letzten Mal jemanden berührt habe.
»Du bekommst einen Zellengenossen Mitbewohner«, haben sie gesagt.
»Wir hoffen, du verrottest hier Für gute Führung«, haben sie gesagt.
»Der ist genauso verrückt wie du Keine Isolationshaft mehr«, haben sie gesagt.
Sie sind die Schergen des Reestablishment, jener Gruppierung, die unserer sterbenden Gesellschaft helfen sollte. Leute, die mich von meinen Eltern weggeschleppt und in ein Irrenhaus gesperrt haben, für etwas, das ich nicht ändern konnte. Keiner schert sich darum, dass ich nicht wusste, wozu ich fähig war. Dass ich nicht wusste, was ich tat.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
Ich weiß nur, dass ich 6 Stunden und 37 Minuten unterwegs war, in einem weißen Lieferwagen. Dass ich mit Handschellen an den Sitz gefesselt war. Dass meine Eltern sich nicht verabschiedet haben. Dass ich nicht geweint habe, als man mich wegbrachte.
Und ich weiß, dass hier jeden Tag der Himmel herabstürzt.
Die Sonne fällt ins Meer und sprenkelt die Welt vor meinem Fenster braun, rot, gelb, orange. Millionen Blätter von Hunderten von Ästen taumeln durch die Luft, als könnten sie fliegen. Doch der Wind packt ihre dürren Flügel nur, um sie nach unten zu pressen, wo sie vergessen und von den Soldaten draußen zertrampelt werden.
Es gibt nicht mehr so viele Bäume wie früher, sagen die Wissenschaftler. Unsere Welt war früher grün, sagen sie. Unsere Wolken waren weiß. Das Licht unserer Sonne war immer passend. Aber ich erinnere mich kaum noch an diese Welt. Ich weiß nicht mehr viel von früher. Nur mein jetziges Leben kenne ich. Ein Echo der Vergangenheit.
Ich presse die Handfläche ans Fenster und spüre die vertraute Umarmung der Kälte. Wir sind beide alleine, sind beide nur Abwesenheit von anderem.
Ich greife nach dem fast nutzlosen Stift und starre darauf. Überlege es mir anders. Lasse das mühevolle Schreiben sein. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, jemanden bei mir zu haben. Mit jemandem zu sprechen. Ich übe, forme mit den Lippen die einst vertrauten Worte, die meinem Mund jetzt so fremd sind. Ich übe von früh bis spät.
Es wundert mich, dass ich noch sprechen kann.
Ich rolle das kleine Notizheft zusammen und stecke es in die Lücke in der Wand. Setze mich auf die notdürftig bedeckten Bettfedern, auf denen ich schlafen muss. Warte. Wiege mich hin und her und warte.
Ich warte zu lange und schlafe ein.
Meine Augen sehen 2 Augen 2 Lippen 2 Ohren 2 Augenbrauen.
Ich unterdrücke einen Schrei, den Drang, wegzurennen, das Grauen, das mich packt.
»Ein J-J-J-J–«
»Und du bist ein Mädchen.« Er zieht eine Augenbraue hoch. Richtet sich auf. Er grinst, aber er lächelt nicht, und ich würde am liebsten schreien, mein Blick zuckt verstört, verzweifelt, zu der Tür, die ich schon so oft zu öffnen versucht habe. Sie haben mir einen Jungen in die Zelle gesteckt. Einen Jungen.
Großer Gott.
Sie wollen mich umbringen.
Das machen sie mit Absicht.
Um mich zu foltern, zu quälen, mir für immer den Schlaf zu rauben. Er hat die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgerollt, seine Arme sind komplett tatöwiert. In einer Augenbraue fehlt ein Ring, den müssen sie konfisziert haben. Dunkelblaue Augen dunkelbraune Haare kantiges Kinn muskulöser schlanker Körper. Umwerfend. Gefährlich. Bedrohlich. Entsetzlich.
Er lacht, und ich falle vom Bett und krabble in die Ecke.
Er beäugt die Liege, die sie heute früh reingeschoben haben, das schmale Kissen, die dünne Matratze, die zerschlissene Decke, die kaum für seinen Oberkörper reicht. Schaut auf mein Bett. Und auf seines.
Rückt beide mit einer Hand zusammen. Befördert die Metallgestelle mit dem Fuß auf seine Seite. Legt sich über beide Matratzen, schüttelt mein Kissen auf und schiebt es sich in den Nacken. Ich fange an zu zittern.
Beiße mir auf die Lippe und versuche mich in der dunklen Ecke zu vergraben.
Er hat mein Bett meine Decke mein Kissen gestohlen.
Mir bleibt nur der Boden.
Für immer.
Ich kann nicht kämpfen, weil ich verängstigt bin, versteinert, verstört.
»Und du bist – was? Verrückt? Bist du deshalb hier?«
Ich bin nicht verrückt.
Er richtet sich auf und schaut mich an. Lacht. »Ich tu dir nichts.«
Ich möchte ihm glauben Ich glaube ihm nicht.
»Wie heißt du?«, fragt er.
Geht dich nichts an. Wie heißt du?
Ich höre ihn ärgerlich schnauben. Höre, wie er sich auf dem Bett umdreht, das zur Hälfte meines war. Ich bleibe die ganze Nacht wach. Die Knie ans Kinn gezogen, die Arme um den schmalen Körper geschlungen, die langen braunen Haare als Vorhang zwischen uns.
Ich werde nicht schlafen.
Ich kann nicht schlafen.
Ich will die Schreie nicht mehr hören.
2
Am nächsten Morgen riecht es nach Regen.
Der Geruch von nassem Stein und aufgegrabener Erde hängt in der feuchten schweren Luft. Ich atme tief ein und schleiche auf Zehenspitzen zum Fenster. Presse die Nase an die kühle Scheibe. Spüre, wie sie beschlägt von meinem Atem. Schließe die Augen und horche auf das leise Plätschern im Wind. Regentropfen erinnern mich daran, dass Wolken einen Herzschlag haben. Dass ich einen habe.
Ich denke immer wieder über Regentropfen nach.
Sie fallen vom Himmel, stolpern über ihre Füße, brechen sich die Beine, vergessen ihre Fallschirme, wenn sie heruntertaumeln, einem ungewissen Ende entgegen. Als entleere jemand seine Taschen über der Erde. Dem es egal ist, dass die Regentropfen zerplatzen, wenn sie auftreffen, dass sie zerspringen, wenn sie den Boden erreichen, dass Menschen die Tage verwünschen, an denen die Tropfen so dreist sind, an ihre Tür zu klopfen.
Ich bin ein Regentropfen.
Meine Eltern haben mich aus ihren Taschen geleert und auf einer Betonplatte verdampfen lassen.
Durchs Fenster kann ich sehen, dass wir nicht weit weg von den Bergen und auf jeden Fall nahe am Wasser sind, aber inzwischen ist das Wasser überall. Ich weiß nur nicht, auf welcher Seite wir sind. In welche Richtung wir schauen. Ich blinzle in die frühe Morgensonne. Jemand hat die Sonne aufgeklaubt und sie wieder an den Himmel gehängt, aber sie steht jeden Tag ein bisschen tiefer. Sie ist wie ein achtloser Elternteil, der sein Kind nur zur Hälfte kennt. Der nie begreift, wie seine Abwesenheit die Menschen verändert. Wie anders wir alle im Dunkeln sind.
Ein plötzliches Rascheln sagt mir, dass mein Zellengenosse wach ist.
Ich fahre herum, als sei ich wieder dabei ertappt worden, wie ich Essen stehle. Das habe ich nur einmal gemacht, und meine Eltern glaubten mir nicht, als ich sagte, ich hätte es nicht für mich getan. Ich sagte, ich wollte nur die Streunerkatzen bei uns um die Ecke retten. Aber meine Eltern dachten, ich sei nicht menschlich genug, um für Katzen zu sorgen. Nicht so etwas jemand wie ich.
Zellengenosse betrachtet mich.
Er war in seinen Kleidern eingeschlafen. Er trägt ein marineblaues T-Shirt und khakifarbene Cargohosen, in kniehohe schwarze Stiefel gesteckt.
Ich trage tote Baumwolle auf dem Körper und Rosenfarbe im Gesicht.
Er tastet mich mit den Augen ab, und die langsame Bewegung bringt mein Herz zum Rasen. Ich fange die Rosenblätter auf, als sie von meinen Wangen fallen, als sie herabschweben, als sie mich mit etwas bedecken, das sich wie ein Mangel an Mut anfühlt.
Hör auf, mich anzuschauen, will ich sagen.
Hör auf, mich mit den Augen anzufassen, und behalte deine Hände bei dir und bitte und bitte und bitte –
»Wie heißt du?« Er legt den Kopf schräg, und die Schwerkraft zerbricht in zwei Stücke.
Ich schwebe im Augenblick. Ich blinzle und halte meinen Atem unter Verschluss.
Zellengenosse bewegt sich, und meine Augen zerspringen in tausend Teile, die durch den Raum jagen, eine Million Fotos schießen; eine Million Augenblicke in der Zeit. Flackernde Bilder aus alter Zeit, erstarrte Gedanken im leeren Raum, ein Wirbelsturm von Erinnerungen, die in meine Seele schneiden. Er erinnert mich an jemanden von früher.
Ein scharfer Atemzug, und meine Augen fliegen auf.
Keine Tagträume mehr.
»Warum bist du hier?«, frage ich die Risse in der Betonwand. 14 Risse in 4 Wänden in tausenderlei Grautönen. Der Boden, die Decke: dieselben Steinplatten. Die erbärmlichen Bettgestelle: aus alten Wasserrohren gebaut. Das kleine Fenster: zu dick zum Zerschlagen. Meine Hoffnung ist erschöpft. Meine Augen sind wirr und schmerzen. Mein Finger zeichnet träge einen Pfad auf den kalten Boden.
Ich sitze auf dem Boden, und da riecht es nach Eis und Metall und Schmutz. Zellengenosse mir gegenüber im Schneidersitz. Seine Stiefel glänzen zu sehr für diesen Ort.
»Du hast Angst vor mir.« Seine Stimme nimmt keine Gestalt an.
Meine Finger ballen sich zur Faust. »Ich fürchte, da irrst du dich.«
Ich lüge vielleicht, aber das geht ihn nichts an.
Er schnaubt, und der Laut bildet ein Echo in der stillen Luft zwischen uns. Ich schaue nicht auf. Will den Blick nicht sehen, der mich durchbohrt. Ich schmecke die abgestandene verbrauchte Luft und seufze. In meinem Hals steckt etwas fest, etwas Altbekanntes, das ich gelernt habe hinunterzuschlucken.
Es klopft zweimal an der Tür, und meine Gefühle springen vor Schreck an ihren Platz zurück.
Zellengenosse ist im Nu auf den Beinen.
»Da ist niemand«, sage ich zu ihm. »Nur das Frühstück.« 265 Mal Frühstück, und ich weiß noch immer nicht, woraus es besteht. Es riecht nach Chemikalien; ein formloser Klumpen, immer im Extremzustand. Zu süß oder zu salzig, aber auf jeden Fall widerlich. Meist bin ich zu ausgehungert, um das zu bemerken.
Ich höre, wie Zellengenosse einen Moment zögert, bevor er sich der Tür nähert. Er schiebt den Schlitz auf und späht hinaus in eine Welt, die es nicht mehr gibt.
»Scheiße!« Er reißt das Tablett durch die Öffnung und schlägt dann seine Hand an seine Brust. »Scheiße, Scheiße.« Er ballt die Finger zur Faust und beißt die Zähne zusammen. Hat sich die Hand verbrannt. Ich hätte ihn warnen können, wenn er mir zugehört hätte.
»Man muss mindestens drei Minuten warten, bevor man das Tablett anfasst«, sage ich zur Wand. Ich schaue nicht auf die hellen Narben an meinen kleinen Händen, auf die einstigen Brandwunden. »Das machen die, glaube ich, mit Absicht«, füge ich leise hinzu.
»Ach, jetzt redest du mit mir?« Er ist wütend. Seine Augen funkeln, bevor er wegschaut, und ich merke, dass es ihm vor allem peinlich ist. Er ist ein harter Bursche. Zu hart, um vor den Augen eines Mädchens dumme Fehler zu machen. Zu hart, um Schmerz zu zeigen.
Ich presse die Lippen zusammen und starre auf das kleine Glasquadrat, das sie Fenster nennen. Es sind nicht mehr viele Tiere übrig, aber ich habe Geschichten von Vögeln gehört, die fliegen. Eines Tages sehe ich vielleicht einen. Die Geschichten heutzutage sind so verworren, dass man nicht viel glauben kann. Aber ich habe von mehr als einer Person gehört, dass sie in den letzten Jahren einen fliegenden Vogel gesehen hat. Deshalb behalte ich das Fenster im Auge.
Heute wird ein Vogel kommen. Er wird weiß sein und auf dem Kopf goldene Federn haben wie eine Krone. Er wird fliegen. Heute wird ein Vogel kommen. Er wird weiß sein und auf dem Kopf goldene Federn haben wie eine Krone. Heute wird ein –
Die Hand.
Auf mir.
Zwei Fingerspitzen
streifen meine Schulter kaum eine Sekunde, und alle Muskeln alle Sehnen meines Körpers sind angespannt und verknotet und krallen sich in mein Rückgrat. Ich bin reglos. Ich rühre mich nicht. Ich atme nicht. Wenn ich mich nie mehr bewege, kann ich dieses Gefühl vielleicht behalten.
Seit 265 Tagen hat mich niemand berührt.
Manchmal denke ich, die Einsamkeit in mir wird durch meine Haut brechen, und manchmal weiß ich nicht, ob ich die Hysterie durch Weinen, Schreien oder Lachen bezwingen kann. Manchmal sehne ich mich so verzweifelt danach, zu berühren, berührt zu werden, zu fühlen, dass ich meine, in einem Paralleluniversum, wo mich niemand je finden wird, von einer Klippe zu stürzen.
Das ist durchaus denkbar.
Ich schreie seit Jahren, ohne gehört zu werden.
»Hast du keinen Hunger?« Seine Stimme klingt tiefer, ein bisschen besorgt.
Ich hungere seit 265 Tagen. »Nein.« Das Wort ist kaum mehr als ein zerfetzter Atemzug, als es über meine Lippen kommt, und ich wende mich ihm zu, obwohl ich das lassen sollte. Er starrt mich an. Forschend. Sein Mund ist leicht geöffnet, die Arme hängen reglos an seiner Seite, er blinzelt, verwirrt.
Etwas schlägt mir in den Magen.
Seine Augen. Da ist etwas mit seinen Augen.
Er ist es nicht er ist es nicht er ist es nicht.
Ich packe die Welt weg. Schließe sie ein. Drehe den Schlüssel um.
Schwärze begräbt mich in ihren Falten.
»Hey –«
Meine Augen brechen auf. Zwei zerschlagene Fenster, die meinen Mund mit Glassplittern füllen.
»Was ist los?« Seine Stimme klingt angestrengt achtlos, bemüht unbeteiligt.
Nichts.
Ich konzentriere mich auf das durchsichtige Quadrat zwischen mir und der Freiheit. Ich will diese Betonwelt zerstören. Ich will größer, besser, stärker sein.
Ich will wütend wütend wütend sein.
Ich will der Vogel sein, der wegfliegt.
»Was schreibst du?« Zellengenosse spricht wieder.
Diese Worte sind Auswurf.
Dieser zitternde Stift ist meine Kehle.
Dieses Blatt Papier ist mein Spucknapf.
»Warum gibst du keine Antwort?« Er ist zu nah zu nah zu nah.
Niemand ist jemals nah genug.
Ich sauge Luft ein und warte darauf, dass er wegläuft, wie alle anderen in meinem Leben. Meine Augen sind aufs Fenster gerichtet, auf eine Verheißung. Eine Verheißung von etwas Großartigem, etwas Wunderbarem, einem Grund für den Irrsinn in meinen Knochen, eine Erklärung für meine Unfähigkeit, jemanden zu berühren, ohne alles zu zerstören. Ein Vogel wird kommen. Er wird weiß sein und auf dem Kopf goldene Federn haben wie eine Krone. Er wird fliegen. Ein Vogel wird kommen. Er wird –
»Hey –«
»Du darfst mich nicht anfassen«, flüstere ich. Ich lüge, doch das verschweige ich. Er darf mich anfassen, aber das werde ich ihm nicht sagen. Bitte fass mich an, möchte ich in Wahrheit sagen.
Aber wenn man mich anfasst, geschieht Seltsames. Schlimmes.
Totes.
Ich kann mich nicht an die Wärme einer Umarmung erinnern. Meine Arme schmerzen von der brutalen Kälte der Isolation. Meine eigene Mutter konnte mich nicht im Arm halten. Mein Vater konnte meine frierenden Hände nicht wärmen. Ich lebe im Nichts.
Hallo.
Welt.
Du wirst mich vergessen.
Klopf klopf.
Zellengenosse springt auf.
Zeit zum Duschen.
3
Die Tür geht auf. Dahinter ein Abgrund.
Keine Farbe, kein Licht, keine Verheißung, nur Grauen. Keine Worte. Keine Anweisung. Nur die offene Tür, die immer das Gleiche bedeutet.
Zellengenosse hat Fragen.
»Was zum Teufel?« Er schaut von mir zu diesem Trugbild von Flucht. »Die lassen uns raus?«
Die werden uns nie rauslassen. »Zeit zum Duschen.«
»Duschen?« Seine Stimme klingt tonloser, aber immer noch fragend.
»Wir haben nicht viel Zeit«, sage ich. »Müssen uns beeilen.«
»Warte mal, was?« Er greift nach meinem Arm, doch ich weiche aus. »Aber es ist dunkel da draußen – wir können nicht sehen, wo wir –«
»Schnell.« Ich schaue zu Boden. »Halt dich an meinem T-Shirt fest.«
»Wie meinst du –«
In der Ferne schrillt eine Sirene. Ein Brummen kommt näher. Bald wird die ganze Zelle vibrieren, und dann geht die Tür zu. Ich packe Zellengenosse am T-Shirt und ziehe ihn mit mir ins Schwarze. »Sei. Ganz. Still.«
»Aber –«
»Still«, zische ich. Ich zupfe an seinem T-Shirt, damit er mir folgt, und taste mich voran durch das Labyrinth des Irrenhauses. Es ist ein Heim, ein Zentrum für gestrauchelte Jugendliche, für verlassene Kinder aus zerbrochenen Familien, ein Zufluchtsort für die psychisch Kranken. Es ist ein Gefängnis. Sie geben uns kaum etwas zu essen, und wir sehen uns nie. Nur ganz selten, wenn ein Lichtstrahl durch die Glasschlitze fällt, die sie als Fenster bezeichnen. Die Nächte sind zerfetzt von Schreien und Schluchzen, Jammern und Klagelauten, den Geräuschen von reißendem Fleisch und brechenden Knochen, durch Gewalt oder aus freiem Willen, das weiß ich nicht. Die ersten drei Monate habe ich in Gesellschaft meines eigenen Gestanks zugebracht. Niemand hat mir gesagt, wo sich Klos und Duschen befinden. Niemand hat mir gesagt, wie das System funktioniert. Niemand spricht mit mir, außer um schlechte Nachrichten zu übermitteln. Niemand berührt mich. Jungen und Mädchen finden niemals zusammen.
Bis gestern.
Das kann kein Zufall sein.
Meine Augen gewöhnen sich an den künstlichen Mantel der Nacht. Meine Finger tasten an den rauen Wänden entlang, und Zellengenosse bleibt stumm. Ich bin beinahe stolz auf ihn. Er ist fast 30 Zentimeter größer als ich. Sein Körper ist fest und muskulös, kraftvoll wie bei Jungen meines Alters. Die Welt hat ihn noch nicht gebrochen. So viel Freiheit durch Ahnungslosigkeit.
»Wa–«
Ich zerre an seinem T-Shirt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Wir haben die Korridore noch nicht hinter uns. Dieser Mensch könnte mich mit zwei Fingern umbringen, aber ich habe das Gefühl, ihn beschützen zu müssen. Er ahnt nicht, dass seine Unwissenheit ihn verletzlich macht. Er ahnt nicht, dass sie ihn ohne jeden Grund töten könnten.
Ich habe beschlossen, mich nicht vor ihm zu fürchten. Ich habe beschlossen, dass er nicht bedrohlich, sondern unreif auf mich wirkt. Er ist mir so vertraut so vertraut so vertraut. Ich kannte mal einen Jungen mit solchen blauen Augen, und meine Erinnerungen wollen nicht zulassen, dass ich ihn hasse.
Vielleicht hätte ich gerne einen Freund.
Noch zwei Meter, dann wird die Wand glatter, und wir biegen rechts ab. Ein halber Meter leerer Raum, dann kommen wir zu einer Tür. Die Klinke ist kaputt, man greift in Holzsplitter. Drei Herzschläge, um festzustellen, dass wir alleine sind. Ein Schritt nach vorne, um die Tür aufzudrücken. Ein leises Knarren. Der Raum fühlt sich so an wie immer. »Hier entlang«, flüstere ich.
Ich ziehe den Zellengenossen zu der Reihe von Duschen und suche im Abfluss nach Seifenresten. Zwei Stücke finde ich, eines doppelt so groß wie das andere. »Mach die Hand auf«, sage ich in die Dunkelheit. »Es ist glitschig, lass es nicht fallen. Wir haben Glück heute, es gibt sonst kaum Seife.«
Er bleibt ein paar Sekunden lang still, und ich bin beunruhigt.
»Bist du noch da?« Ich frage mich, ob das die Falle ist. Der Plan. Ob er mich vielleicht in diesem engen Raum im Dunkeln töten soll. Ich habe nie erfahren, was man hier mit mir vorhat. Ob die damit zufrieden sind, mich nur wegzusperren. Aber ich habe immer damit gerechnet, dass sie mich töten wollen. Das scheint mir naheliegend.
Ich kann nicht behaupten, dass ich es nicht verdient hätte.
Aber ich bin hier wegen etwas, das ich niemals tun wollte. Und niemand scheint sich darum zu scheren, dass es ein Unfall war.
Meine Eltern haben auch nicht versucht, mir zu helfen.
Ich höre nirgendwo Wasser laufen, und mir bleibt fast das Herz stehen. Voll ist es hier nie, aber sonst sind wenigstens ein oder zwei Duschen in Betrieb. Mir ist klar geworden, dass die meisten Insassen entweder so verrückt sind, dass sie den Weg zu den Duschen gar nicht erst finden, oder dass es ihnen egal ist.
Ich schlucke.
»Wie heißt du?« Seine Stimme zerschneidet meinen Gedankenfluss und die Dunkelheit. Ich spüre seinen Atem, dichter bei mir als zuvor. Mein Herz rast, ich weiß nicht, warum, aber ich kann nichts dagegen tun. »Warum sagst du mir deinen Namen nicht?«
»Ist deine Hand offen?«, frage ich heiser. Mein Mund scheint ausgetrocknet.
Er rückt näher heran, und ich wage kaum Luft zu holen. Seine Finger streifen den starren Stoff meiner Kleidung, und ich kann ausatmen. Hauptsache, er berührt meine Haut nicht. Hauptsache, er berührt meine Haut nicht. Hauptsache, er berührt meine Haut nicht. Das scheint die Lösung zu sein. Mein dünnes T-Shirt ist im harten Wasser dieser Anstalt so oft gewaschen worden, dass es sich wie Sackstoff anfühlt. Ich lasse das größere Stück Seife in die Hand des Zellengenossen gleiten und gehe auf Zehenspitzen rückwärts. »Ich stelle jetzt die Dusche für dich an«, erkläre ich mit gedämpfter Stimme, falls mich doch jemand hören kann.
»Was soll ich mit meinen Kleidern machen?« Er ist mir immer noch viel zu nah.
Ich blinzle 1000 Mal. »Die musst du ausziehen.«
Sein Lachen klingt wie amüsiertes Schnauben. »Das weiß ich. Ich meine, was soll ich mit ihnen machen, während ich dusche?«
»Versuche sie nicht nass zu machen.«
Er holt tief Luft. »Wie viel Zeit haben wir?«
»Zwei Minuten.«
»Großer Gott, wieso hast du das nicht gesa–«
Ich stelle seine Dusche im selben Moment an wie meine, und seine Worte gehen im Prasseln der spitzen Geschosse aus den defekten Duschköpfen unter.
Ich bewege mich mechanisch. Ich habe das schon oft gemacht und mir die effektivsten Methoden für Schrubben und Abwaschen und den sparsamsten Umgang mit der Seife für Körper und Haare eingeprägt. Es gibt keine Handtücher. Deshalb darf man keinen Körperteil zu nass machen, sonst wird man nicht richtig trocken und stirbt dann fast an Lungenentzündung. Damit kenne ich mich aus.
In genau 90 Sekunden bin ich fertig, habe meine Haare ausgewrungen und schlüpfe wieder in meine zerschlissenen Kleider. Nur meine Tennisschuhe sind noch in halbwegs gutem Zustand. Man hat hier wenig Gelegenheit, herumzulaufen.
Zellengenosse ist fast sofort zur Stelle. Ich bin erfreut, dass er so lernfähig ist.
»Halt dich am Saum meines T-Shirts fest«, sage ich. »Wir müssen uns beeilen.«
Seine Finger streifen einen langen Moment meinen Nacken, und ich muss mir auf die Lippe beißen, weil das Gefühl so heftig ist. Ich bleibe beinahe stehen. Niemand berührt mit den Händen meine Haut.
Ich haste vorwärts, um seine Finger abzuschütteln. Er stolpert hinterher, um nicht zurückzubleiben.
Als wir schließlich wieder in der engen Zelle sind, starrt Zellengenosse mich hartnäckig an.
Ich rolle mich in der Ecke ein. Er hat immer noch mein Bett, meine Decke, mein Kissen. Ich vergebe ihm seine Unwissenheit, aber es ist vielleicht noch zu früh, um Freundschaft zu schließen. Vielleicht war es vorschnell von mir, ihm zu helfen. Vielleicht ist er nur hier, um mich zu quälen. Aber wenn ich mich nicht wärme, werde ich krank. Meine Haare sind nass, und die Decke, in die ich mich sonst hülle, liegt bei ihm. Vielleicht habe ich immer noch Angst vor ihm.
Ich atme zu heftig ein, schaue zu rasch auf ins trübe Tageslicht. Zellengenosse hat mir 2 Decken um die Schultern gelegt.
Meine.
Und seine.
»Tut mir leid, dass ich mich wie ein Arschloch benehme«, sagt er leise zur Wand. Er fasst mich nicht an, und ich bin enttäuscht froh, dass er es nicht tut. Ich wünschte, er würde mich berühren. Er sollte es lieber nicht tun. Niemand sollte mich berühren.
»Ich bin Adam«, sagt er langsam und geht rückwärts, um Abstand zwischen uns zu bringen. Mit einer Hand schiebt er mein Bettgestell auf meine Seite der Zelle.
Adam.
Was für ein schöner Name. Zellengenosse hat einen schönen Namen.
Ich mochte diesen Namen immer, aber ich weiß nicht mehr, warum.
Ich lege mich sofort auf die bohrenden Bettfedern. Die Metallspiralen drücken sich in meine Haut, aber ich spüre es kaum, weil ich so müde bin. Seit 24 Stunden habe ich nicht geschlafen. Adam ist ein schöner Name, denke ich noch, bevor die Erschöpfung über meinen Körper herfällt.
4
Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt.
Das Grauen reißt mir die Augenlider auf.
Mein Körper ist in kalten Schweiß getränkt, mein Hirn schwimmt in nie vergessenen Schmerzwellen. Meine Augen richten sich auf schwarze Kreise, die sich im Dunkeln auflösen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich meinen Zellengenossen mit meinen Träumen erschreckt habe. Manchmal schreie ich laut.
Adam starrt mich an.
Ich keuche, schaffe es irgendwie, mich aufzurichten. Ziehe die Decken enger um mich und merke, dass ich Adam das einzige Mittel zum Wärmen gestohlen habe. Bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass er auch frieren könnte. Ich zittere, aber die Silhouette seines Körpers wirkt ruhig und kraftvoll in der Schwärze der Nacht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Es gibt nichts zu sagen.
»Die Schreie hören hier wohl nie auf, oder?«
Die Schreie sind nur der Anfang. »Ja«, flüstere ich kaum hörbar. Ich spüre, dass ich rot werde, und bin froh, dass er es im Dunkeln nicht sehen kann. Er muss meine Schreie gehört haben.
Manchmal wünsche ich mir, nie schlafen zu müssen. Manchmal denke ich, wenn ich stillhalten, mich gar nicht rühren und meine Lippen nicht bewegen würde, könnte sich alles verändern. Wenn ich erstarre, erstarrt vielleicht auch der Schmerz. Manchmal bewege ich mich stundenlang nicht. Keinen Zentimeter.
Wenn die Zeit stillsteht, kann nichts schiefgehen.
»Alles in Ordnung?« Adams Stimme klingt besorgt. Ich betrachte seine geballten Fäuste, die Furche zwischen seinen Brauen, die Spannung in seinem Kiefer. Die Person, die mir mein Bett und meine Decke gestohlen hat, ist dieselbe, die heute Nacht ohne Decke auskommt. Vor wenigen Stunden noch großspurig und rücksichtslos; nun so still und achtsam. Es macht mir Angst, dass dieser Ort ihn so schnell brechen konnte. Ich frage mich, was er gehört hat, während ich geschlafen habe.
Könnte ich ihm das Grauen doch nur ersparen.
Etwas zerbricht; ein gequälter Schrei verhallt in der Ferne. Diese Zellen sind begraben zwischen Betonwänden, dicker als Böden und Decken zusammen, um Laute zu dämpfen. Wenn ich diese Qual hören kann, muss sie gewaltig sein. Jede Nacht gibt es hier auch Laute, die ich nicht höre. Und jede Nacht frage ich mich, ob ich als Nächstes dran bin.
»Du bist nicht verrückt.«
Ich reiße die Augen auf. Er hat den Kopf schräg gelegt, und sein Blick ist klar, trotz des nachtschwarzen Schleiers der Luft. Er holt tief Luft. »Ich dachte, hier drin gäbe es nur Irre«, fährt er fort. »Ich dachte, sie hätten mich mit einer Irren eingesperrt.«
Ich sauge hastig Luft ein. »Komisch. Das dachte ich von dir auch.«
1
2
3 Sekunden vergehen.
Er grinst so breit und echt, so erfrischend aufrichtig, dass etwas wie ein Donnerschlag meinen Körper erschüttert. Etwas sticht in meinen Augen und bricht mir die Knie. Seit 265 Tagen hatte ich kein Lächeln gesehen.
Adam steht auf.
Ich halte ihm seine Decke hin.
Er nimmt sie und legt sie enger um mich, und in meiner Brust wird etwas eng. Meine Lungen sind durchlöchert und fest verschnürt, und ich habe gerade beschlossen, mich eine Ewigkeit nicht mehr zu bewegen, als Adam spricht.
»Was ist los mit dir?«
Meine Eltern haben mich nicht mehr angefasst, seit ich zu krabbeln begann. Ich habe Mitschüler zum Weinen gebracht, indem ich sie an der Hand nahm. In der Schule musste ich alleine lernen, damit ich den anderen Kindern nicht weh tat. Ich hatte nie Freunde. Ich habe nie den Trost einer mütterlichen Umarmung erlebt. Ich habe nie die Zärtlichkeit eines väterlichen Kusses erfahren. Ich bin nicht verrückt. »Nichts.«
5 weitere Sekunden. »Darf ich mich zu dir setzen?«
Das wäre wunderbar. »Nein.« Ich starre wieder die Wand an.
Er bewegt den Kiefer hin und her. Streicht sich mit der Hand durchs Haar, und ich merke erst jetzt, dass er sein T-Shirt ausgezogen hat. Es ist dunkel hier drin, nur eine Spur Mondlicht fällt jetzt durch das kleine Fenster, aber ich kann das Spiel der Muskeln an seinem Arm erkennen, und plötzlich gerate ich in Brand. Flammen lecken an meiner Haut, und etwas Heißes explodiert in meinem Bauch. Jeder Zentimeter von Adams Körper ist rohe Kraft, jedes Stück Haut scheint im Dunkeln zu leuchten. 17 Jahre lang habe ich nie jemanden wie ihn erlebt. 17 Jahre lang habe ich nie mit einem Jungen meines Alters gesprochen. Weil ich ein Monster bin.
Ich schließe die Augen, bis sie fest vernäht sind.
Ich höre sein Bettgestell knarren, höre das Ächzen der Federn, als er sich setzt. Ich trenne meine Augen wieder auf und starre auf den Boden. »Dir ist doch bestimmt kalt.«
»Nein.« Er seufzt tief. »Mir ist glühend heiß.«
Ich springe so hastig auf, dass die Decken zu Boden fallen. »Bist du krank?« Meine Augen tasten sein Gesicht ab, aber ich sehe kein Anzeichen von Fieber und wage es nicht, ihm näher zu kommen. »Ist dir schwindlig? Tun dir die Gelenke weh?« Ich versuche mich an meine eigenen Symptome zu erinnern. Eine Woche lang wurde ich von meinem eigenen Körper ans Bett gekettet. Ich konnte nur zur Tür kriechen und mit dem Gesicht ins Essen fallen. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich überlebt habe.
»Wie heißt du?«
Diese Frage stellt er jetzt zum 4. Mal. »Du bist vielleicht krank«, antworte ich.
»Ich bin nicht krank. Mir ist nur heiß. Ich schlafe sonst nicht in Kleidern.«
In meinem Bauch fangen Schmetterlinge Feuer. Eine rätselhafte Scham versengt mein Fleisch. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll.
Ein tiefer Atemzug. »Ich hab mich gestern wie ein Vollidiot benommen. Ich habe dich wie Dreck behandelt, und es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen.«
Ich bringe den Mut auf, ihn anzusehen.
Seine Augen sind kobaltblau, blau wie ein Bluterguss. Klar, tief und entschlossen. Er sieht entschieden und versonnen zugleich aus. Als habe er die ganze Nacht darüber nachgedacht.
»Okay.«
»Warum willst du mir deinen Namen nicht sagen?« Er beugt sich vor, und ich erstarre zu Eis.
Doch dann beginne ich zu tauen.
Zu zerfließen. »Juliette«, flüstere ich. »Ich heiße Juliette.«
Auf seine Lippen tritt ein sanftes Lächeln, das mein Rückgrat zertrümmert. Er wiederholt meinen Namen wie ein Wort, das ihn erheitert. Amüsiert. Erfreut.
17 Jahre hat nie jemand meinen Namen so ausgesprochen.
5
Ich weiß nicht mehr, wann es anfing.
Ich weiß nicht mehr, warum.
Ich weiß nur, dass sie schrien.
Meine Mutter schrie, als sie merkte, dass sie mich nicht berühren konnte. Mein Vater schrie, als er merkte, was ich meiner Mutter angetan hatte. Beide schrien, wenn sie mich in meinem Zimmer einsperrten und mir sagten, ich solle dankbar sein. Für mein Essen. Für ihren menschlichen Umgang mit diesem Ding, das unmöglich ihr Kind sein konnte. Für den Zollstock, mit dem sie ausmaßen, wie weit ich wegbleiben musste.
Ich hatte ihr Leben zerstört, sagten sie mir.
Ich hatte ihr Glück kaputtgemacht. Und die Hoffnungen meiner Mutter, noch weitere Kinder zu haben.
Konnte ich denn nicht sehen, was ich getan hatte, fragten sie mich. Konnte ich nicht sehen, dass ich alles ruiniert hatte.
Ich habe mich so sehr angestrengt, alles wiedergutzumachen. Jeden Tag bemühte ich mich, so zu sein, wie sie es sich wünschten. Dauernd versuchte ich mich zu bessern, aber eigentlich wusste ich nicht, wie.
Ich weiß jetzt nur, dass die Wissenschaftler sich irren.
Die Erde ist eine Scheibe.
Das weiß ich, weil ich vom Rand gestoßen wurde, und seit 17 Jahren versuche mich daran festzuhalten. Seit 17 Jahren versuche ich wieder auf die Scheibe zu klettern, aber man kann die Schwerkraft nicht bezwingen, wenn niemand einem die Hand reicht.
Wenn niemand es wagt, einen zu berühren.
Heute schneit es.
Der Beton ist kalt und härter als sonst, aber ich finde die eisige Kälte besser als die erstickende Schwüle von Sommertagen. Sommer ist wie ein Gartopf, der alles nach und nach zum Schmoren bringt. Sommer verheißt mit schönen Wörtern Glück und serviert dann Fäulnis und Gestank. Ich hasse die Hitze und den klebrigen schweißnassen Dreck, den sie erzeugt. Ich hasse die gelangweilte Trägheit der Sonne, die so selbstverliebt ist, dass sie nicht einmal merkt, wie viele Stunden wir mit ihr verbringen. Sie ist ein arrogantes Wesen, das die Welt im Stich lässt, sobald sie das Interesse an ihr verliert.
Der Mond dagegen ist ein treuer Begleiter.
Er verschwindet nie. Er ist immer da, zuverlässig, schaut herunter, kennt unsere hellen und dunklen Momente, wandelt sich unentwegt, so wie wir. Jeden Tag zeigt er sich in einer anderen Form. Manchmal schwach und schwindend, manchmal kraftvoll und leuchtend. Der Mond versteht, was es heißt, Mensch zu sein.
Unsicher. Allein. Gezeichnet von Kratern der Unvollkommenheit.
Ich starre so lange aus dem Fenster, bis ich mich vergesse. Strecke die Hand aus, um eine Schneeflocke zu fangen. Meine Faust ist leer, umschließt nur kalte Luft.
Ich möchte mit dieser Faust, die an meinem Handgelenk befestigt ist, das Fenster durchstoßen.
Um etwas zu spüren.
Um mich menschlich zu fühlen.
»Wie viel Uhr ist es?«
Meine Lider flattern. Seine Stimme bringt mich zurück in eine Welt, die ich vergessen will. »Weiß nicht«, antworte ich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Ich weiß auch nichts mehr über Wochentage, Monate oder Jahreszeiten.
Es gibt ohnehin keine Jahreszeiten mehr.
Tiere sterben, Vögel fliegen nicht mehr, es gibt kaum noch Feldfrüchte oder Blumen. Das Wetter ist unzuverlässig. Im Winter hat es manchmal überall 30 Grad, und dann kommt es plötzlich zu Schneefällen. Es gibt nicht mehr genug Futter für die Tiere, und man kann nicht mehr genug anbauen, um die Bevölkerung zu ernähren. Die Menschen starben wie die Fliegen, bevor das Reestablishment die Macht übernahm und Lösungen versprach. Die Tiere waren so ausgehungert, dass sie alles fraßen, und die Menschen waren so verzweifelt, dass sie die vergifteten Tiere schlachteten. Dass sie starben, weil sie überleben wollten. Klima, Pflanzen, Tiere und Menschen sind untrennbar verknüpft. Doch die Elemente führten Krieg gegeneinander, weil wir unser Ökosystem misshandelt hatten. Die Atmosphäre misshandelt hatten. Die Tiere und unsere Mitmenschen.
Das Reestablishment verhieß Besserung. Die Gesundheitslage der Bevölkerung hat sich etwas verbessert unter dem neuen Regime, aber dafür sind mehr Menschen durch Waffengewalt zu Tode gekommen als zuvor durch Hunger. Und es wird immer schlimmer.
»Juliette?«
Mein Kopf fährt hoch.
Er betrachtet mich aufmerksam, besorgt, prüfend.
Ich wende den Blick ab.
Er räuspert sich. »Es gibt also nur einmal am Tag Essen?«
Wir schauen unwillkürlich auf den schmalen Spalt in der Tür.
Ich ziehe die Knie an die Brust. Wenn ich ganz still sitze, spüre ich kaum, dass sich die Metallfedern in meine Haut bohren. »Es gibt keine Regeln fürs Essen«, antworte ich. Mein Finger zeichnet ein Muster auf der groben Decke. »Meistens bekommt man morgens was, aber danach weiß man nie. Manchmal haben wir … Glück.« Meine Augen huschen zu der kleinen Glasscheibe in der Wand. Rotes und rosafarbenes Licht sickert herein, und ich weiß, dass etwas Neues beginnt. Der Beginn desselben Endes. Ein neuer Tag.
Vielleicht werde ich heute sterben.
Vielleicht wird heute ein Vogel fliegen.
»Das ist alles? Die machen einmal am Tag die Tür auf, damit man sein Geschäft erledigen kann, und wenn man Glück hat, kriegt man was zu essen? Das ist alles?«
Der Vogel wird weiß sein und goldene Federn auf dem Kopf haben wie eine Krone. Er wird fliegen. »Ja.«
»Es gibt keine … Gruppentherapie?« Er lacht beinahe.
»Als du hier reinkamst, hatte ich seit 264 Tagen mit niemandem geredet.«
Sein Schweigen spricht Bände. Ich kann die Last der Schuld auf seinen Schultern fast mit Händen greifen. »Wie lange musst du drinbleiben?«, fragt er nach einer Weile.
Für immer. »Ich weiß es nicht.« Etwas Mechanisches knarrt/ächzt/knirscht in der Ferne. Mein Leben besteht aus versäumten Chancen, erstarrt zu vier Wänden.
»Was ist mit deinen Eltern?« Seine Stimme klingt so ernst und traurig, als kenne er die Antwort bereits.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. »Warum bist du hier?« Ich spreche zu meinen Fingern, um seinem Blick auszuweichen. Meine Hände kenne ich so gut, dass ich genau weiß, an welchen Stellen Verletzungen meine Haut beschädigt haben. Kleine Hände. Schmale Finger. Ich balle sie zur Faust und öffne sie wieder, um die Spannung abzubauen. Er hat noch nicht geantwortet.
Ich schaue auf.
»Ich bin nicht verrückt«, sagt er nur.
»Das behaupten wir alle.« Ich schüttle leicht den Kopf. Beiße mir auf die Lippe. Mein Blick huscht zum Fenster.
»Warum schaust du ständig raus?«
Ich habe nichts gegen seine Fragen. Es ist nur seltsam, jemanden zum Reden zu haben, Kraft aufbringen zu müssen, damit ich meine Lippen bewegen kann, um mich zu erklären. Niemanden hat das interessiert. Niemand hat mich lange genug beobachtet, um sich zu fragen, warum ich aus dem Fenster starre. Niemand hat mich jemals wie einen gleichwertigen Menschen behandelt. Aber Adam weiß ja nicht, dass ich ein Monster bin ein Geheimnis habe. Ich frage mich, wann er wohl versuchen wird, um sein Leben zu rennen.
Ich habe vergessen zu antworten, und er schaut mich abwartend an.
Ich streiche mir eine Haarsträhne hinters Ohr und überlege es mir anders. »Warum starrst du mich immer an?«
Seine Augen sind zwei Mikroskope, und sie untersuchen die Zellen meines Daseins. Sorgfältig und aufmerksam. »Ich dachte, die hätten mich zu einem Mädchen gesperrt, weil du verrückt bist. Ich dachte, die versuchen mich zu foltern, indem sie mich mit einer Irren einsperren. Ich dachte, du seist meine Bestrafung.«
»Deshalb hast du mir mein Bett gestohlen.« Um Macht zu demonstrieren. Um das Revier zu markieren. Um anzugreifen.
Er senkt den Blick. Faltet die Hände, löst sie wieder, reibt sich den Nacken. »Warum hast du mir geholfen? Woher hast du gewusst, dass ich dir nichts antun würde?«
Ich zähle meine Finger, um zu wissen, dass sie noch vollzählig sind. »Hab ich nicht.«
»Was hast du nicht?«
»Adam.« Meine Lippen umfassen seinen Namen. Ich bin erstaunt, wie gut sich dieser Klang anfühlt.
Adam sitzt fast so reglos da wie ich. In seinen Augen erscheint ein neues Gefühl, das ich nicht deuten kann. »Ja?«
»Wie ist es?«, frage ich, immer leiser werdend. »Draußen. In der realen Welt. Ist es schlimmer geworden?«
Schmerz verwüstet sein fein geschnittenes Gesicht. Es dauert ein paar Herzschläge, bis er antwortet. »Ganz ehrlich? Ich bin mir nicht sicher, ob es hier drin besser ist oder draußen.«
Er schaut zu der Glasscheibe, die uns von der Welt trennt. Ich tue es ihm gleich. Warte darauf, dass seine Lippen sich öffnen, damit ich ihm weiter zuhören kann. Und dann muss ich mich konzentrieren, weil seine Worte in meinem Kopf herumwirbeln, meine Sinne betäuben, mich benebeln.
Wusstest du, dass es eine internationale Bewegung gibt?, fragt Adam.
Nein, antworte ich. Ich erzähle ihm nicht, dass ich vor 3 Jahren von zu Hause verschleppt wurde. Genau 7 Jahre, nachdem das Reestablishment mit seiner Propaganda begann, und 4 Monate nach der Machtübernahme. Ich erzähle nicht, wie wenig ich über die neue Welt weiß.
Adam berichtet, das Reestablishment habe Einfluss auf alle Länder und warte nur auf den Moment, sämtliche politischen Machtpositionen mit seinen eigenen Leuten zu besetzen. Er sagt, die verbliebenen bewohnbaren Flächen der Erde seien in 3333 Sektoren unterteilt worden, beherrscht von jeweils unterschiedlichen Machthabern.
Wusstest du, dass sie uns belogen haben?, fragt er.
Wusstest du, dass sie behauptet haben, jemand müsste die Macht übernehmen, die Gesellschaft retten, den Frieden wiederherstellen? Und das sei nur möglich, indem man alle Systemgegner tötet?
Wusstest du das?, fragt mich Adam.
Und da nicke ich. Sage ja.
Denn daran erinnere ich mich: an die Wut. Die Aufstände. Die Krawalle.
Meine Augen schließen sich, um die schlimmen Erinnerungen auszublenden, doch das Gegenteil tritt ein. Proteste. Demonstrationen. Schreie. Ich sehe Frauen und Kinder verhungern, zerstörte Häuser, verbrannte Landschaften, deren einzige Ernte verfaulende Leichen sind. Tot tot tot und rot, weinrot und rotbraun und das dunkelste Lippenstiftrot meiner Mutter auf der Erde verschmiert.
So vieles alles alles tot.