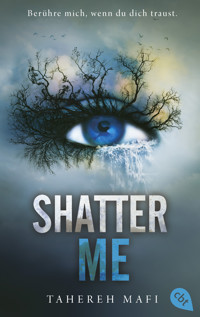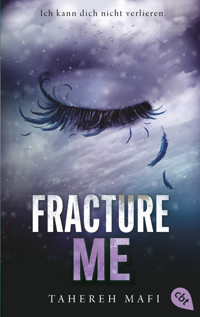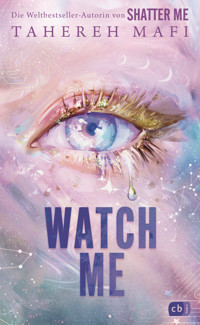
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Shatter-Me-Reihe: The New Republic
- Sprache: Deutsch
Die Welt kurz vorm Krieg – und zwei Jugendliche, die auf verfeindeten Seiten stehen
Vor zehn Jahren versank die Welt im Krieg: Rebellen stürzten das grausame Reestablishment und gründeten die Neue Republik voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch die Macht der Republik ist fragil, ihre Feinde lauern überall. Als sich die Lage immer weiter zuspitzt, wittert James Anderson seine Chance, endlich aus dem Schatten seines Bruders Aaron Warner heraustreten und sich beweisen zu können.
Auf der Seite des Reestablishment hat Rosabelle Wolff ebenfalls auf diesen Moment gewartet. Militärisch abgeschottet auf einer Insel planen die überlebenden Anhänger des Reestablishment, die Macht wieder an sich zu reißen. Tödlich präzise und gerissen ist Rosabelle ihre perfekte Waffe.
Der Weltbestseller der dystopischen Fantasy geht endlich weiter! Das Spin-off zur Shatter-Me-Reihe von Tahereh Mafi
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tahereh Mafi
Watch ME
Aus dem Amerikanischenvon Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.© 2025 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2025 Tahereh Mafi
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel: »Watch Me« bei Storytide, einem Imprint von HarperCollins Publishers, New York
Übersetzung: Mara Henke
Lektorat: Ulla Mothes
Coverkonzeption: Geviert GbR
Covermotiv: © 2025 by Alexis Franklin
skn · Herstellung: AnG
Satz und Reproduktion: GGP Media GmbH, Pößneck
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33176-4V002
www.cbj-verlag.de
Die Frage der nächsten Generation wird nicht sein, wie man das Volk befreien kann, sondern wie man es dazu bringen kann, seine Unfreiheit zu lieben.
Aldous Huxley
Niemand wird je wissen, wie viel Gewalt nötig war, um so sanftmütig zu werden.
Unbekannt
1 Rosabelle
Als ich den Schrank öffne, sind die Fächer leer.
Was mich nicht überrascht, das ist schon seit Wochen nicht anders. Nur für Clara tue ich jeden Morgen so, als könne der Küchenschrank etwas anderes enthalten als die immer gleiche Kakerlake, die dort herumwuselt.
Ich schließe den Schrank, drehe mich zu Clara um. Sie verlässt das Bett nur, wenn ich sie trage. Heute hat sie sich aufgesetzt und starrt durch das vereiste Fenster. Ihre hellen Augen wirken im frühen Morgenlicht besonders fahl. Als sie mit zitternder Hand den fadenscheinigen Vorhang einen Spalt öffnet, leuchtet die Fensterscheibe einen Moment lang grellblau auf.
»Wir haben kein Brot mehr«, sage ich. »Ich geh welches holen.«
An manchen Tagen lässt Clara mich losziehen, ohne Fragen zu stellen. An anderen will sie wissen, womit ich die Lebensmittel bezahle, die ich nach Hause bringe. Heute sagt sie: »Ich habe von Mama geträumt.«
Mit regloser Miene erwidere ich: »Schon wieder?«
Clara wendet sich mir zu. Sie ist so mager, dass ihre Augen eingesunken wirken. »Es ging ihr schlecht, Rosa. Sie hat gelitten.«
Ich schlüpfe in meine Stiefel und muss blinzeln, als ich dabei in den hellen Lichtstrahl trete, der durchs Fenster fällt. »Das war nur ein Traum. Tote leiden nicht mehr.«
Clara schaut zur Seite. »Das sagst du immer.«
»Und du starrst zu oft auf ihr Foto.« Ich binde die Stiefel zu. Heute zittert meine rechte Hand nicht, und ich bin einen Moment lang erleichtert. Doch dann fällt mein Blick auf das fast niedergebrannte Feuer im Ofen und den schwindenden Holzstapel daneben, und Panik packt mich. Ich ringe sie nieder. »Außerdem«, füge ich hinzu, »kanntest du sie kaum.«
»Du sprichst ja auch so selten über sie«, erwidert Clara mit einem Seufzer.
Draußen vor dem Fenster entdecke ich einen Rotkopfspecht und sehe fasziniert zu, wie er mit dem Schnabel auf einen bemoosten Baumstamm einhackt. Etwas über zehn Jahre sind vergangen seit dem Fall des Reestablishment. Seither leben wir hier, auf Ark Island, und ich würde ebenfalls zu gern tagtäglich meinen Kopf gegen etwas Hartes schlagen. Ich hole tief Atem, versuche, den ständigen Hungerschmerz nicht zu beachten.
Es ist immer wieder seltsam, Vögel zu sehen.
Sie füllen den Himmel mit Lauten und Farben, lärmen auf Dächern und Ästen. Rundherum wachsen hohe Nadelbäume, den Jahreszeiten nicht unterworfen. Es ist feucht hier, leuchtend grün, kalt. Seen schimmern glatt und unberührt. In der Ferne ragen gezackte Berggipfel in Aquarellfarben auf, oft verschleiert von Nebelschwaden. Wer es warm hatte und keinen Hunger litt, bezeichnete die Landschaft früher als wunderschön.
»Wird nicht lange dauern«, erkläre ich, während ich Papas alten Mantel zuknöpfe. Vor Jahren habe ich die militärischen Abzeichen mit einem stumpfen Messer abgetrennt und mir dabei eine Narbe eingehandelt. »Wenn ich zurück bin, mache ich das Feuer wieder an.«
»Okay«, sagt Clara leise. Dann: »Gestern war Sebastian hier.«
Ich erstarre.
Dann entspanne ich mich langsam und wickle mir den löchrigen Schal meiner Mutter um den Hals, zu fest. Gestern war mir erlaubt worden, in der Fabrik zu arbeiten, und als ich nach Hause gekommen war, hatte Clara schon geschlafen.
»Er hat die Post gebracht«, fügt sie hinzu.
»Die Post«, wiederhole ich. »Er hat den ganzen weiten Weg gemacht, um die Post zu bringen.«
Clara nickt. Sie greift unter ihr Kissen, fördert eine Zeitung und einen dicken Umschlag ohne Aufschrift zutage. Ohne einen Blick darauf zu werfen, stecke ich beides in die Manteltasche.
»Danke«, sage ich leise. Dabei stelle ich mir kurz vor, wie es sich wohl anfühlen würde, Sebastian die Kehle durchzuschneiden.
Clara sieht mich mit schräg gelegtem Kopf an. »Er hat gesagt, dass du am letzten Treffen nicht teilgenommen hast.«
»Du warst krank.«
»Habe ich ihm gesagt.«
Ich schaue zur Tür. »Du musst dem nichts sagen.«
»Er will dich aber immer noch heiraten, Rosa.«
Ich sehe sie scharf an. »Woher willst du das wissen?«
»Wäre das so schlimm?« Sie geht nicht auf meine Frage ein, zittert heftig. »Magst du ihn denn nicht? Ich dachte immer, du magst ihn.«
Ich blicke auf die enge Küche, den kleinen Ofen, den wackligen Tisch und die Stühle, die wir nie benutzen. Auf die Holztafel über der Spüle.
UNSERREESTABLISHMENT
erneuert
UNSEREZUKUNFT
gesichert
Erinnerungen lassen mich innehalten.
Ich war zehn, als ich nach Hause kam und ein Schwarzbär unsere letzten Vorräte fraß. Clara war drei, Mama seit drei Tagen tot. Ich kann mich nicht mehr erinnern, den Bären getötet und die Überreste meiner Mutter begraben zu haben.
Ich erinnere mich aber an das Blut.
Ich erinnere mich daran, wie ich wochenlang die Dielen schrubbte. Die Stäbe von Claras Kinderbett. Die Decke. Mamas letzte Worte waren gewesen: Mach die Augen zu, Rosa. Doch dann hatte sie ihre geschlossen, und meine waren offen geblieben. Wenige Stunden nachdem wir erfahren hatten, dass man Papa nicht wegen Kriegsverbrechen hinrichten würde, hatte sie sich die Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Er hatte dem Feind Geheimnisse verraten, um im Gefängnis vor sich hinvegetieren zu können, und hatte uns damit zu einer erbärmlichen Existenz verurteilt. Lange hatte ich angenommen, Mama hätte sich umgebracht, weil sie die Scham nicht ertragen konnte. Inzwischen glaube ich, sie wusste, dass man sich für Papas Verrat an ihr rächen würde.
Vielleicht hoffte sie auch, die würden ihre Kinder verschonen.
Ich nehme das Bärenfell vom Haken und lege es um Claras zitternde Schultern. Sie hasst das Fell. Der Schmerz des Bären sei noch spürbar in der Hütte, sagt sie immer und behauptet, ihr würde übel davon. Wenn sie sich widerspruchslos darin einhüllen lässt, weiß ich deshalb, dass es schlimm um sie steht.
»Hättest du Sebastian geheiratet, würde es uns jetzt besser gehen«, sagt Clara fröstelnd. Sie hustet, was so furchtbar klingt, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. »Sie würden die Sanktionen aufheben. Und du müsstest nicht jeden Morgen so tun, als sei was zu essen im Schrank.«
Ich sehe meine Schwester an.
Als ich Clara kurz nach der Geburt betrachtete, kam es mir vor, als habe Mama eine Puppe zur Welt gebracht. Erst später wurde mir bewusst, dass ich wahrscheinlich genauso seltsam ausgesehen habe: gespenstisch gläsern. Ich sehe sie häufig an, wenn sie schläft oder die Krankheit sich so verschlimmert, dass Clara ins Koma fällt. Sie ist jetzt dreizehn und so liebenswürdig und optimistisch wie ich in ihrem Alter nie gewesen bin. Trotz unserer sieben Jahre Altersunterschied ähneln wir uns körperlich: absonderlich hellhäutig, das Haar weißblond, die Augen irritierend eisblau. Clara anzuschauen, ist für mich, wie in die Vergangenheit zu blicken, auf die Person, die ich einmal war, eine Person, die ich hätte werden können.
Früher war ich auch sanft.
»Ich glaube, dass er dich wirklich liebt«, sagt sie mit leuchtenden Augen. »Du hättest hören sollen, wie er über dich spricht … Rosa, warte …«
Ich verabschiede mich nicht von meiner Schwester.
Im Flur hole ich das automatische Gewehr aus seinem Versteck, hänge mir die Waffe um und ziehe mir eine abgetragene Sturmhaube über den Kopf. Dann trete ich nach draußen in die Kälte. Dicke Schneeflocken sinken auf meine Wimpern, während hinter mir die Tür zufällt. Der Knall übertönt seine Stimme. Nur damit lässt sich erklären, dass ich erschrocken zusammenzucke.
»Rosabelle«, sagt er, während er lächelnd vor mich tritt. »Immer noch innerlich tot?«
2 Rosabelle
Ich weiche Lieutenant Soledad aus, berühre dabei unwillkürlich die kalte Waffe vor meiner Brust. Soledad ist kein Lieutenant wie früher mehr, der militärische Titel ist ein Relikt aus der Vergangenheit. In dieser neu erfundenen Zeit ist er Chef der Sicherheitskräfte der Insel und somit ein verherrlichter Wichtigtuer, der überall seine Nase reinsteckt. Und ein Tyrann.
Im Vorbeigehen nicke ich Bekannten zu, die mich und Soledad, der neben mir herschreitet, ängstlich mustern. Der Schnee scheint jetzt liegen zu bleiben. Aus Schornsteinen quillt Rauch. Ich zupfe die Sturmhaube zurecht, die alte Wolle ist kratzig, und merke, dass ich nervös bin.
»Ich dachte, mein Termin sei morgen«, sage ich tonlos.
»Und ich dachte, ich überrasche Sie«, erwidert er. »Spontanverhöre erbringen oft interessante Ergebnisse.«
Ich bleibe stehen, sehe ihn an.
Ich kenne Soledad schon seit der Zeit, als er noch jung und kraftvoll und wagemutig war – damals, als er unter meinem Vater diente, dem Oberkommandeur und Regenten von Sektor 52. Inzwischen hat der Lieutenant gebeugte Schultern, seine Haut wirkt wächsern, sein Haar wird schütter. Ihm haftet die Schalheit des Vergangenen an, einer zurückliegenden Epoche, die nur noch an seinem Gesicht zu erkennen ist. Blaues Licht pulsiert an seinen Schläfen, seine schwarzen Augen leuchten gelegentlich auf, werden dann wieder dunkel.
Mein rechter Arm zittert leicht.
Ich spüre das Gewicht des Schlüssels in der eingenähten Geheimtasche von Papas Mantel und ändere in Gedanken meine Tagesplanung. Das einzige Schloss, das ich mein Eigen nennen kann, befindet sich an einem getarnten Schuppen in der Wildnis hinter unserer Hütte. Den Schuppen hatte ich aufsuchen wollen, doch das muss ich jetzt verschieben. Niemand in der Strafkolonie weiß davon, denn Schlösser sind verboten, alle Unterkünfte müssen permanent zugänglich sein, ebenso wie unser Geist. So hielten es unsere Eltern, das war vorgeschrieben im Reestablishment.
Überwachung schafft Sicherheit, pflegte Papa zu sagen. Nur Kriminelle brauchen Privatsphäre.
Soledad trägt seinen Tarnanzug von damals mit dem dreifarbigen Emblem einer vergangenen Ära auf der Brusttasche. Bei den Gefechten während der Revolution hat er einen Arm verloren und stellt seither mit hochgerolltem Ärmel stolz seine silbern glänzende Prothese zur Schau.
»Also«, sagt er. »Wir können uns hier unterhalten oder zum Hauptgebäude gehen. Überlasse ich Ihnen.«
Ich werfe einen flüchtigen Blick auf die Hütten der Strafkolonie. Einzelne Fenster sind in der Morgendämmerung erleuchtet. Die Leute hasten an uns vorbei, vermeiden Blickkontakt mit Soledad, der die Kolonie noch nie aufgesucht hat, ohne etwas Unangenehmes zu verursachen. Wer dort lebt, wurde wegen diverser Vergehen von der Gemeinschaft ausgesondert. Aber niemand ist länger hier als Clara und ich, wir haben immer nur in der Strafkolonie gewohnt, seit wir auf der Insel sind. In den chaotischen Wochen, nachdem unsere Obersten Befehlshabenden umgebracht worden waren, hatte Papa uns mit Mama nach Ark Island geschickt und versprochen, so bald wie möglich nachzukommen. Doch dann stellte sich heraus, dass er vorsätzlich zurückgeblieben war, um sich den Rebellen auszuliefern. Zur Belohnung wurden wir bei unserer Ankunft in die Strafkolonie abgeschoben.
»Müssen wir das jetzt machen?«, frage ich, weil ich an die hungernde, frierende Clara denke. »Ich würde lieber den Termin morgen wahrnehmen.«
»Wieso, haben Sie Pläne heute Vormittag?«, fragt er mit ironischem Unterton. »Sie haben heute keine Schicht in der Fabrik bekommen.«
Ein schneidendes Hungergefühl durchfährt mich so heftig, dass mir der Atem stockt. »Muss nur ein paar Dinge erledigen.«
Soledad packt mich am Kinn, und ich unterdrücke ein erschrockenes Zurückzucken und sehe ihn gleichmütig an. Er starrt mir lange in die Augen, bevor er mich loslässt, und ich bezwinge meinen Abscheu, konzentriere mich darauf, meinen Herzschlag zu verlangsamen.
Rufe mir in Erinnerung, dass ich innerlich tot bin.
»Wie seltsam, Ihre Gedanken nicht zu kennen«, sagt er stirnrunzelnd. »So viele Jahre, und ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Deshalb ist es schwer zu glauben, dass Sie die Wahrheit sagen.«
Wieder spüre ich ein leichtes Zittern in meiner rechten Hand. Ich bin die einzige Person hier, die nicht mit dem Nexus verbunden ist. Sogar Clara wurde schon vor Papas Verhaftung ans Netz angeschlossen. Kurz vor dem Niedergang wurde auf Geheiß des Reestablishment die gesamte Zivilbevölkerung mit dem neuronalen Netzwerk verbunden, einem Programm, das dann von der neuen Regierung rasch außer Kraft gesetzt wurde. Soledad und die anderen halten uns gern vor, dass wir den Krieg deshalb verloren haben, weil die Rebellen nicht gechipt waren.
Mir fällt keine plausible Entschuldigung ein.
»Ein Jammer, dass wir Sie nicht ans System anschließen können«, sagt Soledad schließlich. »Dann wäre vieles einfacher für Sie.«
Erinnerungen flackern auf: kaltes Metall, erstickte Schreie, drogeninduzierte Albträume. Nach Mamas Tod gab es niemanden mehr, der flehte, mit den Experimenten aufzuhören, die mich womöglich umbringen würden.
»Ich kann Ihnen nur beipflichten«, lüge ich.
Soledad verlagert sein Gewicht. An dem Metallarm pulsieren bläuliche Lichtadern, die silbrigen Finger glitzern, als sie angespannt und wieder entspannt werden. »Also«, sagt er wieder. »Wieso haben Sie nicht am Treffen letzte Woche teilgenommen?«
Und so beginnt von jetzt auf gleich ein Verhör. Hier, in der eisigen Kälte. Wo meine Nachbarn uns beobachten können. Mir wird klar, dass vermutlich auch Clara uns durchs Fenster sehen kann.
Plötzlich ist Geschrei zu hören, mein Herzschlag holpert und beruhigt sich erst wieder, als ich Zadies Zwillinge sehe, Jonah und Micah, die im Schnee rangeln. Einer drischt dem anderen laut lachend die Faust in den Bauch. Der Duft von Frühstücksfleisch weht durch die Luft, und mir werden fast die Knie weich.
Ich richte den Blick wieder auf Soledad. »Clara war krank.«
»Koma?«
»Nein.« Ich schaue an ihm vorbei. »Sie hat die ganze Nacht erbrochen.«
»Essen?«
»Blut.«
»Stimmt.« Soledad lacht. Er mustert mich, versucht, durch Papas dicken Mantel meine Figur zu erkennen. »Das leuchtet ein, da Sie ja beide am Verhungern sind.«
»Wir sind nicht am Verhungern.« Eine weitere Lüge.
Neuer Lärm stresst mein Nervensystem. Eine Schar Krähen landet auf einem Hüttendach, flatternd und bedrohlich krächzend. Ich beobachte sie, einen Moment lang fasziniert vom Schillern der schwarzen Federn, da zerreißt plötzlich der Knall zweier Schüsse die Luft.
Ich erstarre unwillkürlich. Zwinge mich dann, die Finger zu bewegen, mich zu regen, den Herzschlag zu beruhigen.
»Drecksvögel«, murmelt Soledad.
Er marschiert zu den beiden herabgestürzten Krähen, stampft auf den hohlen, brüchigen Knochen herum, bis der Schnee rot ist von Blut und schwarz von Federn. Ich blinzle, lasse langsam den Atem in die kalte Luft strömen. Halte mir vor Augen, dass ich seit Jahren innerlich tot bin.
Die meisten Menschen hier verabscheuen die Vögel, weil sie ein Zeichen für den Sturz des Reestablishment sind, ein Symbol für das Scheitern des Projekts. Die New Republic und deren Regierung, bestehend aus den verräterischen Kindern unserer einstigen Obersten Befehlshabenden, werden seither abgrundtief gehasst.
Clara, wird mir klar, wird über die Schüsse beunruhigt sein.
»Ich habe echte Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind«, sagt Soledad und säubert seine Stiefel im frischen Schnee.
Ich schaue auf. Und verstehe sofort. »Sie sind nicht wegen eines Verhörs hier.«
Soledad lächelt, aber seine Augen sind ausdruckslos. »Ihnen entgeht auch gar nichts. Das konnte ich schon immer nicht leiden an Ihnen.«
»Wie viele diesmal?«, frage ich, während mein Puls sich beschleunigt.
»Insgesamt haben wir vier geschnappt. Drei sind bereits abgefertigt. Ein neuer kam gestern Abend dazu, und der ist eindeutig –« Soledads Augen leuchten plötzlich auf, in einem metallischen Blau. Er fährt abrupt herum, stapft zu den Zwillingen, die immer noch im Schnee rangeln, packt einen der Jugendlichen – Micah – und schleudert ihn zu Boden. »Eure Rationen für diese Woche sind gestrichen.«
Jonah springt auf ihn zu. »Aber … wir haben doch nur gespielt –«
»Er hätte dir das Auge ausgeschlagen«, bellt Soledad und macht die typische ruckartige Kopfbewegung.
Micah schreit.
Jonah erstarrt, den Blick auf seinen Zwillingsbruder gerichtet, der noch immer am Boden liegt, aber jetzt unkontrolliert zuckt. Ein Türknallen, dann ein Schrei, und die Mutter der beiden, Zadie, kommt angerannt. Soledad schüttelt angewidert den Kopf, und Micahs Zucken hört auf. In den Armen seiner Mutter beruhigt sich der Junge.
»Entschuldigung, Sir«, keucht er, »ich wollte nicht –«
Soledad wendet sich an Zadie. »Wenn diese beiden Idioten nicht aufhören, sich wie Tiere aufzuführen, bleibt ihr ein weiteres Jahr im Lager, ist das klar?«
In Fenstern rundum tauchen Köpfe auf, verschwinden dann wieder.
Zadie nickt, murmelt etwas Unverständliches und eilt hastig mit den beiden Jungen ins Haus zurück.
Als erneut Stille eingetreten ist, tritt Soledad wieder zu mir und beäugt mich prüfend, aber ich lasse mir keinerlei Gefühlsregung anmerken. Nur so konnte ich hier überleben, wo ich nicht nur vom System, sondern auch von allen Leuten beobachtet werde – einschließlich meiner eigenen Schwester.
Überwachung schafft Sicherheit, Rosa.
Nur Kriminelle brauchen Privatsphäre.
Nur Kriminelle brauchen Privatsphäre.
So viele Jahre habe ich alles geglaubt, was mein Vater sagte.
Das war in jener Zeit, als Soledad noch ein Freund unserer Familie war. In den Jahren, als wir in einem warmen, komfortablen Haus lebten, Essen im Überfluss hatten und unser Kindermädchen mir Seidenkleider anzog und das Haar flocht. Während der Diners meiner Eltern schlich ich gern nach unten, um das perlende Lachen meiner Mutter zu hören.
»Wie viele noch, bevor Sie die Sanktionen aufheben?«, frage ich und reiße mir die Sturmhaube herunter. Mein Haar knistert statisch, ich spüre Druck auf der Brust. Kalter Wind peitscht mir ins Gesicht, aber die eisige Frische auf der Haut ist mir willkommen.
Soledad schüttelt den Kopf. »Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ihr Vater ist immer noch am Leben und versorgt den Feind mit Geheimnissen. Solange wir keinen Einblick in Ihren Kopf haben, bleiben Sie ein Unsicherheitsfaktor.« Er zuckt mit den Schultern, schaut zur Seite. »Wir alle bringen Opfer für die Sicherheit unserer Nation, Rosabelle. Für die Sicherheit unserer Zukunft. Das ist Ihr Opfer – und so wird es vielleicht auch für immer bleiben.«
Er sieht mich wieder an.
»Sie können alle heute oder mit Zeitabstand töten, die Entscheidung überlasse ich Ihnen. Wenn das erledigt ist, sorge ich dafür, dass Clara Medikamente bekommt.«
»Und Lebensmittel«, sage ich zu schnell, halte dann inne, um mich unter Kontrolle zu bekommen. »Und Feuerholz.«
»Dann alle heute«, sagt er und verengt die Augen.
»Alle heute«, bestätige ich. »Und zwar sofort.«
Soledad zieht die Augenbrauen hoch. »Sicher? Die eine hört nicht auf zu schreien. Sie reagiert nicht auf das Sedativum.«
Mir ist unangenehm warm, als hätte ich zu viel an. Ich lenke mich ab, indem ich die Sturmhaube in die Manteltasche stopfe, und schneide mich dabei an dem Umschlag, der dort schon steckt. Der Schmerz fördert meine Konzentration.
Es wäre überhaupt nicht nötig, jemanden auf diese Art umzubringen.
Zu unserer Führungsriege gehören exzellente Fachkräfte aus Medizin und Naturwissenschaft. Wir verfügen über wesentlich fortschrittlichere und humanere Methoden, die wenigen Spione und Spioninnen zu töten, denen es gelingt, sich Zugang zu Ark Island zu verschaffen.
Aber die sollen natürlich auch gar nicht human behandelt werden.
»Legen Sie Wert auf eine bestimmte Tötungsart?«, frage ich, dankbar für meine ausdruckslose Stimme.
Das Dröhnen eines Hubschraubers nähert sich, ich schaue zum Himmel auf. Clara sieht ihn bestimmt auch und weiß, was er zu bedeuten hat.
»Nein, auch das überlasse ich Ihnen.« Diesmal fällt Soledads Lächeln breiter aus. »Sie waren ja immer schon sehr kreativ.«
3 James
»Okay. Gut. Es ist alles gut. Dir geht’s gut«, sage ich, während ich in der kleinen Gefängniszelle auf und ab tigere. Dann bleibe ich stehen, schaue mich zum hundertsten Mal um.
Ich meine, ich vermute jedenfalls mal, das hier ist eine Gefängniszelle.
Der Raum ist sehr sauber, was mich wundert. Außerdem hell erleuchtet durch irgendeine Lichtquelle, die nicht sichtbar ist. Wände und Boden bestehen aus glänzendem Stahl, sodass ich mich überall selbst verzerrt sehe, was mich irremacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon hier drin bin. Ab und zu wird ein sonderbarer Nebel in den Raum geblasen, und danach kommt es mir immer vor, als seien mehrere Stunden vergangen.
Mein großartiger Plan verläuft gar nicht nach Plan.
»Hör zu«, sage ich und deute auf mein verzerrtes Gesicht an der Wand. »Kein Grund zur Panik. Du hast immer noch deine eigenen Klamotten an, außerdem fehlen dir keine Körperteile. Und wenn du schon hier sterben wirst, ist es auch egal, wenn du aufs Klo musst, okay? Die würden dich eh in deiner eigenen Scheiße …«
Sofort ist ein mechanisches Surren zu hören, und im Boden entsteht eine Öffnung. Ich bin jedenfalls schon lange genug hier, um zu wissen, dass jedes Mal eine Platte beiseitegleitet, wenn ich das Wort Klo sage. Eine bodenlose schwarze Grube kommt zum Vorschein, der Rand ist mit scharfen Metallzacken gespickt, die aussehen, als wollten sie mir den Schwanz abbeißen. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so eine Scheißangst beim Pissen. Gefällt mir gar nicht hier.
Ich habe auch schon andere Wörter geschrien, wie Ich will hier raus und Arschlöcher und Erdbeereisbecher, habe aber jedes Mal nur mehr von diesem Nebel ins Gesicht gekriegt.
Ich frage mich, ob die zu Hause inzwischen gemerkt haben, dass ich weg bin.
»Na klar, du Idiot«, murmle ich.
Adam wird so was von stinksauer sein. Warner wird toben. Juliette weint wahrscheinlich schon. Und sollte ich das hier überleben, wird Kenji mich wohl eigenhändig umbringen.
Vor einer Woche oder so fand ich noch, es sei eine richtig tolle Idee, mir Zugang zu Ark Island zu verschaffen. Diese Drecksinsel ist der letzte Zufluchtsort des Reestablishment – das letzte Aufbegehren eines faschistischen, psychopathischen Regimes, das gern die ganze Welt versklaven möchte –, und niemandem ist es bislang je gelungen, dessen Sicherheitssysteme zu überwinden. Im Schoß von Heim und Familie, wo mich alle immer noch wie ein Baby behandeln, das sich nicht mal selbst den Arsch abwischen kann, fand ich diesen Einfall schlichtweg genial. Wenn ich diese eine Sache schaffen würde, die nicht mal der berühmte Aaron Warner Anderson hinbekommt, dann würden mich vielleicht endlich alle respektieren. Würden mich endlich wie einen Mann behandeln, nicht wie einen zehnjährigen Jungen, der früher jede Nacht weinend nach seinem großen Bruder gerufen hat.
»Super gemacht, du Vollidiot.« Ich schlage den Kopf an die Wand.
Sollte ich überhaupt jemals wieder nach Hause zurückkehren, werden die mich gar nichts Cooles mehr machen lassen. Mein Halbbruder regiert zusammen mit seiner Frau praktisch die ganze Welt, und mich wird man zu Schreibtischarbeit verdammen. Ich darf dann wieder Windeln tragen. Kein Ausgang mehr für mich.
Ich lache zittrig, streiche mir mit beiden Händen durchs Haar. Keine Ahnung, wie Juliette ein Jahr lang Einzelhaft überlebt hat. Bevor sie quasi im Alleingang den Fall des Reestablishment in die Wege geleitet hat, war sie unvorstellbaren Qualen ausgesetzt. Als ich mich jetzt in dieser glitzernden Hölle umsehe, wird mir klar, dass ich Juliette nie genug gewürdigt habe. Ich dachte zwar, ich könnte sie gar nicht mehr lieben als sowieso schon – sie und Warner haben mich schließlich mit großgezogen –, aber wenn ich mir vorstelle, was das Reestablishment ihr angetan hat –
Nee, bloß nicht dran denken. Nicht hier. Nicht jetzt.
»Dusche!«, schreie ich.
Nichts tut sich.
»Das war ja wohl ein Griff ins Klo«, knurre ich.
Das Toilettenloch öffnet sich wieder.
»Hört mal«, sage ich wütend, »wenn ihr mich schon nicht umbringen wollt, könntet ihr zumindest mal ein paar Snacks –«
Das habe ich kaum ausgesprochen, als mir etwas einfällt. Ich krame in meinen Taschen herum, bis ich sie finde – eine kleine Tüte Gummibärchen, die ziemlich verklebt aussehen.
Ich muss grinsen.
Diese Arschlöcher haben mir sämtliche Waffen abgenommen, die Süßigkeiten aber nicht. Die habe ich beim Rausgehen aus der Provianttasche der fünfjährigen Gigi gemopst. Dieser Moment scheint mittlerweile eine Ewigkeit zurückzuliegen. Ich reiße die Packung auf, starre einen Moment auf die klebrigen Gummibärchen. Der Geruch mehrerer künstlicher Fruchtaromen ist so intensiv, dass mir ganz anders wird.
»Hey«, sage ich zu meinem wabernden Spiegelbild, »reiß dich zusammen, ja?« Dann schütte ich mir den Inhalt der Tüte in den Mund, stopfe die Packung in die Tasche. Ich kaue heftig und murmle dabei: »Du kommst wieder nach Hause. Du wirst alle wiedersehen. Du –«
Plötzlich beginnt der Raum brummend zu vibrieren, und ich verstumme abrupt. Weiche erschrocken zurück und überschatte die Augen, als die Wand mir gegenüber zuerst verschwindet und dann in einem grellen Licht wiederauftaucht.
Ich habe Besuch bekommen.
Wir wussten von den technischen Innovationen des Reestablishment, haben uns zehn Jahre eingehend damit beschäftigt. Aber die junge Frau, die mir jetzt gegenübersteht, ist wie aus dem Nichts erschienen. Wir starren uns an, rundum von Stahlwänden umgeben. Sie steht so absolut still, dass ich einen Moment lang nicht sicher bin, ob ich halluziniere. Und sie sieht aus wie eine Elfe aus einem Märchen, beinahe durchsichtig, als bestehe sie aus Licht. Weißblonde Haare, Augen, klar wie Eis, gläsern schimmernde Haut.
Absolut umwerfend.
Mein Herz schlägt ziemlich heftig, während ich blinzle und mich straffe. Die Fruchtaromen auf meiner Zunge sind mir gerade gar nicht willkommen, ich habe den ganzen Mund voll halb zerkauter Gummibärchen, die ich jetzt versuche runterzuwürgen. Mann, wie peinlich.
Die zarte Elfe macht einen Schritt auf mich zu, ich zucke zurück.
»Nenne Namen und Geburtsdatum«, sagt sie ausdruckslos, während mich die kalten Augen forschend mustern.
Wie sie den Kopf bewegt, der monotone Klang der Stimme – plötzlich wird mir alles klar. Dieses schöne seltsame Wesen ist kein Mensch, sondern ein Roboter.
Ich atme aus, entspanne mich.
Dass ich es mit einer Roboterin zu tun habe, macht alles einfacher. Zum einen werde ich nicht mit einer Maschine quatschen. Ich mag ein Idiot sein, aber ein bisschen Ahnung habe ich schon. Ich weiß, wie viel Wert das Reestablishment auf Überwachung legt. Ich weiß, dass diese Zelle unter Beobachtung steht. Die lieben Psychospielchen. Lieben es, Menschen zu quälen. Wenn die mich sofort töten wollten, hätten sie mir eine echte Person geschickt, um mich vorher ein bisschen zu traktieren. Stattdessen zeichnet dieses Ding hier wahrscheinlich meine Vitalzeichen auf und checkt mich ab. Durchforstet bestimmt gerade schon eine Datenbank und stellt fest, dass ich der Halbbruder von Aaron Warner Anderson bin; dass Juliette Ferrars dessen Frau ist; dass ich der jüngste Sohn von Paris Anderson bin, dem toten ehemaligen Obersten Befehlshaber von Nordamerika. Denen ist ein fetter Fisch ins Netz gegangen.
Ich würde mich am liebsten selbst treten.
»Ich habe einen Befehl gegeben«, sagt sie jetzt und tritt einen Schritt näher.
Möglichst unauffällig versuche ich zu kauen, um die Bärchen endlich schlucken zu können. »Hör zu, da der Computer in deinem Kopf ohnehin mein Gesicht gescannt und erkannt hat, wer ich bin, werde ich deine Fragen nicht beantworten.« Es gelingt mir, ein paar Brocken zu schlucken. »Wenn du also irgendwelche Infos aus mir rauskriegen sollst, kannst du das knicken. Schickt lieber den Typen rein, der mich foltern soll.«
Sie zögert, offenbar überrascht, und einen Moment lang steigt Röte in ihr Gesicht, die aber sofort wieder verschwindet. Wirklich faszinierend lebensechte Technologie. Sie blinzelt mit diesen seltsamen Augen und sagt dann leise: »Isst du gerade etwas?«
»Gummibärchen«, murmle ich kauend.
Sie blinzelt erneut. Der Blick der Roboterin ist so menschlich, dass ich Gänsehaut bekomme.
»Das verstehe ich nicht«, sagt sie.
»Gummibärchen? Das ist eine weiche Süßigkeit, die –«
»Hast du keine Angst, zu sterben?«
»Also, ähm –« Ich höre auf zu kauen. »Was?«
Und dann schließt sie blitzschnell die Lücke zwischen uns, und mir wird schockartig klar –
Dass das eine lebendige Frau ist. Keine Maschine.
Ich bin so verblüfft über diese Feststellung, so verstört über die Wärme ihrer zarten Hand an meinem Gesicht, dass ich das Messer an meiner Kehle erst mal gar nicht spüre. Mein Hals ist ungeschützt vor der Klinge, aber ich spüre den Atem der Elfe auf meiner Haut, und das macht was mit mir. Ihre Hände sind so klein wie die einer Puppe, und sie riecht frisch, nach Tannennadeln und Seife. Aus der Nähe sehen ihre Augen graublau aus, und am Kragen des Sweatshirts, das sie unter dem löchrigen Mantel trägt, ist ein Stück Haut zu sehen, so zart und schimmernd, dass mir fast schwindlig wird.
Ich verstehe nicht recht, was hier abläuft.
Ich bin ein hochkarätiger Gefangener, und jeder Idiot weiß doch, dass man so jemanden nicht einfach umbringt. Ich müsste stundenlang gefoltert werden, damit ich Informationen preisgebe. Oder als Druckmittel oder Köder benutzt werden. Stattdessen schicken die mir eine Elfe, die sich recken muss, um meinen Hals zu erreichen. Ich komme mir vor, als würde ich von einer Blume attackiert.
Das Messer an der Kehle fühlt sich allerdings trotzdem blöd an.
Ich beschließe, sie wegzustoßen, damit dieser Zustand ein Ende hat. Aber als ich ihre Taille zu fassen bekomme, zieht die Elfe scharf die Luft ein und zuckt zusammen. Ich halte sie intuitiv fest, überwältigt von diesem Gefühl. Sie wirkt so fragil, als könne sie jeden Moment zerbrechen. Ich starre sie verdattert an, und sie erwidert den Blick mit solcher Intensität, dass mir warm in der Brust wird.
»Du riechst nach Apfel«, flüstert sie, und ich will gerade lächeln, als sie mir die Kehle durchschneidet.
Ich sehe das Messer noch aufblitzen, aber sie ist schnell, und ich spüre den Schmerz erst, als sie zurückweicht. Ich hebe eine Hand zu der Wunde, während mir alles vor den Augen verschwimmt, sehe nur noch das Blut tropfen und merke, dass ich nicht mehr sprechen kann.
Bösartiges Biest.
Hat mir auch die Luftröhre durchgeschnitten.
Puppenhändchen hat das eindeutig nicht zum ersten Mal gemacht, und sie beherrscht ihr Handwerk. Ich schwanke und gebe einen erstickten Laut von mir, als ich auf die Knie sinke. Sie ragt vor mir auf, beobachtet mich mit unbewegter Miene.
Wie aus weiter Ferne höre ich sie sagen: »Er ist bereit zur Organentnahme«, während ich auf dem Boden zusammenbreche.
Bevor sie verschwindet, zieht sie die Verpackung der Gummibärchen aus meiner Tasche.
4 James
Undeutliche Geräusche: Stimmen, das Klirren von Metall. Schmerz. Lichtblitze unter meinen Augenlidern. Ich spüre Hände auf meinem Körper, kalten Stahl, kann keinen klaren Gedanken fassen. Vermute nur, dass ich mich auf einer Rolltrage befinde und einen Gang entlanggefahren werde. Ich muss mich dringend konzentrieren, damit ich nicht ohnmächtig werde. Wenn das nämlich passiert, bevor mein Hals verheilt ist, werde ich als Nächstes merken, dass man mir die Nieren rausschneidet.
Oder noch irgendwas Übleres.
Es ist nicht öffentlich bekannt, dass ich über besondere Heilkräfte verfüge, aber ein Geheimnis ist es auch nicht gerade. Das Reestablishment muss in der Einöde echt vor die Hunde gegangen sein, wenn die hier so schlampig arbeiten. Man sollte doch wohl meinen, dass eines der technologisch höchstentwickelten faschistischen Regimes der Welt ein bisschen zu seinen Gefangenen recherchiert hat. Die sollten doch wohl wissen, dass man mir nicht einfach die Kehle aufschlitzen und mich in einem topsecret Gebäude auf einer topsecret Insel auf eine Rolltrage schmeißen kann, ohne dass das gravierende Folgen hat. Und dass man mich vielleicht besser fesseln, mir einen Tranquilizer verpassen oder mir zumindest die Augen zukleben sollte –
Na ja. Egal. Aber derart blöde sind sie wahrscheinlich doch nicht. Sicher eher eine Falle oder so.
Ich sollte mir was einfallen lassen.
Zum Glück kann ich jetzt klarer denken. Meine Atmung stabilisiert sich. Und ein sonderbarer Gedanke schießt mir durch den Kopf: Ich bin dankbar für das ganze Blut an meinem Hals, weil es verbirgt, dass die Wunde zuheilt.
Ich öffne die Augen einen winzigen Spalt.
Erkenne verschwommen Puppenhändchen neben mir, aber da ist noch jemand. Ich höre jetzt auch wieder besser, und mein Puls beschleunigt sich.
»– hatte ja gehofft, pünktlich zum Essen zu Hause zu sein«, sagt ein Mann und lacht. »Hätte mir denken können, dass daraus nichts wird. Alle auf einmal, wie? Da kann ich die Nacht durchschuften, um deinen Leichenberg zu verarbeiten.«
Na super.
Die Lady ist eine Profikillerin. Ich war scharf auf eine Profikillerin. Kenji würde das so was von witzig finden.
»Hatte ich schon gesagt, dass meine Frau Lasagne zum Abendessen macht?« Der Typ lacht wieder, klingt jetzt aber nervös.
Kann ich verstehen. Wer fühlt sich schon wohl in der Nähe von Killern.
»Ihre Lasagne ist superlecker«, plappert der Typ weiter. »Die Frau ist überhaupt super, in jeder Hinsicht. Ich meine, ich wusste, was sie alles draufhat, aber sie überrascht mich trotzdem jeden Tag wieder. Ach, und wir haben gerade unsere Hochzeitsfotos bekommen –«
Ohne Vorwarnung gibt es einen Aufprall, mein Kopf fährt hoch, knallt dann so heftig auf die Stahlfläche, dass ich fast aufschreie. Stumm zähle ich die wüstesten Schimpfwörter auf, die ich kenne.
»Hoppla, hab die Wand gar nicht bemerkt!« Die Stimme des Kerls klingt schrill und etwas panisch. Dann Scharren und Rollgeräusche, und weiter geht’s. Ich muss darauf achten, mich beim Einatmen nicht zu bewegen, aber ich spüre, wie Kraft in meinen Körper zurückkehrt. Was auch bedeutet, dass ich bald mal was unternehmen kann.
»Weißt du«, sagt der nervöse Typ jetzt, »du musst mich nicht die ganze Zeit begleiten.«
»Doch, Jeff«, erwidert sie sanft. »Befehl von Soledad.«
Als sie spricht, rührt sich etwas in mir, und ich boxe mir mental in den Schritt. Die Stimme ist seidenweich – die Stimme einer Psychopathin oder einer Sirene.
»Ah«, sagt er. »Das – wusste ich nicht.«
Zum Glück schweigt Puppenhändchen jetzt. Und ich überlege, wer Soledad sein könnte.
»Hab ich schon gesagt, dass meine Frau heute Abend Lasagne macht?«
Puppenhändchen bleibt stumm.
»Ich liebe Lasagne«, sagt Jeff. »Magst du – Lasagne auch?«
Als das wieder mit Schweigen beantwortet wird, tut mir der Kerl, der mir die Organe rausschneiden soll, schon fast leid. Ich setze mich auf und wende mich ihm zu. »Also ich finde Lasagne auch superlecker, weißt du.«
Jeff schreit.
Ich schaue Puppenhändchen eine Sekunde lang in die Augen, lange genug, um ihr Grauen zu sehen. Dann springe ich von der Rolltrage und schiebe sie mit so viel Wucht in Richtung der Killerin, dass sie an die Wand gepresst wird, was meine Absicht war. Auch sie schreit jetzt, während Jeff kreischend davonrennt. Dabei löst er anscheinend irgendeinen Alarm aus, denn plötzlich blinken Lichter, und schrille Sirenen machen ein Höllengetöse. Ich fahre herum. Leute in weißen Laborkitteln kommen angerannt, aber als sie meinen blutverschmierten Hals sehen – und die junge Frau, die mit dem Rücken an der Wand hinuntergleitet –, ergreifen sie sofort die Flucht. Alles um mich herum ist grellweiß, und ich kann keine Türen erkennen. Keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Und ich brauche dringend eine Waffe.
Puppenhändchen startet die zweite Runde.
Ruckartig schiebt sie die Rolltrage weg, ringt nach Atem. Legt eine Hand auf ihren Brustkorb, und ich muss unwillkürlich grinsen.
»Sorry. Hab ich dir die Rippen gebrochen?«
»Du bist gleich tot.«
»Du vorher.«
»Bilde dir bloß nichts sein«, erwidert sie. »Du hast hier nicht gesiegt. Du hast keine Ahnung, was die gleich mit dir machen.«
Die Sirenen werden schriller und lauter. Kann nur noch Sekunden dauern, bevor hier Menschenmassen reinstürmen.
»Hör zu.« Ich schreie ein bisschen, um den Krach zu übertönen. »Mir gefällt die Lage auch nicht. Ich schlage echt ungern Frauen. Aber da du mich vorhin abgemurkst hast, hab ich was gut, finde ich. Ich gebe dir zwei Optionen: Du zeigst mir, wie ich hier rauskomme, oder du gibst mir dein Messer.«
»Fahr zur Hölle.«
»Hat sich eine der gebrochenen Rippen in deine Lunge gebohrt?«, frage ich lächelnd. »Hast du das Gefühl, du stirbst?«
»Und hast du mal erlebt, wie man dir die Eingeweide rausschneidet?«, kontert sie. Ihre Augen funkeln wütend. »Soll sich richtig unangenehm anfühlen.«
»Du hast fünf Sekunden zum Entscheiden«, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust. »Fünf. Vier. Drei. Zwei – Scheiße –«
Ich taumele rückwärts, weil mir ein stechender Schmerz in den Arm fährt. Offenbar hat Puppenhändchen Option zwei gewählt: mir ihr Messer überlassen. Ich kneife die Augen zusammen und ziehe die Klinge aus meiner Schulter, verkneife mir dabei eine Fluchtirade.
»Du kannst echt schlecht zielen«, knurre ich, während ich das Messer an meinem Sweatshirt abwische. »Falls du’s noch nicht weißt: Die Kunst ist, mich mit einem Wurf zu töten.« Aber als ich aufschaue, sehe ich, weshalb das Messer danebenging: Die Killerin stützt sich an der Wand ab, gekrümmt und aschfahl im Gesicht. Der Blick in ihren Augen wundert mich allerdings. Sie sieht nicht mehr wütend aus.
Puppenhändchen schüttelt den Kopf. Klingt etwas enttäuscht, als sie sagt: »Idiot.«
Dann holt sie eine Spritze aus der Tasche, zieht mit den Zähnen die Kappe ab und bohrt sich die Nadel in den Oberschenkel. Unterdrückt einen Aufschrei, während sie sich aufrichtet und mühsam einatmet.
Donnernde Schritte nähern sich.
Ich fahre herum und sehe einen Trupp Soldaten auf mich zustürmen. Klar, musste wohl irgendwann passieren, das Reestablishment hat sicher nicht vor, mich hier rausspazieren zu lassen. Aber verdammt – die richten Waffen auf mich, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Riesige, schwere, unheimliche Neonteile. Sehen megacool aus. So was will ich auch.
»Rosabelle!«, brüllt jemand.
Ein Mann aus der Gruppe tritt vor, und ich bin derartig verblüfft über den melodiösen Namen Rosabelle, dass ich den geäderten Metallarm des Typen etwas spät bemerke. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass der Kerl ziemlich wahnsinnig aussieht. Blaues Licht leuchtet aus seinen Augen, pulsiert an seinen Schläfen, überstrahlt die bionische Prothese. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter.
Böse Erinnerungen.
Das Reestablishment hat meinen Vater mit vergleichbar perfekten Prothesen ausgestattet, nachdem er zusammengeflickt worden war. Diese Art von hochfunktionalem Ersatz war vor zehn Jahren absolut innovativ. Und während wir in der New Republic nach wie vor nicht wissen, wie man so etwas herstellen kann, scheint es hier bereits normal zu sein. Das Reestablishment hat auf Ark Island im Bioengineering offenbar große Fortschritte gemacht, was wir eindeutig unterschätzt haben. Seit über einem Jahrzehnt versuchen wir uns darauf vorzubereiten, welche neue Form von Hölle die sich hier ausdenken. Aber unsere Spionageversuche scheitern immer wieder, weil unsere gesamte Technologie auf Systemen und Netzwerken basiert, die vom Reestablishment angelegt wurden.
Die wissen, wie sie unsere Satelliten ausschalten können, weil die von ihnen entwickelt wurden; wie sie unsere Kraftwerke manipulieren können, weil die von ihnen gebaut wurden; wie sie unser Stromnetz lahmlegen können, weil es von ihnen angelegt wurde. Unsere Zivilbevölkerung versteht nicht, dass Anhängerinnen und Anhänger des Reestablishment noch immer unter uns leben. Als das Regime gestürzt wurde, konnte sich nur die Elite auf Ark Island niederlassen. Ausschließlich wohlhabende Familien der militärischen Führungskräfte wussten von dem Fluchtplan, und nur sie konnten per Privatflugzeug entkommen.
Die Gefolgsleute blieben zurück.
Es ist schwierig, zu ermitteln, welche ehemaligen Mitglieder des Reestablishment noch immer dem einstigen Regime hörig sind. Viele von ihnen sind Undercoverleute, die international agieren, um uns systematisch zu unterminieren. Das letzte Jahr war schlimmer denn je: In einer Grundschule gab es eine unerklärliche Gasexplosion, bei der über hundert Kinder ums Leben kamen. Das war einer der düstersten Tage unserer Regierungszeit; dieser Albtraum sitzt mir immer noch in den Knochen. Wir versuchen, dem Volk zu erklären, dass wir gehackt und angegriffen werden. Aber es ist kaum machbar, die Menschen davon zu überzeugen, wenn das Reestablishment gar nicht mehr in Erscheinung tritt.
Wir stehen jedenfalls extrem unter Druck.
Die psychologische Kriegsführung des Reestablishment soll die Massen gegen uns aufbringen. Das Gedächtnis von Menschen ist unzuverlässig; viele fragen sich inzwischen, ob das Leben unter dem faschistischen Regime nicht besser war. Juliette ist besorgt. Und sogar Warner, der seine Gefühle selten zeigt, wirkt gestresst. Er hatte überlegt, eine verdeckte Operation auf Ark Island zu wagen. Aber wir alle wissen, dass er Juliette in ihrem Zustand niemals allein lassen würde.
Deshalb hatte ich diesen genialen Plan entwickelt: hier nützliche Informationen über die Psychopathentruppe sammeln, unversehrt zurückkehren und mir so Anerkennung bei Familie und Freunden verschaffen. Das Problem ist nur, dass noch niemand von einer Spionageaktion auf der Insel lebend zurückgekommen ist. Ich hatte gehofft, mit meinen Fähigkeiten die Ausnahme zu sein.
Scheine mich aber geirrt zu haben.
Der Typ mit dem Roboterarm marschiert jetzt mit Waffe im Anschlag auf mich zu. Ich überlege blitzschnell, ob es wohl machbar wäre, den Typen zu erstechen, bevor er mir das Licht auspustet, als er plötzlich stehen bleibt. Mich mit diesen gruseligen Augen anstarrt und die Waffe sinken lässt.