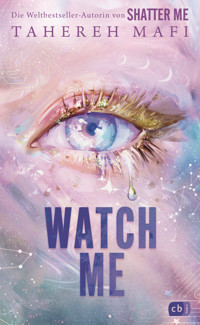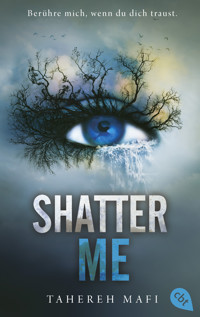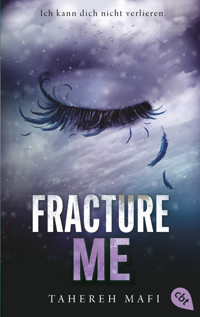0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die »Shatter Me«-Shorts
- Sprache: Deutsch
Für alle, die von Juliettes Welt nicht genug bekommen können: Die E-Shorts zu der TikTok-Sensation
Kenji, der Anführer der Rebellen, befindet sich in einer Zwickmühle. Wie soll er Juliette, die über den Verrat von Warner am Boden zerstört ist, beistehen, und gleichzeitig seiner Verantwortung als Rebellenführer nachkommen? Dann taucht auch noch unerwartet eine Person aus der Vergangenheit von Omega Point auf ...
Dieses E-Short bleuchtet die schockierenden Ereignisse am Ende von Band 4 aus der Sicht von Kenji Kishimoto.
Alle Bände der »Shatter Me«-Reihe:
Shatter Me (Band 1)
Destroy Me (Band 1.5, E-Short)
Unravel Me (Band 2)
Fracture Me (Band 2.5, E-Short)
Ignite Me (Band 3)
Restore Me (Band 4)
Shadow Me (Band 4.5, E-Short)
Defy Me (Band 5)
Reveal Me (Band 5.5, E-Short)
Imagine Me (Band 6)
Believe Me (Band 6.5, E-Short)
Join Me (alle Shorts in einem Sammelband)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Tahereh Mafi
Shadow Me
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
»Shadow Me« bei Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30161 Hannover.
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Lektorat: Ulla Mothes
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Cover art © 2013 by Colin Anderson
Cover art inspired by a photograph by Sharee Davenport
skn · Herstellung: bo
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31765-2V001
www.cbj-verlag.de
1
Ich bin schon wach, als der Wecker klingelt, mache aber die Augen nicht auf. Bin zu müde. Habe immer noch Muskelkater von einer intensiven Trainingseinheit vor zwei Tagen, mein Körper fühlt sich schwer an. Irgendwie leblos.
Und mein Kopf tut weh.
Der Wecker schrillt wie wild, ich beachte ihn nicht. Dehne ächzend die Muskeln im Nacken. Das Ding lärmt weiter, und jetzt höre ich außerdem, wie jemand nebenan mit der Faust an die Wand schlägt. Adam, der brüllt, ich solle endlich den Wecker ausschalten.
»Jeden Morgen!«, schreit er. »Das machst du jeden Morgen! Ich schwöre bei Gott, Kenji, wenn das so weitergeht, komm ich rüber und hau das Teil zu Klump!«
»Schon gut«, murmle ich. »Beruhig dich.«
»Mach das Ding aus!«
Ich hole tief Luft, schlage dann blindlings auf den Wecker ein, bis er Ruhe gibt. Wir haben jetzt endlich unsere eigenen Zimmer im Hauptquartier, aber Ruhe gibt es trotzdem nicht. Auch keine Privatsphäre. Die Wände sind dünn wie Papier, und Adam ist wie immer. Launisch. Humorlos. Ständig gereizt. Manchmal ist mir echt unklar, weshalb wir Freunde sind.
Mühsam setze ich mich auf. Reibe mir die Augen, mache in Gedanken meine To–do–Liste für den Tag, und dann fährt mir der Schreck in die Glieder –
als mir wieder einfällt, was gestern alles passiert ist.
Oh Gott.
So viel Drama an einem Tag, dass ich kaum noch alles zusammenkriege.
Juliette hat eine ihr bislang unbekannte Schwester. Die von Warner gefoltert wurde. Er und Juliette haben sich getrennt, sie lief schreiend davon. Warner hatte eine Panikattacke. Seine Ex–Freundin tauchte auf. Und schlug ihm ins Gesicht. Juliette hat sich betrunken. Nee, Moment – J hat sich betrunken und sich selbst die Haare abgeschnitten. Und ich habe Juliette in Unterwäsche gesehen – dieses Bild versuche ich immer noch zu verdrängen. Und als sei das alles nicht schon genug, habe ich gestern Abend nach dem Essen auch noch was richtig Blödes angestellt.
Ich stütze den Kopf in die Hände und hasse mich dafür. Am liebsten würde ich vor Scham im Erdboden versinken. Ich hole tief Luft. Richte mich auf. Zwinge mich, meine Gedanken zu klären.
Nicht alles ist furchtbar.
Ich habe ein eigenes Zimmer. Es ist klein, hat aber ein Fenster mit Aussicht auf Belüftungsanlagen. Einen Schreibtisch. Ein Bett. Einen Schrank. Das Badezimmer muss ich mit den anderen teilen, aber ich will echt nicht jammern. Ein eigenes Zimmer ist ein Luxus, den ich lange nicht hatte. Es tut mir gut, abends mit meinen Gedanken allein zu sein. Das Grinsegesicht ablegen zu können, das ich von früh bis spät aufsetze, auch wenn ich einen Scheißtag habe.
Für all das bin ich dankbar.
Ich bin überarbeitet, gestresst und erschöpft, aber dankbar.
Ich zwinge mich, das laut auszusprechen: Ich bin dankbar. Ich konzentriere mich darauf, dieses Gefühl zu spüren. Es zu identifizieren. Zwinge mich zum Lächeln, damit mein Gesicht sich entspannt und die Wut nicht wieder die Oberhand bekommt. Ich flüstere ein schnelles Dankeschön in die Luft, für die Geister, die meine Selbstgespräche belauschen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, Kleider am Leib, täglich genug zu essen. Ich habe Freunde. Die wie eine Familie für mich sind. Ich kann für mich sein, bin aber nicht einsam. Mein Gehirn ist intakt, mein Körper auch. Ich lebe. Ich habe ein gutes Leben. Das halte ich mir tagtäglich vor Augen, um froh sein zu können. Sonst hätte der Schmerz mich schon vor langer Zeit umgebracht.
Ich bin dankbar.
Jemand klopft zweimal scharf an die Tür, und ich springe erschrocken auf. Normalerweise klopft hier niemand.
Hastig schlüpfe ich in Sweatpants und öffne vorsichtig.
Warner.
Ich mustere ihn verblüfft. Warner ist noch nie zu mir gekommen, und ich weiß nicht, was ich sonderbarer finde: dass er jetzt hier vor meiner Tür steht oder dass er so normal aussieht. Also, was bei Warner eben als normal gilt. Tadellos und makellos. Beunruhigend ruhig für einen Mann, der am Vortag von seiner Freundin verlassen wurde. Kaum zu glauben, dass es sich um denselben Typen handelt, der danach mit einer Panikattacke am Boden lag.
»Ähm, hi.« Ich räuspere mich. »Was gibt’s?«
»Bist du etwa gerade aufgewacht?« Er beäugt mich wie ein eigenartiges Insekt.
»Um sechs. Alle in diesem Flügel stehen morgens um sechs auf. Du musst jetzt nicht so enttäuscht gucken.«
Warner späht an mir vorbei ins Zimmer und bleibt einen Moment stumm. Dann sagt er: »Yamamoto, wenn ich die zweitklassigen Standards anderer Menschen als Maßstab für meine eigenen Leistungen ansetzen würde, hätte ich es nie zu etwas gebracht.« Er starrt mich eindringlich an. »Du solltest dir selbst mehr abverlangen. Du bist absolut fähig dazu.«
»Sollte das –?« Ich blinzle verdattert. »Sorry, sollte das etwa ein Kompliment sein?«
Er fixiert mich ausdruckslos. »Zieh dich an.«
»Du willst mich zum Frühstück ausführen?«
»Wir haben drei weitere unangekündigte Gäste. Sie sind gerade angekommen.«
»Oh.« Ich weiche unwillkürlich einen Schritt zurück. »Oh Scheiße.«
»Ja.«
»Weitere Kinder von Obersten Befehlshabern?«
Warner nickt.
»Sind die gefährlich?«, frage ich.
Das bringt Warner beinahe zum Lächeln, aber er sieht unfroh aus. »Wären sie hier, wenn sie nicht gefährlich wären?«
»Stimmt.« Ich seufze. »Guter Einwand.«
»Wir treffen uns in fünf Minuten unten, dann erkläre ich dir alles.«
»Fünf Minuten?« Ich reiße die Augen auf. »Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss noch duschen. Und ich habe noch nicht mal gefrüh–«
»Wärst du um drei Uhr aufgestanden, hättest du für all das ausreichend Zeit gehabt. Und für noch viel mehr.«
»Drei Uhr morgens?« Ich glotze ihn fassungslos an. »Spinnst du jetzt komplett?«
Und als er dann ohne die geringste Spur von Ironie antwortet –
»Nicht mehr als sonst«
– ist für mich sonnenklar, dass es ihm richtig mies geht.
Ich seufze tief, hasse mich, weil ich so was grundsätzlich spüre, und hasse mich noch mehr, weil ich dann auch immer helfen will. Aber ich kann nichts dagegen tun. Castle hat das mal zu mir gesagt, als ich noch ein Junge war: dass ich außergewöhnlich einfühlsam sei. Das war mir nicht klar gewesen, bis er das so deutlich in Worte gefasst hatte. Bis dahin hatte ich immer darunter gelitten, dass ich nicht härter war. Dass ich furchtbar weinen musste, als ich zum ersten Mal einen toten Vogel sah. Dass ich immer alle verletzten Tiere nach Hause schleppte, bis Castle mir eines Tages sagte, ich müsse damit aufhören, wir könnten die nicht alle versorgen. Damals war ich zwölf. Ich musste sie alle freilassen und weinte eine ganze Woche lang. Und hasste mich dafür. Weil ich es nicht ändern konnte. Alle denken immer, dass ich mir nichts zu Herzen nehme. Aber das ist genau das, was geschieht. Ich kann gar nicht anders.
Und dieses Arschloch Warner geht mir auch nah.
Deshalb hole ich jetzt tief Luft und sage: »Hey, Mann – alles okay mit dir?«
»Mir geht’s gut«, sagt er. Zu schnell. Tonlos.
Ich könnte es dabei belassen.
Er will nicht reden. Das sollte ich so akzeptieren. Ich sollte es dabei belassen und so tun, als bemerkte ich seinen verbissenen Kiefer und die Röte in seinen Augen nicht. Ich habe schließlich meine eigenen Probleme, meinen eigenen Schmerz, meine eigenen Enttäuschungen, und abgesehen davon fragt mich nie jemand, wie mein Tag gewesen ist. Niemand kümmert sich um mich, niemand macht sich die Mühe, hinter das Grinsen zu schauen. Warum also sollte ich mich um andere kümmern?
Ich sollte es lassen.
Halt dich da raus, sage ich mir.
Ich öffne den Mund, um das Thema zu wechseln, über was anderes zu reden, und stattdessen höre ich mich sagen –
»Komm schon, Bro. Wir wissen doch beide, dass das nicht stimmt.«
Warner schaut zur Seite. An seinem Kiefer zuckt ein Muskel.
»Du hattest gestern einen harten Tag«, sage ich. »Es ist völlig okay, wenn man sich am nächsten Morgen nicht gut fühlt.«
Nach längerem Schweigen sagt er: »Ich bin schon ziemlich lange auf.«
Ich atme aus. Das kommt nicht unerwartet für mich. »Verstehe«, sage ich. »Tut mir leid für dich.«
Er sieht mich an. »Verstehst du das wirklich?«
»Ja. Ich glaub schon.«
»Ich glaube das eher nicht. Oder genauer gesagt: Ich hoffe es für dich. Du möchtest nämlich garantiert nicht wissen, wie mir gerade zumute ist. Das wünsche ich keinem.«
Das trifft mich schlimmer, als ich erwartet hatte, und es verschlägt mir einen Moment lang die Sprache.
Ich beschließe, auf den Boden zu schauen.