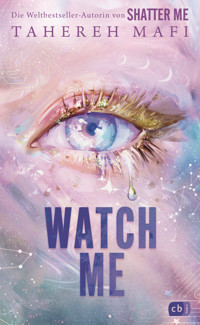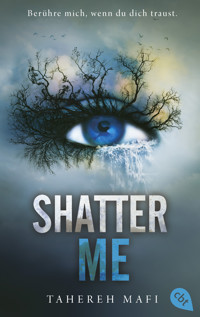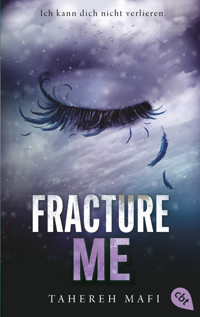9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die "Shatter Me"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Juliette Ferrars. Ella Sommers. Wer von beiden ist die Wahrheit und wer die Lüge?
Seit Ella weiß, wer Juliette ist und warum sie erschaffen wurde, wurde alles nur noch komplizierter. Während ihre Vergangenheit sie heimsucht und sie sie nicht versteht, und ihre Zukunft unsicherer ist als je zuvor, beginnt die Grenze zwischen richtig und falsch, zwischen Ella und Juliette, zu verschwimmen. Als ein altbekannter Widersacher wieder auftaucht scheint es immer unwahrscheinlicher, dass sie ihr Schicksal noch selbst in die Hand nehmen kann. Der Tag der Abrechnung ist gekommen! Doch ist es überhaupt noch ihre Entscheidung, auf welcher Seite sie steht?
Die TikTok Sensation – Mitreißende Young Adult Romantasy-Reihe mit Suchtfaktor für alle Fans von Leigh Bardugo, Sarah J. Maas und Victoria Aveyard.
Alle Bände der »Shatter Me«-Reihe:
Shatter Me (Band 1)
Unravel Me (Band 2)
Ignite Me (Band 3)
Restore Me (Band 4)
Defy Me (Band 5)
Imagine Me (Band 6)
Watch Me (Spin-off, Band 1)
Release Me (Spin-off, Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tahereh Mafi
Imagine Me
Aus dem amerikanischen Englischvon Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch März 2024
© 2020 Tahereh Mafi
Published by Arrangement with Tahereh Mafi
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Imagine Me« bei Harper, einem Imprint von HarperCollins Publishers, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30161 Hannover.
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Lektorat: Ulla Mothes
Covergestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Cover art © 2013 by Colin Anderson.
Cover art inspired by a photograph by Sharee Davenport
skn · Herstellung: bo
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31389-0V001
www.cbj-verlag.de
Für Tara Weikum, für all die Jahre
Ella
Juliette
Im Dunkel der Nacht höre ich Vögel.
Ich höre sie, sehe sie, schließe die Augen und spüre sie, das Schwirren der Federn, den Lufthauch, die Schwingen, die meine Schulter streifen, wenn die Vögel sich erheben, wenn sie landen. Schrille Schreie, Echo, schrille Schreie, Echo –
Wie viele mögen es sein?
Hunderte.
Weiße Vögel, weiß mit goldenen Federn auf dem Kopf wie eine Krone, fliegen am Himmel, schweben mit ruhigen starken Schwingen, Lenker ihres Schicksals. Früher gaben sie mir Hoffnung.
Nie wieder.
Ich drücke das Gesicht ins Kissen, kralle mich darin fest, als die Erinnerungen über mich hereinbrechen.
»Gefallen sie dir?«, fragt sie.
Wir sind in einem großen Raum, in dem es unangenehm riecht. Überall stehen Bäume, so hoch, dass sie beinahe die Rohre und Balken der Kuppel berühren. Zahllose Vögel kreischen und schlagen mit den Flügeln. Die Schreie sind laut, machen mir ein bisschen Angst. Ich versuche, nicht zusammenzuzucken, als einer der großen weißen Vögel dicht an mir vorbeifliegt. Er hat einen leuchtend grünen Ring an einem Bein wie alle anderen auch.
Ich verstehe das nicht.
Wir sind doch nicht draußen, sondern in einem Raum mit weißen Wänden und Betonboden. Fragend schaue ich zu meiner Mutter auf.
Ich habe sie noch nie so oft lächeln sehen. Meist lächelt sie, wenn Dad in der Nähe ist oder wenn die beiden zusammen in einer Ecke stehen und miteinander flüstern. Aber jetzt bin ich hier allein mit ihr und diesen Vögeln, und sie sieht so glücklich aus, dass ich versuche, das mulmige Gefühl in meinem Bauch nicht zu beachten. Wenn Mum gute Laune hat, ist immer alles besser.
»Ja«, lüge ich. »Sie gefallen mir sehr.«
Ihre Augen leuchten auf. »Das dachte ich mir. Emmaline mochte sie nicht, aber du – du warst immer gerne verliebt in etwas, nicht wahr, Liebling? Ganz anders als deine Schwester.« Irgendwie hört sich das gehässig an. Nicht die Worte selbst. Aber der Tonfall.
Ich runzle die Stirn.
Versuche immer noch, zu begreifen, warum wir hier sind, als sie sagt:
»In deinem Alter hatte ich mal so einen Vogel als Haustier. Damals gab es so viele davon, dass sie regelrecht lästig sein konnten.« Meine Mutter lacht, und ich sehe sie an, während sie einen der fliegenden Vögel beobachtet. »Einer lebte in einem Baum bei unserem Haus, und wenn ich vorbeiging, rief der Vogel meinen Namen. Kannst du dir das vorstellen?« Ihr Lächeln verblasst, als sie die Frage stellt.
Dann wendet sie sich mir zu.
»Inzwischen sind sie fast ausgestorben. Du verstehst sicher, dass ich das nicht zulassen konnte.«
»Natürlich«, sage ich, aber auch das ist gelogen. Ich finde meine Mutter ziemlich unverständlich.
Sie nickt. »Das sind ganz besondere Wesen. Sehr intelligent. Können sprechen und tanzen. Und jeder trägt eine Krone.« Sie wendet sich ab, betrachtet erneut die Vögel, mit diesem freudigen Blick, den sie auch hat, wenn sie Dinge für ihre Arbeit vorbereitet. »Der Gelbhaubenkakadu bindet sich fürs Leben«, sagt sie dann. »So wie dein Vater und ich.«
Ich zittere ein bisschen, als ich plötzlich eine warme Hand spüre, Finger, die sachte über meinen Rücken streichen.
»Liebste«, flüstert er, »ist alles okay?«
Als ich stumm bleibe, bewegt er sich, die Decke raschelt, und er schmiegt sich an mich, ich spüre seine Wärme und Festigkeit und lege den Kopf an seine Schulter, werde ruhig in seiner Nähe, in der Geborgenheit seiner Arme. Seine Lippen streifen meinen Hals, so zart, dass heiße und kalte Funken durch mein Blut jagen, bis hinunter in meine Zehenspitzen.
»Ist es wieder passiert?«, flüstert er.
Meine Mutter kam in Australien zur Welt.
Das weiß ich, weil sie es mir einmal erzählt hat und weil ich es – obwohl ich versuche, viele der Erinnerungen sofort wieder zu verdrängen, die jetzt zurückkehren – nicht vergessen konnte. Sie hat mir auch erzählt, dass der Gelbhaubenkakadu in Australien heimisch ist. Er wurde im neunzehnten Jahrhundert in Neuseeland eingebürgert, aber Evie, meine Mutter, hat diese Vögel nicht dort kennengelernt. Sondern entdeckte ihre Liebe für sie zu Hause, als einer von ihnen, wie sie erzählte, ihr das Leben gerettet hatte.
Das sind die Vögel, die eine Zeit lang in meinen Träumen aufgetaucht waren.
Diese Vögel, die von einer Verrückten gehalten und gezüchtet wurden. Es ist mir unangenehm, dass ich mich damals an Schimären festhielt, an zusammenhanglosen Fragmenten von Erinnerungen, die nicht gelöscht worden waren. Ich hatte Hoffnungen daran geknüpft, und jetzt spüre ich die Enttäuschung wie einen Kloß im Hals, den ich nicht schlucken kann.
Und dann
schon wieder
spüre ich es
Ich erstarre, um die Übelkeit abzuwehren, die der Vision vorausgeht, den Schlag in die Magengrube, der bedeutet, dass noch mehr kommt, immer noch mehr.
Aaron zieht mich dichter an seine Brust, hält mich ganz fest.
»Ruhig atmen«, raunt er. »Ich bin hier, Liebste. Ich bin bei dir.«
Ich klammere mich an ihn, kneife die Augen fest zusammen, während mir schwindlig wird. Die Erinnerungen sind eine Gabe von meiner Schwester Emmaline. Meiner Schwester, die ich gerade erst entdeckt und wiedergefunden habe.
Und das nur, weil sie darum gekämpft hat, mich aufzuspüren.
Trotz der hartnäckigen Bemühungen unserer Eltern, die Erinnerungen an ihre eigenen Grausamkeiten aus unserem Gedächtnis zu löschen, hielt Emmaline durch. Sie nutzte ihre psychokinetischen Kräfte, um mir zurückzugeben, was aus meinem Gedächtnis gestohlen worden war. Dieses Geschenk – meine Erinnerungen – schickt sie mir, um mich zu retten. Um sich selbst zu retten. Um unseren Eltern Einhalt zu gebieten.
Um die Welt zu heilen.
Aber jetzt, nach unserer Flucht, wird dieses Geschenk zum Fluch. In jeder Stunde wird mein Gedächtnis erneut wiedergeboren. Verändert. Die Erinnerungen sind wie eine Flut.
Und meine tote Mutter weigert sich, endlich zu schweigen.
»Vögelchen«, flüstert sie und streicht mir eine Haarsträhne hinters Ohr. »Es ist jetzt Zeit zum Wegfliegen.«
»Aber ich will nicht weg«, sage ich mit vor Angst zittriger Stimme. »Ich will hierbleiben, bei dir und Dad und Emmaline. Ich verstehe nicht, warum ich woandershin soll.«
»Das brauchst du nicht zu verstehen«, erwidert sie sanft.
Ich verstumme verstört.
Mum schreit nicht. Sie hat mich noch nie angeschrien. Mein ganzes Leben lang hat sie nie die Hand gegen mich erhoben, hat mich noch nie angebrüllt oder beschimpft. Sie ist nicht wie Aarons Vater. Aber Mum hat es auch nicht nötig, zu schreien. Manchmal sagt sie einfach nur etwas wie Das brauchst du nicht zu verstehen,und dann liegt darin eine Warnung, eine eiserne Entschlossenheit, die mir immer schon Angst gemacht hat.
Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen, brennend, und –
»Nicht weinen«, sagt sie. »Dafür bist du schon viel zu groß.«
Ich schniefe heftig, um die Tränen zu unterdrücken. Aber meine Hände zittern unkontrolliert.
Mum schaut auf, nickt jemandem hinter mir zu. Als ich mich umdrehe, sehe ich Paris, Mr Anderson, mit meinem Koffer. Mr Andersons Blick ist ausdruckslos, ohne jede Wärme. Er schaut Mum an, ohne sie zu begrüßen.
Sagt nur: »Hat Max sich eingewöhnt?«
»Er ist schon seit Tagen bereit.« Mum wirft einen Blick auf ihre Uhr. »Du kennst Max ja«, fügt sie mit einem kleinen Lächeln hinzu. »Er ist nun mal Perfektionist.«
»Aber nur bei deinen Wünschen«, entgegnet Mr Anderson. »Ich habe noch nie einen erwachsenen Mann erlebt, der so in seine Frau vernarrt ist.«
Mums Lächeln wird breiter. Sie will etwas sagen, aber ich komme ihr zuvor.
»Redet ihr über Dad?«, frage ich mit pochendem Herzen. »Kommt Dad mit?«
Mum blickt so überrascht auf mich herunter, als hätte sie mich vergessen. Dann wendet sie sich wieder Mr Anderson zu. »Wie geht es denn Leila?«
»Gut«, antwortet er, klingt aber gereizt.
»Mum?« Die Tränen geben keine Ruhe. »Kann ich dann dort bei Dad bleiben?«
Aber meine Mutter scheint mich nicht zu hören, sondern sagt zu Mr Anderson: »Max wird dir alles erklären, wenn ihr ankommt, und die meisten deiner Fragen beantworten können. Was er nicht beantwortet, liegt dann vermutlich außerhalb deines Zuständigkeitsbereichs.«
Mr Anderson sieht plötzlich verärgert aus, schweigt aber, ebenso wie Mum.
Ich kann das nicht ertragen.
Jetzt rinnen Tränen über mein Gesicht, und ich zittere so heftig, dass meine Stimme mir nicht mehr gehorcht. »Mum?«, flüstere ich. »Mum, bitte g-gib A-Antwort –«
Sie packt mit eisernem Griff meine Schulter, und ich verstumme schlagartig.
Mum sieht mich nicht an. »Das erledigst du auch, Paris, nicht wahr?«, sagt sie.
Er wirft mir einen Blick zu. Blaue Augen, eiskalt. »Selbstverständlich.«
Urplötzlich packt mich eine hitzige Wut. So heftig, dass sie meine Angst für einen Moment vertreibt.
Ich hasse Mr Anderson.
Ich hasse ihn so sehr, dass irgendetwas in mir passiert, wenn ich ihn anschaue – und dieses überwältigende Gefühl macht mich mutig.
Ich wende mich wieder meiner Mutter zu. Mache noch einen Versuch.
»Warum darf Emmaline hierbleiben?«, frage ich und wische mir wütend die Tränen ab. »Wenn ich schon wegmuss, können wir dann nicht wenigstens zusam–«
Ich verstumme, als ich sie sehe.
Emmaline späht durch einen schmalen Türspalt. Sie dürfte nicht hier sein. Das hat Mum angeordnet.
Sie soll ihre Schwimmübungen machen.
Aber sie ist hier, aus ihrem nassen Haar tropft Wasser auf den Boden, und sie starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Versucht etwas zu sagen, aber ihre Lippen bewegen sich zu schnell, ich kann sie nicht verstehen. Und dann, abrupt und aus dem Nichts, durchfährt mich etwas wie ein elektrischer Schlag, und ich höre ihre Stimme, scharf und fremd –
Sie lügen
SIELÜGENALLE
TÖTESIE
Meine Augen fliegen auf, ich bekomme keine Luft, ringe nach Atem, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Warner hält mich in den Armen, gibt beruhigende Laute von sich, streicht mir über den Arm.
Tränen strömen mir übers Gesicht, ich versuche, sie wegzuwischen.
»Ich hasse es«, flüstere ich, entsetzt über meine bebende Stimme. »Ich hasse es so sehr. Es ist schrecklich, dass es immer wieder passiert. Es ist schrecklich, was es mit mir macht. Ich hasse es.«
Warner Aaron berührt mit den Lippen meine Schulter, sein Atem liebkost meine Haut.
»Ja, ich hasse es auch«, sagt er leise.
Ich drehe mich vorsichtig in seinen Armen, lehne die Stirn an seine nackte Brust.
Vor knapp zwei Tagen sind wir aus Ozeanien entkommen. Vor zwei Tagen habe ich meine eigene Mutter getötet. Habe das entdeckt, was von meiner Schwester Emmaline noch übrig ist. In nur zwei Tagen wurde mein gesamtes Leben erneut auf den Kopf gestellt, was mir unbegreiflich absurd vorkommt.
Zwei Tage, und schon herrscht um uns her das reinste Chaos.
Wir sind die zweite Nacht hier im Refugium, dem geheimen Stützpunkt der Widerstandsgruppe, die von Castles Tochter Nouria und ihrer Frau Sam geleitet wird. Wir sollen hier in Sicherheit sein. Und nach den höllischen letzten Wochen durchatmen und wieder zu uns finden können, aber ich komme nicht zur Ruhe. Mein Gehirn steht unter dauerndem Beschuss, wird förmlich überrannt. Ich hatte erwartet, dass die anfängliche Flut von Erinnerungen irgendwann nachlassen würde, stattdessen wurde es in den letzten vierundzwanzig Stunden immer schlimmer. Und ich scheine die Einzige zu sein, die dieses Problem hat.
Emmaline hat allen Kindern der Obersten Befehlshaber die Erinnerungen zurückgegeben, die uns von unseren Eltern gestohlen wurden. Einer nach dem anderen wurde erschüttert durch die Wahrheiten, die unsere Eltern verborgen hatten, kehrte dann aber nach und nach ins normale Leben zurück.
Nur ich nicht.
Die anderen haben sich längst mit diesem Verrat abgefunden und mit ihrer Geschichte ausgesöhnt. Mein Gehirn dagegen rotiert weiter. Aber den anderen war auch nicht so viel genommen worden wie mir; deshalb gibt es weniger zu erinnern. Sogar Warner – Aaron – muss nicht so einen extremen Durchlauf seines Lebens ertragen.
Diese Entwicklung fängt an, mir Angst zu machen.
Es kommt mir vor, als würde meine Geschichte neu geschrieben, als würden zahllose Absätze ausgelöscht und hastig neu verfasst. Alte und neue Bilder werden übereinandergelegt, bis die Tinte zerfließt und etwas Unbekanntes und Unverständliches entsteht. Manchmal erscheinen meine Gedanken mir wie Halluzinationen, und diese Prozesse sind so massiv, dass ich befürchte, sie werden bleibende Schäden hinterlassen.
Denn etwas verändert sich.
Jede neue Erinnerung erfasst mich jetzt mit einer enormen emotionalen Wucht, die mich von Grund auf verändert, mein Gehirn umstrukturiert. Die Übelkeit, den Schwindel, die Desorientiertheit habe ich immer wieder durchlebt, wollte mich aber nicht näher damit befassen. Ich wollte nicht zu genau hinschauen, weil ich meinen eigenen Ängsten keinen Raum geben wollte. Aber die Wahrheit ist: Ich bin wie ein beschädigter Reifen. Sobald Luft in mich hineingepumpt wird, bin ich voller und zugleich leerer.
Ich vergesse.
»Ella?«
Grauen packt mich, dringt durch meine offenen Augen nach draußen. Ich brauche einen Moment, um mich zu erinnern, dass ich Juliette Ella bin. Und jedes Mal dauert es etwas länger.
Panik droht –
Ich gehe dagegen an.
»Ja«, sage ich und atme tief ein. »Ja.«
Warner Aaron wirkt erschrocken. »Liebste, was ist mit dir?«
»Nichts«, lüge ich. Mein Herz schlägt viel zu schnell. Ich weiß nicht, warum ich lüge. Es ist ohnehin sinnlos, denn er kann alles spüren, was ich empfinde. Ich sollte es ihm sagen. Ich weiß nicht, warum ich es ihm nicht sage. Ich weiß, warum ich es ihm nicht sage.
Weil ich abwarte.
Ich will abwarten, ob das alles irgendwann nachlässt, ob die Ausfälle in meinem Gedächtnis nur Pannen sind, die noch ausgebessert werden. Wenn ich darüber spreche, wird das alles zu real, und es ist zu früh, um die Angst zuzulassen. Schließlich passiert das erst seit einem Tag. Erst gestern ist mir klar geworden, dass etwas ganz und gar nicht stimmt.
Ich merkte es, weil ich einen Fehler machte.
Mehrere Fehler.
Wir saßen draußen und schauten zu den Sternen auf. Ich konnte mich nicht erinnern, sie jemals so leuchtend und klar gesehen zu haben. Es war spät, mitten in der Nacht, und der Anblick war atemberaubend. Ich fröstelte. Der Wind fegte rauschend durch den Wald in der Nähe. Ich hatte den Bauch voller Kuchen, und Warner roch nach Zucker, nach Genuss. Ich war berauscht von Glück.
Ich will nicht länger warten, sagte er und ergriff meine Hand. Drückte sie. Lass uns nicht länger warten.
Ich blinzelte und sah ihn fragend an. Auf was?
Auf was?
Auf was?
Wie konnte ich vergessen, was nur wenige Stunden vorher passiert war? Wie konnte ich den Moment vergessen, als Warner mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle?
Es war eine Panne. Wo früher eine Erinnerung gewesen wäre, war ein Loch entstanden, eine Leerstelle, die sich nur wieder füllte, wenn ich mich darum bemühte.
Ich erinnerte mich dann. Warner lachte.
Ich nicht.
Ich habe den Namen von Castles Tochter vergessen. Habe vergessen, wie wir im Refugium gelandet sind. Zwei ganze Minuten lang wusste ich nicht mehr, wie ich aus Ozeanien entkommen war. Aber diese Lücken waren vorübergehend, fühlten sich an wie kleinere Fehler. Ich war nur verwirrt, wenn die Erinnerungen langsam auftauchten, vage und verschwommen. Dachte, ich sei wahrscheinlich übermüdet. Überanstrengt. Ich nahm das alles nicht ernst, bis ich mich unterm Sternenhimmel nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich jemandem versprochen hatte, mein Leben mit ihm zu verbringen.
Ich schämte mich.
Ich schämte mich so entsetzlich, dass ich glaubte, sterben zu müssen. Sogar jetzt wird mir allein beim Gedanken daran glühend heiß, und ich bin froh, dass Warner mein Gesicht im Dunkeln nicht sehen kann.
Aaron, nicht Warner.
Aaron.
»Ich spüre gerade nicht deutlich, ob du dich schämst oder fürchtest«, sagt er und atmet leise aus. Es hört sich fast wie ein kleines Lachen an. »Machst du dir Sorgen um Kenji? Um die anderen?«
Ich stürze mich dankbar auf diese Halbwahrheit.
»Ja«, sage ich. »Kenji. James. Und Adam.«
Kenji liegt seit dem frühen Morgen krank im Bett. Als ich vor unserem Fenster die Mondsichel sehe, fällt mir wieder ein, dass es schon nach Mitternacht ist, was heißt, dass Kenji genau genommen seit gestern früh krank ist.
Was uns allen einen furchtbaren Schrecken eingejagt hat.
Die Drogen, die Nasira Kenji auf dem Flug vom Sektor 45 nach Ozeanien injiziert hat, waren etwas zu stark, und seither ringt er mit den Folgen und ist schließlich zusammengeklappt. Tana und Randa, die Heilerzwillinge, haben sich um ihn gekümmert und meinen, er würde sich erholen. Vorher hatten wir noch erfahren, dass Anderson die anderen Kinder der Obersten Befehlshaber entführt hat.
Adam, James, Lena, Valentina und Nicolás werden von Anderson gefangen gehalten.
James. Der noch ein Kind ist.
Es waren grauenhafte, kräftezehrende Tage. Wochen.
Monate.
Im Grunde Jahre.
Manchmal will mir absolut nichts Gutes aus meiner Vergangenheit einfallen, so weit ich auch zurückschaue. Mitunter erscheint mir das Glück, das ich gelegentlich erlebt habe, wie ein bizarrer Traum. Ein Irrtum. Irreal und undeutlich, die Farben zu grell, die Geräusche zu laut.
Hirngespinste.
Vor wenigen Tagen noch erlebte ich Klarheit, die wohltuend war. Vor wenigen Tagen noch schien das Schlimmste hinter mir zu liegen, die Welt voller Verheißung zu sein. Mein Körper schien stärker denn je, mein Geist reicher und schneller und fähiger.
Aber jetzt
Aber jetzt
Aber jetzt kommt es mir vor, als müsste ich mich an die verblassenden Umrisse meiner inneren Balance klammern, dieser flüchtigen launischen Freundin, die mir immer wieder das Herz bricht.
Aaron streichelt mich, und ich halte ihn ganz fest, dankbar für seine Wärme und Kraft. Stockend hole ich tief Luft, lasse dann mit dem ausströmenden Atem alles los. Nehme den betörenden Geruch seiner Haut in mich auf, den dezenten Gardenienduft, den er immer verströmt. In entspanntem Schweigen vergeht die Zeit, wir hören einander beim Atmen zu.
Ganz allmählich beruhigt sich mein Herzschlag.
Die Tränen trocknen. Die Ängste legen eine Pause ein, und die Traurigkeit macht ein Nickerchen.
Eine Zeit lang gibt es nur mich und ihn und uns beide, und alles ist makellos, unberührt von dunklen Schatten.
Ich weiß, dass ich Warner Aaron schon früher geliebt habe – bevor wir vom Reestablishment gefangen genommen und getrennt wurden, bevor wir von unserer gemeinsamen Vorgeschichte erfuhren –, aber diese Liebe war neu, noch unreif, die Tiefen unergründet, unerprobt. In diesem kurzen schillernden Zeitfenster, in dem die gähnenden Löcher in meinem Gedächtnis verständlich wurden, änderte sich etwas zwischen uns. Alles zwischen uns änderte sich. Sogar jetzt, mit diesem Tumult in meinem Kopf, spüre ich das noch.
Hier.
Das.
Meine Haut an seiner Haut. Das ist mein Zuhause.
Plötzlich erstarrt er, und ich spüre, dass sich die Härchen an seinen Armen aufrichten, als er mich fragt:
»Woran denkst du?«
»An dich«, murmle ich.
»An mich?«
Ich nicke, lege den Kopf an seine Brust.
Er bleibt stumm, aber ich höre sein Herz schnell pochen, und irgendwann atmet er langsam aus, als hätte er zu lange die Luft angehalten. Obwohl wir so viel zusammen sind, vergesse ich manchmal, dass er meine Gefühle spüren kann, vor allem, wenn wir so dicht zusammen sind wie jetzt gerade.
Ich streichle seinen Rücken. »Ich habe daran gedacht, wie sehr ich dich liebe«, flüstere ich.
Einen Moment lang reagiert er nicht. Dann lässt er seine Finger durch mein Haar gleiten.
»Hast du es gespürt?«, frage ich.
Als er nicht antwortet, lehne ich mich zurück und blinzle, bis ich das Glitzern seiner Augen, die Linie seines Mundes erkennen kann.
»Aaron?«
»Ja.« Er klingt ein wenig atemlos.
»Also, konntest du es spüren?«
»Ja«, sagt er wieder.
»Und wie hat es sich angefühlt?«
Er seufzt. Rollt sich auf den Rücken. Bleibt so lange stumm, dass ich nicht sicher bin, ob er antworten will. Schließlich sagt er leise:
»Ist schwer zu beschreiben. Es ist eine Freude, die so dicht am Schmerz ist, dass ich die Gefühle manchmal nicht unterscheiden kann.«
»Das klingt ja ziemlich schrecklich«, sage ich.
»Nein, gar nicht. Es ist herrlich.«
»Ich liebe dich.«
Er zieht scharf die Luft ein. Und ich spüre seine Anspannung, als er an die Decke starrt.
Überrascht setze ich mich auf.
Aarons Reaktion ist so offen, wie ich es noch nie bei ihm erlebt habe.
Aber vielleicht geschieht eben auch etwas ganz Neues zwischen uns. Vielleicht habe ich ihn noch nie so intensiv erlebt wie jetzt gerade. Das würde schon passen, glaube ich. Wenn ich daran denke, wie sehr ich ihn liebe, nach allem, was wir gemeinsam –
Wieder atmet er scharf ein. Lacht dann, nervös.
»Wow«, sage ich.
Er legt eine Hand über die Augen. »Ist mir ja alles bisschen peinlich.«
Ich grinse, muss fast lachen. »Hey, das ist doch –«
Ein Schock durchfährt meinen Körper.
Ein heftiger Schauer überläuft mich, mein Rücken ist starr, mein Mund bleibt offen stehen, ich ringe nach Atem.
Glühende Hitze durchdringt mich.
Ich höre nur Rauschen, gigantischer Wasserfall, gischtendes Wasser, tosender Wind. Ich fühle nichts. Denke nichts. Bin nichts.
Ich bin, für den Bruchteil einer Sekunde –
Frei.
Meine Augenlider flattern auf zu auf zu auf zu ich bin ein Flügel, zwei Flügel, eine Schwingtür, fünf Vögel
Feuer steigt in mir auf, lodert.
Ella?
Die Stimme in meinem Kopf ist scharf, kraftvoll, wie spitze Pfeile. Benommen spüre ich Schmerzen – mein Kinn tut weh, mein Körper fühlt sich verdreht an –, aber ich achte nicht darauf. Und ich höre die Stimme erneut:
Juliette?
Als ich begreife, fühlt es sich wie Stiche an. Bilder meiner Schwester füllen meinen Kopf: Knochen, schrumpelige Haut, Finger mit Schwimmhäuten, entstellter Mund, augenlos. Ihr langes Haar wie ein Schwarm Aale, im Wasser treibend. Ihre seltsam körperlose Stimme durchdringt mich. Stumm sage ich:
Emmaline?
Ein vehementes Gefühl erfasst mich, als krallten sich Finger in meine Haut. Ich spüre Emmalines Erleichterung, schmecke sie förmlich. Meine Schwester ist erleichtert, erleichtert, dass ich sie erkenne, dass sie mich gefunden hat, erleichtert erleichtert erleichtert –
Was ist passiert?, frage ich.
Bilder überfluten mein Gehirn, bis es ertrinkt, versinkt. Emmalines Erinnerungen betäuben meine Sinne, blockieren meine Lunge. Ich ringe um Atem, während die Bilder über mich hereinbrechen: Max, mein Vater, untröstlich nach dem Mord an seiner Frau; der Oberste Befehlshaber Ibrahim, außer sich vor Wut, als er von Anderson verlangt, dass er die anderen Kinder fassen muss, bevor es zu spät ist; Emmaline, wie sie in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit ergreift –
Ich keuche.
Evie hatte alles so angelegt, dass nur sie und Max Emmalines Kräfte steuern konnten, und jetzt, nach Evies Tod, waren die Sicherungsschaltungen angreifbar. Emmaline hatte die Chance gewittert, für einen kurzen Zeitraum die Kontrolle über ihren Geist wiederzuerlangen, bevor Max die Algorithmen reparieren konnte.
Aber Evie hatte zu sorgfältig gearbeitet, und Max war zu schnell. Emmaline war nur zum Teil erfolgreich.
Sterben, sagt sie.
Sterben.
Ihre Gefühle sind eine Attacke auf meinen Körper. Alles schmerzt, mein Rückgrat fühlt sich wie Gummi an, ich kann nichts mehr sehen, scheine zu verglühen. Ich spüre meine Schwester – ihre Stimme, ihre Gefühle und Visionen – stärker denn je, weil Emmaline auch tatsächlich stärker ist als zuvor. Dass sie genügend Kraft aufbringen konnte, um mich zu finden, bedeutet, dass sie zumindest teilweise nicht kontrolliert wird. In den letzten Monaten haben Max und Evie vermehrt Experimente an Emmaline durchgeführt, in dem Versuch, sie stärker zu machen, weil ihr Körper verfällt. Das hier ist die Folge davon.
Meiner Schwester so nahe zu sein, ist eine Tortur.
Ich schreie, glaube ich.
Habe ich geschrien?
Emmalines Energien sind tobend, hitzig, atemberaubend, erschüttern meinen Körper, bringen meine Nerven zum Vibrieren. Ich sehe nur verschwommen, höre aber die kleinsten Geräusche. Eine Spinne krabbelt über den Boden. Erschöpfte Falter flattern gegen Wände. Eine Maus schreckt aus dem Schlaf auf. Stäubchen prallen ans Fenster, schürfen über das Glas.
Meine Augen scheinen in meinem Kopf umherzurollen.
Mein Haar so bleiern wie meine Glieder, die Haut über den Knochen wie Zellophan, ein lederner Sarg. Meine Zunge, meine Zunge ein lebloser Lurch in meinem Mund, rau und schwer. Die Härchen an meinen Armen, aufgerichtet, wehen hin und her, hin und her. Die Hände so fest zu Fäusten geballt, dass sie schmerzen.
Ich spüre eine Hand auf mir. Wo? Bin ich?
Einsam, sagt sie.
Und zeigt es mir.
Ein Bild von uns, im Labor, wo ich Emmaline zum ersten Mal wiedersah und unsere Mutter tötete. Ich nehme mich selbst mit dem Blick meiner Schwester wahr, was verblüffend ist. Sie kann mich nur verschwommen erkennen, sieht meine Umrisse, spürt meine Körperwärme. Und dann höre ich meine eigenen Worte, laut –
es muss einen anderen Weg geben
du musst nicht sterben
wir können das gemeinsam bewältigen
bitte
ich will meine Schwester zurückbekommen
ich will, dass du lebst
Emmaline
ich lasse dich hier nicht sterben
Emmaline Emmaline
wir können das gemeinsam bewältigen
wir können das gemeinsam bewältigen
wir können das bewältigen
gemeinsam
Ein kaltes metallisches Gefühl beginnt sich in mir auszubreiten, kriecht von meiner Brust in meine Arme und meinen Hals. Ein pochender Schmerz in meinen Zähnen. Emmalines Schmerz, der sich in mich krallt, so vehement, dass ich es kaum aushalten kann.
Auch ihre Zärtlichkeit ist massiv, beängstigend in ihrer Wahrhaftigkeit. Meine Schwester wird von ihren Gefühlen überwältigt, hitzig und eisig, gehetzt von Zorn und absoluter Verzweiflung.
Emmaline hat nach mir gesucht, die ganze Zeit.
In den letzten Tagen hat sie die Welt nach meinem Geist durchforstet, um einen Zufluchtsort zu finden, eine Stätte der Ruhe.
Einen Ort zum Sterben.
Emmaline, sage ich. Bitte –
Schwester.
Etwas in meinem Gehirn wird zusammengepresst. Angst durchfährt mich, bohrt sich in meine Organe. Ich röchle. Rieche Erde und feuchte, welke Blätter, fühle die Sterne, die auf meine Haut starren, Wind, der durch die Dunkelheit geistert wie angstvolle Eltern auf der Suche nach ihrem Kind. Mein Mund steht offen, Falter fliegen hinein. Ich liege am Boden.
Wo?
Nicht mehr im Bett, merke ich, nicht mehr im Zelt. Nicht mehr geschützt.
Aber wann habe ich mich bewegt?
Wer hat meine Füße bewegt? Meinen ganzen Körper?
Und wohin?
Ich versuche, mich umzusehen, bin aber blind, mein Kopf ist festgeklemmt, mein Rückgrat zerfasert. Mein Atem donnert in meinen Ohren, rau und laut, rau und laut, rauer Atem röchelnd in meinem Kopf
der sich dreht
Meine Fäuste lösen sich, Nägel scharren, als meine Finger sich öffnen, die Hände flach, ich rieche Hitze, schmecke Wind, höre Erde.
Erde an meinen Händen, in meinem Mund, unter meinen Fingernägeln. Ich schreie, merke ich. Jemand berührt mich, und ich schreie.
Nicht, schreie ich. Bitte, Emmaline – Bitte tu es nicht –
Einsam, sagt sie.
e i n s a m
Und dann, mit einem abrupten, wilden Schock –
Bin ich weg.
Kenji
Es fühlt sich absurd an, das als Glück zu betrachten.
Aber auf eine bizarre, verdrehte Art habe ich tatsächlich Glück. Dass ich in einem feuchtkalten Waldstück stehe, vor Sonnenaufgang. Dass mein nackter Oberkörper fast gefühllos ist vor Kälte.
Dass Nasira bei mir ist.
Wir haben uns beide sofort unsichtbar gemacht, sodass wir zumindest vorerst geschützt sind, hier in diesem kleinen Stück unberührter Wildnis zwischen Sperrzone und dem Refugium. Letzteres ist nur ein paar Hundert Meter weiter mitten in der Sperrzone angelegt worden und wird – damit es nicht weithin sichtbar ist – geschützt durch Nourias Superkraft, Licht zu steuern. Im Refugium ist das Klima moderat, das Wetter berechenbar. Aber hier draußen in der Wildnis sind die Winde ungezähmt und gnadenlos und die Temperaturen mörderisch.
Nasira und ich sind schon eine Weile draußen und haben uns gegenseitig durch die Dunkelheit gescheucht, in dem jeweiligen Versuch, den anderen zu ermorden. Dann hat sich das Ganze als kompliziertes Missverständnis herausgestellt, war aber auch eine Art glückliche Fügung: Hätte Nasira sich nicht um drei Uhr morgens in mein Zimmer geschlichen und mich um ein Haar versehentlich abgemurkst, hätte ich sie nicht aus dem Schutz des Refugiums hinaus in den Wald gejagt. Und wenn wir nicht so weit entfernt gewesen wären, hätten wir nicht die Angstschreie gehört, wären also auch nicht hingeeilt, um nachzusehen, was da geschah. Und wir hätten Folgendes nicht gesehen: wie meine beste Freundin sich im Morgengrauen die Seele aus dem Leib schreit.
Das hätte ich verpasst:
J auf den Knien am Boden, Warner neben ihr kauernd, beide kreidebleich, während sich über ihnen der Himmel buchstäblich spaltete. Das Ganze spielte sich vor dem Eingang zum Refugium ab, das Waldstück ist eine Art Puffer zwischen dem Stützpunkt und dem nächsten Sektor, 241.
Was geschieht hier?
Ich erstarrte, als ich die beiden sah, am Boden kauernd. War wie gelähmt vor Verwirrung und Angst, während die Bäume sich seitwärtsbogen und der eiskalte Wind meinen nackten Oberkörper peitschte, weil ich keine Gelegenheit gehabt hatte, mir was überzuziehen.
Wäre die Nacht anders verlaufen, hätte ich die Gelegenheit dazu gehabt.
Wäre die Nacht anders verlaufen, hätte ich zum ersten Mal im Leben einen romantischen Sonnenaufgang und die längst überfällige Versöhnung mit einer schönen Frau erlebt. Nasira und ich hätten darüber gelacht, wie sie mich in den Rücken getreten und fast gekillt hätte und wie ich sie daraufhin beinahe erschossen hätte. Danach hätte ich ausgiebig geduscht, bis Mittag gepennt und mir dann ein gigantisches Frühstück einverleibt.
Ich hatte einen Plan für heute: entspannen.
Ich wollte mir eine kleine Auszeit genehmigen, um mich von meiner letzten Nahtoderfahrung zu erholen, und fand, das sei nicht zu viel verlangt. Ich dachte mir, nach allem, was ich durchgemacht hätte, würde mir die Welt eine kleine Ruhepause gönnen. Mich zwischen Tragödien mal durchatmen lassen.
Von wegen.
Stattdessen stehe ich hier, von Grauen und Kälte geschüttelt, und darf zusehen, wie die Welt untergeht. Wie der Horizont wegkippt. Wie der Wind tobt, Bäume im Erdboden versinken, Blätter wild herumwirbeln. Ich sehe das, bin Zeuge davon und kann es einfach nicht glauben.
Aber ich beschließe, das als Glück zu bezeichnen.
Glück, Schicksal, günstiger Zufall, Fügung –
Die scheußliche Übelkeit in meinem Bauch betrachte ich als coolen Zaubertrick, weil es mir deshalb gelingt, die Augen offen zu halten, um das alles zu erleben. Und mir zu überlegen, wie ich helfen kann.
Weil niemand sonst hier ist.
Niemand außer mir und Nasira, was eigentlich vollkommen verrückt und unwahrscheinlich ist. Normalerweise gibt es vor dem Refugium rund um die Uhr Wachen, aber da ist niemand. Auch keine Soldaten aus dem Sektor. Nicht mal verängstigte Zivilisten.
Es ist, als stünden wir auf einem unsichtbaren Existenzlevel in einem Vakuum. Wie J und Warner hier gelandet sind, ohne entdeckt zu werden, ist mir ein Rätsel. Beide sehen aus, als wären sie durch Schlamm gerobbt. Und obwohl J vielleicht gerade erst zu schreien begonnen hat, habe ich tausend Fragen.
Doch die müssen warten.
Ich will Nasira ansehen, habe einen Moment lang vergessen, dass wir unsichtbar sind. Aber dann höre ich sie hinter mir und seufze erleichtert, als ich spüre, wie sie meine Hand ergreift und fest drückt. Ich erwidere den Händedruck.
Glück, sage ich mir.
Ich habe Glück, dass wir jetzt hier sind, denn sonst läge ich im Bett und wüsste gar nicht, dass J in Gefahr ist. Würde die zittrige, verzweifelte Stimme meiner Freundin nicht hören. Den zersplitternden Sonnenaufgang nicht sehen, pfauenbunt inmitten des Infernos. Würde nicht sehen, wie J sich den Kopf hält und schluchzt. Hätte den scharfen Geruch von Kiefern und Schwefel im Wind nicht gerochen, die schmerzende Trockenheit in der Kehle nicht gespürt, das Beben in meinen Gliedern. Hätte nicht miterlebt, wie J den Namen ihrer Schwester schrie. Und sie anflehte, irgendetwas Bestimmtes nicht zu tun.
Ja, Glück also.
Denn hätte ich das alles nicht miterlebt, wüsste ich auch nicht, wer dafür verantwortlich ist.
Emmaline.
Ella
Juliette
Ich habe Augen, zwei, sie rollen hin und her, in meinem Kopf herum, ich habe Lippen, zwei, feucht und schwer, aufstemmen, habe Zähne, viele, Zunge, eine, Finger, zehn, zähle sie
einszweidreivierfünf, und seltsam, so ssseltsam, diese Zunge, sseltsam, sssseltsames Ding, so ein sssssssssseltsamesDing
Einsamkeit
schleicht sich heimlich an
still
und
leise,
sitzt neben dir im Dunkeln, streichelt dein Haar, während du schläfst umschlingt dich drückt dich sofestdassdukaumatmenkannst das Pochen deines pulsierenden Bluts kaum noch hören kannst, schnell und schneller unter deiner
Haut
streift mit ihren Lippen die feinen Härchen in deinem
Nacken
Einsamkeit ist ein seltsamesDingein sseltsamesDing alte Freundin, steht neben dir im Spiegel und schreit du bist nichtgutgenugnichtgutgenug nie nie gutgenug
mmmmmanchmal lässt sie
einfach
nicht
los
Kenji
Ich weiche einer klaffenden Erdspalte aus und ducke mich unter einem Gestrüpp hinweg, das plötzlich in der Luft auftaucht. Ein Fels schwillt zu gigantischer Größe an, und als er in unsere Richtung zu rollen beginnt, packe ich Nasiras Hand noch fester, und wir rennen weiter.
Der Himmel zersplittert, vor unseren Füßen bricht die Erde auf. Die Sonne flackert wie ein Stroboskop, dunkel, hell, dunkel, hell. Und die Wolken – was ist mit denen los?
Zerteilen sich so schnell wie im Zeitraffer.
Bäume biegen sich bis zum Erdboden, donnernde Windböen fegen heran, und plötzlich ist der Himmel voller Vögel. Vögel.
Emmaline ist vollkommen außer Kontrolle.
Wir wussten, dass ihre telekinetischen und psychokinetischen Kräfte gewaltig sind – in bislang unbekannten Dimensionen –, und wir wussten, dass Emmaline vom Reestablishment manipuliert wurde, damit sie die Welt beherrschen kann. Aber mehr wussten wir auch nicht, und bislang waren das nur Worte. Reine Theorie.
So hatte sie noch niemand je erlebt.
Tobend.
Und sie tut J irgendetwas an, attackiert brutal ihr Gehirn, verwüstet gleichzeitig die Welt, und dieser Horrortrip, den ich hier gerade erlebe, wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer.
»Lauf ins Refugium«, schreie ich Nasira zu. »Hol Hilfe – hol die Zwillinge!«
Ein Antwortruf, dann löst sich ihre Hand von meiner, und ich höre kurz die Schritte ihrer schweren Stiefel auf dem Boden, als sie Richtung Lager rennt. Ich bin erleichtert, dass sie so schnell handelt.
Fühlt sich gut an, eine kompetente Partnerin an meiner Seite zu haben.
Ich stemme mich gegen den Wind, kämpfe mich voran, bis ich nahe genug bei Warner und J bin, um ihre Gesichter deutlicher erkennen zu können. Dann mache ich mich wieder sichtbar.
Inzwischen zittere ich am ganzen Körper vor Erschöpfung, stütze keuchend die Hände auf die Knie, um zu Atem zu kommen.
Ich hatte mich gerade erst einigermaßen von den Folgen der Drogen erholt, und jetzt bin ich schon wieder in Lebensgefahr. Aber mir wird klar, dass ich keinen Anlass zum Jammern habe, als ich mich aufrichte und sehe, in welchem Zustand Warner ist.
Er sieht absolut furchtbar aus.
Scheint fast am Ende seiner Kräfte zu sein, während er Js Schultern umklammert, als müsste er sie davon abhalten, wegzufliegen, und erst in diesem Moment ahne ich, dass er nicht nur bei ihr ist, um sie seelisch zu stärken.
Die ganze Szene ist surreal: Beide sind nur teilweise bekleidet, knien auf der Erde, J presst die Hände auf die Ohren – und ich frage mich, was für eine Hölle diese zwei wohl gerade durchleben.
Und ich habe geglaubt, ich hätte eine merkwürdige Nacht.
Plötzlich knallt etwas mit solcher Wucht gegen meinen Rücken, dass ich zu Boden gehe. Als ich mich aufstütze und wild um mich blicke, sehe ich etwas, das mich zum Würgen bringt.
Ein großer toter Vogel.
Oh Gott.
Und J schreit weiter.
Ich rapple mich auf, und als ich mich weiterschleppe, um die restlichen Meter zu meinen Freunden zu überwinden, verstummt plötzlich alles.
Wie ausgeschaltet.
Kein heulender Wind, keine angstvollen Schreie, kein Donnern und Tosen. Das ist keine gewöhnliche Stille.
Kein Ton ist zu hören.
Absolut gar nichts.
Ich blinzle verwirrt, drehe den Kopf hin und her, schaue dann in alle Richtungen, um eine Erklärung zu finden. Hoffe inständig, dass sie sich irgendwo zeigen wird.
Doch dem ist nicht so.
Was nur heißen kann, dass ich taub geworden bin.
Nasira ist nirgendwo zu sehen, J und Warner sind immer noch etwa zwanzig Meter entfernt, und ich bin taub. Höre den Wind nicht mehr, den Lärm aus den Siedlungen in der Nähe, nicht einmal mehr mein eigenes Keuchen. Als ich die Hände zu Fäusten ballen will, dauert das ewig, als wäre die Luft plötzlich eine zähe Masse, die Widerstand leistet.
Etwas stimmt nicht mit mir.
Ich bin so langsam wie nie zuvor, so langsam, als müsste ich unter Wasser rennen. Irgendetwas zieht mich körperlich von Juliette weg, versucht, mich von ihr fernzuhalten – und plötzlich verstehe ich. Plötzlich erkenne ich die Zusammenhänge.
Natürlich ist niemand hier. Natürlich eilt niemand zu Hilfe.
Emmaline verhindert es.
Vielleicht bin ich überhaupt nur so nahe herangekommen, weil sie mich durch die Unsichtbarkeit nicht wahrgenommen hat. Ich frage mich, wie es ihr gelingt, alle von hier fernzuhalten.
Und ich frage mich, wie ich es unter diesen Umständen schaffen kann, zu überleben.
Das Denken fällt auch schon schwerer. Es dauert endlos lange, einen Gedanken zu fassen. Die Arme zu bewegen. Den Kopf zu heben. Mich umzusehen. Als es mir schließlich gelingt, den Mund zu öffnen, wird mir klar, dass meine Stimme gar nicht funktioniert.
J, immer noch auf den Knien kauernd, hat sich vorgebeugt und die Augen zusammengekniffen, den Mund zum Schrei geöffnet, aber falls sie immer noch schreit, kann ich es nicht hören.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals im Leben so viel Angst gehabt zu haben.
Ich muss unbedingt näher an J und Warner herankommen, kann von hier aus nicht mal erkennen, ob sie verletzt sind. Aber als ich mich schwerfällig vorwärtsschleppe, explodiert mit einem Knall etwas in meinen Ohren.
Dann herrscht wieder diese unheimliche Stille, doch jetzt ist auch ein furchtbarer Druck in meinem Kopf entstanden, ein grausam stechender Schmerz, und der Druck nimmt stetig zu, als sollte ich von innen heraus gesprengt werden. Es ist, als wäre mein Kopf mit Helium gefüllt und würde anschwellen wie ein Ballon, der gleich platzen wird. Als ich glaube, dass es nicht mehr zu ertragen ist und ich in der nächsten Sekunde sterben werde, erbebt die Erde unter meinen Füßen.
Eine seismische Erschütterung –
Und plötzlich sind alle Geräusche wieder da, aber mit so brutaler Lautstärke, dass etwas in mir zu zerreißen scheint. Als ich die Hände von den Ohren nehme, sind sie rot vor Blut. Ich schwanke, Dröhnen und schrilles Pfeifen im Kopf.
Als ich mir die Hände an meinem nackten Oberkörper abwische, wird mir schwarz vor Augen. Ich stürze, lande so hart auf der Erde, dass ich den Aufprall in allen Knochen spüre. Die Erde an meinen Händen fühlt sich weich an, schlammig. Nass. Wolkenbruchartiger Regen fällt vom Himmel, und ich hebe den Kopf, noch immer so langsam, als wäre er festgeschraubt, während ich spüre, wie mir Blut aus den Ohren tropft. Blut tropft, auf meine Schultern, Blut –
Name.
Jemand ruft meinen Namen.
Brüllt meinen Namen, so laut, dass das Wort in meinem Kopf widerhallt, ein Echo erzeugt, ich kann es nicht orten.
Kenji
Ich versuche, mich umzuschauen, aber mein Kopf dröhnt und pfeift zu heftig.
K e n j i
Ich blinzle, was Tage zu dauern scheint.
Vertrauter
Freund
Etwas rührt sich, unter mir, versucht mich hochzuziehen, aber das nützt nichts. Ich bewege mich nicht.
Zu
schwer
Ich versuche zu sprechen, aber das geht nicht. Ich sage nichts, tue nichts, während es sich anfühlt, als würden kalte Finger mein Gehirn umklammern, es zusammendrücken, die Synapsen zerstören. In der Schwärze unter meinen Augenlidern erwachen weitere Worte, Worte, die wie Erinnerungen klingen, aber ich verstehe sie nicht, kann sie nicht deuten
der Schmerz in mir, die Ängste, die ich überwunden haben sollte. Ich erschlaffe unter dem Gewicht der Einsamkeit, der Ketten der Enttäuschung. Allein mein Herz wiegt tausend Pfund. Ich bin so schwer, dass ich nicht mehr hochgehoben werden kann. Ich bin so schwer, dass ich mich in der Erde begraben muss. Ich bin so schwer, zu schwer
Mit einem Seufzer gebe ich auf, sacke nach vorn, mein Gesicht sinkt in den Schlamm. Die Erde heißt mich willkommen, zu Hause.
Die Welt wird schwarz.
Mutig
Meine Lider zucken. In meinen Ohren ein stetiges Brummen, wie ein Generator. Kein Licht mehr, nur noch Dunkelheit. Ein Blackout. Angst legt sich auf meine Haut, bedeckt mich.
aber
s c h w a c h
Messerstiche in meinen Knochen, sie füllen sich mit Trauer, einer Trauer, so überwältigend, dass mir der Atem stockt.
Noch nie habe ich so sehr gehofft, meine Existenz beenden zu können.
Ich schwebe.
Schwerelos und dennoch – beschwert, dazu bestimmt, ewig zu sinken. Trübes Licht dringt durch die Dunkelheit unter meinen Lidern, und ich sehe Wasser. Meine Sonne, mein Mond sind das Meer, meine Berge der Ozean. Ich lebe in Flüssigkeit, die ich niemals zu mir nehme, ertrinke in milchigen, schlierigen Gewässern. Mein Atem ist schwer, automatisch, mechanisch. Ich bin gezwungen, einzuatmen, auszuatmen. Der raue röchelnde Laut meines eigenen Atems ist meine ständige Erinnerung an das Grab, das mein Heim ist.
Ich höre etwas.
Ein metallisches Geräusch, dumpf, Metall auf Metall, dringt zu meinen Ohren aus weiter Ferne, wie aus dem Weltall. Ich blinzle, erkenne verschwommen neue Formen und Farben. Balle die Fäuste, aber mein Fleisch ist weich, meine Knochen wie Teig, meine Haut schuppig. Ich bin von Wasser umgeben, aber mein Durst wird nie gelöscht, und meine Wut –
Meine Wut –
Etwas knackt. Mein Kopf. Mein Gehirn. Mein Hals.
Meine Augen sind weit aufgerissen, ich keuche panisch. Knie am Boden, Stirn in den Schlamm gedrückt, die Hände stecken in der weichen, nassen Erde.
Ich richte mich langsam auf, alles dreht sich vor meinen Augen.
»Was zum Teufel?«, murmle ich. Ringe um Atem. Schaue mich um. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. »Was – Was –«
Ich war gerade dabei, mir mein eigenes Grab auszuheben.
Und mit maßlosem Schrecken wird mir klar: Emmaline war in meinem Kopf. Sie wollte, dass ich mich umbringe.
Aber sobald ich mir das bewusst mache – und auf meine schlammbedeckten Hände schaue, mit denen ich mich selbst beerdigen wollte –, empfinde ich intensives Mitgefühl für Emmaline. Denn ich habe ihren Schmerz gespürt, und er war nicht grausam.
Nur zutiefst verzweifelt.
Als hoffte sie, wenn ich mich umbringen würde, während sie in meinem Kopf war, könnte ich zugleich auch sie töten.
Wieder ein Schrei von J.
Mit letzter Kraft rapple ich mich hoch, in dem unerbittlichen Regen, der vom Himmel prasselt. Weshalb Emmaline mir die Worte mutig, aber schwach eingegeben hat, begreife ich nicht. Jedenfalls komme ich allein nicht klar mit alldem, ich muss dringend meine Freunde erreichen. Und kann nur hoffen, dass im Refugium alle unversehrt sind und Nasira wieder auftaucht. Bis dahin muss ich versuchen, mich durchzuschlagen, so erledigt ich auch bin.
Ich setze mich in Bewegung.
Schleppe mich voran und versuche nicht daran zu denken, dass mir Blut aus den Ohren rinnt. Versuche die Erdstöße, die Blitze, den tosenden Sturm nicht zu beachten, der sich gerade zum Orkan auswächst. Ich halte durch, bis ich vor den beiden stehe.
Warner schaut auf.
Er wirkt verwirrt, als könne er nicht glauben, dass ich hier vor ihm stehe. Einen Moment lang sieht er erleichtert aus, dann wieder gequält.
Und sagt zwei Worte, die ich von ihm niemals erwartet hätte:
»Hilf mir.«
Angesichts der Verzweiflung in seinen Augen begreife ich plötzlich, was er hier gerade durchmacht. Zuerst dachte ich, er würde Juliette nur berühren, um sie zu stützen und zu stärken.
Das war ein Irrtum.
Ihr ganzer Körper wird von einer fremden Energie förmlich geschüttelt, und Warner gelingt es nur mit äußerster Mühe, sie an Ort und Stelle festzuhalten. Etwas – jemand – hat Besitz von J ergriffen, will sie steuern und von hier wegbewegen. Und es gelingt Emmaline nur deshalb nicht, weil Warner hier ist und sich an J festklammert.
Ich habe keine Ahnung, wie er das schafft.
Ihre Haut ist fast durchsichtig, die Adern gespenstisch blau in ihrem bleichen Gesicht. J sieht aus, als würde sie gleich zerbersten. Ihr Körper gibt ein dumpfes elektrisches Brummen und Dröhnen von sich. Ich packe ihren Arm, und in der Sekunde, in der Warner sich bewegt, um Js Gewicht auf uns beide zu verlagern, werden wir alle drei nach vorn geschleudert. Wir knallen so hart auf den Boden, dass mir die Luft wegbleibt, und als ich endlich den Kopf wieder heben kann, starre ich Warner entsetzt an.
»Das ist Emmaline«, schreie ich.
Er nickt nur.
»Was sollen wir tun? Sie kann doch nicht immer so weiterschreien!«
Warner sieht mich wortlos an.
Sieht mich nur an, und das Grauen in seinem Blick sagt mir alles, was ich wissen muss. J kann eben wirklich nicht ewig so weiterschreien. Sie wird daran sterben. Großer Gott. Dass die Lage übel ist, war mir klar. Aber sie ist noch viel schlimmer, als ich vermutet hatte.
J sieht jetzt aus, als würde sie gleich zerplatzen.
»Sollen wir versuchen, sie hochzuheben?«, schreie ich, obwohl ich wahrscheinlich nicht mal ihren Arm, geschweige denn ihren ganzen Körper anheben könnte. Ich zittere selbst so heftig, dass ich es nur mit Mühe schaffe, sie überhaupt festzuhalten. Keine Ahnung, was für ein irrer Scheiß da gerade in ihr abläuft, aber sie wirkt wie ein Wesen von einem anderen Planeten, wie ein Alien. Und halb tot. Ihre Augen sind nach wie vor fest zusammengekniffen, ihr Mund weit aufgerissen. Sie verströmt irgendeine extreme Energie. Es ist absolut beängstigend.
Und ich merke, wie meine Kräfte nachlassen.