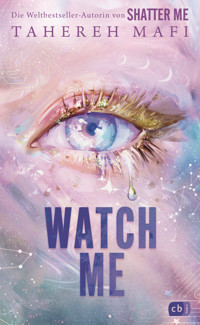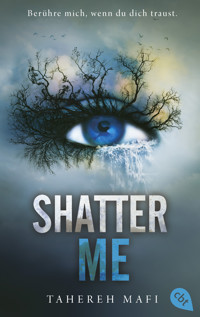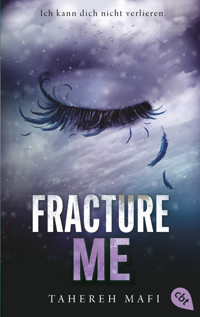8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütendwerden Bestsellerautorin Tahereh Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch geprägten Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran teilhaben lässt, wie Liebe alles Trennende überwindet. Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die sie ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training mit ihrem Bruder und dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ... »Die allerbesten Bücher bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und das ist eines von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tahereh Mafi
Wie du mich siehst
Über dieses Buch
Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütendwerden
Bestsellerautorin Tahereh Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch geprägten Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran teilhaben lässt, wie Liebe alles Trennende überwindet.
Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die sie ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training mit ihrem Bruder und dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ...
»Die allerbesten Bücher bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und das ist eines von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Tahereh Mafi wurde 1988 in einer Kleinstadt in Connecticut, USA, geboren. Sie ist iranischer Abstammung und die jüngste von fünf Geschwistern neben vier älteren Brüdern. Ihr Debütroman Shatter Me (dt.: Ich fürchte mich nicht), der erste Band einer Trilogie, ist 2011 in den USA erschienen, wurde in über 30 Sprachen übersetzt und stand auf den Bestsellerlisten der New York Times und der USA Today. Mafi ist mit dem Filmemacher und Schriftsteller Ransom Riggs verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Santa Monica, Kalifornien.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel A Very Large Expanse of Sea bei HarperCollins, New York
© by Tahereh Mafi, 2018
Published by Arrangement with Tahereh Mafi
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: formlabor unter Verwendung einer Abbildung von GoodStudio (shutterstock.com)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5223-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Es kam mir vor, als wären wir ständig nur am Umziehen, immer, um uns irgendwie zu verbessern, ein besseres Leben zu haben, was weiß ich. Für mich war es das totale emotionale Schleudertrauma. Seit der ersten Klasse war ich auf so vielen unterschiedlichen Schulen gewesen, dass ich ihre Namen durcheinanderbrachte, und die andauernden Schulwechsel hatten mich so zermürbt, dass mir die Lust an meinem Leben verging. Das war jetzt schon die dritte Highschool in weniger als zwei Jahren. Ich kam da nicht mehr mit. Dabei musste ich mich sowieso schon jeden Tag mit so viel Bullshit rumschlagen, dass ich es manchmal kaum mehr schaffte, die Lippen zu bewegen. Ich fürchtete mich davor, zu sprechen oder zu schreien, weil ich Angst hatte, die Wut würde mich an meinen geöffneten Mundwinkeln packen und in Stücke reißen.
Also schwieg ich.
Für mich war es beinahe schon Routine. Wieder mal ein erster Schultag in einer wieder mal neuen Stadt. Ich machte es wie an jeder neuen Schule und vermied es, irgendwen anzuschauen. Ich wurde nämlich angeschaut, und sobald ich zurückschaute, fassten die Leute das als Einladung auf, irgendeinen Kommentar von sich zu geben. Das war dann fast immer entweder etwas Beleidigendes oder Dummes oder beides. Deshalb hatte ich schon vor längerer Zeit entschieden, es mir leichter zu machen, indem ich so tat, als wären sie gar nicht da. Die ersten drei Stunden waren ohne größeren Zwischenfall vorübergegangen, aber ich hatte noch Orientierungsprobleme. Der nächste Kurs fand anscheinend in einem ganz anderen Gebäude statt, und ich war gerade dabei, die Zimmernummern an den Türen mit denen auf meinem Stundenplan zu vergleichen, als es zum zweiten Mal klingelte. Bis ich begriff, was los war und entgeistert auf die Wanduhr schaute, hatten sich die Schülerhorden um mich herum schon verzogen, und ich stand allein in einem langen, ausgestorbenen Flur, den zerknitterten Ausdruck meines Stundenplans zwischen den Fingern. Ich schloss die Augen und stieß einen unterdrückten Fluch aus. Als ich das Klassenzimmer endlich gefunden hatte, war ich sieben Minuten zu spät. Ich stieß die Tür auf, die leise in den Angeln quietschte, worauf sich ein paar Schüler umdrehten. Der Lehrer verstummte, die Lippen noch zum letzten Wort geformt, die Mimik zwischen zwei Ausdrücken erstarrt.
Er blinzelte mich an.
Die Wände zogen sich um mich zusammen, ich schaute zu Boden und rutschte wortlos auf den nächsten freien Platz. Ich holte mein Heft aus der Tasche. Einen Stift. Atmete flach. Und während ich darauf wartete, dass der Moment vorüberging, dass sich die Leute wieder umdrehten und der Lehrer weiterredete, räusperte er sich plötzlich. »Wie ich eben schon sagte, werdet ihr für diesen Kurs eine umfangreiche Lektüreliste abarbeiten müssen, und diejenigen, die neu bei uns sind …«, er zögerte und warf einen Blick auf die Anwesenheitsliste in seiner Hand, »… werden über unser extrem anspruchsvolles Lernpensum vielleicht erst einmal überrascht sein.« Er schwieg. Zögerte wieder. Sah mit zusammengekniffenen Augen auf den Zettel.
Dann sagte er unvermittelt: »Entschuldige bitte, falls ich das nicht richtig ausspreche, aber du bist … Sharon?« Er sah auf, sah mir direkt in die Augen.
»Shirin«, sagte ich.
Wieder drehten sich einige Schüler zu mir um.
»Ah ja.« Der Lehrer – Mr Webber – machte keinen Versuch, meinen Namen noch einmal korrekt auszusprechen. »Willkommen.«
Ich sagte nichts.
»Schön.« Er lächelte. »Du weißt, dass das hier ein Englischkurs mit erhöhtem Anforderungsniveau ist.«
Ich stutzte. Was für eine Reaktion erwartete er auf eine so banale Feststellung? Schließlich sagte ich: »Ja?«
Er nickte, dann lachte er. »Na ja, Herzchen, ich fürchte, du bist hier im falschen Kurs.«
Ich wollte ihm sagen, dass er mich nicht Herzchen nennen sollte, wenn er mit mir redete. Ich wollte ihm sagen, dass er überhaupt nicht mit mir reden sollte, niemals, prinzipiell nicht. Stattdessen sagte ich: »Ich bin im richtigen Kurs«, und hielt meinen zerknitterten Stundenplan hoch.
Mr Webber schüttelte immer noch lächelnd den Kopf. »Kein Problem, das ist nicht deine Schuld. So etwas passiert bei neuen Schülern öfter. Aber das Sekretariat ist gleich …«
»Ich bin im richtigen Kurs, klar?« Das klang heftiger als beabsichtigt. »Ich bin im richtigen Kurs.«
Genau so ein Scheiß passierte mir ständig.
Es war total egal, wie akzentfrei mein Englisch war. Es war egal, wie oft ich den Leuten sagte, dass ich hier geboren war, dass Englisch meine erste Sprache war, dass sich meine Cousins und Cousinen im Iran über mich lustig machten, weil ich holpriges Farsi mit amerikanischem Akzent sprach – alles egal. Sie nahmen trotzdem automatisch an, ich wäre frisch per Boot aus irgendeinem fernen Land gekommen. Jetzt verflog Mr Webbers Lächeln. »Oh«, sagte er. »Okay.« Um mich herum ertönte Lachen, und ich spürte, wie mein Gesicht heiß wurde. Ich senkte den Blick und schlug mein leeres Heft wahllos irgendwo auf, in der Hoffnung, dem Gespräch damit ein Ende zu machen.
Stattdessen hob Mr Webber beide Hände und sagte: »Hör zu – ich persönlich freue mich, dich in der Klasse zu haben, okay? Aber das ist nun mal ein Kurs für Schüler mit besonderem Leistungsprofil, und obwohl ich mir sicher bin, dass dein Englisch wirklich gut ist, bist du trotzdem …«
»Mein Englisch ist nicht wirklich gut«, sagte ich. »Mein Englisch ist – verfickt nochmal – perfekt.«
Den Rest der Stunde verbrachte ich im Büro des Schulleiters, der mir streng auseinandersetzte, dass ein solches Benehmen von der Schule nicht akzeptiert würde. Falls ich vorhätte, weiterhin ein absichtlich feindseliges und unkooperatives Verhalten an den Tag zu legen, sollte ich vielleicht noch mal überdenken, ob dies die geeignete Schule für mich sei. Und wegen meiner vulgären Ausdrucksweise könnte ich gleich eine Stunde nachsitzen. Während er noch schimpfte, klingelte es zur Mittagspause, und als er mich gehen ließ, raffte ich meine Sachen zusammen und stürzte davon.
Ich hatte es nicht eilig, irgendwo hinzukommen; ich wollte nur weg von den Leuten. Nach der Mittagspause musste ich noch zwei weitere Kurse durchstehen, war mir aber nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Für heute war meine Frustrationstoleranz in Sachen Dummheit anderer Leute eigentlich schon aufgebraucht.
Ich saß in einer Toilettenkabine, balancierte mein Mittagessentablett auf den Knien und hielt meinen Kopf mit beiden Händen im Schraubzwingengriff, als mein Telefon summte.
Mein Bruder.
was machst du?, schrieb er.
mittag essen
blödsinn. wo versteckst du dich?
auf dem klo
was? warum?
was soll ich sonst 37 minuten lang machen?
leute anstarren?
Er schrieb, ich solle verdammt nochmal aus dem Klo kommen und in die Cafeteria gehen und dort mit ihm essen. Anscheinend hatte die Schule schon ein ganzes Aufgebot an neuen Freunden angekarrt, um sein hübsches Gesicht zu feiern. Jedenfalls wollte er, dass ich mich ihm anschloss, statt mich zu verstecken.
danke, kein bedarf, tippte ich.
Und dann warf ich mein Essen in den Müll und verkroch mich bis zum Ende der Pause in der Bibliothek.
Mein Bruder war zwei Jahre älter als ich; wir waren eigentlich fast immer auf denselben Schulen. Aber für ihn waren die Umzüge nicht so schlimm wie für mich. Für ihn bedeutete eine neue Stadt nicht jedes Mal neues Leiden. Allerdings gab es auch zwei große Unterschiede zwischen mir und meinem Bruder: Erstens sah er extrem gut aus, und zweitens lief er nicht mit einer metaphorischen Neonleuchtschrift auf dem Kopf rum, die ACHTUNG! TERRORISTIN IM ANMARSCH blinkte.
Die Mädchen standen Schlange, um ihm die Schule zu zeigen. Er war der »süße Neue«. Der faszinierende Fremde mit der faszinierenden Lebensgeschichte und dem faszinierenden Namen. Der schöne Exot, auf den sich all die hübschen und beliebten Mädchen stürzten, um ihr Bedürfnis nach einem Objekt zum Experimentieren und gleichzeitig auch noch Gegen-die-Eltern-Rebellieren zu befriedigen. Ich hatte aus bitterer Erfahrung gelernt, dass ich mich mittags nicht zu ihm und seiner Clique in die Cafeteria setzen konnte. Jedes Mal, wenn ich auftauchte – mit eingezogenem Schwanz und einem Selbstwertgefühl, das sowieso schon in der Tonne lag –, dauerte es keine fünf Sekunden, bis ganz klar war, dass die neuen Freundinnen meines Bruders nur nett zu mir waren, weil sie sich über mich an ihn ranmachen wollten.
Danke, nein. Da setzte ich mich doch lieber aufs Mädchenklo.
Ich redete mir ein, es würde mir nichts ausmachen, aber das tat es doch. Klar tat es das.
Das politische Klima ließ mir keinen Moment zum Durchatmen. Kurz nach dem 11. September – zwei Wochen nachdem ich in die neunte Klasse gekommen war – hatten mich auf dem Heimweg zwei Typen aus meiner Schule attackiert, aber das Schlimmste …
… das Schlimmste daran war gewesen, dass es Tage gedauert hatte, bis ich bereit war, mir einzugestehen, was wirklich passiert war. Warum es passiert war. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, es gäbe eine komplexere Erklärung; hatte gehofft, es hätte mehr dahintergesteckt als blinder Hass. Dass etwas anderes sie dazu getrieben hätte. Dass diese zwei, mir komplett unbekannten Jungs einen anderen Grund gehabt hätten, mich bis nach Hause zu verfolgen, einen anderen Grund, mir das Tuch vom Kopf zu reißen und mich damit zu würgen. Ich verstand nicht, warum sie ihren Hass mit solcher Brutalität an mir abreagiert hatten, ohne dass ich irgendwem etwas getan hatte. Warum sie geglaubt hatten, das Recht zu haben, mir am helllichten Tage Gewalt anzutun, obwohl ich doch einfach nur eine Straße entlanggegangen war.
Ich hatte es nicht verstehen wollen.
Aber genau so war es gewesen.
Obwohl ich keine Erwartungen in unseren Umzug hierher gesetzt hatte, spürte ich jetzt doch Enttäuschung darüber, dass diese Schule auch nicht besser war als meine letzte. Wieder mal war ich in einer Kleinstadt gelandet, wieder mal saß ich in einem Universum fest, das von Menschen bevölkert war, die Gesichter wie meines nur aus den Abendnachrichten kannten – und das machte mich wütend. Es machte mich wütend, weil ich genau wusste, wie viele anstrengende, einsame Monate jetzt wieder vor mir lagen, bis man sich an der neuen Schule an mich gewöhnt hatte. Es machte mich wütend, weil ich wusste, wie lang meine Mitschüler brauchen würden, bis sie endlich einsahen, dass ich nicht gemeingefährlich war und dass man vor mir keine Angst haben musste. Es machte mich wütend, weil ich wusste, wie unfassbar viel Mühe und Selbstüberwindung es mich kosten würde, bis ich endlich eine einzige Freundin gefunden hätte, ein Mädchen, das mutig genug war, sich in der Öffentlichkeit neben mich zu setzen. Ich hatte diese immer gleiche, immer schlimme Erfahrung schon so viele Male an so vielen unterschiedlichen Schulen machen müssen, dass ich manchmal am liebsten den Kopf gegen die Wand geschlagen hätte. Alles, was ich mir von dieser Welt noch wünschte, war die totale Unauffälligkeit. Ich hätte so gern gewusst, wie es sich anfühlt, einen Raum zu durchqueren und von niemandem angestarrt zu werden. Aber ein einziger Rundumblick ließ mich erkennen, dass jede Hoffnung darauf hier vergebens war.
Die Schülerschaft meiner neuen Highschool bestand zum allergrößten Teil aus einer Masse von gleich aussehenden Jugendlichen, die anscheinend alle basketballverrückt waren. Ich war schon an Dutzenden von Jubelplakaten vorbeigekommen, und über dem Haupteingang hingen riesige Banner, die das schuleigene Team feierten, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hatte. An den Wänden klebten überdimensionale schwarze Ziffern auf weißem Grund und brüllten den Vorübergehenden den Countdown der Tage bis zum ersten großen Spiel entgegen.
Ich zählte stattdessen die blöden Bemerkungen, die ich mir heute hatte anhören müssen. Obwohl ich schon bei vierzehn war, hielt ich mich ganz gut, bis ich auf dem Weg zu meinem nächsten Kurs im Gang von einem Typen gefragt wurde, ob ich mir die Windel um den Kopf gewickelt hätte, um darunter einen Sprengsatz zu verstecken. Als ich ihn nicht beachtete, meinte sein Kumpel, wahrscheinlich hätte ich unter dem Tuch eine Glatze, und ein dritter verdächtigte mich, ein verkleideter Mann zu sein. Während sie sich gegenseitig zu ihren wahnsinnig originellen Thesen gratulierten, empfahl ich ihnen, sich zu verpissen. Ich hatte keine Ahnung, wie diese Arschlöcher aussahen, weil ich sie keines Blickes gewürdigt hatte und wiederholte in meinem Kopf ständig: »Siebzehn, siebzehn …«, bis ich – natürlich zu früh – im Klassenzimmer ankam und in dem dämmerigen Raum darauf wartete, dass die anderen eintrudelten.
Diese regelmäßigen Giftspritzen, die mir irgendwelche unbekannten Menschen verabreichten, waren definitiv das Schlimmste am Kopftuchtragen. Das Beste war, dass ich Musik hören konnte, ohne dass Lehrer es mitbekamen.
Unter dem Tuch blieben meine Kopfhörer perfekt verborgen.
Die Musik erleichterte mir das Leben enorm. Mit Knopf im Ohr fiel es mir leichter, allein durch die Schulflure zu gehen oder einsam herumzusitzen. Ich freute mich, dass keiner sehen konnte, dass ich Musik hörte, weshalb mir auch keiner sagte, ich solle sie ausmachen. Mittlerweile war ich sehr geübt darin, Gespräche mit Lehrern zu führen, die keine Ahnung hatten, dass ich nur die Hälfte von dem mitbekam, was sie zu mir sagten, und das machte mich glücklich. Die Musik verlieh mir zusätzlichen Halt, sie war wie eine Art Ersatzskelett für mich. Ein Skelett, an das ich mich lehnen konnte, wenn ich vor Erschöpfung zusammenzusacken drohte. Der iPod, den ich meinem Bruder geklaut hatte, war im Dauereinsatz, und ich fühlte mich, als würde ich dem Soundtrack zum Film meines Lebens lauschen, während ich durch die Flure ging. Irgendwie gab mir das Hoffnung. Fragt mich nicht, warum.
Als die Teilnehmer des letzten Kurses an diesem Tag schließlich alle im Raum waren, hatte ich die Lehrerin schon auf stumm geschaltet. Meine Gedanken wanderten. Ich schaute immer wieder zur Uhr und konnte es nicht erwarten, endlich hier rauszukommen. Die Fugees füllten das Vakuum in meinem Kopf, während ich auf meine Stiftedose starrte, die ich in den Händen drehte. Ich liebte Druckbleistifte. Schöne, besondere Druckbleistifte. Ich besaß eine kleine Sammlung, die mir eine Freundin aus meiner vorvorvorletzten Highschool aus Japan mitgebracht hatte. Sie waren schmal und bunt und glitzerten, und dazu gab es passende Radiergummis, und alles zusammen steckte in einer echt niedlichen Dose mit einem Comicschaf, das blökte: Mach dich nicht über mich lustig, bloß weil ich ein Schaf bin. Ich fand das witzig und lächelte bei der Erinnerung, als mir jemand auf die Schulter klopfte. Fest.
Ich drehte mich um. »Was?«, fragte ich lauter als beabsichtigt.
Ein Typ. Er sah überrascht aus.
»Was?«, fragte ich noch einmal, diesmal etwas gereizt.
Er sagte etwas, das ich nicht hörte. Ich zog den iPod aus der Tasche und machte ihn aus.
»Wow.« Er blinzelte mich an. Lächelte, wirkte aber auch erstaunt. »Hörst du da drunter etwa Musik?«
»Gibt’s irgendwas, was ich für dich tun kann?«
»Ach so, nein, nein. Ich hab dich nur eben aus Versehen mit meinem Buch angerempelt. Ich wollte mich bloß entschuldigen.«
»Okay.« Ich drehte mich um und schaltete den iPod wieder an.
Und dann war der Schultag vorbei.
Mein Name war verunstaltet worden, Lehrer hatten nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollten, mein Mathelehrer hatte einen Blick auf mich geworfen und der Klasse anschließend einen fünfminütigen Vortrag darüber gehalten, dass Menschen, die dieses Land nicht lieben, in das Land zurückgehen sollten, aus dem sie gekommen waren, und währenddessen hatte ich die ganze Zeit in mein aufgeschlagenes Mathebuch gestarrt, so dass sich die quadratische Gleichung auf der Seite in meine Netzhaut gebrannt hatte und ich sie tagelang nicht mehr aus dem Kopf bekam.
Keiner meiner Mitschüler hatte mit mir gesprochen, bis auf den einen, der mir aus Versehen sein Biobuch in die Schulter gerammt hatte.
Ich wünschte, das alles wäre mir egal gewesen.
Auf dem Nachhauseweg spürte ich Erleichterung, war aber zugleich auch gedrückter Stimmung. Es kostete Kraft, den Schutzschild hochzuhalten, der mich vor Verletzungen schützte, und am Ende des Tages war ich oft so ausgelaugt, dass ich am ganzen Körper zitterte.
Während ich die stille Straße entlangtrottete, die mich nach Hause führte, versuchte ich, den schweren, drückenden Nebel aus meinem Kopf zu schütteln und wieder Kraft zu schöpfen, als ein Wagen neben mir das Tempo drosselte und eine Frau rief, ich sei jetzt in Amerika, also solle ich mich gefälligst auch entsprechend kleiden, aber ich war so … so müde, dass ich noch nicht mal die Energie aufbrachte, wirklich wütend zu sein, als ich dem davonfahrenden Wagen zumindest meinen Mittelfinger hinterherstreckte.
Noch zweieinhalb Jahre, war alles, was ich denken konnte.
Noch zweieinhalb Jahre, bis ich aus diesem Gefängnis namens Highschool entlassen, bis ich diesen Monstern, die sich Menschen nannten, entkommen würde. Ich konnte es nicht erwarten, der Sicherungsverwahrung für Schwachköpfe endlich den Rücken zu kehren, endlich zu studieren und mein Leben selbst zu gestalten. Ich musste es nur schaffen, bis dahin irgendwie zu überleben.
Ich fand meine Eltern ganz schön bewundernswert. Immigranten aus dem Iran, die stolz auf ihre Herkunft waren und Tag für Tag hart arbeiteten, um mir und meinem Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit jedem neuen Umzug sorgten sie dafür, dass wir in eine bessere Gegend kamen, in ein besseres Haus, einen besseren Schulbezirk, der uns bessere Zukunftschancen bot. Sie kämpften. Strampelten sich ab. Gönnten sich keine Pause. Ich spürte, wie sehr sie mich liebten, aber es war auch klar, dass sie kein Verständnis für meine Probleme hatten, weil es in ihren Augen schlicht keine waren.
Sie besprachen nie etwas mit meinen Lehrern. Riefen nie in der Schule an. Drohten nicht, die Mutter des Mitschülers zu kontaktieren, der mir den Stein an den Kopf geworfen hatte. Seit ich denken konnte, hatten die Leute mich wie Dreck behandelt – falscher Name/falsche Herkunft/falsche Religion/falsche Gesellschaftsschicht –, aber im Vergleich zu dem, was meine Eltern in ihrer Jugend durchgestanden hatten, war mein Leben so wunderbar einfach, dass sie beim besten Willen nicht nachvollziehen konnten, weshalb ich nicht jeden Morgen mit einem Lied auf den Lippen aufwachte. Was mein Vater erlebt hatte, der als Sechzehnjähriger von zu Hause weg und allein nach Amerika gegangen war, war so krass, dass seine Einberufung nach Vietnam dagegen geradezu als Glanzpunkt erschien. Wenn ich mich als Kind bei meiner Mutter beklagte, wie gemein die anderen in der Schule zu mir gewesen waren, tätschelte sie mir den Kopf und erzählte mir, wie sie einen Krieg und eine Revolution überlebt hatte und wie ihr mit fünfzehn auf der Straße der Schädel eingeschlagen worden war, während man ihre beste Freundin ausgeweidet hatte wie einen Fisch. Also iss brav deine Cheerios und stell dich nicht an, du undankbares amerikanisches Mädchen.
Also aß ich meine Cheerios. Also hörte ich auf, über diese Dinge zu sprechen.
Ich liebte meine Mutter und meinen Vater, liebte sie wirklich über alles. Aber über meinen Schmerz redete ich nie mit ihnen. Es war sinnlos, Mitgefühl von Eltern zu erwarten, die der Meinung waren, ich sollte mich glücklich schätzen, auf eine Schule zu gehen, wo die Lehrer uns bloß mit verletzenden Bemerkungen traktierten und nicht mit Schlägen.
Also erzählte ich kaum etwas.
Wenn ich nach Hause kam, beantwortete ich ihre Fragen zu meinem Tag mit einem Schulterzucken. Ich erledigte meine Hausaufgaben. Ich beschäftigte mich. Ich legte mir Hobbys zu. Ich las viel. Ja, ein totales Klischee. Das einsame Mädchen und ihre Bücher. Aber der Tag, an dem mein Bruder in mein Zimmer kam und mir mit den Worten: »Hier. Hab ich in der Schule gewonnen. Ist wahrscheinlich eher was für dich«, den ersten Harry-Potter-Band an den Kopf warf, war wirklich einer der schönsten meines Lebens. Meine wenigen, nicht auf Buchseiten lebenden Freunde wurden zu Erinnerungen, die schnell verblassten. Im Laufe unserer Umzüge war vieles verlorengegangen – Sachen, Dinge, Zeug –, aber nichts tat so weh wie der Verlust von Menschen.
Meistens beschäftigte ich mich mit mir selbst.
Mein Bruder dagegen war ständig unterwegs. Als Kinder hatten wir immer zusammengesteckt, waren allerbeste Freunde gewesen, aber dann war er eines Tages aufgewacht und war cool gewesen und gutaussehend und ich nicht. Ich machte den Leuten schon durch mein bloßes Äußeres Angst, und irgendwie führte das dazu, dass unsere Wege sich trennten. Nicht mit Absicht, aber es gab eben immer irgendwelche Freunde, mit denen er verabredet war, Sachen, die er unternahm, Mädchen, die er anrief, und bei mir war das nicht so. Trotzdem mochte ich meinen Bruder sehr. Liebte ihn. Er war wirklich ein Schatz – wenn er mich nicht gerade zu Tode nervte.
Ich überstand die ersten drei Schulwochen, ohne dass viel Berichtenswertes passierte. Die Tage verliefen unspektakulär. Ermüdend. Der immer gleiche sinnlose Trott. Mein Kontakt mit Lehrern und Schülern beschränkte sich auf das Notwendigste, ansonsten verbrachte ich meine Zeit damit, Musik zu hören. Zu lesen. In der Vogue zu blättern. Die Mode der großen Designer, unbezahlbar für mich, faszinierte mich ohne Ende. An den Wochenenden durchforstete ich Secondhandläden nach Stücken, die mich an meine Lieblingslooks von den Laufstegen erinnerten und die ich später in der Abgeschiedenheit meines Zimmers nachzugestalten versuchte. Mit der Maschine kam ich nicht so gut zurecht, lieber nähte ich mit der Hand. Trotzdem zerbrachen mir ständig Nadeln, und ich stach mich, was mir in der Schule wegen meiner verpflasterten Fingerkuppen noch misstrauischere Blicke von den Lehrern einbrachte. Aber das Nähen war eine gute Ablenkung. Obwohl der September noch nicht zu Ende war, hatte ich die neue Schule schon mehr oder weniger abgeschrieben.
Nach einem weiteren fröhlichen Tag in der Strafanstalt kam ich nach Hause zurück und warf mich aufs Sofa. Meine Eltern waren beide noch arbeiten, und mein Bruder war unterwegs. Ich seufzte, schaltete den Fernseher an, zog mir mein Tuch vom Kopf und rupfte das Gummi aus dem Pferdeschwanz. Kämmte mir mit den Fingern durch die Haare. Lehnte mich zurück.
Um diese Uhrzeit liefen immer Wiederholungen von Matlock, und ich gebe es offen zu – egal, wie peinlich es ist: Ich verpasste nie auch nur eine einzige Folge. Ich fand die Serie über den alten Anwalt, der für teuer Geld unschuldige Leute verteidigt und Verbrechen aufklärt, genial. Als Matlock das erste Mal im Fernsehen lief, war ich noch nicht mal auf der Welt gewesen. Jetzt schauten nur noch Rentner die Serie, aber das machte nichts. Ich hatte selbst oft das Gefühl, ein sehr alter Mensch in einem jungen Körper zu sein. Bei Matlock fühlte ich mich unter meinesgleichen. Fehlte nur noch eine Schale mit Trockenpflaumen oder Apfelmus, um das Bild perfekt zu machen. Als ich gerade darüber nachdachte, in der Küche nachzusehen, ob wir irgendwelche Rentnerkost da hatten, hörte ich meinen Bruder nach Hause kommen.
Er brüllte Hallo ins Haus, aber ich gab nur ein unverbindliches Brummen von mir. Die Folge war spannend, und ich hatte jetzt keine Zeit für irgendwas anderes.
»Hey! Hast du mich nicht gehört?«
Ich hob den Kopf. Mein Bruder stand in der Tür.
»Ich hab noch ein paar Freunde mitgebracht«, sagte er, aber ich verstand ihn erst, als ein Junge ins Wohnzimmer kam und ich so erschrocken aufsprang, dass ich fast das Gleichgewicht verlor.
»Verdammt, Navid!«, fauchte ich und griff nach meinem Tuch. Normalerweise schlang ich mir den weichen Pashmina-Schal routiniert um den Kopf, aber ich war so überrumpelt, dass ich fahrig herummachte und ihn mir zuletzt einfach irgendwie überwarf. »Kein Grund zur Panik.« Der Junge lächelte beruhigend. »Ich bin zu achtzig Prozent schwul.«
»Schön für dich«, sagte ich gereizt. »Aber um dich geht es hier nicht.«
»Darf ich vorstellen: Bijan.« Navid verbiss sich das Lachen und nickte seinem Freund zu, der so offensichtlich Perser war, dass ich es kaum fassen konnte. Ich war mir sicher gewesen, dass wir hier in diesem Kaff die einzige Familie aus dem Iran waren. Als Navid laut lachte, wurde mir bewusst, dass ich mit meinem schief gewickelten Schal wahrscheinlich wie eine komplette Witzfigur aussah. »Und das sind Carlos und Jacobi …«
»Toll. Ich geh dann mal nach oben.«
Ich stürmte die Treppe hinauf.
Ein paar Minuten lang saß ich auf dem Bett und wäre vor Scham am liebsten gestorben. Ich kam mir so unendlich doof vor, aber dann entschied ich, dass die Szene eben zwar peinlich gewesen war, aber auch nicht so peinlich, dass ich mich deswegen stundenlang verstecken musste. Außerdem hatte ich Hunger. Also band ich mir die Haare wieder zusammen und schlang das Tuch um den Kopf, wobei ich die Enden wie immer über die Schultern warf, statt sie festzustecken. Dann holte ich tief Luft und ging nach unten.
Die vier saßen im Wohnzimmer auf der Couch und hatten alles, was auch nur entfernt essbar war, aus unserer Küche geholt und vor sich aufgebaut. Sie hatten sogar Trockenpflaumen gefunden, die sich einer von ihnen gerade in den Mund stopfte.
Navid schaute auf. »Hey.«
»Hi.«
Der mit den Pflaumen musterte mich. »Du bist also die kleine Schwester, ja?«
Ich verschränkte die Arme.
»Carlos«, stellte Navid ihn mir vor und zeigte dann mit dem Kinn auf den großen schwarzen Jungen am Rand. »Und Jacobi.«
Jacobi hob nur lässig die Hand, ohne in meine Richtung zu schauen. Vor ihm stand die Schachtel mit dem persischen Nougat, das die Schwester meiner Mutter uns aus dem Iran geschickt hatte. Sie war schon halbleer, und dabei wusste er wahrscheinlich nicht mal, was er da aß. Dieser extreme Heißhunger von Jungen erstaunte mich immer wieder. Irgendwie fand ich ihn fast abstoßend. Navid war der Einzige, der gerade nicht kaute, dafür trank er aber einen dieser ekligen Eiweißshakes.
Bijan musterte mich. »Ja. Sieht schon besser aus als eben.«
Ich schaute ihn mit verengten Augen an. »Wie lange bleibt ihr?«
»Jetzt sei nicht unhöflich«, sagte Navid, ohne aufzusehen. Er kniete sich vor den Fernseher und schob eine Kassette in den Videorekorder. »Wir wollen Breakin’ schauen.«
Ich war mehr als überrascht.
Breakin’ gehörte zu meinen absoluten Lieblingsfilmen.
Ich kann nicht sagen, wann und wie genau unsere Begeisterung für Breakdance angefangen hatte, aber mein Bruder und ich konnten uns stundenlang Videos über Breakdancer und Wettbewerbe aus aller Welt anschauen. Unsere Faszination für diese damals schon wieder fast vergessene Form des Urban-Dance war etwas, was uns immer wieder zusammenbrachte. Die Videokassette von Breakin’ hatten wir vor ein paar Jahren auf einem Flohmarkt gefunden und bestimmt schon zwanzigmal gesehen.
»Warum?«, fragte ich und setzte mich mit untergeschlagenen Beinen in einen Sessel. Es war klar, dass ich hierbleiben würde. Breakin’ gehörte zu den wenigen Filmen, die ich noch lieber schaute als Matlock. »Wie kommt ihr jetzt darauf?«
Navid drehte sich um. Lächelte. »Ich gründe eine Breakdance Crew.«
Ich starrte ihn an. »Im Ernst?«
Navid und ich hatten uns oft vorgestellt, wie es wäre, richtig Breakdance zu lernen, vielleicht irgendwann sogar bei Wettbewerben mitzumachen, hatten die Idee aber nicht weiterverfolgt. Trotzdem hatte mich der Gedanke nie losgelassen.
Navid stand auf. Lächelte breiter. Anscheinend sah er, dass ich angefixt war. »Machst du mit?«
»Ob ich mitmache?«, sagte ich. »Scheiße … Na klar!«
Meine Mutter kam mit einem Kochlöffel ins Zimmer und schlug mir auf den Hinterkopf. »Fosh nadeh!«, schimpfte sie. Keine Flüche.
Ich rieb mir den Kopf. »Verdammt, Ma«, beschwerte ich mich. »Das hat scheißweh getan.«
Sie schlug mir noch mal auf den Kopf.
»Verdammt.«
»Und wer ist das?« Sie nickte in Richtung der neuen Freunde meines Bruders.
Während Navid ihr die Jungs schnell vorstellte, betrachtete meine Mutter die Sachen auf dem Tisch. »In chie?«, fragte sie. Was ist das? Und dann auf Englisch: »Das ist doch kein Essen.«
»Was anderes hatten wir aber nicht da«, behauptete Navid. Was in gewisser Weise stimmte. Meine Eltern kauften nie Knabberzeug oder Süßigkeiten. Niemals. Bei uns gab es weder Chips noch Kekse. Wenn ich zwischendurch Hunger hatte, gab mir meine Mutter ein Stück Salatgurke.
Sie seufzte theatralisch und erklärte, dass sie uns etwas »Richtiges« bringen würde. Auf Farsi brummte sie, sie würde jetzt schon seit Jahren versuchen, uns das Kochen beizubringen, und morgen solle gefälligst etwas auf dem Tisch stehen, wenn sie von der Arbeit käme, sonst könnten wir was erleben.
Navid schnaubte, und als ich leise lachte, drehte meine Mutter sich um. »Was macht die Schule?«
Ihre Frage wischte mir mein Lächeln ganz schnell aus dem Gesicht. Aber ich wusste auch, dass es ihr nicht darum ging, ob ich Anschluss gefunden hatte, sondern um meine Noten. Dabei war ich doch noch keinen Monat an der Schule.
»Alles gut«, sagte ich.
Sie nickte und verschwand in der Küche. Immer in Bewegung, immer am Machen, immer im Überlebensmodus.
Ich sah meinen Bruder an. »Und wann und wie?«
»Morgen«, sagte er. »Wir treffen uns nach der Schule.«
»Wenn wir einen Lehrer finden, der bereit ist, die Betreuung zu übernehmen«, sagte Carlos, »könnten wir eine richtige AG starten.«
»Nicht schlecht.« Ich strahlte meinen Bruder an.
»Ja. Cool, oder?«, sagte er.
»Ach so, eine Frage noch«, sagte ich. »Vielleicht habt ihr ja nicht daran gedacht.«
Navid sah mich mit hochgezogener Braue an.
»Wer soll uns Breakdance beibringen?«
»Na, ich.« Navid grinste.
Mein Bruder besaß eine Hantelbank, die so riesig war, dass sie eine Hälfte seines Zimmers einnahm. Er hatte sie in verrosteten Einzelteilen auf dem Sperrmüll gefunden, nach Hause geschleppt, die Teile abgeschliffen, lackiert und zusammengebaut und sich nach und nach Gewichte angeschafft. Die Bank wurde bei jedem Umzug mitgeschleift. Er trainierte wie ein Irrer. Joggte, boxte. Eine Zeitlang hatte er Geräteturnen gemacht, aber die Kursgebühren waren zu teuer geworden. Ich glaube, insgeheim träumte er davon, Personal Trainer zu werden. Mit dem Krafttraining hatte er angefangen, als ich zwölf gewesen war. Navid bestand praktisch nur aus Muskeln und hatte kein Gramm Fett, was ich wusste, weil er mich gern regelmäßig über seinen Körperfettanteil informierte. Als ich irgendwann sagte: »Schön für dich«, befühlte er meinen Bizeps und spitzte die Lippen. »Gar nicht mal so übel, aber ein paar mehr Muskeln könnten dir auch nicht schaden.« Von da an musste ich mit ihm trainieren und Hanteln stemmen.
Deswegen glaubte ich ihm, als er sagte, er würde uns Breakdance beibringen.
Ich ahnte nicht, was alles noch passieren würde.
Noch so ein Highschool-Ding. Partnerarbeit. Was für ein Mist. Ich hasste das. Für mich war es die totale Folter. Und jedes Mal superpeinlich, weil ich niemanden hatte, mit dem ich zusammenarbeiten konnte. Das bedeutete, dass ich am Ende der Stunde zur Lehrerin gehen und ihr leise sagen musste, dass ich keinen Partner hätte und ob es okay sei, wenn ich die Aufgabe allein erledigte, ginge das, ja? Aber natürlich schüttelte sie den Kopf, lächelte gütig und dachte, sie würde mir einen Gefallen tun, indem sie mich anderen zuteilte, die sich schon total darauf gefreut hatten, das Projekt zu zweit zu machen. O Mann, echt …
Aber diesmal lief es anders.
Diesmal hatte Gott die Wolken geteilt und Hirn vom Himmel geworfen, so dass die Lehrerin auf die glorreiche Idee kam, die Teams auf Grundlage der Sitzordnung zu bilden, wodurch ich plötzlich zusammen mit dem Typen, der mir am ersten Tag sein Biobuch in die Schulter gerammt hatte, eine tote Katze häuten musste.
Er hieß Ocean. Ocean James.
Bei mir genügte den Leuten ein Blick in mein Gesicht und sie ahnten, dass ich einen seltsamen Namen haben würde, aber ich hätte niemals erwartet, dass ein Typ, der aussah wie Ken von Barbie, Ocean hieß.
»Ja. Meine Eltern sind ein bisschen komisch«, war alles, was er dazu sagte.
Ich nahm es achselzuckend hin.
Die Häutung der toten Katze verlief schweigend, was hauptsächlich daran lag, dass das Ganze echt ekelhaft war und kein Mensch auch noch kommentieren möchte, wie es ist, in weiches, nach Formaldehyd stinkendes Fleisch zu schneiden. Ich dachte die ganze Zeit daran, wie schrecklich diese Highschool war und was wir hier für einen Scheiß machen mussten und warum so was überhaupt im Lehrplan stand, und, o mein Gott, das war alles so was von krank, so krank, ich wollte mir gar nicht vorstellen, dass wir jetzt die nächsten zwei Monate an dieser toten Katze herumschnippeln mussten …
»Lange kann ich heute nicht, aber nach der Schule habe ich noch ein bisschen Zeit«, sagte Ocean, was irgendwie ein bisschen plötzlich kam. Aber dann dämmerte mir, dass er anscheinend schon länger redete und ich so auf das wackelige Skalpell in meiner Hand konzentriert gewesen war, dass ich es nicht mitbekommen hatte.
Ich schaute hoch. »Wie bitte?«
Er war dabei, ein Arbeitsblatt auszufüllen. »Na ja, wir müssen doch noch den Bericht schreiben, über das, was wir hier heute gemacht haben«, sagte er und warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. »Aber es klingelt gleich, deswegen sollten wir das vielleicht nach der Schule erledigen.« Er sah mich an. »Oder?«
»Schon. Aber nach der Schule kann ich mich nicht mit dir treffen.«
Oceans Ohren liefen ein bisschen rot an. »Ach so«, sagte er. »Okay, klar. Verstehe. Weil du … Ich meine, du darfst wahrscheinlich nicht mit …?«
»Wow«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Wow.« Ich seufzte und wusch mir die Hände.
»Wow was?«, fragte er leise.
Ich drehte mich zu ihm um. »Hör zu. Ich habe keine Ahnung, was du aus dem, was du bis jetzt mitgekriegt hast, schon für Rückschlüsse auf mein Leben gezogen hast, aber meine Eltern haben nicht vor, mich für eine Horde Ziegen zu verkaufen, okay?«
»Eine Herde«, sagte er und räusperte sich. »Man spricht von einer Herde Ziegen …«
»Egal, was für Scheißziegen.«
Er zuckte zusammen.
»Ich hab heute nur zufällig nach der Schule schon was vor.«
»Oh.«
»Also können wir das vielleicht irgendwie anders machen«, sagte ich. »Okay?«
»Klar. Okay. Was, äh, was machst du denn nach der Schule?«
Ich war gerade dabei, meine Sachen in meinen Rucksack zu stopfen, als er das fragte, und mir rutschte vor Überraschung die Stiftedose aus der Hand. Ich bückte mich danach. Als ich mich wieder aufrichtete, schaute er mich an.
»Was?«, sagte ich. »Warum interessiert dich das überhaupt?«
Er guckte ein bisschen unbehaglich. »Weiß ich auch nicht.«
Ich warf ihm einen kurzen Blick zu, um die Situation zu analysieren. Vielleicht war ich diesen Ocean mit seinen komischen Eltern ein bisschen zu hart angegangen. Dann warf ich die Stiftedose in meinen Rucksack, zog den Reißverschluss zu, hängte ihn mir über die Schultern und sagte: »Ich mache mit ein paar Leuten Breakdance.«
Ocean runzelte die Stirn und lächelte gleichzeitig. »Verarschst du mich?«
Ich verdrehte die Augen. Es klingelte.
»Ich muss los«, sagte ich.
»Aber was ist mit unserem Laborbericht?«
Ich überlegte, dann schrieb ich ihm meine Handynummer auf. »Hier. Du kannst mir eine SMS schreiben. Dann können wir heute Abend darüber sprechen.«
Er starrte auf den Zettel.
»Aber sei bloß vorsichtig«, sagte ich. »Wenn die SMS zu lang ist, musst du mich heiraten. Das ist in unserer Religion so.«
Er wurde blass. »Moment mal, was?«
Jetzt lächelte ich beinahe. »Ich muss los, Ocean.«
»Warte mal … Quatsch, oder? Das ist jetzt aber echt Verarsche, oder?«
»Wow«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Bis dann.«
Mein Bruder hatte tatsächlich einen Lehrer gefunden, der bereit war, uns zu unterstützen. Bis Ende der Woche mussten wir einen schriftlichen Antrag bei der Schulleitung einreichen, um eine offizielle Arbeitsgemeinschaft gründen zu dürfen, was bedeutete, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben Mitglied einer schulischen AG sein würde. Und das fühlte sich echt komisch an. AGs waren bis dahin wirklich nicht mein Ding gewesen.
Aber ich freute mich wie verrückt.
Jetzt passierte genau das, wovon ich geträumt hatte. Bisher hatte ich meine Begeisterung für Breakdance nur aus der Ferne ausgelebt. Die B-Girls in den Wettkampfvideos waren mir immer so cool vorgekommen, so stark. Ich hatte wie sie sein wollen. Aber Breakdance war nicht wie Ballett. Man konnte nicht einfach in den Gelben Seiten des Telefonbuchs nach Tanzschulen suchen, an denen Breakdance unterrichtet wurde. So was existierte nicht. Jedenfalls nicht da, wo wir wohnten. Es gab keine ehemaligen B-Boys, die gelangweilt rumsaßen und nur darauf warteten, von meinen Eltern gefragt zu werden, ob sie mir im Austausch für persisches Essen nicht bitte einen perfekten Flare beibringen konnten. Ohne Navid hätte ich wahrscheinlich niemals die Chance bekommen, richtig damit anzufangen.
Am Abend vorher hatte er mir erzählt, dass er in den letzten Jahren heimlich Moves geübt hatte, und ich war hin und weg gewesen, als er mir zeigte, wie gut er schon war. Im Gegensatz zu mir hatte er wirklich daran gearbeitet, unseren Traum wahr zu machen. Ich war wahnsinnig stolz auf ihn und schämte mich ein bisschen für mich selbst. Aber vor allem freute ich mich darauf, jetzt endlich selbst Breakdance lernen zu können. Vorerst bestand unsere AG zwar nur aus den vier Jungs und mir, aber vielleicht fanden sich ja auch noch Mädchen, die Interesse hatten. Es war für mich immer schwierig gewesen, Freundschaften zu schließen. Nicht unmöglich – irgendwann lernte ich an jeder Schule ein oder zwei Leute kennen, mit denen ich mich gut verstand –, aber es dauerte. Ich hatte das Gefühl, dass die meisten mich erst mal nicht einordnen konnten. Dass ich ihnen sogar Angst machte.
»Hey.« Ich hob grüßend die Hand, als ich zu unserem ersten Training kam.
Wir trafen uns in einem Tanzraum unserer Sporthalle, und die drei neuen Freunde meines Bruders musterten mich von oben bis unten, obwohl wir uns ja schon kennengelernt hatten. Ich fühlte mich wie auf dem Prüfstand.
»Du breakst also?«, fragte Carlos.
»Na ja, noch nicht«, sagte ich, plötzlich verunsichert.
»Das stimmt nicht«, sagte mein Bruder und kam auf mich zu. Er lächelte mich an. »Ihr Toprock und ihr Sixstep sind gar nicht übel.«
»Aber ich kann keinen einzigen Powermove«, wandte ich ein.
»Kein Problem. Bringe ich dir bei.«
Mir kam plötzlich der Gedanke, ob Navid das womöglich alles nur machte, um mir einen Gefallen zu tun. Zum ersten Mal seit langem hatte ich das Gefühl, dass mein Bruder wieder mir gehörte, und begriff erst in diesem Moment, wie sehr er mir gefehlt hatte.