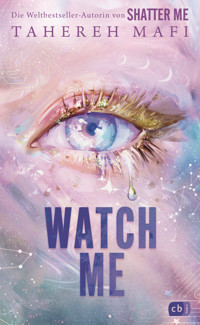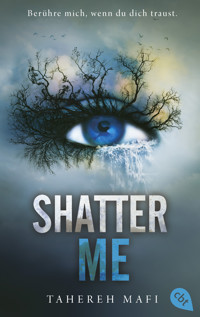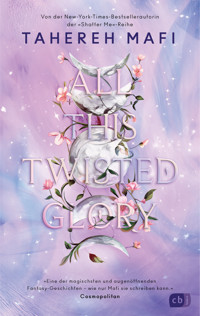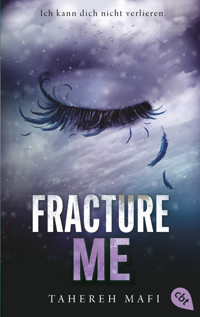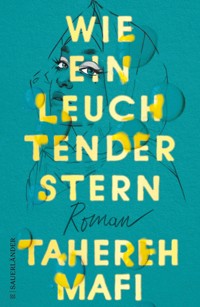
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender, aufwühlender Roman über Liebe, Einsamkeit und Trauer der »New York Times«-Bestsellerautorin Tahereh Mafi Shadi hat niemanden, mit dem sie reden kann. Weder über die täglichen Anfeindungen in der High School oder auf der Straße, weil sie Muslima ist und ein Kopftuch trägt, noch über den Unfalltod des geliebten Bruders. Und schon gar nicht über ihre heimliche Liebe zu Ali. Sogar ihre beste Freundin hat mit ihr gebrochen. Mühsam versucht Shadi, die zerbrechliche Fassade aufrecht zu erhalten und den Alltag zu bestehen. Noch ahnt sie nicht, dass sich die Hoffnungen, die mit ihrem Namen verbunden sind, erfüllen werden. Shadi bedeutet »Freude«. Eine bewegende, von Tahereh Mafis eigenen Erfahrungen inspirierte Geschichte über das Leben eines muslimischen Mädchens in den USA nach 9/11. Alle Romane von Tahereh Mafi: Wie du mich siehst Wie ein leuchtender Stern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tahereh Mafi
Wie ein leuchtender Stern
Biografie
Tahereh Mafi wurde 1988 in einer Kleinstadt in Connecticut, USA, geboren. Sie ist iranischer Abstammung und die Jüngste von fünf Geschwistern neben vier älteren Brüdern. Ihr Debütroman ›Shatter Me‹ (dt.: ›Ich fürchte mich nicht‹), der erste Band einer Trilogie, ist 2011 in den USA erschienen, wurde in über 30 Sprachen übersetzt und stand auf den Bestsellerlisten der New York Times und der USA Today. Mafi ist mit dem Filmemacher und Schriftsteller Ransom Riggs verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Santa Monica, Kalifornien.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Inhalt
Dezember 2003
Kapitel 1
Kapitel 2
Letztes Jahr TEIL I
Es klopfte zweimal scharf [...]
Dezember 2003
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Letztes Jahr TEIL II
Meine Sorge wegen des [...]
Dezember 2003
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Letztes Jahr TEIL III
Mom wartete nach der [...]
Dezember 2003
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Letztes Jahr TEIL IV
Es war ein seltsamer, [...]
Dezember 2003
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Dezember 2003
Kapitel 1
Das Sonnenlicht war heute schwer. Finger aus Hitze bildeten schwitzige Hände, die sich um mein Gesicht legten und mich zusammenzucken ließen. Ich war wie versteinert. Reglos starrte ich einer strahlenden Sonne ins Auge und hoffte, geblendet zu werden. Ich liebte sie, liebte die glühende Hitze und wie sie meine Lippen verbrannte.
Es fühlte sich gut an, berührt zu werden.
Heute war ein perfekter Sommertag, allerdings unpassend für die Jahreszeit. Die stehende Hitze wurde nur von einer kleinen, duftenden Brise gestört, die ich nicht zuordnen konnte. Ein Hund bellte. Er tat mir leid. Über meinem Kopf dröhnten Flugzeuge, die ich beneidete. Autos, von denen ich nur die Motoren hörte, rauschten vorbei. Schmutzige Metallkörper, die ihre Ausscheidungen hinterließen, und doch –
Ich holte tief Luft und hielt den Atem an. Der Geruch von Diesel war in meiner Lunge und auf meiner Zunge. Das schmeckte nach Erinnerung, nach Bewegung. Nach dem Versprechen, irgendwohin zu fahren. Ich atmete aus. Wohin auch immer.
Ich, ich würde nirgendwohin kommen.
Es gab nichts zu belächeln, trotzdem lächelte ich. Das Zittern meiner Lippen war ein fast sicheres Anzeichen für eine bevorstehende Hysterie. Ich war jetzt angenehm blind, denn die Sonne hatte sich so tief in meine Netzhaut gebrannt, dass ich nur noch glühende Kreise und schimmernde Dunkelheit sah. Als ich mich rücklings auf den staubigen Asphalt legte, war der so heiß, dass er an meiner Haut klebte.
Ich stellte mir wieder meinen Vater vor.
Seinen glänzenden Schädel, auf dem zwei Büschel dunkler Haare oberhalb der Ohren saßen wie schlecht aufgesetzte Kopfhörer. Dazu sein beruhigendes Lächeln, dass alles gut würde. Das schwindelerregende Gleißen der fluoreszierenden Lampen.
Mein Vater war schon wieder fast tot, aber ich konnte nur daran denken, wie lange ich vortäuschen müsste, traurig darüber zu sein, wenn er tatsächlich starb. Oder schlimmer, noch viel schlimmer: Ob ich es vielleicht nicht vortäuschen müsste. Ich schluckte den plötzlichen, unwillkommenen Kloß in meinem Hals runter. Als ich das verräterische Brennen von Tränen spürte, kniff ich die Augen zu und zwang mich zum Aufstehen. Steh auf.
Geh.
Nachdem ich die Augen wieder aufgeschlagen hatte, ragte ein dreitausend Meter großer Polizist vor mir auf. Stimmengewirr aus seinem Funkgerät. Schwere Stiefel, ein kurzes metallisches Geräusch, als er das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte.
Ich blinzelte und wich zurück. Wie eine Krabbe. Erschrocken und verwirrt verwandelte ich mich aus einer beinlosen Schlange in einen aufrechten Menschen.
»Deiner?«, sagte der Polizist und hielt einen schäbigen, blassblauen Rucksack in die Höhe.
»Ja«, sagte ich und streckte die Hand danach aus. »Yeah.«
Er ließ den Rucksack fallen, kaum dass ich ihn berührte. Von dem Gewicht wäre ich beinah nach vorne gekippt. Ich hatte den aufgeblähten Kadaver nicht ohne Grund abgelegt. Unter anderem enthielt er vier dicke Schulbücher, drei Mappen, drei Hefte und zwei zerschlissene Taschenbücher für Englisch, die ich immer noch nicht gelesen hatte. Die Stelle, wo Leute nach der Schule mit dem Auto abgeholt wurden, befand sich neben einem Rasenfleck, den ich viel zu optimistisch regelmäßig aufsuchte. Zu oft hoffte ich darauf, dass jemand aus meiner Familie sich an meine Existenz erinnerte und mir den Fußmarsch nach Hause ersparte. Heute hatte ich kein Glück. Ich hatte den Rucksack und den Rasen zurückgelassen und mich für den leeren Parkplatz entschieden.
Statisches Geknister aus dem Funkgerät. Wortfetzen.
Ich schaute nach oben.
Oben, über einem gespaltenen Kinn, dünnen Lippen, Nase und umgeben von spärlichen Wimpern blitzten strahlend blaue Augen. Der Beamte trug eine Mütze. Deshalb konnte ich seine Haare nicht sehen.
»Haben einen Anruf bekommen«, sagte er und musterte mich immer noch misstrauisch. »Gehst du hier zur Schule?« Eine Krähe schoss im Sturzflug vorbei und mischte sich krächzend in meine Angelegenheiten.
»Yeah«, sagte ich. Mein Herz hatte begonnen zu rasen. »Ja.«
Er sah mich mit schräg gelegtem Kopf an. »Was hast du denn da auf dem Boden gemacht?«
»Was?«
»Hast du gebetet oder so?«
Mein rasendes Herz begann sich zu beruhigen. Aber es rutschte auch tiefer. Mir fehlte es nicht an einem Gehirn, zwei Augen und der Fähigkeit, Zeitung zu lesen. Ich fühlte mich wie in einem Raum, wo dieser Mann mein Gesicht in seine Einzelteile zerlegte. Wut kannte ich, aber Angst war mir vertrauter.
»Nein«, sagte ich leise. »Ich hab hier nur in der Sonne gelegen.«
Der Polizist schien mir das nicht abzunehmen. Sein Blick glitt noch mal suchend über mein Gesicht und das Kopftuch, das ich trug. »Ist dir nicht heiß in dem Ding?«
»Jetzt gerade, ja.«
Er lächelte beinah, drehte sich dann aber lieber weg und scannte den Parkplatz mit den Augen. »Wo sind deine Eltern?«
»Keine Ahnung.«
Er zog nur eine Augenbraue hoch.
»Sie vergessen mich«, sagte ich.
Jetzt beide Augenbrauen. »Sie vergessen dich?«
»Ich hoffe immer, dass jemand aufkreuzt«, erklärte ich. »Wenn nicht, gehe ich zu Fuß nach Hause.«
Der Polizist sah mich lange an. Schließlich seufzte er.
»Na gut.« Er machte eine Handbewegung zum Himmel. »Na gut, dann sieh zu, dass du weiterkommst. Aber mach das nicht noch mal«, sagte er streng. »Das ist öffentliches Eigentum. Verrichte deine Gebete zu Hause.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab nicht – «, versuchte ich zu sagen. Ich hab nicht, wollte ich schreien. Ich hab nicht.
Aber da war er schon weggegangen.
Kapitel 2
Es dauerte ganze drei Minuten, bis das Feuer in meinen Knochen erlosch.
In der zunehmenden Stille schaute ich nach oben. Die vormals weißen Wolken waren fett und grau geworden. Statt der sanften Brise wehte jetzt ein kalter Wind. Der betrunkene Dezembertag war mit einer Plötzlichkeit ausgenüchtert, die schon ans Extreme grenzte. Stirnrunzelnd betrachtete ich die Szenerie und ihre verbrannten Ränder, die Krähe, die immer noch über meinem Kopf kreiste und deren Krah-Krah wie ein Refrain klang. Auf einmal grollte in der Ferne Donner.
Der Polizist war jetzt schon weitgehend Erinnerung.
Was noch von ihm übrig war, marschierte ins verblassende Licht. Seine Stiefel wirkten schwer, seine Schritte ungleichmäßig. Ich sah ihn lächeln, während er in sein Funkgerät murmelte. Als ein Blitz den Himmel in zwei Teile riss, zuckte ich erschauernd zusammen, als hätte man mir einen Elektroschock verpasst.
Ich hatte keinen Schirm.
Ich griff unter mein Shirt und zog die gefaltete Zeitung hervor, die ich flach in den Hosenbund gesteckt hatte, und klemmte sie mir unter den Arm. Die Luft war schwer vom Versprechen eines Gewitters. Der Wind fuhr rüttelnd durch die Bäume. Ich glaubte nicht wirklich, dass eine Zeitung vor Regen schützen würde, aber sie war nun mal alles, was ich hatte.
Damals war sie das, was ich immer dabeihatte.
Gleich um die Ecke von unserer Wohnung stand ein Zeitungsautomat, und ein paar Monate zuvor hatte ich aus einer Laune heraus ein Exemplar der New York Times gekauft. Ich war neugierig auf Zeitung lesende Erwachsene gewesen, neugierig auf die Artikel darin, die Gespräche entfachten. Denn diese Gespräche schienen mein Leben, meine Identität und die Bombardierung von Familien meiner Freunde im Nahen Osten zu bestimmen. Nach zwei Jahren Panik und Trauer in der Folge des elften September hatte unser Land sich zu aggressivem politischem Handeln entschlossen: Wir hatten dem Irak den Krieg erklärt.
Unaufhörlich wurde darüber berichtet.
Das Fernsehen bot eine grelle, brutale Verbreitung von Informationen zum Thema, wie ich sie kaum ertrug. Doch die gemächliche, stille Tätigkeit der Zeitungslektüre passte mir. Und was noch besser war: Sie füllte die Löcher in meiner freien Zeit.
Ich hatte begonnen, mir täglich einen Vierteldollar in die Tasche zu stecken, um auf dem Weg zur Schule die Zeitung zu kaufen. Während ich die Meile lief, überflog ich die Artikel, wobei dieses geistige und körperliche Training meinen Blutdruck gefährlich in die Höhe trieb. Wenn ich dann zur ersten Stunde eintraf, hatte ich sowohl meinen Appetit als auch meine Konzentration eingebüßt. Von den Nachrichten wurde mir zunehmend schlecht, von der ganzen Sache, rücksichtslos überfraß ich mich am Schmerz, und vergeblich suchte ich im Gift nach einem Gegenmittel. Sogar jetzt fuhr mein Daumen langsam über die verwischte Druckerschwärze alter Artikel, vor und zurück, als streichelte ich meine Sucht.
Ich starrte in den Himmel.
Die einsame Krähe über mir hörte nicht auf, mich anzustarren. Dabei schien das Gewicht ihrer Anwesenheit die Luft aus meiner Lunge zu pressen. Ich zwang mich, weiterzugehen und die Fenster meines Bewusstseins zu schließen. Stille machte es unwillkommenen Gedanken zu leicht. Deshalb lauschte ich auf die Geräusche vorbeifahrender Autos, auf den Wind, der sich an ihren Körpern aus Metall schärfte. Es gab zwei Menschen, über die ich vor allem nicht nachdenken wollte. Genauso wenig wollte ich mir Gedanken über die bevorstehenden Collegebewerbungen machen, über den Polizisten oder die Zeitung, die ich immer noch umklammert hielt. Und trotzdem –
Ich blieb stehen, schlug die Zeitung auf und strich sie an den Ecken glatt.
Afghanische Dorfbewohner nach US-Angriff, der neun Kinder tötete, von Trauer überwältigt.
Mein Handy klingelte.
Ich zog es aus der Tasche und erstarrte, während ich die Nummer las, die auf dem Display aufleuchtete. Eine Klinge aus Gefühl spießte mich auf – und wurde dann genauso plötzlich wieder herausgezogen. Andere Nummer. Überschäumende Erleichterung brachte mich beinah zum Lachen. Nur der dumpfe Schmerz in meiner Brust hielt mich davon ab. Es fühlte sich tatsächlich an, als hätte jemand Stahl zwischen meine Lungenflügel gerammt.
Ich klappte das Handy auf.
»Hallo?«
Stille.
Schließlich war doch eine Stimme zu hören, kaum ein halbes Wort in einem Chaos aus Rauschen. Ich schaute aufs Display, auf meine schwindende Akkuleistung, auf den einen Balken für Empfang. Als ich das Handy wieder zuklappte, lief mir ein Angstschauer über den Rücken.
Ich dachte an meine Mutter.
Meine Mutter, meine optimistische Mutter, die glaubte, wenn sie sich in ihren Schrank sperrte, würde ich sie nicht schluchzen hören.
Ein einzelner fetter Regentropfen landete auf meinem Kopf.
Ich schaute nach oben.
Ich dachte an meinen Vater. An gute ein Meter achtzig eines sterbenden Mannes, der eingepackt in einem Krankenhausbett lag und ins Nichts starrte. Ich dachte an meine Schwester.
Ein zweiter Regentropfen fiel mir ins Auge.
Der Himmel riss mit einem plötzlichen Knack auf, und in der dazwischenliegenden Sekunde – in diesem Pulsschlag vor dem Wolkenbruch – dachte ich über Reglosigkeit nach. Ich zog es in Betracht, mich mitten auf die Straße zu legen und für immer dort liegen zu bleiben.
Doch dann, Regen.
Er kam schnell, schlug mir ins Gesicht, färbte meine Kleidung schwarz, sammelte sich in den Falten meines Rucksacks. Die Zeitung, die ich mir über den Kopf hielt, war nach gerade mal vier Sekunden durchgeweicht. Hastig packte ich sie weg, diesmal in meine Tasche. Ich blinzelte in den Platzregen, rückte den Dämon auf meinem Rücken zurecht und zog die dünne Jacke enger um meinen Körper.
Ging einfach weiter.
Letztes Jahr TEIL I
Es klopfte zweimal scharf an meiner Tür, und ich zog mir stöhnend die Decke über den Kopf. Am Vorabend war ich lange auf gewesen, um Gleichungen für Physik auswendig zu lernen. Deshalb hatte ich ungefähr vier Stunden geschlafen. Allein bei der Vorstellung, aus dem Bett aufzustehen, hätte ich am liebsten losgeheult.
Wieder wurde scharf geklopft.
»Es ist zu früh«, sagte ich mit von der Decke gedämpfter Stimme. »Geh weg.«
»Pascho«, hörte ich meine Mutter sagen. Steh auf.
»Nemikhan«, rief ich zurück. Ich will nicht.
»Pascho.«
»Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich heute in die Schule kann. Ich glaube, ich habe Tuberkulose.«
Ich hörte ein leises Schsch, als die Tür sich beim Öffnen über den Teppich schob, und rollte mich instinktiv zusammen. Eine Meeresschnecke in ihrem Häuschen. Dazu gab ich ein erbärmliches Geräusch von mir, während ich auf das Unvermeidliche wartete – dass meine Mutter mich gewaltsam aus dem Bett zerrte oder mir, das wäre das Mindeste, die Bettdecke wegriss.
Stattdessen setzte sie sich auf mich.
Ich schrie wegen des unerwarteten Gewichts beinah auf. Es ist eine Qual, wenn sich jemand auf einen setzt, während man sich wie ein Fötus zusammengerollt hat. Irgendwie machte das meine Knochen noch empfänglicher für eine Beschädigung. Ich strampelte herum und schrie, sie solle runtergehen. Doch sie lachte nur und kniff mich ins Bein.
Ich kreischte auf.
»Goftam pascho.« Ich hab gesagt, steh auf.
»Wie soll ich denn jetzt aufstehen?«, fragte ich und schlug die Decke von meinem Gesicht zurück. »Du hast mir alle Knochen gebrochen.«
»Äh?« Sie zog die Augenbrauen hoch. »So was sagst du zu mir? Deine Mutter« – sie sagte das alles auf Farsi – »soll so schwer sein, dass sie dir alle Knochen brechen könnte? Das sagst du zu mir?«
»Ja.«
Sie schnappte nach Luft und riss die Augen auf. »Ay, bacheyed bad.« Oh, du schlimmes Kind. Und leicht wippend setzte sie sich noch schwerer auf meine Oberschenkel.
Ich stieß einen erstickten Schrei aus. »Okay, okay, ich steh ja schon auf, o mein Gott –«
»Maman? Bist du hier oben?«
Als sie die Stimme meiner Schwester hörte, stand meine Mutter auf. Sie riss die Decken von meinem Bett und antwortete: »Hier drinnen!« Und dann mit schmalen Augen an mich gerichtet: »Pascho.«
»Ich paschoe ja schon, ich paschoe«, brummte ich.
Ich stand auf und schaute aus purer Gewohnheit auf den Wecker, den ich schon ein halbes Dutzend Mal zum Schweigen gebracht hatte. Als ich die Uhrzeit sah, traf mich fast der Schlag. »Ich werde zu spät kommen!«
»Man keh behet goftam«, sagte meine Mom achselzuckend. Ich hab’s dir gesagt.
»Du hast mir gar nichts gesagt.« Mit weit aufgerissenen Augen drehte ich mich zu ihr um. »Du hast mir nicht gesagt, wie spät es ist.«
»Das hab ich dir gesagt. Vielleicht hat deine Tuberkulose dich taub gemacht.«
»Wow.« Ich schüttelte den Kopf und stakste an ihr vorbei. »Sehr witzig.«
»Ich weiß, ich weiß, ich bin sehr wiedzick«, sagte sie und machte eine affektierte Handbewegung. Dann wechselte sie wieder zu Farsi. »Übrigens kann ich dich heute nicht zur Schule fahren. Ich habe einen Zahnarzttermin. Dafür bringt Shayda dich hin.«
»Nein, tu ich nicht«, rief meine Schwester, wobei ihre Stimme lauter wurde, weil sie näherkam. Schließlich steckte sie den Kopf in mein Zimmer. »Ich muss jetzt fahren, und Shadi ist noch nicht mal angezogen.«
»Nein – warte –« Hektisch kam ich in Bewegung. »Ich kann in fünf Minuten angezogen sein –«
»Nein, kannst du nicht.«
»Doch, kann ich!« Ich war schon über den Flur in unser gemeinsames Bad geeilt und drückte wie eine Verrückte Zahnpasta auf meine Bürste. »Warte, okay, warte –«
»Auf keinen Fall. Ich werde nicht wegen dir zu spät kommen.«
»Shayda, was zum Teufel –«
»Du kannst laufen.«
»Da brauche ich eine Dreiviertelstunde!«
»Dann frag Mehdi.«
»Mehdi schläft noch!«
»Hat jemand meinen Namen gesagt?«
Ich hörte meinen Bruder die Treppe raufkommen. Seine Worte klangen ein bisschen runder als sonst, vielleicht weil er beim Reden irgendwas aß. Mein Herz machte einen abrupten Sprung.
Ich spuckte die Zahnpasta ins Waschbecken, rannte auf den Flur. »Ich brauche eine Fahrgelegenheit zur Schule«, rief ich, wobei ich die Zahnpastatube noch in meiner Faust umklammert hielt. »Kannst du mich hinbringen?«
»Ach egal. Ich bin plötzlich taub geworden.« Er trampelte die Treppe wieder runter.
»O mein Gott. Was ist bloß mit allen in dieser Familie los?«
Da dröhnte die Stimme von meinem Dad nach oben. »Man raftam! Khodafez!« Ich gehe jetzt! Wiedersehen!
»Khodafez!«, riefen wir anderen vier im Chor.
Ich hörte die Haustür ins Schloss fallen, als ich zum Treppengeländer raste. Mehdi war gerade unten am Treppenabsatz.
»Warte«, sagte ich, »bitte, bitte –«
Mehdi schaute zu mir hoch und lächelte dieses umwerfende Lächeln, das sein Markenzeichen war und von dem ich wusste, es hatte schon ein paar Leben ruiniert. Seine haselnussbraunen Augen glitzerten im frühmorgendlichen Licht. »Sorry«, sagte er. »Ich hab was vor.«
»Wie kannst du um halb acht Uhr morgens was vorhaben?«
»Sorry«, wiederholte er und schon war seine schlanke Gestalt nicht mehr zu sehen. »Voller Tag.«
Meine Mom tätschelte mir die Schulter. »Mikhast zoodtar paschi.« Du hättest früher aufstehen können.
»Da ist was dran«, bemerkte Shayda, während sie sich ihren Rucksack über eine Schulter warf. »Wiedersehen.«
»Nein!« Ich rannte zurück ins Bad, spülte mir den Mund aus und spritzte mir Wasser ins Gesicht. »Ich bin fast fertig! Nur noch zwei Minuten!«
»Shadi, du hast noch nicht mal eine Hose an.«
»Was?« Ich schaute an mir herab. Ich trug tatsächlich nur ein Oversized-T-Shirt. Keine Hose. »Warte – Shayda –«
Aber sie lief schon die Treppe runter.
»Manam bayad beram«, sagte meine Mom. Ich muss auch los. Sie warf mir noch einen mitfühlenden Blick zu. »Dafür hole ich dich nach der Schule ab, okay?«
Das nahm ich mit einem abwesenden »Wiedersehen« zur Kenntnis und raste zurück in mein Zimmer. Dort zog ich in halsbrecherischem Tempo eine Jeans und einen Pulli an und fiel beinah über meine eigenen Füße, als ich mir Socken, ein Haargummi, mein Kopftuch und den halboffenen Rucksack schnappte. Wie eine Irre flog ich die Stufen hinunter und schrie Shaydas Namen.
»Warte«, rief ich. »Warte, ich bin fertig! Dreißig Sekunden!«
Während ich meine Socken anzog und in die Schuhe schlüpfte, hüpfte ich jeweils auf einem Bein. Schließlich band ich mir noch die Haare zusammen und verknotete mein Kopftuch à la Jackie O – oder so, wie viele persische Damen das tun –, bevor ich zur Haustür raus schoss. Shayda stand am Straßenrand und schloss gerade ihr Auto auf. Meine Mom stieg eben in ihren Minivan, der in der Einfahrt parkte. Ich winkte ihr und rief atemlos –
»Hab’s geschafft!«
Mom lächelte und reckte einen Daumen in die Höhe, was ich beides sogleich erwiderte. Dann schenkte ich Shayda mein 100-Watt-Lächeln, woraufhin sie nur die Augen verdrehte und mir mit einem tiefen Seufzer die Beifahrertür ihres uralten Toyota Camry aufmachte.
Ich war euphorisch.
Noch einmal winkte ich meiner Mom zum Abschied – sie ließ gerade den Motor ihres Wagens an –, bevor ich mein unhandliches Gepäck auf Shaydas Rücksitz warf. Meine Schwester schnallte sich noch an, arrangierte ihre Sachen, stellte den Kaffeebecher in den Becherhalter usw. Ich lehnte mich an die Beifahrertür und nutzte den Moment, um zu Atem zu kommen und meinen Triumph zu genießen.
Zu spät fiel mir auf, dass ich fror.
Es war Ende September, Herbstanfang, und ich hatte mich noch nicht auf die neue Jahreszeit eingestellt. Das Wetter war unbeständig, jeder Tag hatte quälend heiße und kalte Phasen. Ich war mir nicht sicher, ob es sich lohnte, Shaydas Zorn zu riskieren, indem ich noch mal nach oben lief und meine Jacke holte.
Meine Schwester schien meine Gedanken zu lesen.
»Hey«, schnauzte sie mich aus dem Wageninneren an. »Denk nicht mal dran. Wenn du zurück ins Haus gehst, fahre ich.«
Meine Mom, die ebenfalls Gedankenleserin war, trat plötzlich auf die Bremse ihres Minivans und ließ das Fenster herunter.
»Bea«, rief sie. Hier. »Fang.«
Ich streckte die Hände aus, während sie ein zusammengeknülltes Sweatshirt in meine Richtung warf. Ich fing und begutachtete es, indem ich es in die Höhe hielt. Ein stinknormaler schwarzer Hoodie, den man sich über den Kopf ziehen musste. Das einzig Besondere daran war die neonblaue Kordel der Kapuze.
»Wem gehört der?«, fragte ich.
Meine Mom zuckte mit den Achseln. »Muss Mehdis sein«, sagte sie auf Farsi. »Der liegt schon lange hier im Wagen.«
»Schon lange?« Ich verzog das Gesicht. »Wie lang ist denn lange?«
Mom zuckte wieder mit den Achseln und setzte ihre Sonnenbrille auf.
Ich schnupperte misstrauisch am Baumwollstoff. Doch anscheinend lag das Sweatshirt noch nicht zu lange in unserem Wagen, denn es roch immer noch gut. Ein bisschen nach Rasierwasser. Und zwar nach einem, dessen Vertrautheit meine Haut kribbeln ließ.
Mein Gesicht verfinsterte sich noch mehr.
Schließlich zog ich mir das Ding über den Kopf und sah meiner Mom nach, die jetzt wegfuhr. Der Hoodie war weich und warm und mir im besten Sinne viel zu groß. Allerdings war der schwache, angenehme Duft so nah an meiner Haut plötzlich überwältigend. Meine Gedanken begannen zu rasen, und ich zerbrach mir den Kopf wegen einer einfachen Frage.
Da hupte Shayda. Ich bekam fast einen Herzanfall.
»Wenn du jetzt nicht sofort einsteigst«, schrie sie, »überfahr ich dich.«
Dezember 2003
Kapitel 3
Wenn es so schüttete wie jetzt, dann warfen Leute mir oft vielsagende Blicke zu und machten eine Geste, als würden sie mit ihren Zeigefingern auf mich zielen. »Glück gehabt, was? Unser Einstein hier braucht nicht mal einen Schirm.« Zielen mit zwei Zeigefingern und Wackeln mit den Augenbrauen. Ich lächelte immer, wenn jemand so etwas zu mir sagte. So ein Lächeln aus Höflichkeit mit fest geschlossenem Mund. Dabei habe ich diese Annahme, mein Kopftuch sei irgendwie wasserundurchlässig, nie verstanden.
Denn das war es ja offensichtlich nicht.
Mein Kopftuch war offensichtlich nicht aus Neopren. Es hatte keine Ähnlichkeit mit Vinyl. Es war aus Seide. Eine bewusste Entscheidung, nicht nur wegen des Gewichts und der Textur, sondern aus Eitelkeit. Die Seide umschmeichelte mein Haar tagsüber, so dass es, wenn ich nach Hause kam, glatt und glänzend aussah. Wie jemand glauben konnte, dass mein Hidschab einem Wolkenbruch standhielt, verwunderte mich. Aber trotzdem schienen überraschend viele Menschen es zu denken.
Wenn die mich jetzt sehen könnten.
Der Regen hatte mein Tuch durchweicht, so dass es mir am Kopf klebte. Wasser lief mir in Rinnsalen am Hals entlang, mein Haar war schwer und tropfte. Ein paar rebellische Strähnen hatten sich gelöst. Scharfer Wind peitschte sie mir in die Augen, und auch wenn ich versuchte, sie wegzustreichen, mich zusammenzunehmen, waren meine Bemühungen eher gewohnheitsmäßig als hoffnungsvoll. Ich war ja nicht dumm. Daher wusste ich, dass ich noch heute an Lungenentzündung sterben würde. Wahrscheinlich noch vor Beginn meiner nächsten Unterrichtsstunde.
An der High School besuchte ich die zwölfte Klasse, aber Montag- und Mittwochabend nahm ich an einem Kurs in Differential- und Integralrechnung am örtlichen Community College teil. Das galt genauso viel wie die Belegung eines Kurses auf Collegeniveau an der Schule. Die Unterrichtseinheiten waren übertragbar und sollten helfen, meinen Notendurchschnitt für die Collegebewerbung zu verbessern.
Meine Eltern waren begeistert davon. So wie die meisten Eltern.
Nur dass meine Eltern, wie die meisten Mütter und Väter aus dem Nahen Osten, das von mir erwarteten. Genauso wie sie erwarteten, dass ich Ärztin würde. Oder Rechtsanwältin. Ein Doktortitel in einer Geisteswissenschaft wäre auch noch akzeptabel, würde aber bereits deutlich weniger Begeisterung hervorrufen.
Ich schaute wieder hoch, auf meinen Gegner.
Es regnete jetzt noch heftiger, schneller, doch mir blieb keine Zeit, mich irgendwo unterzustellen. Wenn ich pünktlich zum Kurs erscheinen wollte, musste ich jetzt gehen. Ich wusste, dass ich nach Schulschluss zu viel Zeit in der Hoffnung verbracht hatte, jemand würde mich abholen kommen. Doch ich konnte nicht anders – montags und mittwochs war meine Hoffnung immer besonders groß. Das lag daran, dass ich auf mehr hoffte als die Fahrt nach Hause – ich wünschte mir, den langen Weg zum zweieinhalb Meilen entfernten College nicht machen zu müssen.
Ich erwog, den Kurs zu schwänzen.
Die Versuchung war so greifbar, dass ich ein Zittern in der Wirbelsäule spürte. Ich stellte mir vor, wie meine durchweichten Knochen mich direkt nach Hause trugen. Bei der Vorstellung stockte mein Herz, Glückseligkeit drohte. Autos rasten an mir vorbei und bespritzten mich mit Dreckwasser. Schwankend lief ich weiter, bibbernd in durchweichter Jeans und triefnassen Schuhen. Wie ein Schmutzfleck mit einem Traum stand ich an einer sprichwörtlichen Kreuzung. Ich träumte davon, nach links statt nach rechts abzubiegen. Ich träumte von heißem Tee und trockenen Klamotten. Ich wollte nach Hause, wollte eine Stunde lang unter der Dusche sitzen, bis mein Blut kochte.
Ich konnte nicht.
Ich durfte den Unterricht nicht verpassen, weil ich letzten Monat schon einen Tag verpasst hatte. Zwei Tage zu versäumen, das würde sich negativ auf meine Note auswirken, was meinem Notendurchschnitt schaden würde, was wiederum meine Mutter verletzen würde. Und das würde die einzige und wichtigste Regel brechen, die ich mir in meinem Leben gegeben hatte: ein so braves Kind zu werden, dass ich praktisch verschwand. Das alles natürlich meiner Mutter zuliebe. Meinem Vater gegenüber war ich unentschlossen, aber meine Mutter, meine Mutter sollte nicht weinen, nicht wegen mir. Sie weinte derzeit schon genug wegen allen anderen.
Ich fragte mich, ob sie aus dem Fenster sehen und sich in einem seltenen Augenblick an ihr jüngstes Kind und an dessen Pilgerschaft zum Mathekurs erinnern würde. Mein Vater, das wusste ich, würde das nicht tun. Entweder schlief er oder sah sich Wiederholungen von Hawaii-Five-0 an, und zwar in einem Fernseher, der auf einer Trennwand befestigt war. Meine Schwester würde sich mit Sicherheit keine Gedanken machen, über gar nichts. Und niemand, den ich sonst kannte, wüsste auch nur, dass ich abgeholt werden sollte.
Letztes Jahr wäre meine Mutter gekommen.
Letztes Jahr hätte sie meinen Stundenplan gekannt. Sie hätte angerufen, sich nach mir erkundigt, meiner Schwester Gewalt dafür angedroht, dass sie mich schutzlos den Elementen ausliefere. Doch nach dem Tod meines Bruders war die Seele meiner Mutter umorganisiert, ihr Skelett neu konfiguriert worden. Die vernichtenden Wellen der Trauer, die mich zunächst ertränkt hatten, begannen ganz langsam abzuebben, doch meine Mutter … Mehr als ein Jahr danach kam sie mir immer noch vor wie empfindsames Treibholz, das in den kühlen, unverdünnten Gewässern des Leids auf und ab tanzte.
Also war ich zu einem Geist geworden.
Es war mir gelungen, meine ganze Person auf ein Nicht-Ereignis von solcher Bedeutungslosigkeit zu reduzieren, dass meine Mutter mir selten überhaupt noch Fragen stellte. Dass sie meine Gegenwart nur noch selten bemerkte. Ich redete mir ein, ihr damit zu helfen, ihr Raum zu geben, wenn ich ein Kind weniger war, um das sie sich sorgen musste. Diese Mantras halfen mir dabei, den scharfen Schmerz zu ignorieren, der mein erfolgreiches Verschwinden begleitete.
Ich hoffte nur, damit richtigzuliegen.
Eine plötzliche Böe fegte durch die Straßen und stieß mich zurück. Mir blieb keine andere Wahl, als den Kopf zu senken und dadurch meinen offenen Kragen dem Regen auszusetzen. Über mir wurde ein Baum durchgeschüttelt und ließ einen eisigen Wasserschwall direkt auf mein Shirt herabstürzen.
Ich schnappte hörbar nach Luft.
Bitte, Gott, dachte ich, bitte, bitte lass mich nicht an Lungenentzündung sterben.
Meine Socken fühlten sich an wie Suppe, meine Zähne klapperten, und meine zu Fäusten geballten Hände wurden langsam gefühllos. Ich beschloss, das Handy auf ein Lebenszeichen zu checken, und ging in Gedanken die kurze Liste der Leute durch, die ich vielleicht anrufen und um einen Gefallen bitten konnte. Doch bis ich den Metallklotz aus dem Sumpf meiner Tasche gefischt hatte, war der schon wasserdurchtränkt und glitschig. Kein Gedanke mehr an Lungenentzündung, denn ich würde wahrscheinlich an einem Stromschlag draufgehen. Meine Zukunft hatte noch nie so vielversprechend ausgesehen.
Ich lächelte über meinen eigenen Scherz und spürte, wie meine Lippen sich Richtung Irrsinn verzogen. Da raste ein Auto so schnell an mir vorbei, dass es mich quasi badete. Ich blieb stehen und starrte mich selbst in diesem amphibischen Zustand an. Ich sah geradezu surreal aus. So konnte ich keinesfalls zum Unterricht gehen. Und doch würde ich es tun, vorwärtsgetrieben von irgendwelchen wichtigeren Bedenken, irgendwelchem Unsinn, der meinem Leben eine Bedeutung gab. Schlagartig kam mir das alles lächerlich vor. Mein Leben. So lächerlich, dass ich loslachte. Lachte und dann hustete, weil ich ein bisschen von dem Dreckwasser eingeatmet hatte. Egal, ganz egal, ich hatte mich getäuscht. Ich würde weder an Lungenentzündung noch an einem elektrischen Schlag sterben. Ersticken würde den Engel des Todes an meine Tür geleiten.
Jetzt lachte ich nicht mehr.
Das Auto, das eben vorbeigerast war, hatte unvermittelt angehalten. Direkt dort, mitten auf der glitschigen Straße. Weiß und grell gingen die Lichter für den Rückwärtsgang an, doch der Wagen blieb mindestens fünfzehn Sekunden abwartend stehen, bevor eine Entscheidung fiel. Mit quietschenden Reifen setzte er auf der leeren Straße zurück, bis er bedrohlich schlitternd neben mir hielt.
Wieder geirrt.
Nicht Lungenentzündung, kein elektrischer Schlag oder Ersticken, nein – heute würde ich ermordet.
Ich schaute erneut in den Himmel.
Lieber Gott, dachte ich, so habe ich das nicht gemeint, als wir das letzte Mal miteinander sprachen.
Kapitel 4
Stocksteif stand ich da und wartete, wartete, dass das Fenster runterging und meine Zukunft sich entschied. Ich erwartete mein Schicksal.
Nichts passierte.
Sekunden verstrichen – erst ein paar, dann ein Dutzend – und nichts, nichts. Das silberne Auto stand neben mir, seine schwere, nass glitzernde Karosserie tropfte beständig im Dämmerlicht. Ich wartete, dass sein Fahrer etwas tat. Irgendwas.
Nichts.
Ich konnte meine Enttäuschung kaum ertragen. In dem atemlosen Intermezzo hatte meine Neugier die Oberhand über meine Furcht gewonnen, die jetzt so etwas wie Vorfreude schon gefährlich nah kam. Diese Beinah-Auflösung kam dem am nächsten, was ich an Aufregung seit dem Tag erlebt hatte, als ich glaubte, mein Vater würde sterben. Und noch dazu sah das Auto warm aus. Immerhin, dachte ich, würde der Tod warm sein. Trocken. Ich war bereit, alles zu ignorieren, was man mir je übers Einsteigen in fremde Autos beigebracht hatte.
Doch das dauerte hier alles zu lange.
Ich blinzelte in den Regen. Von da, wo ich stand, konnte ich nicht viel sehen, nur abgedunkelte Scheiben und Auspuffwolken. Es waren nur ein paar Schritte vom Bürgersteig zu dem Auto. Ich wollte schon die Entfernung überwinden, an die Scheibe klopfen und eine Erklärung verlangen. Doch abrupt wurde ich vom Geräusch gedämpfter Stimmen aus dem Wageninneren gestoppt.
Da wurde sich nicht unterhalten, sondern gestritten.
Ich runzelte die Stirn.
Die Stimmen wurden lauter, aufgebrachter. Ich näherte mich dem Wagen wie ein Halbmond, mit gegen den Regen gewölbtem Rücken, den Kopf Richtung Beifahrertür gesenkt. Anscheinend konnte ich mir heute meines Schicksals absolut nicht sicher sein, doch wenn ich tatsächlich ermordet werden sollte, dann wollte ich es schnell hinter mich bringen. Ich platschte drei Schritte über den Bürgersteig, rückte mein triefendes Kopftuch zurecht und winkte ins abgedunkelte Fenster des fremden Wagens. Vielleicht lächelte ich sogar. Meine zitternde, heimliche Hoffnung war, dass der Fahrer doch kein Mörder, sondern ein barmherziger Samariter war. Jemand, der gesehen hatte, wie ich schier ertrank, und helfen wollte.
Da raste der Wagen davon.
Ohne Vorwarnung – der müde Motor beschleunigte ein bisschen zu stark – raste er davon und badete mich noch mal in Schmutzwasser. Ich stand triefend auf dem Bürgersteig, und meine Haut brannte vor unerklärlicher Verlegenheit. Ich begriff das nicht, konnte nicht verstehen, wie ich soeben von einem Mörder, nein, sogar von einem Mörderduo, taxiert und abgelehnt worden war.
Kurz überlegte ich, dass das Auto mir bekannt vorgekommen war, dass der Fahrer jemand gewesen sein konnte, den ich kannte. Dieser Gedanke war nicht tröstlich, und trotzdem wurde ich ihn nicht los. Er konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft werden. Ich schüttelte den Kopf, wie um die sich festigende Hypothese herauszuschütteln. Der Himmel wurde schon grau, und silberfarbene Honda Civics gab es überall. Deshalb konnte ich mir absolut nicht sicher sein.
Ich setzte erst einen nassen Fuß nach vorn, dann den anderen.
Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, hakte sich auch noch der Jingle von Toys R Us in meinem Kopf fest. Ich summte ihn, während ich an gesichtslosen Shoppingmalls und Tankstellen vorbeilief. Ich summte ihn, bis er ein Teil von mir war. Bis er die irritierende Hintergrundmusik zur PowerPoint-Präsentation von Enttäuschungen wurde, die auf Dauerschleife vor meinem inneren Auge lief.
Als ich endlich beim Community College ankam, sah ich den Honda Civic wieder.
Er stand dort auf dem Parkplatz, und ich tropfte auf meinem Weg ins Hauptgebäude daran vorbei. Es hatte jetzt aufgehört zu regnen, dafür war es beinah ganz dunkel und ich beinah tot. Im Moment besaß ich gerade noch genügend funktionierende Hirnmasse, um meine Zähne am Klappern zu hindern, doch ich konnte nicht verhindern, dass ich den Honda Civic anstarrte, während ich über den