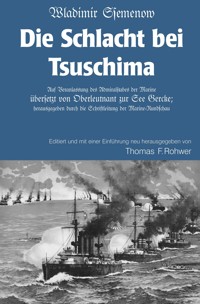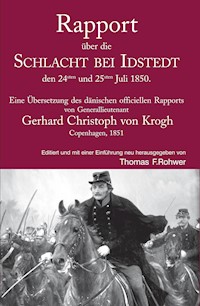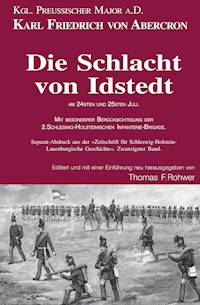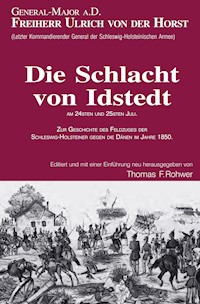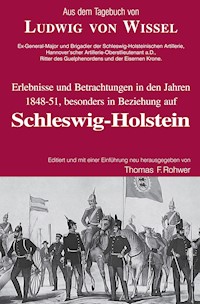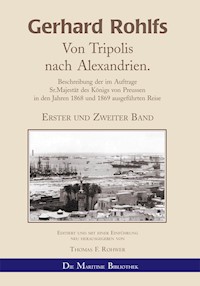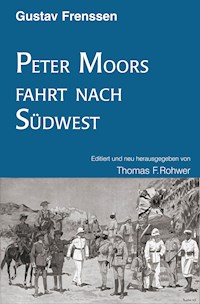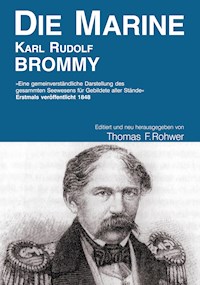0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Die Maritime Bibliothek
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DETLEV VON LILIENCRON (1844-1909), preußischer Offizier und Schriftsteller, gilt als ein wichtiger Vertreter des beginnenden "Naturalismus" des späten 19.Jahrhunderts. In einer Reihe von Novellen verarbeitete er seine Erlebnisse als Teilnehmer des "Deutschen Krieges" 1866 und des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71, in dem er verwundet und mehrfach ausgezeichnet wurde. Ungekürzte editierte und mit vielen Erläuterungen ergänzte Neuausgabe. Enthalten sind die Novellen: Verloren • Adjutantenritte • Eine Sommerschlacht • Unter flatternden Fahnen • Der Narr • Nächtlicher Angriff • Portepeefähnrich Schadius • Der Richtungspunkt • Das Wärterhäuschen • Umzingelt • Eine Soldatenphantasie • Der alte Wachtmeister vom Dragonerregiment Anspach-Bayreuth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Detlev von Liliencron
Kriegsnovellen
Editiert und
mit einer Einführung neu herausgegeben von
Thomas F.Rohwer
Die Maritime Bibliothek
Die Maritime Bibliothek
Selbstverlag T.Rohwer - Unterjörn 77 - D-24536 Neumünster
www.maritime-bibliothek.de
© 2022
Vorweg / Hinweise zur Editierung
Dieser Neuausgabe liegt ein Original zugrunde, das 1899 im Verlag Schuster & Loeffler, München, erschienen ist. Ergänzt wurde dieses Buch, weil thematisch passend, durch die Novelle »Der alte Wachtmeister«, die in der ursprünglichen Novellensammlung nicht enthalten ist.
Die originalen Texte wurden ungekürzt mit größtmöglicher Sorgfalt für die Neuausgabe übertragen und vom Herausgeber editiert. Die altmodische Schreibweise und Grammatik wurden konsequent beibehalten. Wollte man Texte dieser Art teilweise modernisieren, würde dies zwangsläufig schnell willkürlich werden. Also ist es sinnvoller, sie so zu lassen, wie sie sind – und die altmodische Sprache hat ja auch ihren ganz eigenen Reiz.
Der Leser wird dabei übrigens recht bald amüsiert feststellen, daß heutige Debatten über »korrekte Rechtschreibung«, »moderne Rechtschreibung« und »Rechtschreibreform« nur noch begrenzt ernstgenommen werden können, wenn man erkennt, daß vieles, das in der letzten »Rechtschreibreform« als »Modernisierung« verkauft wurde, exakt den Gepflogenheiten der frühen wilhelmischen Kaiserzeit entspricht.
Erste Anregungen zu einer einheitlichen Rechtschreibung stammen aus den Jahren nach 1850; 1879 und 1880 erfolgte die Veröffentlichung der bayerischen und preußischen offiziellen Regelbücher, die dann mit geringen Veränderungen auch im übrigen Deutschland angenommen wurden. Auf der »II.Orthographischen Konferenz« von 1901 wurde die deutsche Schriftsprache erstmals einheitlich geregelt, dies manifestierte sich schließlich im »Duden«.
Vorher gab es eine bunte Vielfalt von Schreibweisen. Und das, was in der letzten Rechtschreibreform »wegreformiert« wurde, ist selbst das Ergebnis einer großen Reform, die 120 Jahre vor ihrer Nachfolge-Reform als altmodisch und unlogisch angesehene Schreibweisen modernisieren sollte. Und so möchten die »Rechtschreibreformer« in manchen Fällen, daß wir heute »ganz modern« wieder so schreiben, wie es zu Kaiser Wilhelms I. Zeiten als korrekt galt und von den damaligen »Rechtschreibreformern« als zu altmodisch verworfen wurde.
Auch der heute so gern verspottete »Deppen-Apostroph« des Genitivs (zB. in »Rendburg’s Befestigungswerke«) ist mitnichten eine »Anglizismen-Mode« aus der jüngsten Zeit – die Genitiv-Form mit »‘s« war schon einmal vor über 150 Jahren üblich und galt damals als richtig...
Insofern wurde die Texte einfach so belassen, wie Detlev von Liliencron sie zu Papier gebracht hat.
Eine Reihe von militärischen Fachausdrücken und altmodischen Begriffen ist im Interesse einer bequemeren Lesbarkeit durch durchgehend numerierte Fußnoten erklärt, die sich zusammengefasst am Ende dieses Buches befinden.
Detlev von Liliencron (1844-1909)
Der deutsche Offizier und Schriftsteller Detlev von Liliencron, der eigentlich Friedrich Adolf Axel Freiherr von Liliencron hieß, wurde 1844 in Kiel geboren. Liliencron war Sohn eines dänischen Zollbeamten. Er war ein Neffe von Rochus Freiherr von Liliencron, dem Herausgeber der »Allgemeinen Deutschen Biographie«. Sein Vater Louis (1802-92) war einer der Söhne des dänischen Oberkriegskommissars und Kapitäns Andreas von Liliencron (1774-1823), die Mutter des Vaters war eine Leibeigene. Wegen dieser »unstandesgemäßen Ehe« wurde der Großvater von seiner Familie enterbt. Detlev von Liliencrons Mutter Adeline war die Tochter eines amerikanischen Schiffskapitäns, Frederick von Harten, und einer Portugiesin.
Liliencron brach das humanistische Gymnasium (die Kieler Gelehrtenschule) ein Jahr vor dem Abitur ab, absolvierte in Erfurt die Realschule und trat 1863 in die Berliner Kadettenanstalt ein. Er wollte eigentlich Kavallerieoffizier werden, das scheiterte aber an fehlenden finanziellen Mitteln. Als Infanterieoffizier des Preußischen Heeres nahm er am sogenannten »Deutschen Krieg« 1866 teil, in dem Preußen zusammen mit diversen verbündeten deutschen Staaten und Italien gegen Österreich, Bayern und einige weitere deutsche Staaten kämpfte. Der Krieg endete mit einem Sieg Preußens und der Gründung des Norddeutschen Bundes. 1870 bis 1871 nahm Liliencron am Deutsch-Französischen Krieg teil, in dem er verwundet und mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Eisernen Kreuz II.Klasse. Seine persönlichen Kriegserlebnisse ließen die zuvor vorhandene Kriegsbegeisterung deutlich schrumpfen und führten zu deutlich größerer Nachdenklichkeit in dieser Hinsicht.
Detlev von Liliencron war dem Glücksspiel zugeneigt und verschuldete sich dabei erheblich. Aus der Schuldenfalle kam er auch im späteren Leben nie wieder völlig heraus, die Schulden zwangen ihn, den aktiven Militärdienst zum ersten Mal 1871 und dann ein weiteres Mal 1875 zu quittieren, und im Rang eines Premierlieutenants (Oberleutnant) in die Reserve einzutreten.
1875 ging Liliencron für kurze Zeit in die USA, wo er als Klavier- und Sprachlehrer arbeitete. Schon 1877 kehrte er aber nach Deutschland zurück. Auf Initiative seines Vaters wurde er weitgehend rehabilitiert, er bekam eine kleine Militärpension samt Verwundetenzulage. 1878 fand er eine Anstellung in der preußischen Verwaltung und heiratete Helene von Bodenhausen, die Tochter aus einem alten Adelsgeschlecht.
Anfang 1882 wurde Liliencron zum »Hardesvogt« – eine Art Stellvertreter des Landrats vor Ort – auf der Insel Pellworm ernannt, die seit dem Deutsch- Dänischen Krieg von 1864 wie ganz Schleswig-Holstein zu Preußen gehörte. Auf Pellworm entstand sein berühmt gewordenes Gedicht »Trutz, blanke Hans«. Ebenfalls 1882 wurde Detlev von Liliencron zum Hauptmann der »Landwehr« befördert. Im Oktober 1883 wurde er »Kirchspielvogt“ im holsteinischen Kellinghusen. (Die »Kirchspiele« waren örtliche Verwaltungseinheiten unterhalb der Ebene der Landkreise, der »Vogt« der oberste Verwaltungsbeamte.)
Hier entstand sein wohl berühmtestes Gedicht Trutz, blanke Hans, daneben aber auch experimentelle, innovative Verse wie Betrunken. Ebenfalls in diesem Jahr wurde er als ehemals aktiver, dann der Reserve zugeteilter Offizier zum Hauptmann der Landwehr befördert. Im Oktober 1883 wurde er zum Kirchspielvogt in Kellinghusen (Holstein) ernannt.
Ab 1883 wandte sich Detlev von Liliencron zunehmend seiner Leidenschaft der Schriftstellerei zu. Es erschien sein erster Band mit Lyrik mit dem Titel »Adjutantenritte«. Es folgten »Eine Sommerschlacht« (1887), »Unter flatternden Fahnen« (1888) und »Der Heidegänger« (1893). Liliencrons Lyrik wird heute als wichtige Wegmarke des aufkommenden Naturalismus des späten 19.Jahrhunderts eingestuft.
Schon 1885 musste der »Lebemann« und notorische Glücksspieler Liliencron wieder aus dem Staatsdienst ausscheiden, weil es zur Pfändung seiner Dienstbezüge gekommen war. Im selben Jahr wurde auch seine Ehe geschieden.
Ab 1886 lebte Liliencron als freier Schriftsteller, 1887 heiratete er die Gastwirtstochter Augusta Brandt. Im selben Jahr erfolgte die Veröffentlichung von »Arbeit adelt«. 1888 knüpfte Liliencron Kontakte zu den Dichtern des Friedrichshagener Dichterkreises. Auch der Breslauer Dichterschule war er als externes Mitglied verbunden; sein Freund Paul Barsch, Redakteur der Vereinszeitschrift, sammelte Spenden, um dem Dichter einen Schreibtisch zu kaufen. Mit finanzieller Unterstützung der Schillerstiftung verbrachte Liliencron 1890/1891 einige Zeit in München.
1891 zog er nach Ottensen in Altona, der damals zweitgrößten Stadt Schleswig-Holsteins, und nach der Scheidung von Augusta Brandt 1892 an die Palmaille in Altona. Hier verfasste er unter anderem sein Hauptwerk »Poggfred«. Seine Schulden plagten ihn weiter, und er versuchte 1898, mit Vortragsreisen Geld zu verdienen. 1899 heiratete er zum dritten und letzten mal, die Bauerstochter Anna Micheel. Aus akuter Geldnot schloss er sich ein Jahr später dem literarischen Kabarett »Überbrettl« an.
1901 kam Liliencron etwas zur Ruhe, als er mit Hilfe von Freunden eine Wohnung in Alt-Rahlstedt (im Nordosten von Hamburg) fand, und Kaiser Wilhelm II. ihm ein jährliches »Ehrengehalt« von 2.000 Goldmark bewilligte. Zur selben Zeit erreichte sein Ansehen als Dichter den Höhepunkt. Zu seinem 60.Geburtstag 1904 wurde er mit einer deutschen und österreichischen Festschrift geehrt, an der sich die bekanntesten Schriftsteller der Zeit beteiligten.
1908 veröffentlichte er den autobiographischen Roman »Leben und Lügen«. 1909, kurz vor seinem Tod, wurde ihm zu seinem 65.Geburtstag die Ehrendoktorwürde der Universität Kiel verliehen. Eine letzte Reise führte ihn auf die Schlachtfeldern des Deutsch-Französischen Krieges. Liliencron starb kurz darauf an einer Lungenentzündung, er wurde auf dem Rahlstedter Friedhof begraben.
T.F.R.
Verloren
I.
Die erste Schlacht war geschlagen. Der Sieger lagerte auf dem Gefechtsfelde. Der Rauch zahlreicher Biwakfeuer stieg zum wolkenlosen Frühlingsnachthimmel empor. In der Ferne, bei den Feldwachen und Patrouillen, fielen einzelne Schüsse.
Abseits der eigentlichen Wahlstatt dunkelte, in helles Mondlicht getaucht, ein Wäldchen. In seiner Mitte stand ein einstöckiges, jagdschloßartiges Haus. Vor diesem breitete sich ein großer Rasenplatz, von zwei Kieswegen umarmt. Am anderen Ende des freien Raumes, grade der Front des Gebäudes gegenüber, trat, wie eben aus dem Walde kommend, die Diana von Versailles, auf breitem Sandsteinsockel, hervor.
Hier hatte ein heißer Kampf stattgefunden. Thür und Fenster waren zertrümmert; Kugelspuren an den Wänden. Gefallene Grenadiere, Schmerz und Wut noch auf den Gesichtern, hatten mit ihrem Blut den Rasen gefärbt. Einer lehnte am Sockel der Diana. Sein Nacken war zurückgebogen; die halb offnen Augen sahn zu ihr auf. Die altitalische Göttin hatte dem deutschen Krieger den Weg zur Walhalla gezeigt.
Einige Schritte vor seinen Soldaten, kurz vor der eingeschlagnen Thür, lag ausgestreckt ein junger Offizier. Das blasse Gesicht war zur Seite geneigt. Unter dem Helm hervor drängte sich zwischen die gebrochnen Augen eine dichte schwarze Locke. Seine Rechte hielt noch, wie im Leben, den Degen umfaßt. Die Linke lag auf dem Herzen. Nur ein einziger Blutstropfen war ihm aus der Wunde auf die Hand geträufelt, im Sternenlicht glänzend, als wäre er ein Rubin, der zu dem kleinen, den vierten Finger umschließenden Goldreifen gehöre.
Frühlingsfriede. Es war so still wie Stein auf Gräbern ruht. Ab und zu nur rauschte ein Windhauch durch die Zweige, klagend und gleichgiltig zugleich: er rauschte das ewige Lied des Todes – der Entsagung.
II.
Dieselbe Frühlingsnacht lag auch auf Wald und Feld, auf Stadt und Dorf im Norden unsers Vaterlandes. In dem kleinen Orte war Alles schon zur Ruhe gegangen. Auch in dem großen, schloßartigen Hause des Amtmanns schien Alles still. Hinter den Fenstern waren die weißen Rouleaux[1] heruntergelassen. Nur nach der Gartenseite im Erdgeschoß waren zwei Fenster weit geöffnet. Ein persischer Teppich bedeckte den Fußboden des Zimmers. Auf dem runden Tisch vor dem Sofa stand eine Lampe, die den Raum hell erleuchtete. Den Fenstern gegenüber war ein Bechstein hingeschoben. In die Nacht hinaus klang das Impromptu Asdur, Opus 142, Nummer 2 von Franz Schubert. Der Zwischensatz wurde zu schnell, zu leidenschaftlich gespielt; es lag wie Angst und Unruhe darin. Bald waren auch die letzten Akkorde des vornehmen kleinen Stückes verhallt.
In weiter Ferne hörte man Gesang. Bald deutlicher, bald schwächer. Es waren Soldaten, die auf dem Wege zur Grenze marschierten, wo der Krieg in diesen Tagen ausgebrochen war.
Jetzt klang es klar zu ihr herüber:
Sie horchte atemlos. Der Mund öffnete sich ein wenig. Die Augen wurden größer. Auf dem holden Gesicht prägte sich Angst und Sorge aus.
klang es, schwächer und schwächer werdend.
hörte sie noch einmal deutlich.
Die Stirn tief gebeugt, die Augen geschlossen, so hatte sie die letzten Töne vernommen. Nun war es still und einsam um sie her. Langsam ging sie zum Flügel:
Sie spielte und sang das alte schöne Soldatenlied. Als sie geendet hatte, lag noch lange die rechte Hand auf den Tasten. Wie oft hatte er es ihr gesungen, mit seiner klaren, ruhigen Stimme. Sie hatte ihn begleitet. Begeistert hatte er dann von den Volks- und Soldatenliedern erzählt. Wie sich die Soldaten selbst ihre Melodieen zurechtlegen, zuerst durch kleine Abänderungen von alten Kirchen- und Volksweisen. Wie die Grundstimmung fast in allen ihren Gesängen eine weiche, ernste sei; wie durch alle das Heimweh ziehe, oft unbewußt.
Ein Nachtfalter flatterte um die Lichter. Sie erhob sich und ging ans Fenster. Die obere Fläche der linken Hand legte sie an die Seitenwand und stützte die Stirn hinein. Aus den großen, grauen Augen brachen Thränen, unaufhaltsam.
Ab und zu rauschte ein Windhauch durch die Zweige, klagend und gleichgültig zugleich: er rauschte das ewige Lied der Entsagung – des Todes.
Adjutantenritte
(Aus einer Januarschlacht)
Zu spät
Der Oberbefehlshaber hatte um Mitternacht den um ihn versammelten Generalstabsoffizieren und von allen Seiten zum Befehlsempfang herbeigeeilten Adjutanten die Dispositionen zur Schlacht für den folgenden Tag selbst diktiert. Klar und ruhig sprach er jedes Wort, den Rücken gegen den Kamin kehrend und sich die Hände wärmend. Ohne ein einziges Mal zu stocken, vollendete er den Armeebefehl.
Es war drei Uhr morgens, als wir Adjutanten, uns die Hände zum Abschiede reichend, zu unseren Truppenteilen zurückritten. Ich konnte erst in drei bis vier Stunden bei meinem General sein. Es war eine naßkalte, windige Winternacht mit spärlichem Monde. Meine beiden mich begleitenden Husaren und ich kamen ohne Abenteuer im Quartier an. Ich traf den General »fix und fertig.« Er hatte sich unausgekleidet aufs Bett gelegt und nur von seinen Mänteln zudecken lassen.
Als ich den Befehl zum Vormarsch verlesen, erhielt ich von ihm die Weisung, ungesäumt nach dem rechten Flügel zu reiten, um dorthin eine wichtige Meldung zu bringen. Ich hätte gerne einen heißen Schluck gehabt, aber der Kaffee war noch nicht fertig; so nahm ich, was ich grade fand. Es wurde rasch eine Flasche Sekt geleert, die der General so liebenswürdig war mit mir zu teilen. Wir tranken ihn aus Tassen. Roher Schinken schmeckte nicht übel dazu.
Dann ritt ich ab. Der Frühmorgen zeigte ein mürrisches Gesicht; nur der Wind hatte sich gelegt. Dumpf und still und grämlich lags auf der Gegend. Die stark verregnete Karte in der Linken, hier und dort einen Kameraden grüßend, mir von Patrouillen Auskunft geben lassend, trabte ich meinem Ziele zu.
Noch wars nicht voller Tag. Vom Feinde war nichts zu sehn. Bei den Doppelposten fielen einzelne Schüsse. Als ich in ein Thälchen einlenkte, entschwanden auch unsere Truppen. Das Thal engte sich, und bald bemerkte ich ein Brückchen, das sich über ein träges, schmutzig gelbes Wasser bog. Halt – was ist das? Da lag ein Mensch und sperrte mir den schmalen Übergang. Ich gab meinem Pferde die Sporen und war im Nu an seiner Seite. Es war ein toter Garde mobile, platt auf dem Gesicht liegend. Die Beine und Arme lagen ausgespreizt gleich Mühlenflügeln. Nein! Nicht tot! Denn der linke Arm hob sich mit letzter Kraftanstrengung empor, als zucke er in der Abwehr vor meines Pferdes Hufen. Ein Rabe, der auf dem Geländer saß und den Schwerverwundeten mit schiefem Kopfe sehnsüchtiglich betrachtete, flog mürrisch ins Weite.
Die Meldung war von Wichtigkeit, ich mußte weg. Hier lag einer nur, und Hunderte büßten vielleicht mein Zögern mit dem Tode. Da fiel mir in den Zügel links ein südfranzösisch Weib mit roten, jungen Lippen. Ihre dunklen Augen gruben sich flehentlich in die meinen. Gerechter Gott! Vor meinem Gaule kniete, den linken Arm ausstreckend gegen mich, den andern um den einzigen Sohn klammernd, ein altes Mütterchen und rief: »Halt! Halt! Gib meinem Sohn zu trinken, nur einen Schluck. Noch lebt er! Hilf, hilf.«
Schon lockerte ich im strohumwickelten Bügel den Fuß, um abzuspringen, als mich zwei ruhige graue Augen trafen. Rechts vom Geländer stand ein langes, schmales Weib, im weißen, togaähnlichen Faltengewande! Nicht trüb und traurig, doch auch nicht fröhlich sah sie mich an. Ihre Züge blieben gleichmäßig ernst und streng. Die Dame Pflicht rief mich, und ich gehorchte.
Als ich auf dem Rückweg an dieselbe Brücke kam, lag noch immer der Garde mobile da. Ich sprang vom Pferde, und mir den Trensenzügel über die Schulter hängend, kniete ich nieder, um ihm aufzuhelfen. Doch zu spät; aus seinen Augen lachte mich der Tod an, und die Urmutter Erde sog gierig sein Blut. Der Tag ward heller, wenn er auch trübe blieb. Der Himmel zeigte dem Schlachttage ein widerwärtiges, heimatforderndes Graueinerlei. Schwach klang vom linken Flügel Gewehrfeuer her. Ich nahm den Krimstecher. Doch kaum hielt ich ihn vor den Augen, als mich ein heftiges Knattern schnell zum Umsehn zwang. Vor einem durchsichtigen, nahen Wäldchen lagen graue Wölkchen im Ringeltanze. Da knallte es wieder. Wetter! Das galt mir. Klipp, klapp, schlugs um mich ein in die nackten Zweige einer Eiche. Ich schoß wie die Schwalbe davon, nach rückwärts, zum Wäldchen, Abschiedshandkußgrüße sendend...
Dann, im ruhigen, englischen Trabe weiter reitend, stieß ich plötzlich auf einen Zug Husaren, der um die Ecke eines Häuschens bog. Voran mein Freund, ein junger Offizier mit schiefer Pelzmütze. Ihm gehörte schon seit Jahren mein Herz; wir hatten uns manchen Tag und manche Nacht zusammengefunden. Wie immer war er a quatre epingles. Im rechten Auge glitzerte die Scherbe, von der ich behauptete, daß er sie auch nachts nicht ablege. »Wo willst du hin?« »Und du?« Er deutete auf das Wäldchen, das sich mir eben so freundschaftlich gezeigt hatte, und berichtete, daß er auf Kundschaft ausgesandt sei: man habe das Schießen gehört. Zugleich solle er erforschen, ob sich Kolonnen hinter dem Walde gesammelt hätten.
Ich bot mich an, ihm den Weg zu zeigen. Wir schlichen, Indianern gleich, hinter Knick und Wall, jede Terrainfalte sorgsam benutzend. Voran wir zwei, nach allen Seiten spähend. Neben uns blieb der bärtige Trompeter, die unzertrennliche Begleitung des Leutnants. Dann folgten zwanzig bartlose, frische, blonde, blauäugige Bauernburschen.
Wir hatten uns allmählich dem Ziele genähert. Halt... Dreihundert Schritte kaum lag das Wäldchen vor uns, bestanden mit wenigen Bäumen, durch deren dünne Stämme der Lichtstreifen des Horizontes freigelegt ward. Die vorliegende Wiese war wie zur Attacke gemacht.
Nun zogen wir Husaren dicht heran. Ein Klingenblitz und Vorwärts, vorwärts.
Die Attacke
Platz da, und Zieten aus dem Busch,Mit Hurrah drauf in Flusch und Husch,Und vorgebeugten Leibes rasenIn einem Strich die Pferdenasen,Wir zwei weit voran den Husaren,So sind wir in den Feind gefahren.Die roten Jungen hinterherIn todesbringender Carriere,Daß wild die Spitzen der ChabrackenDen Grashalm fegen wie der Wind.Und hussah, ho, die bunten Jacken,Sind wir am Waldesrand geschwind.Geknatter, dann ein tolles Laufen,Wir konnten kaum mit ihnen raufen,So rissen die Gascogner ausVor unserm Säbelschnittgesaus.Doch hinter einer schmalen ErleStand einer dieser kleinen KerleUnd macht auf mich recht schlechte Witze,Und schoß mir ab die Helmturmspitze.Ei, du verfluchter gelber Lümmel,Ich treffe gleich dich im Getümmel.Und »Hieb zur Erde tief«, saß ihmIm Schädel eine forsche Prim.Kolonnen rückten nun heran,Der Auftrag war erfüllt, gethan.Der Leutnant sammelte den Zug,Und als er durch die Säbel frug,Ob keiner wegblieb, keiner fehle,Da schnürt es ihm die junge Kehle.Denn der Trompeterschimmel bäumte,Den Sattel frei, und schnob und schäumte.Wir fanden seinen Leiter baldAn Brombeersträuchern, tot, im Wald.Ein blaurot Fleckchen zeigte nurDen Schuß ins Herz, der Kugel Spur.Bei meinem Freund zum ersten MalSah ich die Scherbe niederschnippen,Und Thränen fielen ohne ZahlDem Toten auf die bleichen Lippen.O schäm dich nicht, wenn dies du liest,Daß dir so leicht die Thräne fließt.Im Sterben trägst du noch die Scherbe,Ich sei, stirbst früher du, der Erbe,Dann denk ich an den treusten Freund,Den je die Sonne hat gebräunt.
In der Mittagsstunde
Zwischen zwölf und ein Uhr stand die Schlacht. Auf einem Hügel, neben einem einsamen, brennenden Hause, aus dem die Bewohner geflohen waren, hielt der Oberbefehlshaber, die Hände kreuzweise übereinander auf dem Sattelknopf haltend, regungslos seit einer halben Stunde.
Der Stab stand gedeckt hinter dem Hause. Von allen Seiten, in rascher Aufeinanderfolge, kamen und ritten ab auf triefenden Pferden Adjutanten, Ordonnanzoffiziere und Ordonnanzen, um zu melden. Den Ordonnanzen war die Meldung schriftlich mit Blei gegeben. Der General schob die kleinen vierkantigen Zettel in die Satteltasche, ohne einen der hinter ihm haltenden Offiziere heranzuwinken. Noch immer hielt er regungslos; nur zuweilen den Krimstecher[2] gebrauchend oder in die Karte blickend. Sein großer Dunkelbrauner kaute unaufhörlich den linken Trensenzügel, ab und zu mit dem Kopfe nickend. Eine Granate krepierte zwischen uns und riß einen Hauptmann vom Stabe in Stücke. Sein Pferd bäumte hoch auf, schlug mit den Vorderhufen in die Luft, und brach dann, gräßlich zerschmettert, zusammen. Wir waren alle unwillkürlich auf einen Augenblick auseinandergesprengt. Ein Offizier eilte zum General, um ihm den Tod des von ihm sehr hoch gehaltenen Hauptmanns zu melden. Der General blieb regungslos; nur klopfte er seinem, durch den furchtbaren Knall unruhig gewordnen Pferde den Hals, und ritt einmal eine liegende Acht.
Die Suite[3] stand wieder auf demselben Fleck. Auf die entsetzlich verstümmelte Leiche breitete eine Stabsordonnanz ein vor dem brennenden Gebäude liegendes buntes Bettlaken. Um das Bettlaken herum waren hingeworfen eine Kaffeemühle, ein Bauer mit einem Kanarienvogel, der piepte und lustig, selbst in der schiefen Lage, sein halb verstreutes Futter nahm. Vor dem Hause lagen ferner Bücher, Tassen, eine Frauenmütze, zerbrochne Vasen, Bilder, Kissen, eine Cigarrentasche mit einer Stickerei, ein Kamm, eine Zuckerdose und tausenderlei sonstige Hausgeräte und nützliche und nichtnützliche Gegenstände.
Verwundet war sonst keiner von uns. Die Granate mußte auf dem Sattelknopf des Pferdes des Hauptmanns zerplatzt sein. Ab und zu schwirrte eine verlorne Gewehrkugel mit pfeifendem Tone über unsre Köpfe. Eine schlug in den Gartenzaun ein. Klapp! klang es leicht. Wie ein Spechtschnabelhieb.
Der General hielt regungslos. Sein ernstes, durchgeistigtes, feines Gesicht war blaß. Je mehr es in ihm arbeitete, je mehr beherrschte er sich äußerlich. Wir Offiziere sahn fortwährend durch unsre Gläser und tauschten Bemerkungen.
Verwundete hinkten bei uns vorüber oder wurden vorbeigetragen.
Der Tag war trüb und grau, doch die Übersicht nur zuweilen durch den sich schwer verziehenden Pulverdampf behindert. Wir konnten deutlich vor uns und rechts und links die gegenseitigen Schützenlinien und die Kolonnen, die sich, wenn sie ins Granatfeuer kamen, teilten, sehen.
Auf drei Infanterie-Bataillone westlich von uns richtete sich plötzlich unsre ganze Aufmerksamkeit. Sie zogen neben einander in einer engen Mulde, wie ratlos, hin und her, ohne sich entwickeln zu können. Wie uns schien, marschierten sie in aufgeschlossener Kolonne nach der Mitte; Kompagnie-Kolonnen zu formieren, hinderten die steilen Wände des Einschnitts. Ein Füllhorn von Granaten schüttete sich über sie aus. Auch der General bemerkte es. Er wandte den Kopf zu uns und rief meinen Namen. Ich war mit einem einzigen Sprunge von der Stelle an seiner Seite.: »Excellenz?« »Sehen Sie die kleine Kuppe halb rechts vor uns?« Er deutete, den Krimstecher in der Hand behaltend, auf diese. »Es steht dort ein einzelner Baum; sehen Sie ihn?« »Zu Befehl, Excellenz.« Ich hatte zu thun, mein lebhaft drängendes Pferd zu beruhigen. »Reiten Sie zur 97.leichten Batterie[4]; sie soll unverzüglich dort Stellung nehmen und feuern. Haben wir uns verstanden?« »Zu Befehl, Excellenz.« »Reiten Sie selbst mit der Batterie auf den Hügel und klären Sie dem Batterie-Chef die Situation auf.« »Zu Befehl, Excellenz.«
... und ich war schon unterwegs zu der nur wenige Minuten hinter uns haltenden, vom Oberbefehlshaber zu seiner speziellen Verfügung gestellten Batterie. Es war ein schauderhafter Weg. Gräben und Wälle mußten übersprungen werden.. Bald schwamm, bald kletterte mein kleiner Husarengaul, den ich für meinen alten Trakehner Hengst, dem denn doch endlich der Pust ausgegangen war, vertauscht hatte. Vorwärts, vorwärts. Was sind Gräben, noch so breite, was überhaupt Hindernisse im Gefecht. Endlich sah ich die Batterie. Ich winkte schon aus der Ferne mit dem Taschentuch. Der Batterie-Chef verstand es. Er gab Befehle; ich merkte es an der wimmelnden Bewegung, die an den Geschützen entstand. Dann raste er auf mich zu, den Trompeter an der Seite. Wir trafen uns; sein Gesicht glühte, als ich ihm den Befehl zum Vorrücken überbrachte. Der Trompeter war schon in Carriere zur Batterie unterwegs, um vom Hauptmann dem ältesten Offizier die Ordre zu übermitteln, die Batterie »Zu Einem« so rasch wie möglich vorzuführen. Der Hauptmann und ich setzten uns dann in Trab, doch so, daß wir mit der Batterie, die zahlreiche Terrainschwierigkeiten zu überwinden hatte, Fühlung behielten. Ich kannte den Weg aus den Frühstunden. Wir mußten durch eine enge, kurze, schluchtartige Vertiefung, die just so breit war, daß nur ein Geschütz dem andern folgen konnte. In Zügen hier zu fahren verbot die Enge. Links dieser schmalen Einsenkung war, auch nachdem das felsige Terrain hinter uns lag, durch Sumpf und nasse Wiesen ein Vorgehen von Kavallerie und Artillerie unmöglich; rechts hätten wir große Umwege machen müssen und dadurch viel Zeit verloren. Die Bataillone, die Bataillone! lagen mir im Sinn; dutzendweise wurden dort die Leute gemäht. Hatte unsre Batterie erst Stellung genommen, dann mußte sich die französische Artillerie gegen diese wenden.
Der Hügel war lang genug, um weite Räume zwischen den einzelnen Geschützen zu erlauben. Die Verluste gingen geringer. Wo ist die Schlucht, die Schlucht? Um uns sah es wild und wüst auf. Aber vorwärts, vorwärts! Der Hauptmann und ich, nachdem der Batterie ein Zeichen gegeben war, zu folgen, jagten vor, um rasch durchzupreschen und die günstigste Stellung für die Batterie auf dem Hügel vor ihrem Eintreffen auszusuchen.
»Um Gott!« rief der keineswegs zartbesaitete Hauptmann, als wir einbogen: »Bei Gott! da durch zu kommen, ist ja unmöglich! Das liegt ja alles voll von Verwundeten.«
Ein grausenhafter Anblick bot sich uns: auf einander geschichtet lagen in der Schlucht Tote und Verwundete, wenn auch in geringer Zahl. Die Verwundeten hatten unsere Batterie heranrasseln hören und waren mit größester Anstrengung an die Seiten gekrochen, um dem Rädertode zu entgehen. Es mußte hier vor wenigen Stunden ein verzweifelter Kampf gewesen sein.
Unmöglich! Hier war nicht durchzukommen. Aber die Bataillone, die Bataillone! Der Hauptmann und ich hielten einige Sekunden ratlos; die Batterie arbeitete mit keuchenden, dampfenden Pferden näher und näher heran.
Unmöglich! Da raste auf nassem Pferde ein junger Generalstabsoffizier des Oberbefehlshabers auf uns zu. Um seine Stirn war ein weißes Tuch geknotet; auf den Haaren saß die Feldmütze irgend eines Musketiers. Er lenkte sein Pferd mit der Rechten; mit der linken Hand wischte er fort und fort das unter dem Tuche hervorquellende Blut aus den Augen. Er konnte kaum mehr sehen. Von weitem schon schrie er mit ganz heiserer Stimme: »Die Batterie, die Batterie soll vor! Wo bleibt die Batterie? Excellenz ist...« Ich schoß auf ihn zu, um ihn aufzufangen; er lag, fast ohnmächtig, auf der Mähne des nun nicht mehr von ihm geführten Pferdes; die Arme hingen schlaff um den Hals des Tieres. Ich hatte keine Zeit, Verwundeten zu helfen, und wärs mein Bruder gewesen. So rief ich einen im Graben sitzenden Leichtverwundeten, der damit beschäftigt war, seine Hand zu verbinden, indem er das eine Ende des Tuches mit den Zähnen festhielt. Er legte mit mir den Hauptmann vom Generalstabe sanft nieder. Noch einmal sah ich in das blasse, blutüberströmte Gesicht; in halber Ohnmacht schon, bebten noch die Lippen: »Batbatbatbatbat...« Er wollte sagen: Batterie vor!... O du treuer, o du lieber Mensch!
Keine Sekunde Zeit war mehr zu verlieren. Ich flog zurück zum Hauptmann. Auch er war entschlossen nun. Also vorwärts.
»Nicht umsehn! Nicht umsehn!« schrie der Hauptmann. Wir zwei kletterten, so rasch es ging, voran. Nur einmal wandte ich den Kopf: Bald hoch, in der Luft, bald niedrig kreisende kreischende Räder, schräg und schief liegende Rohre und Achsen, sich unter dem Rade drehende Tote und Verwundete, der Kantschu in fortwährender Bewegung auf den Pferderücken, Wut, Verzweiflung, Fluchen, Singen, Schreien ...
Nun fuhr die Batterie auf dem Hügel auf, Haare, Gehirn, Blut, Eingeweide, Uniformstücke in den Speichen. In wundervoller Präcision fuhr sie auf. Abgeprotzt[5]. Geladen. Richten. Und: »Erstes Geschütz – Feuer!« Der Qualm legte sich dicht vor die Lafetten, wir konnten die Wirkung nicht beobachten. Doch schon beim zweiten Schuß pfiff eine feindliche Granate über uns weg. Sie galt der Batterie. Die Bataillone waren degagiert. Ich ritt, mich vom Hauptmann verabschiedend, zurück zum General, das Schreckensthal vermeidend. Als ich mich zurückgemeldet, sagte mir der Oberbefehlshaber ein gütiges Wort. Dann schloß ich mich wieder der Suite an.
Und regungslos hielt der General.
Hinter uns klang häufig das Kavallerie-Signal Trab. Wir konnten die Schwadronen nicht sehen. Aber es war mir, als hörte ich das Stapfen, Schnaufen, Klirren. Kommandorufe drangen an mein Ohr: Ha–hlt ... Ha–hlt ... und immer schwächer und schwächer werdend: Ha–hlt ... Ha–hlt. Alles das klang her, was die Bewegungen eines Reiterregiments so poetisch macht; erst recht, wenn man »drin steckt.« Ich hörte das Alles deutlich, und doch war um uns ein einziger Donnerton.