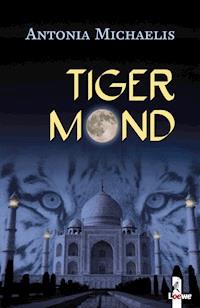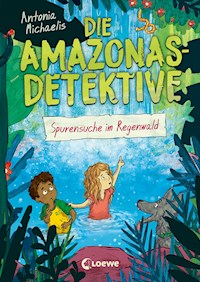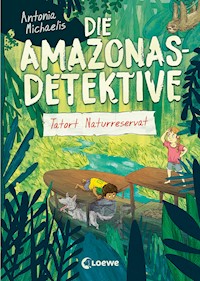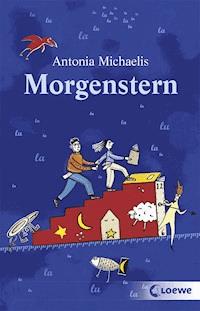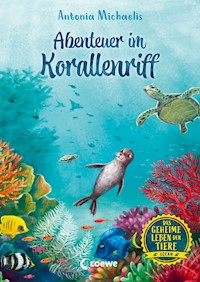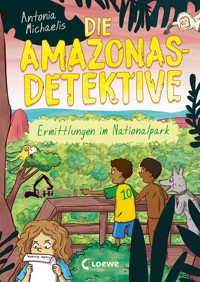
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Die Amazonas-Detektive
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft liegt in unseren Händen Springende Flussdelfine, himmelhohe Baumriesen, Hausboote auf dem Amazonas: Rund um die Stadt Manaus wartet der Dschungel. Doch im Geheimen geschehen erschreckende Verbrechen … Band 4 der spannenden Detektivreihe! Ein mysteriöser Brief von Ximenas verstorbenem Vater führt sie, Pablo und Davi in ein wildes Durcheinander aus bunten Paraden und verkleideten Menschenmengen. Hier sollen sie das Grab von Ximenas Vater finden – und einen geheimnisvollen Schatz. Doch die Kinder geraten in das Visier von Unbekannten, die verheerende Pläne in dem Nationalpark bei Rio de Janeiro verfolgen. Können die Amazonas-Detektive diesen verzwickten Fall lösen? Auf nach Rio! Tief im dichten brasilianischen Dschungel wartet der vierte Kriminalfall auf die Amazonas-Detektive. Eine spannende und unterhaltsame Detektiv-Reihe mit starker Umweltthematik für Jungs und Mädchen ab 9 Jahren rund um Klimaschutz, Umweltzerstörung,Kulturen, Brasilien, Regenwald und die Natur. Großartig erzählt von der unvergleichlichen Antonia Michaelis und mit coolen Schwarz-Weiß-Illustrationen von Kurzi Shortriver. Für Fans von Kirsten Boie und Annelies Schwarz. Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle mutigen Kinder, die nie aufhören, die verschwundenen Dinge und Leute zu suchen.
INHALT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Nachwort
ERSTES KAPITEL,
in dem ein Brief ankommt, der den Detektiven Rätsel aufgibt und sie mal wieder zu einer Reise aufbrechen
Ximena las den Brief vier Mal.
Sie wurde nicht schlau daraus.
Der Silberbaron wanderte hinter ihr in der Bibliothek auf und ab und stieß seinen Stock mit dem Silberknauf bei jedem Schritt mit einem Klicken auf den Boden.
»… an ihrem zehnten Geburtstag«, murmelte Ximena. »Warum an meinem zehnten Geburtstag? Und warum liegt er in Rio begraben, wenn sie ihn damals im Urwald ganz woanders … entführt haben?«
»Ich weiß es nicht.« Der Silberbaron seufzte. »Ich weiß es nicht, mein Kind.«
Sie drehte sich zu ihm um und sah auf einmal, wie alt er war, dieser stets gut angezogene Herr mit seinem Stock: Die faltigen Hände, die er auf den Silberknauf gelegt hatte, zitterten. Er sah aus wie eine Figur aus brüchigem Papier, das im nächsten Lufthauch zerkrümeln und zu Staub zerfallen würde. Sie wollte nicht, dass er so aussah.
»Komm«, sagte sie. »Gehen wir an die frische Luft. In die Sonne. Diese Bibliothek ist auch wie ein Grab, hier kann man nicht denken.«
Eine halbe Stunde später saßen sie im schattigen grünen Hof eines Cafés unter Bäumen. Draußen in der Gasse summte das wirre Leben der Stadt Manaus vorüber. Nicht weit über den Dächern strahlte die Kuppel des alten Theaters golden und Ximena hörte die Hunde, die Autos, die Touristen, die Bettler, gedämpft durch den Schatten des ruhigen Hofs.
Der Silberbaron hatte die Hände jetzt um seine Kaffeetasse gelegt.
»Wie seltsam, dass du es warst, die mich in dieses Café geführt hat«, sagte er und lächelte. »Und dass du dich in der Stadt besser auskennst als ich. Du bist die Große jetzt, was? Früher war das anders. Du bist nie ohne deine Nanny irgendwo hingegangen.«
»Weil du mich in der Villa eingesperrt hast«, meinte Ximena. »Aber das ist jetzt wohl nicht mehr möglich, wo ich ein halbes Jahr im Urwald gelebt habe, ohne Villa und Wände und fließend Wasser.«
Sie grinste und der Silberbaron seufzte. »Ich habe immer noch Angst um dich. Und in letzter Zeit noch viel mehr. Diese Anrufe … von Leuten, die sich nicht melden … Ihr habt euch in zu viele Dinge eingemischt. Von wegen Amazonas-Detektive und den Wald retten. Es ist eine Sache, in der Zeitung aufzutauchen oder in diesem modernen Internet. Und eine ganz andere, wenn Leute einen bemerken, die sich gestört fühlen. Ihr wärt nicht die Ersten, die einfach verschwinden.«
»Aber das hier ist kein Brief von jemandem, der uns loswerden will«, sagte Ximena mit fester Stimme und kippte ihren Saft herunter wie Schnaps. Wie eine echte Detektivin eben. »Es ist ein Brief von jemandem, der meinen Vater gekannt hat. Der ihm versprochen hat, diesen Brief zu meinem zehnten Geburtstag zu schreiben, damit ich endlich sein Grab besuche.«
Der Silberbaron kniff die Augen zusammen. »Und wenn nicht? Wenn es eine Falle ist?«
Pablo bekam den Anruf, als er auf dem Turm der kaputten Villa saß und hauptsächlich nichts tat. Er überlegte, ob es sich lohnte, etwas zu tun. Zum Beispiel ein paar Touristen durch die Stadt zu führen, die ihm vielleicht Geld gaben. Er war hungrig, wie immer, aber in letzter Zeit hatte er zu nichts Lust. Er verschlief halbe Tage, da es ihm einfacher schien, den Hunger wegzuschlafen als zu arbeiten. Er saß nachts unter den Sternen und grübelte.
Er verließ den Turm immer seltener.
Die Wahrheit war – er vermisste Ximena und Davi. Er vermisste ihre Abenteuer.
Seitdem Ximena bei ihrer Mutter im Regenwald lebte, war nichts Aufregendes mehr passiert.
Aber dann – dann kam der Anruf. Da Pablo kein Telefon besaß, kam der Anruf in Form von Miguel, der immerhin erwachsen und Student war. Der hatte natürlich ein Handy.
Und jetzt stand er unten und rief zu ihm hoch: »Paaablo! Komm runter, wenn du da bist! Ich habe eine Botschaft von Ximena! Sie ist in der Stadt! Und es hört sich an, als hätte sie … einen neuen Fall.«
Nie war Pablo schneller an der Schlingpflanze außen am Turm hinabgeklettert. Er sprang die letzten paar Meter, landete atemlos vor Miguel und sah zu ihm auf.
»Einen Fall? Was für einen Fall?«
Miguel runzelte die Stirn und sah auf sein Handy.
»Sie schreibt: Sag Pablo, er möchte bitte zum Café beim kleinen Kunstmuseum kommen. Der Silberbaron hat mich in die Stadt geholt, weil er Post für mich bekommen hat. Einen Brief. Es geht um meinen Vater. Aber vielleicht um viel mehr. Der Brief enthält ein Geheimnis und noch kann ich es nicht lüften.«
Miguel grinste schief. »Sie schreibt Kurznachrichten so, als wären es versiegelte Briefe in einem alten Kriminalroman.«
»Das ganze Leben ist ein Kriminalroman«, sagte Pablo feierlich. In ihm leuchtete etwas wie ein Feuerwerk, glühte, sprühte Funken. »Wir werden wieder ein Abenteuer erleben.« Pablo bückte sich, um den Hund zu streicheln, den Miguel mitgebracht hatte. »Wir alle zusammen.«
»Oder«, murmelte Miguel, als sie lostrabten, »wir lassen uns alle zusammen in eine Falle locken und beseitigen. Das war es dann mit den Amazonas-Detektiven.«
Meine liebe Tochter,nun bist du zehn Jahre alt und es ist an der Zeit, dass wir uns kennenlernen.Du wirst dich nicht an mich erinnern, aber ich erinnere mich gut an dich.Daran, wie du mit großen Augen in die Bäume des Waldes hinausblicktest.Daran, wie du am Fluss den Delfinen zugehört hast, wenn sie schnatterten, als könntest du ihre Sprache verstehen. Du warst ein besonderes Kind und ich hoffe, du bist es noch immer.Als du ein Jahr alt warst, wollten deine Mutter und ich ein Kunstprojekt durchführen: Ein riesiger Heißluftballon sollte über dem Regenwald aufsteigen, um die Welt auf die Verbrechen dort aufmerksam zu machen. Doch ehe er fliegen konnte, sind sie gekommen und haben uns geholt. Sie haben deine Mutter verschleppt und mich auch. Dich ließen wir im Wald zurück. Unsere Freunde, die Yanomami, sind geflohen, um anderswo im großen Wald Schutz zu suchen. Das habe ich erst später erfahren.Später, ja: Denn obwohl die, die uns holten, uns töten wollten, habe ich überlebt.Vielleicht war es ein Zufall.Sie ließen mich im Wald liegen, verletzt, und glaubten, ich würde sowieso sterben.Ich war lange bewusstlos, und als ich erwachte, hatte mich jemand auf die Ladefläche eines Lastwagens geladen. Ich werde wohl nie erfahren, wer das war oder wie ich den weiten, weiten Weg aus dem Wald zur Straße gekommen bin.Ich lag zwischen Kisten und Säcken, mein Hemd blutgetränkt, und konnte mich kaum rühren. Der Lastwagen fuhr mehrere Tage lang. Er fuhr an die Küste, nach Rio de Janeiro: die bunteste, lauteste aller Städte, immer fröhlich, immer lachend, heiß, stickig, riesig.Und als ich dort von der Ladefläche taumelte und am Straßenrand zusammenbrach, fand mich einer, der mich aufnahm, obwohl er selbst nichts hatte: Carlos, der wunderbarste, verrückteste Mensch von Rio. Maler, Straßenkünstler, Zauberer. Er hat mich auf seinem Rücken zu seinem Zimmerchen getragen in den Favelas, den Armenvierteln am Berg in Rio, wo die Häuser über- und untereinander gebaut sind wie ein eigenes Kunstwerk. Dort lebte er zusammen mit seinem Freund Emilio.Sie haben mich gepflegt, wochenlang, zusammen mit anderen: lauter Malern, Dichtern, Musikern. Und schließlich begann auch ich, wieder zu malen. Aber die Trauer um deine Mutter und um dich fraß Löcher in mich, durch die man leicht hindurchsehen konnte. Ich wandelte auf Rios Straßen wie ein durchsichtiger Mensch und ich lebte unter falschem Namen, damit die Männer, die versucht hatten, mich zu töten, mich nicht wiederfanden.Diese Männer haben keinen eigenen Willen, sie sind die Helfer eines Mächtigeren.Eines Tages erfuhr ich, dass du lebst, meine Tochter. Jemand, der in Manaus gewesen war, erzählte, der Silberbaron hätte seine Enkelin bei sich. Und das warst du, kein Zweifel. Mein Herz sang vor Freude. Doch ich beschloss, dich in Ruhe zu lassen – dort, wo du in Sicherheit warst. Wie hättest du bei einem Vater leben können, der einen falschen Namen trägt, auf einer alten Matratze in einem Abstellraum schläft und nichts macht als merkwürdige Figuren und Bilder?
Ximena ließ den Brief sinken und blickte auf. Pablo sah es in ihren Augen blitzen.
»Klar hätte ich das!«, sagte sie und schnaubte. »Es wäre sicher abenteuerlich gewesen, meinst du nicht?«
»Beim Silberbaron gab es mehr zu essen, wetten«, sagte Pablo.
Sie saßen mit dem Brief im Café-Garten. Der Silberbaron saß auch noch dort und hörte zu, obwohl er den Brief vermutlich schon zehn Mal gelesen hatte. Er spielte nervös mit dem Silberknauf seines Gehstocks und räusperte sich von Zeit zu Zeit.
Und manchmal murmelte er etwas wie »mein Sohn, mein völlig übergeschnappter Sohn« und seufzte.
»Lies weiter!«, drängte Pablo. »Wo ist er denn nun, dein Vater? Ist er noch in Rio?«
Ximena nickte. Und auf einmal seufzte auch sie und streckte Pablo das zu oft gelesene, etwas zerknitterte Papier hin. »Lies selbst.«
»Och nee …«, begann Pablo. Er hasste Lesen. Er war nie in die Schule gegangen, natürlich nicht. Niemand, der auf der Straße lebte, ging zur Schule. Miguel hatte ihm das Lesen und Schreiben zwar beigebracht, aber seine Freunde waren die Buchstaben des Alphabets noch immer nicht.
»Na gut«, murmelte er schließlich und hob den Brief hoch. »Meine … meine liese … meine liebe Tochter, ich schrie… ich schrieb dir, es sei an der Zeit, dass wir uns kennenlernen.
Aber du wirst nur noch mein Grab vorfinden. Ich bin sehr krank, der Arzt sagt, ich habe nur noch wenige Tage, und deshalb schreibe ich dir diese Zeilen. Es ist kein gesundes Leben hier draußen in den Favelas. Du wirst es finden. Mein Freund Emilio wird dafür sorgen, dass dieser Brief dich erreicht, wenn du alt genug bist. Wenn du persönlich mit ihm sprechen möchtest, such Emilio dort, wo die Kunst wohnt. Der Aufstieg ist steil, aber er lohnt sich. Such das Grüne im Roten. Emilio wird dir helfen, mein Grab zu finden. Er wird wohl dann der Einzige sein, der noch weiß, wo es liegt. Ich habe es selbst gewählt, unter den schattigen Kronen der größten Bäume, umgeben von meinen kleinen Freunden, deren Füße oben über die Erde laufen. Die laute, bunte Stadt ist ganz nah und doch fern. Wenn du an meinem Grab stehst, wirst du den Hut aus Zucker nicht sehen. Nur unserem Herrn, dem kannst du von meinem Grab aus winken, weiß sieht er durch die Äste zu dir.«
Pablo sah auf.
»Schöner Mist, was?«, knurrte Ximena. »Erst hat man auf einmal einen Vater und dann ist er doch wieder tot.«
Pablo fragte sich, wozu der Vater einen Brief hinterlassen hatte, wenn er doch sowieso jetzt tot war.
»Aber es kommt noch was, warte«, sagte Ximena, schnappte sich den Brief und las selbst weiter. »Ich habe dir in meinem Grab etwas hinterlassen. Obwohl ich in den Favelas gelebt habe, auf einer alten Matratze, hat sich meine Kunst nicht schlecht verkauft. Mit einem Teil habe ich meinen Freunden geholfen, den Rest habe ich nicht ausgegeben. Du wirst wissen, was mit dem zu tun ist, was du finden wirst. Halte dich an meine Freunde, aber nimm dich in Acht vor meinen Feinden. Sie sind überall. Denk an den Karneval in Rio. Nichts ist so, wie es scheint. In Liebe, dein Vater.«
Miguel pfiff durch die Zähne und der Hund stellte neugierig die Fledermausohren auf.
»Ein geheimnisvoller Schatz in einem Grab. Und die Beschreibung ist ein Rätsel. Na, wenn das mal nicht bestens zu euch passt. Ein hübsches kleines Ratespiel für die berüchtigten Amazonas-Detektive.«
»Wir machen keine Ratespiele, wir lösen Fälle«, sagte Pablo würdevoll.
»Und das hier ist kein Fall, sondern eine Falle.« Der Silberbaron klopfte energisch mit seinem Gehstock auf den Boden. »Niemand fährt nach Rio de Janeiro. Seit ihr im Internet aufgetaucht seid mit eurem Detektivnamen, bekomme ich Anrufe von Leuten, die kein Wort sagen. Leute, die uns nachspionieren. Ich meine, kommt euch das nicht ein bisschen komisch vor, dass das Briefpapier so weiß und neu aussieht? Nach einem Brief, der jahrelang irgendwo lag, sieht dieser nicht aus. Schmeiß ihn weg, Ximena, und vergiss das Ganze.«
»Pablo!«, rief Ximena verzweifelt. »Miguel! Sagt was dazu! Ich versuche schon seit zwei Stunden, ihn zu überreden! Ich muss nach Rio! Ich muss! Ich habe drei Monate lang allein auf einem Baum im Regenwald gelebt … na ja, mit meiner Mutter … Du kannst mich nicht mehr einsperren, so wie früher! Ich bin kein kleines Kind mehr!«
Sie war aufgesprungen und ihr braunes Lockenhaar hatte sich gelöst und stand wild und kampfeslustig nach allen Seiten ab.
»Ich könnte anbieten mitzufahren«, sagte Miguel. »Oder … Gita und ich. Im Moment haben wir an der Uni keine Prüfungen und wir müssen ohnehin Orte erschließen für unser kleines Reisebüro …«
»Nein«, sagte der Silberbaron. »Ende der Diskussion. Selbst wenn der Brief echt ist – mein Sohn hat dich selbst vor seinen Feinden gewarnt. Diese Sorte Männer hat keine Skrupel. Sie werden von oben bezahlt, von den Mächtigen, und ein Leben ist ihnen nichts wert. Komm nach Hause, in die Villa. Dort und nur dort ist es wirklich sicher.«
»Sicher? Haha«, murmelte Ximena um ungefähr ein Uhr nachts, als der Mond auf die Büsche hinter der Villa schien. »Jeder kann hier durchkrabbeln und mich entführen.«
Sie krabbelte aus dem Durchschlupf, stand auf und bürstete sich die kleinen grünen Blättchen von der Hose. »Also ist es doch am besten, ich entführe mich einfach selbst.«
Pablo sah sie an, wie sie da vor ihm stand, mitten in der Nacht, ihren Rucksack geschultert, das lange Haar unter die Kappe gestopft, in weiten Hosen und Pullover.
»Da drin«, Ximena deutete stolz auf den Rucksack und sah Pablo verheißungsvoll an, »ist noch viel, viel bessere Verkleidung, du wirst schon noch sehen. Für Rio natürlich.«
Aus dem Rucksack lugten ein paar lange, wippende Federn in Blauviolett und Türkisgrün hervor.
»Du verkleidest dich als … Papagei?«, fragte Pablo zweifelnd.
»Du dich auch«, sagte Ximena zufrieden. »Wir werden im Karneval völlig in der Masse untergehen. Keiner wird uns überhaupt bemerken. Und dann finden wir schließlich diesen Emilio. Und das Grab meines Vaters. Und den Schatz.«
Pablo seufzte und streichelte den Hund, der ihn begleitet hatte.
Eigentlich gehörte er Gita, Miguels Freundin, aber wenn er ein Abenteuer witterte, tauchte er meistens bei Pablo auf.
»Müssen wir den Hund auch verkleiden?«, fragte Pablo. »Und womit fahren wir überhaupt? Rio ist echt weit.«
»Überland-Bus«, meinte Ximena kurz angebunden. »Der erste Morgenbus geht um 5:30 Uhr. Los, komm.«
Als Pablo ihr durch die stille, nächtliche Straße zwischen den alten Häusern folgte, hatte er das seltsame Gefühl, dass der Silberbaron recht hatte.
Dies hier war nicht nur ein Ausflug zu einem Grab. Es würde gefährlich werden.
Aber immerhin waren sie die Furchtlosen Drei vom Rio Negro.
Der Hund, dachte Pablo, sah viel furchtloser aus als er selbst.
ZWEITES KAPITEL,
in dem ein tanzender Tintenfisch vorkommt und jemand spurlos verschwindet
Als sie drei Tage später aus dem Bus kletterten, lag beinahe das komplette Land zwischen ihnen und Manaus. Es war ein seltsames Gefühl. So viel Grün war an den Busfenstern vorübergeglitten, so viele Kilometer Asphaltstraße, so viele kleine und große Städte. Winzige Stände an Umsteigepunkten, die Essen verkauften, bettelnde Kinder, reiche Autobesitzer.
»Es gibt noch tausend Sachen zu erforschen in diesem Land«, sagte Ximena. »Aber ich steige nie wieder in einen Bus. Mein Hintern ist viereckig.«
»Ich habe gar keinen Hintern mehr«, knurrte Pablo.
Der Hund hatte die meiste Zeit über unter den Sitzen geschlafen und gähnte ausgiebig.
Dann fuhr der Bus ab und sie folgten der Menge über den Platz, an dem er gehalten hatte: ein wuseliger, chaotischer Busbahnhof mit jeder Menge anderer Busse, fliegenden Händlern, schreienden Kindern. Eine Frau trug einen Korb voller Hühner vorbei, ein Mann mit einem Hotelschild versuchte, Touristen anzuwerben. An der Wand des öffentlichen Klos war jemand dabei, mit einer grünen Spraydose etwas zu malen, die Kapuze über den Kopf gezogen. Ehe sie ihn erkennen konnten, huschte er fort, verschwand im Gedränge.
Ein Wunderheiler verkaufte Kräuterbündel, ein Straßenkünstler jonglierte mit fünf Bällen und einem Hut.
Und dann standen Ximena, Pablo und der Hund an der Ausfahrt des Busparkplatzes. Vor ihnen erstreckte sich die mehrspurige, hektische Küstenstraße und dahinter, verziert mit einem weißsandigen Strand, räkelte sich das blaue Meer in der Sonne.
Pablo sog die Luft tief ein. Er hatte das Meer noch nie gesehen.
»Wir könnten uns einfach eine Weile hier in die Sonne legen«, sagte er träumerisch. »Stell dir vor, man könnte über den Horizont segeln! Was es da draußen alles gibt! Unbekannte Welten, unentdeckte Küsten … unbezwingbare Berge … Eisbären …« Er sah es vor sich. Wie er am Bug eines Schiffes mit weißen Segeln stand, eine Hand am Steuer, in der anderen einen Degen, zu allem bereit. Niemand würde mehr fragen, ob er auf der Straße oder in einer Villa aufgewachsen war, wenn er erst ein berühmter Entdecker und Held wäre.
»Das ist der südliche Atlantik und dahinter kommt die westafrikanische Küste«, erklärte Ximena nüchtern. »Eisbären sind da nicht. Und Berge …« Sie sah sich um. »Die findest du hier wahrscheinlich eher.«
Pablo wollte erst etwas Ärgerliches über Träume sagen, die man doch wohl haben könnte. Doch dann folgte er ihrem Blick. Und er sah, dass sie recht hatte: Ein Stück weiter die Küste entlang ragte ein riesiger, steiler Felsen in den Himmel.
»Da ist der Zuckerhut«, wisperte Ximena. »Ich hab’s nachgelesen. So heißt der. Man kann mit der Seilbahn hoch.«
In Richtung Inland schmiegte sich das Häusermeer dicht an dunkelgrüne, jäh ansteigende Berghänge. Auf einem Berg stand eine gigantische Statue: ein weißer Cristos mit ausgebreiteten Armen.
Pablo musste zugeben, dass die Statue beinahe genauso gut war wie ein unentdeckter Eisbär.
Ganz Rio de Janeiro sah nach einem Abenteuer aus. Vielleicht hielt Rio Aufgaben für Helden bereit.
»Wo finden wir diesen Emilio?«, murmelte Pablo. »Den Freund deines Vaters?«
Ximena hob den Zeigefinger und zitierte mit Bühnenstimme. »Such ihn dort, wo die Kunst wohnt, der Aufstieg ist steil, aber er lohnt sich.«
»Wo die Kunst wohnt«, wiederholte jemand neben ihnen. Sie fuhren herum.
Neben ihnen stand ein grüner Tintenfisch mit Glitzerarmen.
Der Hund bellte verwundert und schnappte nach einem Arm, den der Tintenfisch schnell wegzog.
»Der Aufstieg ist steil … das wird Santa Marta sein«, sagte der Tintenfisch. »Alle Touristen sehen sich das Viertel Santa Marta an.« Als er nickte, wippte auf seinem Kopf eine Menge langer grün glitzernder Pfauenfedern auf und ab.
»Entschuldigung, Sie sind ein … Oktopus mit … Federn?«, fragte Pablo, möglichst höflich.
»Richtig, richtig«, sagte der Tintenfisch. »Ich bin Teil einer Sambaparade, aber irgendwie bin ich falsch abgebogen und habe die anderen verloren.« Er schüttelte wieder den Kopf, bekümmert. »Ständig kommen mir diese Arme in die Quere. Und dann liegt es natürlich an der fehlenden Brille. Beim Sambatanzen sollte man keine Brille tragen, aber ich sehe ohne sie so wenig … Was wollt ihr denn in Santa Marta? Wen sucht ihr? Woher kommt ihr?« Als der Tintenfisch seine Federn beiseiteschob, sah Pablo, dass er eine Frau war. Eine sehr wenig bekleidete Frau mit viel Glitzer an sich.
»Wir suchen E…«, begann Ximena, doch Pablo trat ihr auf den Fuß. Es war besser, dachte er, den Leuten nicht zu viel zu erzählen. »Wir sehen uns nur um. Wir mögen einfach … steile Aufstiege. Und Kunst. Wohnende Kunst. Ja, so in etwa.«
Der Hund sah ihn an, als wäre er übergeschnappt. Vermutlich hatte er recht.
»Sante Marta ist da lang«, sagte die Glitzertintenfischin. »Aber Kinder, ich sehe auch ohne Brille, dass ihr zu jung seid, um ohne Eltern hier herumzustreunen. Habt ihr keine Eltern?«
»O doch.« Ximena setzte ein unschuldiges Lächeln auf wie einen Hut. »Mein Vater ist in der Stadt. Ehrlich gesagt suchen wir ihn. Er … wartet auf uns.«
»Ja, zwei Meter unter der Erde«, knurrte Pablo, aber das hörte niemand. Und irgendwie waren sie plötzlich unterwegs in ein Stadtviertel namens Santa Marta, mit einer kurzsichtigen Glitzertintenfischin voller Federn. Der Urwald auf den Bergen winkte aus der Ferne. Als wüsste er schon, was hier alles passieren würde.
Sie verließen die Küste, wanderten stadteinwärts, und Ximena erzählte der Glitzertintenfischin von ihrem Vater, der Künstler war und in der Stadt lebte.
Und den sie treffen würden. Sie erzählte, wie er in einer kleinen bunten Hütte wohnte, von der aus man aufs Meer sehen konnte, und wie er auf der Terrasse dieser Hütte malte, während die Sonne unterging. Sie erzählte, wie sie abends zusammen dort saßen und aßen. Wie er Musik anmachte und sie zusammen unter dem Mond auf der Terrasse tanzten. Und wie er an manchen Tagen eine eigene Staffelei für sie aufbaute, damit sie auch malen konnte.
»Ximena«, flüsterte Pablo. »Du weißt schon, dass das alles nicht stimmt?«
»Psst!«, fauchte Ximena. »Ich schmücke nur etwas aus. Einmal hat er das Grab gemalt, das er eines Tages haben möchte«, fuhr sie fort. »Es lag unter den schattigen Kronen der größten Bäume, umgeben von seinen kleinen Freunden, deren Füße oben über die Erde liefen. Die laute, bunte Stadt wäre ganz nah und doch fern …«
Genau so hatte es im Brief gestanden und genau wie damals ergab es keinen Sinn.
»Das ergibt keinen Sinn«, überlegte die Glitzertintenfischfrau. »Er möchte da oben irgendwo im Wald begraben werden, in den Bergen, ja? Im Tijuca-Nationalpark? Aber warum die Füße? Vielleicht …«
Aber Ximena und Pablo erfuhren nicht, was vielleicht war, denn in diesem Moment bogen sie aus einer schmalen Gasse auf eine große, gerade Straße ab. Eine Welle von etwas Lautem, Großem, Buntem erfasste sie. Es schwemmte sie einfach mit sich wie ein Strom: ein Strom aus tanzenden, sich wiegenden, im Rhythmus stampfenden Körpern.
»Da sind sie!«, rief die Glitzertintenfischin. »Ich habe sie wiedergefunden!«
Auf einmal war sie fort, eingetaucht in den Strom.
»Wir … wir sind mitten in einer Sambaparade!«, rief Ximena. Doch Pablo erriet ihre Worte mehr, als dass er sie hörte, denn die Musik war ohrenbetäubend laut. Hunderte von Glitzertintenfischen mit Federschmuck tanzten um sie herum vorwärts. Die falschen Diamanten funkelten grün und blau auf den engen Oberteilen der Tänzerinnen. Ihre Gesichter waren kunstvoll geschminkt, ihre Leiber glänzten vor Schweiß oder Öl. Die Frisuren waren kompliziert aufgesteckt und wurden von noch mehr falschen Juwelen gehalten.
Sie alle lachten beim Tanzen, lachten und strahlten und streckten die Arme nach den Neuankömmlingen aus.
»Kommt, kommt, Kinder!«, rief eine Tänzerin. »Wo ihr schon hier seid, tanzt mit uns! Feiert mit uns den Karneval!«
Ximena begann, sich so zu bewegen wie die Tänzer, aber Pablo kamen seine eigenen Füße in die Quere. Er schien viel zu viele davon zu haben, er stolperte voran und kam sich ausgesprochen blöd vor. Selbst der Hund schien besser tanzen zu können.
»Wir … wir wollten doch … nach Santa Marta …«, keuchte er, aber niemand hörte ihn.
Es gab nur eine Richtung. Die Richtung der Parade.
Und dann sah Pablo den Wagen, der sich mitten zwischen den Federtintenfischen entlangschob. Er dachte »Wagen«, weil Ximena gesagt hatte, jede Sambatanzschule hätte einen Wagen, den sie für den Karneval schmückten. Aber eigentlich sah man von dem Wagen nichts. Man sah lediglich ein riesiges buntes Korallenriff, das die Straße entlangglitt. Ein Riff aus Pappmaschee voller wedelnder Stoffkorallen, riesiger Seesterne und Muscheln. Ganz oben thronte eine sicher vier Meter hohe Tintenfischgöttin und lächelte hinab auf die Straßen von Rio.
»Da rauf!«, keuchte Pablo und zog Ximena am Arm. »Wir müssen … da rauf!«
Ximena war ganz in ihrem Tanz mit den anderen versunken und er musste sie fast gewaltsam mit sich ziehen, aber der Hund, dem all die Füße zu viel wurden, half ihm. Auch er wollte aus der Parade hinaus, irgendwohin, wo es leiser und weniger voll war.
Pablo schlängelte sich zwischen Tänzerinnen und Trommlern hindurch, Ximena im Schlepptau, überholte Gruppe um Gruppe, und dann waren sie ganz nah bei dem Wagen. Er sah jetzt seine Räder. Er griff nach einem Delfin aus Pappe, zog sich hoch und jetzt leuchteten Ximenas Augen.
»Delfine!«, rief sie.
Es waren keine Botos, keine rosa Flussdelfine, sondern graue Delfine aus dem Meer, aber Ximena hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Delfinen gehabt. Als Kind hatten die Delfine sie gerettet, als sie allein im Dschungel zurückgeblieben war, und bei ihrer Mutter im Wald war sie mit ihnen geschwommen.
»Wenn Delfine da sind, sind wir richtig«, sagte sie und Pablo wusste, dass das Unsinn war, doch er nickte. Er zog den Hund ebenfalls hoch auf den Wagen, wo der sich erschöpft in einer großen Pappmuschel zusammenrollte. Ximena und Pablo kletterten höher, kletterten bis auf den Schoß der Tintenfischgöttin. Der Wagen schwankte, aber niemand schien sich daran zu stören, dass sie auf ihm herumkletterten. Vielleicht merkte es auch einfach niemand in dem Chaos aus Farbe und Musik. Schließlich saßen sie auf der Schulter der Göttin und es war verdammt wackelig dort. Pablo klammerte sich an einem Pappohr fest, das Geschwanke machte ihn seekrank.
Doch von hier aus hatte man einen wunderbaren Ausblick.
Er sah die Straßen der Stadt, die sich an allen Seiten bis zur Küste hin erstreckten. Die Stadt schien auf eine Art ins Meer ragende Halbinsel gebaut zu sein, überall war Wasser. Er sah den steil aufragenden Berg am Ende einer der Buchten und jetzt entdeckte er auch die Seilbahn, die auf den Gipfel führte: Eine gläserne Kapsel bewegte sich wie von Zauberhand durch die Luft dorthin.
Pablo sah die Hochhäuser der Stadt, glänzende, moderne Felsen, menschengemacht und zu gerade, um schön zu sein.
»Da!«, sagte Ximena. »Der Aufstieg ist steil, aber er lohnt sich! Dort, wo die Kunst wohnt.«
Pablo drehte sich um und blickte zur anderen Seite. Er sah Hütten über Hütten an den Hängen kleben, wild über- und untereinander gebaut. Sie schienen die Berge hochzukrabbeln, bis sie oben mit dem Grün des Urwaldes zusammenstießen. Ein Vorgebirge aus notdürftigen Behausungen, manche aus Wellblech oder Pappe, andere aus Holz oder Beton, bunt angestrichen, mit Balkons und kleinen Wegen und Stegen dazwischen, in einem Wirrwarr aus Elektroleitungen, Treppen, Blumentöpfen, Wäscheleinen.
Hier und da ragte der Turm einer Kirche aus dem Durcheinander.
»Das Rote!«, rief Ximena neben ihm. »Wir sollen das Rote suchen! Da! Guck! Siehst du die Treppe?«