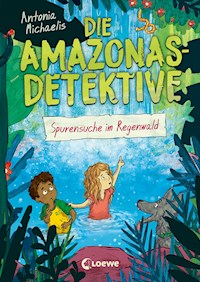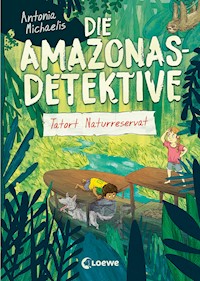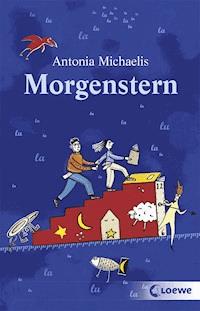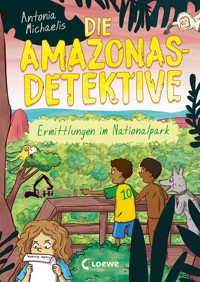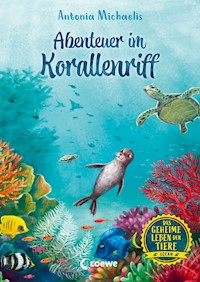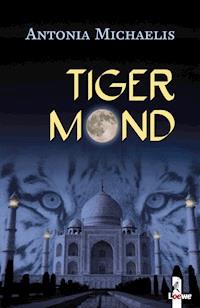
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Vor dir liegt ein langer Weg – du wirst durch das Feuer gehen, durch das Wasser und durch den Wind. Am Ende jedoch steht der Tod." Noch immer hallen Farhad die Worte des heiligen Mannes im Ohr. Bis zum nächsten Vollmond hat er Zeit, den geheimnisvollen Blutstein zu finden und diesen dem Diener des Dämonenkönigs zu übergeben. Nur so kann Farhad die Prinzessin befreien, die der grausame Herrscher in seinem Palast gefangen hält. Begleitet von Nitish, einem weißen Tiger mit geheimnisvollen blauen Augen, begibt sich Farhad auf die ungewisse Reise durch Indien, ohne zu ahnen, welch gefährliches Abenteuer ihm bevorsteht. Und dabei ist ihm der Tod stets dicht auf den Fersen ... Lektorix des Monats (Juni 2006) Auswahlliste der besten Medien für Jugendliche der Frankfurter JungenMedienJury (2006)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwarnung
Safia und Raka
Durch den Wind
Der Blutstein
Die Nacht der Ratten
Der Tisch eines indischen Schlachters
Der Stamm des heiligen Bodhi-Baums
Raka und Lalit
Durch das Wasser
Ein Gruß des Monsuns
Eine kleine weiße Kuh
Ein Abbild seiner selbst
Ein Glänzen so hell wie die Sonne
Lalit und Raka
Durch das Feuer
Asche
Arrak
Sand
Stein
Lalit und Lagan
Durch die Liebe
Zwischen den Dornen der Rosenhecke
Unter der Dattelpalme
Abgesang
To Roy and his children
Vorwarnung
Wie beginnt eine Geschichte über Indien?
Beginnt sie mit den drei großen Strömen – Ganga, Yamuna und der unsichtbaren Sarasvati, die ihr träumendes Wasser von den verschneiten Bergen hinab in die heiße, trockene Ebene ergießen?
Beginnt sie mit den drei großen Göttern – den Trimurti: Brahma, Shiva und Vishnu, dem Schöpfer, dem Erhalter und dem Zerstörer? Jenen drei, die sich ihren Weg mit Schwertern aus Weisheit, Erkenntnis und Alogik durch die verwirrende Landschaft der letzten Jahrtausende bahnen?
Beginnt sie mit dem Tiger, der durch den Dschungel im Süden streift? Mit dem narbigen, rissigen Boden der Wüsten im Norden? Mit der stickigen Luft der Tempel oder der schattigen Kühle der Moscheen? Der militärisch aufrechten Haltung der britischen Kirchen? Oder mit den Geiern, die um die Türme des Schweigens kreisen, wo die Parsen ihre Toten aufbahren – wenig entfernt nur von der pulsenden, grellbunten Ader des Handels am Hafen in Mumbay?
Womit beginnt eine Geschichte über Indien? Mit dem Regen? Der Hitze? Dem Tod? Den heiligen weißen Kühen?
Beginnt sie mit den Frauen, die in den Straßen von Madras die weißen Jasminblüten zu Girlanden winden? Beginnt sie mit den Männern, die an der äußersten Spitze Indiens in Rameshvaram den glitzernden Fang aus ihren Netzen befreien?
Mit den Kindern, die im Dreck von Kalkutta spielen, oder den heiligen Sadhus, die in Varanasi die staubigen Strahlen der Morgensonne grüßen, den Blick nach innen und die mageren Hände nach außen gekehrt?
Oder beginnt sie ganz anders? Plötzlich, abrupt, ohne Vorwarnung.
Wie das Leben, das so wenig wert ist in Indien. Mit einem Sprung mitten hinein ins Chaos.
Ja, so soll sie beginnen.
Safia und Raka
Der indische Wind hoch in der Luft
ist träge und hat einen Bauch,
er trägt des goldnen Currys Duft
und schweren heiligen Rauch.
Der indische Wind hoch über dem Land
ist lange schon trächtig und prall,
er trägt das Schwarz von Kohlenbrand
und gelber Sonne Ball.
Der indische Wind in indischen Gassen
treibt alte Geschichten vor sich her
von Leben und Tod, von Lieben und Hassen,
und läufst du dem indischen Wind hinterher,
um ihm zu lauschen, dann sag ich dir ehrlich:
Die Märchen des indischen Winds sind gefährlich.
Natürlich ist es eine vollkommen abwegige Geschichte.
Alle Geschichten in Indien sind abwegig, wobei nur wenige vollkommen sind.
Wie das Leben, beginnt und endet diese Geschichte mit einer Reise.
Einer Reise durch die Wüste.
Auf die Reise, mit der sie beginnt, machte sich der Händler Ahmed Mudhi zusammen mit seinen Männern an einem heißen Junitag Anfang des 19. Jahrhunderts. Ahmed Mudhi war ein wohlhabender Mann, der sich gerne mit dem Titel Raja anreden ließ und über viele schöne Pferde und eine nicht ganz so große Zahl schöner Frauen verfügte. Zwar glänzten die Haare der Frauen schwarz wie die Nacht, ihre Augen strahlten wie Sterne, und die heimliche Musik ihrer silbernen Fußkettchen erfreute Ahmed Mudhis Ohren. Doch noch mehr erfreute ihn das Schnauben seiner Rappen in den Ställen. Bis er auf jener Reise durch die Wüste die schönste Frau fand, die er je gesehen hatte. Er fand sie in einem kleinen Dorf mitten im Nichts durch einen Zufall, unter einer Dattelpalme, wo sie im Schatten saß und träumte. Als sie seinen Blick bemerkte, schlug sie die ungewöhnlich hellen Augen nieder, was Ahmed Mudhi für ein Zeichen von Bescheidenheit hielt – und in diesem Moment hätte er alle seine Pferde gegen sie eingetauscht.
Der Preis fiel in den folgenden Verhandlungen jedoch weitaus geringer aus, denn der Vater des Mädchens war arm und froh, dass nicht er selbst es sein würde, der – wie es eigentlich der Sitte entsprach – die Mitgift für seine Tochter zu zahlen hatte.
Das Mädchen hieß Safia, was Tugend bedeutet, und das schien dem Raja auch der richtige Name für sie. Sie erwiderte seinen Blick kein einziges Mal, doch Ahmed Mudhis Blut geriet in Wallung, und er wusste, dass er sich verliebt hatte.
Nicht so verliebt, wie es die romantischen Lieder der Frauen in der Wüste besangen, er hatte sich so verliebt, wie man sich in einen schönen Ring verliebt, wie in ein Paar fein gearbeitete Schuhe, eine silberne Kette, eine bestickte Kameltasche. In etwas, das man besitzen muss – koste es, was es wolle.
Ahmed Mudhi heiratete das Mädchen noch am gleichen Abend.
Obwohl er gläubiger Muslim war, unterwarf er sich den Sitten der Familie seiner Schönen und nahm an einer weitgehend hinduistischen Zeremonie teil. Keine der Frauen in seinem Harem war eine Hindu – bisher. Doch schon in alten Zeiten, als die Moslems in Wellen über das Land der Wüste geschwappt waren, um es nach und nach zu erobern, hatten muslimische Fürsten hinduistische Prinzessinnen geheiratet.
Es gab also keinen Hinderungsgrund.
Die Familie des Mädchens gehörte einer hohen Kaste an.
Das änderte nichts daran, dass sie bettelarm war. Es machte die Sache vermutlich nur noch schlimmer, denn es war beinahe unmöglich, einen Bräutigam für irgendeine der Töchter zu finden, der ihr in der Kaste ebenbürtig und gleichzeitig bereit war, auf die Mitgift zu verzichten.
Ahmed Mudhis Antrag kam für Safias Familie als ein Wink der Götter, und wenn schon nicht ein Wink der Götter, so doch ein Wink größerer finanzieller Zusammenhänge.
Safia spürte das kühle Silber des Hochzeitsschmucks auf ihrer Stirn, sah den Raja an und wusste, warum die Dinge geschahen. Sie hatte schon viele Geschichten gehört – zu viele. Der Raja würde sie mitnehmen, fort von ihren Träumen, der Dattelpalme und von ihrer Heimat, denn von diesem Tag an gehörte sie ihm. Der geliehene Schmuck lastete schwer auf ihrem Kopf und ihren Schultern – so schwer, als wollte er sie in die Tiefen des Sandes hinabdrücken, hinunter bis zum Mittelpunkt der Erde, um sie dort im Dunkeln zu ersticken.
Sie sagte nichts.
Ahmed Mudhi bekam nicht sofort, was er wollte.
Noch in derselben Nacht riefen dringende Geschäfte ihn in die Stadt, und er ließ den Großteil seiner Männer zurück, um ihm sein frisch erworbenes Schmuckstück auf langsameren und sichereren Wegen durch die Weiten der Wüste nachzutragen.
Er selbst gab seinem Pferd die Sporen und freute sich darauf, bald unter weniger staubigen Umständen endgültig mit seiner jungen Braut vereint zu werden.
Safias Mutter und ihre acht kleineren Geschwister standen schüchtern aufgereiht vor den Resten des Festes – den fortgeworfenen Palmwedeln und den welkenden Blütengirlanden –und sahen zu ihr auf, als sie auf das Pferd des Rajas stieg, auf dem sie durch die Wüste reiten sollte.
Ihr Vater legte die Hände vor der Brust zusammen und murmelte einen Abschiedssegen. Er vergoss keine Tränen. Die dünne Haut um seine Augen herum war so faltig und ausgetrocknet wie der Wüstensand, der sein Leben bestimmte.
Er hatte nur zweimal in seinem Leben geweint: Einmal bei seiner Geburt und einmal, als sein bestes Kamel gestorben war.
Es war lange her, seit er Kamele besessen hatte. Der unvorhersehbare Weg des Lebens hatte seinen gesamten Besitz aufgeleckt.
Als er seine älteste Tochter davonreiten sah, fiel einer der vielen Steine von seinem Herzen. Er liebte seine Tochter nicht, aber er war ein verantwortungsvoller Mann. Im kühlen Schatten im Garten des Rajas würde ihr widerspenstiges Herz sich endlich formen lassen. Und die Götter würden ihm verzeihen, dass er sie einem Moslem gegeben hatte.
Er ahnte nichts von dem Todesurteil, das er über seine Tochter ausgesprochen hatte.
Denn kein Inder wird gerne betrogen. Und dass Raja Ahmed Mudhi im Besonderen nicht gerne betrogen wurde, hatte sich bis weit über die Grenzen seiner Stadt herumgesprochen.
Raja Ahmed Mudhi hatte eine Jungfrau erhandelt. Und nur Safia selbst wusste, dass er betrogen worden war.
Dreimal versuchte sie auf der Reise zu entwischen.
Doch die Männer, die sie geleiteten, achteten gut darauf, das Kleinod ihres Rajas nicht zu verlieren. Sie hatten geglaubt, seinen Erwerb gegen die Banditen der Wüste verteidigen zu müssen, nicht gegen den eisernen Willen des Erwerbs selbst.
Anfangs machten sie sich lustig über Safia. Dann begannen sie zu murren, denn Safia war schlau, und einmal wäre es ihr beinahe gelungen zu fliehen.
Schließlich setzten sie sie zu dem Stärksten von ihnen aufs Pferd.
„Jetzt hat es ein Ende mit diesen sinnlosen Fluchtversuchen“, sagten die Männer, und das hatte es. Safia spürte den Schweiß des bulligen, kleinen Mannes an ihrem Rücken und roch seine Gier, und sie hasste ihn. Sieben Tage lang hasste sie ihn, obwohl sie wusste, dass das ungerecht war.
Er war nichts als ein Diener: Sein Geist diente dem Raja, und sein Körper diente der Natur.
Er rührte sie nicht an und lieferte sie am dreizehnten Tag ihrer Reise am Haveli, dem Prachthaus des Rajas, ab. Hinter ihm summte das geschäftige Leben der Stadt Jaisalmer, als er sich in der Tür noch einmal verbeugte und sie dann schloss.
Safia stand allein im Innenhof, in dessen Mitte ein Brunnen kühle Fantasien in ein Marmorbecken plätscherte.
Im Schatten der Bougainvilleen – jener Pflanzen, die in aufdringlichem Zyklam über die Mauer schäumten – sang ein gelber Kanarienvogel in einem Käfig aus dünnen Holzstäben.
Eine Dattelpalme erhob ihren schlanken Stamm in der Mitte des Gartens, der nur einer von vielen war. Safia atmete die Stille ein und ließ ihre Augen wandern. Ihr Herz wollte sich niederlegen und ausruhen, wollte sich dort in den grünen Schatten der Mangobäume betten und dem Glitzern des Sonnenlichtes im Brunnen lauschen. Aber sie riss ihr Herz an der Kette: Sie musste wachsam bleiben.
Noch heute, sagte sie sich. Noch diese eine Chance.
Danach würde sie sich ihrem Schicksal fügen, wie die silbernen Fäden sich in die verschlungenen Muster fügten, mit denen die Frauen der Wüste Seidenstoffe bestickten.
Sie wünschte sich mit all ihrer Kraft, dass es gelänge. Die Mauer war nicht sehr hoch. Oh, wie sie wünschte, kein fügsamer seidener Faden zu werden!
In der ersten Nacht, in der der Raja sie zu sich rief, wäre alles vorüber. Und der Faden, ihr silberner Lebensfaden, würde reißen. Sie wusste es.
In der Wüste laufen die Gerüchte schneller über den heißen Sand als der Wind.
Die Vögel in den Oasen sangen seit langem von Ahmed Mudhis ungezügeltem Temperament, und die Spiegel auf den Kameltaschen zeigten nachts die Gesichter zweier Frauen, die er in einem Wutanfall vor einigen Jahren erwürgt hatte.
Safia hatte die Skorpione in der Wüste mit ihren emporgereckten Hinterleibern ein Lied vom Jähzorn des Rajas sirren hören – und selbst die Tauben in ihren Verschlägen in diesem kühlen Hof gurrten Verse über seine Eifersucht.
Safia zitterte, wenn sie daran dachte.
Als sie die kühle Hand auf ihrer Schulter spürte, zuckte sie zusammen.
„Komm“, sagte die Stimme, die zu der Hand gehörte. Eine angenehme, sanfte Stimme. Zuerst dachte sie, es wäre die Stimme einer Frau. Dann wandte sie sich um und blickte in das Gesicht eines jungen Mannes. Ein weiches, beinahe kindliches Gesicht.
„Komm“, wiederholte er leise. „Sie haben mich geschickt, um dir deine Gemächer zu zeigen. Der Raja wird dich heute Nacht nicht empfangen. Es geht ihm nicht gut.“
„Das will man auch hoffen“, flüsterte Savidh, doch sie flüsterte es so leise, dass der Junge es nicht hören konnte, und er hörte auch die Erleichterung nicht, die in ihrem Herzen schlug.
Sie folgte ihm ins Dunkel des Hauses und bewegte das Wort „Gemächer“ in ihrem Kopf hin und her. Es fühlte sich kalt, glatt und sauber an – wie eine Glasmurmel. Noch nie hatte sie einen eigenen Raum besessen, um darin zu schlafen.
„Mein Name ist Lagan“, sagte der Junge. „Wann immer du etwas brauchst, genügt es, nach Lagan zu rufen.“
„Lagan“, murmelte sie. „Die rechte Zeit. Ein seltsamer Name.“
Der Junge hob die Schultern. „Sie nennen mich ohnehin anders. Sie nennen jeden anders, als er wirklich heißt. Die Frauen im Harem haben scharfe Zungen.“
Safia sah ihn an. „Wie nennen sie dich?“
„Lalit“, antwortete er leise und lächelte. „Der Schöne. Sie nehmen mich nicht ernst.“
Sie musterte ihn. Er war wirklich schön. Schön wie eine der steinernen Figuren, die den Innenhof zierten. Sein Gesicht war so ebenmäßig wie nichts sagend. Vermutlich war es schwer, ihn ernst zu nehmen. Er wirkte so kindlich. Und auch er, dachte sie, war ein Diener. Es gab nichts in seinem schönen Gesicht, das ihm selbst gehörte.
Sie ließ ihre Hand am Treppengeländer entlangstreifen, während sie ihm die Stufen hinauffolgte und wusste, dass sie den heißen, körnigen Wüstensand vermissen würde.
Und so begann ihr kurzes Leben im Harem.
Der Raja empfing sie des Längeren nicht.
Kaum, dass die dringenden Geschäfte hinter den Mauern von Jaisalmer erledigt waren, hatte ein Fieber ihn gepackt und auf sein reich besticktes Bett geworfen.
Und da lag er nun und glühte und träumte alb und ärgerte sich, dass er das Schmuckstück, welches er von seiner Reise mitgebracht hatte, noch immer nicht berühren konnte.
In den besseren Momenten ließ er sich in eine Unzahl weicher Decken wickeln, saß in dem kleinen Erker seines Schlafgemachs und sah durch das Fenster hinaus in einen der Höfe, wo das schöne Mädchen aus der Wüste bisweilen am Brunnenrand träumte: Genauso, dachte er, wie sie unter der Dattelpalme in jener Oase geträumt hatte, wo er ihr zuerst begegnet war.
Und er verzehrte sich nach ihr, er fieberte im allerwahrsten Sinne nach ihrer kühlen Nähe. Doch sein Körper verwehrte ihm die Zusammenarbeit, und Ahmed Mudhi musste sich in Geduld üben, bis das Fieber abgeklungen war.
Lalit stand seit zwei Jahren im Dienste des Rajas.
Er war sehr gehorsam und überbrachte seiner Familie jeden Monat das Geld, das er dort verdiente.
Ahmed Mudhi besaß zwei Haupt- und fünf Nebenfrauen. Sie verwandelten die kühlen Innenhöfe des Harems in eine Landschaft aus blitzendem Schmuck und flirrender Seide, und nach und nach hatten sie ihm eine unübersichtliche Anzahl von Kindern geschenkt. Die Kinder wuchsen und gediehen in den Höfen wie die duftenden Jasminsträucher, und an manchen Tagen besuchte Ahmed Mudhi sie, um mit ihnen im flirrenden Licht unter den Schatten spendenden Blättern seiner Mangobäume zu spielen.
Abgesehen von Ahmed Mudhi selbst kümmerte sich eine kleine Heerschar von Schneidern, Köchen, Wächtern und Dienerinnen um die Frauen – und da er etwas auf sich hielt, hatte der Raja im vorletzten Monsun auch einen jungen Eunuchen angestellt, der mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut war, sich um die Tauben und den Staub in den Innenräumen zu kümmern: Lalit mit dem schönen, weiblichen Gesicht. Er teilte seine Aufmerksamkeit gerecht zwischen den Tauben und dem Staub auf, und er arbeitete sehr gewissenhaft und still.
Da die Frauen ihn mochten, beauftragten sie ihn gegen ein angemessenes Entgelt mit einer Menge kleiner Botengänge – und die eine oder andere ließ ihm auch ein noch etwas angemesseneres Entgelt zukommen, wenn er seine Tauben in ihren Diensten ein geheimes Briefchen an einen nicht ganz offiziellen Liebhaber in der Stadt überbringen ließ.
Als er die neue, die achte Frau des Rajas sah, war auch Lalit beeindruckt von ihrer Schönheit. Es ist ein Gerücht, dass Eunuchen keinen Blick für schöne Frauen haben. Und Safias Schönheit strahlte heller als alles, was er bisher gesehen hatte.
Aber sie war auch seltsam. Sie machte ihm Angst.
Er hatte die anderen Diener über sie reden hören: Sie sagten, sie wäre eine Verrückte.
Sie war anders als alle Frauen, die Lalit kannte. Sie schlug ihre Augen nieder wie eine, die schüchtern ist, doch als er den Blick dieser Augen zum ersten Mal einfing, erschrak er. Da war ein Glühen in ihnen und ein Zischen wie von Wassertropfen, die im Feuer zerstoben. Ihre Augen waren grün wie Türkise. Noch nie hatte er eine mit türkisfarbenen Augen gesehen.
Sie musterte die Umgebung mit diesen Augen wie ein kleines Tier. Ihr Blick sprang unter der Tarnung ihrer gesenkten Lider und ihrer langen Wimpern hin und her, rastlos, gehetzt, scharf. Sie nimmt alles in sich auf, dachte er. Die Kübel mit den Palmen im Hof. Die Formen der Schatten auf dem glatten Steinboden. Jede Tür, jedes Fenster.
Sie plant ihre Flucht, dachte er. Er sollte Recht behalten. Es vergingen zwei Wochen, bis sie es eines Nachts versuchte. Doch sie kam nicht weit. Ihre Hände waren zerkratzt von den Dornen der Ranken, als die Wächter sie zurückbrachten, und die weißen Zähne in ihrem schönen Mund blitzten kampfeslustig. Ihre grünen Augen aber glänzten, als stünden Tränen darin. Lalit stand am Fenster seiner kleinen Kammer und sah es, obwohl es Nacht war.
Sie hatte versucht, über die Mauer im Garten zu klettern.
Beinahe wäre es ihr gelungen. Doch von nun an würden sie sie strenger bewachen: Es würde keine zweite Chance geben.
Die Nacht ihres einzigen Fluchtversuches aus dem Hause des Rajas war jene, in der sie das erste Mal länger mit ihm sprach. Und es war die Nacht, in der sein Leben begann, sich zu ändern.
Lalit hatte lange wach gelegen und keinen Schlaf gefunden, wobei sich ja zumeist das eine aus dem anderen ergibt. Schließlich war er aufgestanden und durch die stillen Höfe geschlichen, hatte die schlafenden Tauben im Traum gurren hören und an die misslungene Flucht der achten Frau des Rajas gedacht.
Er konnte nicht anders, als vor sich selbst zuzugeben, dass er neugierig war. Warum hatte die Schöne versucht, über die Mauer zu klettern?
Schließlich nahm er all seinen Mut zusammen, verließ seine träumenden Tauben und stieg die Treppen zu ihrem Zimmer hinauf.
Er klopfte ganz leise an ihre Tür.
„Komm herein“, sagte sie.
Und da saß sie, im Schneidersitz auf einem bestickten Kissen im Fenster, ganz still und ganz gerade, und sah hinaus. Sie drehte sich nicht nach ihm um.
„Ich sah, dass seit langem eine Öllampe in deinem Fenster brennt“, sagte er und wurde rot. „Und ich dachte … ich wollte fragen … ob du etwas brauchst?“
Sie nickte. „Ich brauche eine ganze Menge“, entgegnete sie, „aber nichts, was du mir bringen könntest.“
„Wer weiß?“, sagte er ernst. „Was, beispielsweise?“
Sie lachte. Nun drehte sie sich doch um.
„Den Wind in der Wüste“, erwiderte sie. „Den Geruch des offenen Feuers. Die Spur der Sterne am Himmel. Kannst du mir eines dieser Dinge bringen?“
Lalit versuchte, eine schlagfertige Antwort zu finden, doch ihm fiel auf die Schnelle keine ein. So trat er unbehaglich nur von einem Bein aufs andere und hielt sich mit dem Blick an dem kleinen Tisch in der Ecke fest.
Sie hatte eine Art Altar darauf aufgebaut. Er erinnerte sich, dass die anderen Frauen gesagt hatten, sie wäre eine Hindu, keine Muslimin, und ließ seine Augen über die winzigen, bunt angemalten Götterfiguren gleiten, die dort nebeneinander standen.
Da waren sie alle: Shiva mit der Mondsichel im Haar, seine Gattin Parvati, Brahma mit den vier Gesichtern und seine weise Angetraute Sarasvati. Ganesha, der freundliche Gott mit dem Elefantenkopf, Kali, die Göttin der Wut, Hanuman, der Affengott, Lakshmi, die Göttin des Wohlstandes in ihrer Lotusblüte – und zuletzt Krishna, der Flötenspieler.
Sie war wohl den Spuren seines Blickes gefolgt, denn sie sah ihn an und sagte: „Auch du bist Hindu, nicht wahr?“
Er nickte.
„Ich vermisse die Geschichten hier“, sagte sie. „Die Geschichten über die Götter. Hier gibt es niemanden, der sie erzählen könnte. Das Ramayana, das Mahabharata … und all die kleinen, verworrenen Erzählungen über diese große, unübersichtliche Familie.“
Sie nickte den Götterfiguren zu, und es kam ihm merkwürdig vor, dass sie so über sie sprach. Er war sich nicht sicher, ob man so über die Götter sprechen durfte und was sie sagen würden, wenn sie es hörten.
„Geschichten“, fuhr sie fort, „sind ausgezeichnete Fluchtwege.“
Sie schwieg eine Weile, und er trat vorsichtig einen Schritt näher, um sich ihre Götterversammlung genauer anzusehen. Die kleinen Figuren wirkten abgenutzt – als hätte jemand sie viele, viele Male in der Hand gehabt, um ihren Rat zu erbitten. An einigen Stellen war die grelle Bemalung abgeplatzt, und das einfache, billige Holz kam zum Vorschein.
Geschichten sind ausgezeichnete Fluchtwege.
Der Satz stand noch immer im Raum, hing zwischen den Götterfiguren wie eine schwere, dunstige Wolke.
„Wovor willst du fliehen?“, fragte er.
„Vor dem Tod“, sagte sie ernst und sah wieder aus dem Fenster, wo die steinernen Mauern Ahmed Mudhis die Weite der Nacht zu einem Viereck zusammenschnürten.
„Vor dem Tod“, entgegnete Lalit, „kann man nicht fliehen. Man muss ihn annehmen, wenn er kommt.“
„Es ist eine Frage des Zeitpunkts.“
„Jedenfalls“, sagte er schnell, „ist es nicht an uns, den Zeitpunkt zu bestimmen.“
„Vielleicht nicht“, antwortete sie. „Aber es scheint an Ahmed Mudhi zu sein, das zu tun.“
Lalit sah sie fragend an, und obgleich sie nach wie vor in die Dunkelheit hinaussah, spürte sie seine Frage offenbar in der stickigen Luft.
Es war warm in dieser Nacht. Der Wind war ausgefallen, und die Verantwortlichen schienen ihn nicht wieder zum Laufen zu bekommen.
„Ich werde sterben“, sagte sie fest. „Wenn er mich zu sich ruft, wird er mich töten. Er hat eine Jungfrau erhandelt, und er ist betrogen worden. Man weiß, was er mit solchen Frauen tut.“
Sie sah ihn an, und ihre türkisfarbenen Augen flackerten. „In Indien“, sagte sie, „gibt es zu viele Namen mit zu vielen Bedeutungen. Die meisten sind falsch. Mich nennen sie Safia, die Tugend. Aber ich bin Shamim, das Feuer. Sie wollen, dass ich Satya bin, die Wahrheit, Sadhana, die Verehrung, Sarala, die Ehrliche. Doch ich bin Sandhya, die Dämmerung, Sanvali, das Zwielicht, Sharvati, die Nacht.
Ich bin Shampa, der Blitz, Shalmali, die auf dem Seidenbaum lebt, und Shakuntala, die von den Vögeln aufgezogen wurde. Wenn ich von mir selber spreche, bin ich Raka. Der volle Mond. Das ist es, was ich in der Wüste war, wenn sie mich alleine ließen. Falls du mich rufst, rufe mich so.“
Lalit schwieg. Er spürte ihre türkisfarbenen Augen noch immer auf sich ruhen und hatte das Gefühl, sie erwartete, dass er etwas sagte. Aber er schwieg.
Es gab nichts, das er hätte sagen können.
„Vielleicht brauche ich doch etwas“, sagte sie nach einer Weile. „Eine Geschichte ist nur dann eine gute Geschichte, wenn sie einen guten Zuhörer hat.“
Raka strich über Gott Ganeshas Elefantenrüssel und lächelte wieder. „Wenn du versprichst, mir zuzuhören, werde ich erzählen. Ein Stück weit. Jede Nacht. Wirst du zuhören?“
Lalit zögerte. Was würde geschehen, wenn man ihn hier entdeckte? War es erlaubt, des Nachts bei einer von Ahmed Mudhis Frauen zu sitzen, um ihr zuzuhören?
Es war nicht verboten. Das Zwielicht zwischen beiden jagte ihm einen bisher unbekannten Schauer über den Rücken. Und er hatte noch immer Angst vor ihren Augen. Doch gleichzeitig faszinierte sie ihn.
Sie stand auf, und Lalit bewunderte wieder die Anmut ihrer Gestalt. Es war nicht weiter verwunderlich, dass Ahmed Mudhi sie besitzen wollte. Doch das, was Lalit in ihren Augen sah, passte so gar nicht zu Rakas lieblichem Äußeren. Ahmed Mudhi, überlegte Lalit, konnte ihre Augen nicht gesehen haben. Sonst hätte er es nicht gewagt, sie zu heiraten.
Sie nahm in einer Ecke des breiten Fensterbretts Platz, schlug die Beine unter und wies Lalit an, sich ihr gegenüberzusetzen.
„Es kann nicht schaden“, sagte sie, „die Nacht im Auge zu behalten.“
Lalit setzte sich und achtete darauf, sie nicht zu berühren.
Ihm fiel auf, dass er ihre Frage nicht beantwortet hatte.
Nicht mit Worten.
Aber die Tatsache, dass er genau jetzt hier saß, versprach der achten Frau des Rajas: Er, Lalit, würde zuhören. So lange und so oft sie wollte. In jeder Nacht, in der noch Zeit dafür war. Die Tauben kratzten seine Antwort mit ihren träumenden Krallen ins Holz ihrer Verschläge, die Zikaden summten sie in die Nacht, und die Blätter des Mangobaums unter dem Fenster raschelten sie in grüner Dunkelheit.
Und Savidh – oder Raka – wusste derlei Antworten zu deuten: so, wie sie die Botschaft der Skorpione in der Wüste gedeutet hatte, die ihren Tod ankündigten. Sie schlug die Augen nieder, um ihren geduldigen Zuhörer nicht mit dem Feuer darin zu versengen, und begann.
Durch den Wind
Der Blutstein
Ich brauche dir nicht zu erzählen, dass es in Indien üblich ist, mehrfach zu leben.
Unsere Welt ähnelt einem großen bunten Spielbrett: Man steigt und fällt auf der Skala, je nachdem, wie viele Punkte man in der letzten Runde gesammelt hat.
Punkte für Tapferkeit, Punkte für Treue, Punkte für Ehrlichkeit.
In manchen Spielrunden kommt man als Ratte zur Welt, in manchen als weiser Mann.
Auch die Götter werden mehrfach geboren.
Vishnu beispielsweise erschien sieben Mal auf der Erde und verwirrenderweise jedes Mal unter einem anderen Namen.
Zur Zeit dieser Geschichte hieß er Krishna und war der Gott der Liebe. Mit der Musik seiner Querflöte betörte er die Kuhhirtinnen auf den kargen Weiden am Rande der Wüste. Es war eine großartige Zeit, voll vom Duft des weißen Jasmins und dem Geruch der Nacht. Die steinernen Figuren in den Tempeln erzählen eine Menge davon.
Doch eines verschweigt der behauene Stein: Eines Tages nämlich zeugte Krishna in einem Palmenhain südlich von Nirgendwo eine Tochter.
Danach verschwand der schöne Flötenspieler, und seine Tochter wuchs als gewöhnliches kleines Mädchen bei einer Familie auf, in einem Dorf aus Lehmhäusern und Staub, wo der sandige Wind ihr Schlaflieder sang. Und doch wusste sie tief in ihrem Herzen, dass sie eine Prinzessin war.
Eines Tages spielte sie am Rand eines Reisfeldes und fütterte die Vögel, als der Dämonenkönig Ravana sie aus einer Hecke heraus beobachtete.
Bei ihm war sein erster Diener Suryakanta, dessen Name Edelstein bedeutet.
Die Anwesenheit der Dämonen machte die Vögel nervös, sodass einer von ihnen nach der Prinzessin hackte. Sie zog mit einem Aufschrei ihre Hand fort, während ein einziger, dicker Tropfen Blut an ihrem Zeigefinger erschien.
Bei der plötzlichen Bewegung wandte sich die Prinzessin der Hecke zu, in der Ravana und sein Diener sich versteckt hielten. Und kaum hatte Ravana ihr wunderschönes Antlitz erblickt, da war er verloren: Er verliebte sich sofort in die kindliche Prinzessin.
Das Blut an ihrem Finger floss zur Erde. Doch ehe er dort ankommen konnte, verwandelte sich der Tropfen in einen taubeneigroßen roten Edelstein, der intensiv zu leuchten begann.
Und so hatte sich Suryakanta, Ravanas gieriger Diener, ebenfalls verliebt – er war sofort in Liebe zu dem Edelstein entbrannt.
Der Stein aber versank in den grünen Fluten des Reisfeldes, an dessen Rand die kindliche Prinzessin gespielt hatte. Suryakanta verbiss sich einen Fluch. Im Wasser zwischen den Halmen wurde der Juwel lange Zeit nicht wiedergefunden, bis ihn schließlich ein Bauer entdeckte, der ihn gegen eine weiße Kuh an einen Freund eintauschte, welcher ihn wiederum einem reisenden Franzosen verkaufte, der ihn später in Paris an einen Briten verlor … doch dies ist eine andere Geschichte – zu sagen bleibt nur so viel: Der Stein verschwand für eine geraume Weile und tauchte erst sehr viel später wieder in Indien auf – ungefähr zu der Zeit, zu der auch alles andere sich zutrug.
Die Jahre gingen ins Land, und Krishnas Tochter wuchs zu einer jungen Frau heran. Ihre ehedem bereits beträchtliche Schönheit vermehrte sich immer weiter, bis sie so hell erstrahlte wie die Sonne am Himmel, und der Dämonenkönig Ravana sann lange darüber nach, wie es ihm gelingen könnte, sie an sich zu reißen.
Denn obgleich sie das Leben eines gewöhnlichen Menschen lebte, hatte ihr Vater Krishna doch im Geheimen ein Auge auf die Prinzessin.
Schließlich, in einem unbeobachteten Augenblick, da sie unter einer Dattelpalme eingeschlafen war und von Ländern fern des Südens von Nirgendwo träumte, gelang Ravanas Plan: Sein Diener Suryakanta entführte die junge Frau mithilfe dreier weißer Elefanten, und Ravana nahm die junge Prinzessin überglücklich in Empfang.
Er gab sich zu dieser Zeit meistens als Mensch aus und genoss dadurch eine Menge Annehmlichkeiten, die Dämonen verwehrt sind – feine Kleider, den Duft von Mandelöl im Badewasser, weiche Teppiche unter den bloßen Füßen und eine Menge Ansehen. Wenn er nicht gerade Prinzessinnen auflauerte, war er ein reicher Händler und verbarg die Geheimnisse seiner Person hinter den sicheren Mauern einer befestigten Wüstenstadt.
Wie für jeden Mann in Indien üblich, befragte Ravana daher einen Gott nach dem günstigsten Datum für seine Heirat mit Krishnas Tochter. Krishna konnte er nicht fragen, der vielgesichtige Brahma war gerade anderswo beschäftigt, und so wählte er Lord Shiva. Dieser nannte ihm ein Datum, das weit genug weg lag, um Krishna eine Chance zur Befreiung seiner Tochter zu geben.
Es war der Tag nach dem vollen Mond, an dem die Entführung stattgefunden hatte. Und Shiva prophezeite dem Dämonenkönig, dass der nächste volle Mond der einzige glückgesegnete Tag für seine Hochzeit wäre.
So musste der Dämonenkönig Ravana einen ganzen Monat lang warten, bis er seine schöne Gefangene zur Frau nehmen konnte, um sie für immer mit sich und dem Dämonenreich zu vereinen.
Und in einem Monat, das wusste Shiva – und das wusste auch die Prinzessin –, konnte einiges geschehen.
Nun hätte man einfach einen jener schönen Kriege beginnen können, die in den großen Tagen des Hinduismus üblich waren und in denen ein Heer von Göttern und Helden gegen ein Heer von Dämonen antritt.
Krishna selbst hatte einst als Berater und Wagenlenker in einem solchen Heer gekämpft.
Doch es gab ein Problem: die Briten.
Die Briten hatten zu jener Zeit bereits die Kolonialherrschaft über Indien an sich gerissen und eine neue Zeit mit sich gebracht.
Und sie hatten etwas gebracht, das sie „den Fortschritt“ nannten. Es bedeutete, dass das Land von seinen Wurzeln fort schritt, um einer ungewissen Zukunft entgegenzublicken. Wer modern war, versuchte, sich so zu benehmen wie die Engländer. Und die Engländer lebten ein geometrisches und gut berechnetes Leben voller wichtiger Uhrzeiten.
Die Leute hatten ihren Glauben an Wunder und Märchen verloren. Die hinduistischen Götter waren klein geworden. Auch wenn sie es nicht gerne hörten.
Doch an wen nicht geglaubt wird, der kann nicht einfach so auf der Erde erscheinen.
Lange zog Krishna mit seiner Hirtenflöte durch die grünen Auen südlich von Nirgendwo und grübelte. Seine Tochter lebte als Mensch auf der Erde, und auch Ravana gab sich zu jener Zeit als Mensch aus. Und schließlich musste Krishna einsehen, dass es nur eine Lösung gab: Er brauchte einen menschlichen Helden.
Einen Helden, der schlau genug war, den Dämonenkönig zu überlisten, stark genug, ihm im Kampf gegenüberzutreten, und edel genug, um die Prinzessin unbeschadet an Körper und Moral zu retten.
Doch mit dem Glauben an Märchen und Wunder waren in Indien auch die Helden selten geworden.
Krishna ließ vom besten Silberschmied in Madurai eine feingliederige Kette mit einem kleinen Amulett anfertigen, in das er ein Bild seiner Tochter legte (eine jener modernen, bräunlich-weißen Fotografien).
Mit diesem Schmuckstück schlich er sich des Nachts in einen heiligen Hain und legte es in den Schoß einer Lotusblüte, die dort in einem Teich wuchs. Das Schmuckstück fing das Licht von Raka, dem vollen Mond, ein und schien sich ganz damit voll zu saugen – und fortan erstrahlte es in einem sanften, milden Glanz.
Krishnas Plan war einfach und logisch: Der erste Mann, der den heiligen Hain zur Andacht besuchen würde und dessen Auge fein genug wäre für die Details der heiligen Natur, würde das Amulett finden. Dieser Mann sollte sein Held werden.
Und sobald der Held die Hand um das Schmuckstück schloss, würde Krishna ihm erscheinen, um ihn von seiner Aufgabe zu unterrichten.
Der heilige Hain gehörte zu den uralten, gesegneten Stätten Indiens – und so war Krishna mehr als verärgert, als er am nächsten Morgen bei Tageslicht feststellen musste, dass genau dieser heilige Hain inzwischen im weitläufigen Garten einer englischen Kolonialvilla lag. Zur Linken des Teichs verlief der Zaun, der das Grundstück von einem Reisfeld trennte.
Krishna knirschte mit den Zähnen, setzte sich aber geduldig hin und wartete auf seinen Helden.
Er kam gegen Mittag.
Die Sonne brannte glühend auf die Felder hinab, und Krishna wunderte sich, dass der Mann gerade zu dieser tödlichen Zeit unterwegs war, zu der sich eigentlich jeder vernünftige Mensch im Schatten verkroch. Doch der Mann hatte durchaus seinen Grund gehabt, die nahe Stadt Madurai zu verlassen und auf die ungeschützten Felder hinauszuwandern.
Es war ihm nur recht, dass er niemandem begegnete.
Er hieß Farhad Kamal, zählte ungefähr 16 Jahre (genau wusste er es nicht zu sagen) und ging dem ehrenwerten Beruf eines Diebes und Betrügers nach.
Farhad bedeutet Glückseligkeit und Kamal die Lotusblüte, und bis zu diesem Zeitpunkt in Farhad Kamals Leben hatte sich ihm nicht erschlossen, was jenes Leben mit dem einen oder dem anderen zu tun hatte. Er war auf den Straßen der Tempelstadt Madurai aufgewachsen und sich nicht einmal sicher, welcher Kaste er angehörte, denn er hatte keine Ahnung, wer seine Eltern waren. An seine Geburt erinnerte er sich nur verschwommen, und die Zeit unmittelbar danach entzog sich bei näherer Betrachtung ebenfalls seinem Gedächtnis. So konnte Farhad auch nur schätzen, in welcher Umgebung er gezeugt worden war, und er schätzte, dass sie nicht zu den feinsten gezählt hatte.
Seit er denken konnte, hatte er sich mehr oder weniger alleine durchs Leben geschlagen und genügend blaue Flecken davongetragen. Er konnte weder lesen noch schreiben, nur die Zahlen auf den Geldscheinen, welche er den Leuten aus der Tasche schwindelte, beherrschte er perfekt.
Bisweilen besuchte er den einen oder anderen großen Tempel, um zu den Göttern zu beten, wobei der Zufall es meist wollte, dass er mit einer Hand voll Münzen wieder herauskam, die einem der Opferteller fehlten. Er hätte auch die neue Kirche der Engländer besucht, doch deren Opferstöcke waren fest verschlossen, und so hatte er beschlossen, nicht zum Christentum überzutreten. Die Muslime waren schlau und hatten ihn gleich fortgejagt. So war Farhad in gewisser Weise aus wirtschaftlicher Überzeugung Hindu geblieben und schlug sich mehr oder weniger gut durchs Leben.
Wenn man Farhad Kamal hätte genau beschreiben wollen, hätte man sich schwer getan. Er achtete darauf, sich oft genug zu verändern, dass niemand ihn genau beschreiben konnte.
Farhad war ein Meister der Verwandlung. Mal hatte er dunkle Haut und mal einen Teint, beinahe so hell wie der der Briten. Mal besaß er eine lange, wilde Mähne wie ein Asket, mal geöltes, kurzes Haar, mal einen kahlen Schädel wie ein Bettelmönch und ein glatt rasiertes Gesicht – und schon am nächsten Tag zierte ihn ein undurchdringliches Bartgestrüpp. Mal hatte er einen notdürftig bandagierten Klumpfuß, mal fehlten ihm scheinbar ein paar Zähne, und mal hatte er ein paar zu viel. Eine Zeit lang war er als Lahmer auf einem Rollbrett durch den Basar geschlittert, was zu den anstrengensten Perioden in seinem Leben gehört hatte.
Zu guten Freunden, als welche er jene Gauner definierte, die ihm gerade ein Essen ausgaben, pflegte Farhad zu sagen: „Ihr seht, ich bin ein hervorragender Hindu: Wie die Götter habe ich dutzende von Avatars, von Erscheinungsformen. Und bisweilen habe ich zum Stehlen auch so viele Arme wie sie.“
Nur eines hatten alle Erscheinungen von Farhad Kamal gemeinsam: den verschlagenen, immer leicht gehetzten Ausdruck um seine Augen herum. Er wohnte in den winzigen Fältchen direkt seitlich vom äußeren Lidwinkel, und man entdeckte ihn nur, wenn man genau hinsah.
Als Farhad an diesem Tag über die Felder unterwegs war, trug er das Haar kurz und etwas struppig und hatte einen leicht gebräunten Teint. Er war unterwegs zur Villa des Mr Arthur Shaw, in dessen Wohnzimmer es eine hübsche Sammlung an antiken Porzellanfiguren gab, die Farhad sich – selbstverständlich aus rein kunsthistorischem Interesse – näher anzusehen plante.
Er schlich am Zaun entlang und suchte nach einem Durchschlupf – da sah er den silbernen Glanz. Er schien direkt aus dem Teich von Mr Arthur Shaw zu kommen, und Farhad blieb stehen, um seine Augen anzustrengen: nein, nicht direkt aus dem Teich.
Der Glanz strahlte ihm aus einer der Lotusblüten entgegen, die dort friedlich in der Sonne schwammen. Farhad dachte an Lakshmi, die Göttin des Reichtums, die selbst meist in einer Lotusblüte erschien, und sein Herz machte einen Sprung.
Wenig später fand er ein Loch im Zaun und zwängte seinen mageren Körper hindurch wie eine streunende Katze. Er bewegte sich im Schutz der lichten Bäume, die um den Teich herum wuchsen, und je näher er dem Teich kam, desto heller leuchtete das silberne Etwas aus der Lotusblüte und desto schneller schlug Farhads Herz.
Schließlich berührten seine bloßen Zehen das Wasser, er hockte sich hin und beugte sich weit vor, um den Arm nach der Lotusblüte auszustrecken … dann spürten seine Finger etwas Kaltes, Glattes, und er hob es aus dem Bett aus rosafarbenen Blättern und hielt es ans Licht: Besser hätte er es nicht treffen können. In seiner Hand lag ein winziges, kostbar gearbeitetes Amulett aus reinem Silber, von dem eine ebenso silberne Kette herabbaumelte. Sein prüfender Blick schätzte den Wert des Schmuckstücks, und in seinem Kopf sang es vor Freude.
Wer, dachte Farhad, versteckt eine silberne Kette in einer Lotusblüte mitten in einem Garten? Und wozu?
Er schloss seine Finger um das kleine Amulett, sah sich prüfend um und erhob sich eilig. Egal, wer die Kette aus welchem Grund hierher gebracht hatte, nun war es die seine. Er würde sich irgendwann anders um das Porzellan des Mr Shaw kümmern, jetzt musste er zunächst seinen Schatz in Sicherheit bringen.
Doch er kam nicht weit.
In dem Augenblick, in dem Farhad das silberne Amulett mit allen Fingern umfasste, schlug vor ihm ein lautloser Blitz in den Boden ein, und jemand versperrte ihm den Weg.
Farhad, der kein Mann von außergewöhnlichem Mut war, erschrak beinahe zu Tode und taumelte zurück. Er schirmte die Augen mit der Hand ab, da die gleißende Erscheinung vor ihm ihn blendete, und krümmte sich wie ein ertappter Hund.
Dann blinzelte er zwischen den Fingern hindurch und erkannte die Gestalt sofort: Wie oft hatte er vor dem Bild des flötespielenden Kuhhirten mit dem feinen Gesicht im Tempel gestanden und gewartet, dass eine unbewachte Opfergabe den Weg in seine Taschen fand!
„Lord … Lord Krishna“, flüsterte Farhad und machte noch einen Schritt zurück. Das Amulett ließ er nicht los. Ihm schoss die Frage durch den Kopf, ob Krishna seinen Diebstahl bemerkt hatte. Vielleicht war er nur zufällig hier –
„Du hast das Amulett gefunden“, sagte der Gott mit einer Stimme, so sanft wie die Augen der weißen Kühe, die er der Sage nach hütete. „Du bist der auserwählte Mann.“
„Wie – wie bitte?“, stammelte Farhad.
„Der Held“, fuhr Krishna fort, „den ich brauche. Der Krieger, den ich aus allen Kriegern ausgesucht habe, um die Aufgabe zu erfüllen, die erfüllt werden muss.“
Farhad schüttelte wild den Kopf. „N-nein“, stotterte er nun ängstlich. „Da muss ein Irrtum vorliegen! Ich bin kein Held und schon gar kein Krieger. Ich kann nicht kämpfen, und ich habe Angst vor allem! Vor Schlangen, vor Hunden, selbst vor den Fischen im Teich“, log er, „ich kann auf gar keinen Fall irgendeine Aufgabe erfüllen.“ Farhad war immer weiter zurückgestolpert, während er gesprochen hatte, und nun stand er mit einem Bein bis zum Knie im Teich.
„Bleib stehen, und hör mir zu“, sagte Krishna sanft.
Farhad nickte furchtsam und deutete eine untertänige Verbeugung an. Die Angst vor dem Zorn des Gottes hatte ihn nun mit aller Macht gepackt, und seine Knie schlotterten unvorteilhaft.
„Ravana“, sagte Krishna, „hat meine Tochter entführt. Du erinnerst dich, wer Ravana ist?“
„I-i-ich – ich glaube schon“, stammelte Farhad. „Der Dä-dä-dämonenkönig. Er hat damals in der Ramayana-Sage schon Ramas Frau Sita nach Ceylon verschleppt, nicht wahr? Und Ihr standet Rama als Wagenlenker und Berater bei, u-u-um seine Armeen zu besiegen.“
Krishna nickte. „Das ist lange her. Jetzt jedenfalls gibt sich Ravana als Händler aus und lebt in der Stadt im Herzen der Wüste Rajasthans.“ Lord Krishna stützte den Kopf in vier seiner Hände und seufzte. Und dann erzählte er Farhad Kamal die ganze Geschichte vom Unglück der Prinzessin. Von der Dattelpalme südlich von Nirgendwo, von Ravanas besessener Liebe und von der Entführung durch dessen Diener Suryakanta. „Er hält die Prinzessin in seinem Haus dort gefangen“, schloss er. „Und in genau einem Monat, wenn der Mond wieder voll ist und die Zeichen günstig stehen, wird er sie heiraten und für immer in sein dunkles Reich des Bösen mitnehmen.“
„Da-da-das tut mir Leid“, sagte Farhad und klapperte mit den Zähnen.
„Aber es wird nicht geschehen“, sagte Krishna. „Denn du wirst sie befreien.“
Farhad starrte den Gott an. „I-i-ich?“
„Ja“, sagte Krishna. „Du. Denn du warst es, der das Amulett gefunden hat. Du sollst ein Reittier bekommen, das schneller ist als die Wolken in der Luft, und ich werde dafür sorgen, dass du deinen Weg nicht verlierst. Alles andere musst du selbst erledigen. Einen Monat hast du Zeit, um die Stadt im Herzen der Wüste zu erreichen und dem Dämonenkönig gegenüberzutreten. Wenn der nächste volle Mond über den Sanddünen scheint, soll die Hochzeit zwischen Ravana und meiner Tochter stattfinden. Ich würde dir raten, unverzüglich aufzubrechen. Und pass gut auf das Amulett auf. Es wird dich schützen.“
„Was bekomme ich, wenn ich das tue?“, fragte Farhad. Obgleich ihm noch immer vor Angst abwechslend heiß und kalt wurde, hatte er seine geschäftliche Ader wiederentdeckt.
„Wenn es dir gelingt, die Prinzessin zur rechten Zeit zu befreien“, antwortete Krishna ernst, „sollst du im nächsten Leben in eine wundervolle Stufe aufsteigen und wiedergeboren werden als wohlhabender, weiser Mann. Wenn du es nicht schaffst …“
Er machte eine Pause, und Farhads Finger spielten nervös mit dem Amulett.
„… wenn du es nicht schaffst“, wiederholte Krishna, „wirst du als ein niedriges, Ekel erregendes Wesen wiedergeboren werden. Ein Wurm, wenn es dir beliebt. Oder eine Assel, die die Menschen mit Füßen treten. Und der Kreislauf deiner Lebenszeiten hier auf der Erde wird sich ins schier Unendliche verlängern, bis du das Nirwana erreichst.“
Er lächelte.
Farhad wurde noch blasser, als er ohnehin schon war.
„Ich wünsche dir viel Glück“, sagte Krishna, streckte einen Arm aus und strich mit drei Fingern über Farhads Stirn. Farhad spürte das göttliche Zeichen, das Krishna gemalt hatte, wie eine glühende Brandmarke.
Er sah den Gott noch einmal sein unergründliches Lächeln lächeln, dann war er verschwunden.
Farhad Kamal stand alleine im heiligen Hain im Garten des Mr Arthur Shaw.
Alleine mit einem silbernen Amulett, das den ganzen sanften Glanz des vollen Mondes in sich trug.
Farhads Kenntnisse von Geografie waren auf die nähere Umgebung seiner Heimatstadt Madurai begrenzt, und seine Vorstellung davon, wo sich die Wüste Rajasthans befinden könnte, war vage.
So kehrte er in die Stadt zurück und erkundigte sich bei einem Parotaverkäufer nach ihrer Lage.
Der Parotaverkäufer rollte einen seiner papierdünnen Pfannkuchen zusammen und überlegte.
„Die Wüste Rajasthans – die Thar – ist alt und weit fort“, sagte er. „Da ich weiß, dass im Süden von hier das Land irgendwo endet und an seinem Ende das Meer liegt, kann dort nicht die Wüste Rajasthans sein. Sie muss also im Norden sein.“
„Wie weit im Norden?“, fragte Farhad.
„Ein Dutzend und noch ein Dutzend Tage zu Pferd“, sagte der Mann, der die zusammengerollte Parota entgegennahm. „Vielleicht auch mehr.“
Farhad seufzte und verfolgte mit hungrigen Augen, wie der Mann sich an einen der alten niedrigen Tische setzte und seinen Pfannkuchen in rote Sauce tunkte, deren Schärfe ihm bereits beim Hinsehen in den Augen brannte.
„Ich habe kein Pferd“, sagte Farhad und setzte sich zu dem Mann an den Tisch.
„Zu Fuß sicher zwei Monate“, sagte der Mann und biss in die Parota. Die kleinen Krümel des krossen Teiges verteilten sich in seinen Mundwinkeln, und als er schluckte, schluckte Farhad mit.
„Ich habe keine zwei Monate Zeit“, sagte er. „Ich habe nicht einmal genug Geld, um eine Parota zu kaufen.“
„Wenn du glaubst, dass ich dich einlade“, sagte der Mann und lächelte, „dann bist du an der falschen Adresse, mein Freund. Such dir eine anständige Arbeit, und tu etwas für deine Parota.“
„Ich habe leider keine Zeit für eine anständige Arbeit“, sagte Farhad – überrascht darüber, dass er zur Abwechslung die Wahrheit sprach. „Was ich suche, ist die Stadt in der Mitte der Wüste Thar. Und in genau einem Monat muss ich dort sein.“
Der Mann brach in ein lang anhaltendes, schallendes Lachen aus.
Farhad sprang von dem niedrigen Tisch auf, an dem er gesessen hatte, und verließ den Laden. Dabei fand eine Parota von dem Stapel, den der Verkäufer produziert hatte, den Weg in seine Tasche. Auf der Straße begann er, ärgerlich darauf herumzukauen. Er hatte bisher noch keinen Weg gefunden, die scharfe Sauce mitgehen zu lassen, und so lebte er meist von recht trockenen Dingen.
An diesem Abend organisierte sich Farhad eine Flasche Schnaps, den sie hier aus allerlei zwielichtigen Abfällen herstellten, und setzte sich damit auf die Stufen eines Schreins am Straßenrand. Hanuman, der Affengott, sah ihn mit seinem orangefarbenen Gesicht gütig an.
Über ihm stand der volle Mond am Himmel.
Farhad holte das Amulett hervor und betrachtete nachdenklich seinen Glanz – ein zweiter, kleinerer Mond in seiner Hand. Was sollte er tun? Bisher war er sich bei der Sache mit Karma und Wiedergeburt nie so wirklich sicher gewesen. Und nun hatte Krishna ihm durch sein Auftauchen nicht nur die Existenz dieser Dinge bewiesen – er hatte ihm gleichzeitig auch eine unlösbare Aufgabe gestellt und ihn dazu verdammt, jenem ewigen Kreis von Wiedergeburt und Leid niemals zu entgehen. Das war etwas viel auf einmal.
Denn wie sollte es ihm gelingen, die Prinzessin zu befreien, wenn er sie nicht einmal rechtzeitig erreichen konnte?
Krishna hatte ihm ein Reittier versprochen, das schneller war als die Wolken in der Luft. Sicher, alle Helden in der hinduistischen Sagenwelt hatten ein Reittier. Aber wo sollte er dieses Reittier finden?
Krishna hatte ihm versprochen, dass er ihm den Weg weisen würde, aber wie sollte er Krishnas Zeichen lesen?
Er hatte keine Ahnung von den Zeichen der Götter. Er war sich nicht einmal sicher, ob die Wolken in der Luft tatsächlich schnell waren oder langsam. So trank er nach und nach die Flasche Schnaps aus und klagte dem Affengott Hanuman in seinem kleinen Schrein sein Leid.
„Mein Leben ist verwirkt“, flüsterte er Hanuman zu. „Schlimmer noch: Alle meine Leben sind verwirkt. Ich werde ein Wurm sein, den die Leute mit Füßen treten … ein Wurm …“
Dann sank sein Kopf gegen das eiserne Gitter des Schreins, und ein Tropfen Schnaps lief ihm aus dem Mundwinkel und rann sein Kinn hinunter, während er wegdämmerte.
Kurz, ehe ein traumvoller, verzweifelter Schlaf ihn packte, meinte er zu sehen, wie Hanuman mit dem linken Auge zwinkerte – als wollte er ihm etwas sagen. Doch er konnte sich getäuscht haben.
Zu jener Zeit gab es nur eine einzige Straße, die von Madurai aus nach Norden führte. Farhads einziger Gefährte auf dieser Straße war sein eigener Schatten, den die grelle Vormittagssonne an seine bloßen Füße hängte.
Um den Hals trug er das silberne Amulett.
Kurz nach Madurai stieß er auf eine Polizeikontrolle der Engländer.
Seit die Engländer ihre Queen anstelle der Handelsgesellschaft gesetzt hatten, die zuvor über Indien geherrscht hatte, bildeten sie sich ein, überall Kontrollen aufstellen zu müssen.
Da die Polizei meistens gerade die eine oder andere Sache gegen Farhad in der Hand hatte, verließ er die Straße und schlug sich nach links in die Felder, wo ein schmaler Pfad sich durch das Reis-Grün und das Erd-Rot schlängelte.
Er ärgerte sich, dass die Engländer ihre Polizeikontrolle gerade hier aufgestellt hatten, doch zugleich bewunderte er sie auf eine gewisse Weise.
Sie hatten sich das Land mit ihrer Handelsgesellschaft nach und nach erschlichen, ohne eine Notwendigkeit zu sehen, es zu erobern. Sicher hatte es hier und da Kämpfe gegeben. Aber im Großen und Ganzen schien das eher nebensächlich. Eines Tages hatte Indien plötzlich einer englischen Gesellschaft gehört, und da kein Land einer Gesellschaft gehören kann, hatte die britische Krone es im Sinne der Gerechtigkeit und der größeren Zusammenhänge politischer Korrektheit einfach übernommen.
So etwas, dachte Farhad, musste man erst einmal können. Er wäre gerne bei den Briten in die Lehre gegangen – was die Erschleichung von Wertgegenständen betraf.
Zunächst ging er jedoch ohne die Briten in die Leere – in die Leere der verwilderten Landschaft jenseits der Felder bei Madurai. Er hatte das ungute Gefühl, dass die Posten der Kontrolle ihn gesehen hatten, ihn eventuell seit einer Weile beobachteten und sich fragten, wohin er wohl unterwegs war. Daher wählte Farhad immer kleinere und kleinere Pfade, die ihn aus der Reichweite der Posten brachten, und achtete lediglich darauf, dass die Richtung grob stimmte.
Hatte Krishna nicht versprochen, ihm den rechten Weg zu weisen? Farhad dachte sich nicht viel dabei, als der Weg begann, leicht bergan zu führen. Er wunderte sich erst, als er feststellte, dass er seit geraumer Zeit über alte, steinerne Treppen unterwegs war, die stetig hinauf-, aber niemals hinunterführten. Und sie wurden steiler.
Andererseits war der Weg deutlich, und er führte nach Norden. Farhad hatte keine Lust, umzukehren und sich einen anderen Pfad durch das Gestrüpp und die Felsen zu suchen, die hier überall unordentlich herumlagen.
Schließlich musste er jedoch einsehen, dass er dabei war, einen Berg zu besteigen. Das Land lag schon ein gutes Stück unter ihm, als er an den ersten Aussichtspunkt kam. Er blieb stehen und sah hinab.
„Es ist eine ziemlich dumme Idee“, sagte er laut zu sich selbst, „irgendwohin über einen Berg zu gehen.“
Nach der nächsten Treppe fügte er hinzu: „Es gehört zu den dümmsten Ideen überhaupt.“
Und nach zwei weiteren Treppen: „Allerdings würden die Briten nie auf die Idee kommen, etwas so Dummes zu tun. Also werden sie mir nicht folgen, und ich bin sie los. Deshalb ist es den Umweg wert.“
Und so kletterte er weiter über die grob behauenen Steinquader aufwärts, die so uralt aussahen, als hätten die Götter selbst sie in einer Zeit bearbeitet, in der es unter Göttern noch nicht bekannt war, wie man eine anständige Treppe baut.
Am Fuße des Berges legten zwei Männer vom britischen Kontrollposten ihre Hände über die Augen und folgten der schmalen Gestalt, die sich den steilen, geschlängelten Weg hinaufarbeitete, mit ihren amtlichen Blicken.
„Das ist er nicht“, sagte der eine zum anderen. „Der, den wir suchen, verkleidet sich nur als Inder. In Wirklichkeit stammt er aus England wie wir. Sieh dir den da an! Nur ein Inder ist verrückt genug, in dieser Hitze einen so steilen Berg hinaufzuklettern, ohne wenigstens Proviant bei sich zu tragen. Ich sage dir: Das ist einer von den Pilgern, die ab und zu den heiligen Mann da oben besuchen. Hast du gehört, was sie über ihn berichten? Er soll dort ohne Nahrung und Wasser leben, nur vom Tau, der in den Morgenstunden auf die Blätter fällt.“
Der zweite zuckte mit den Achseln. „Wenn man es glauben will, bitte. Unser Junge da am Berg soll ihn mal schön grüßen. Ansonsten kann er uns egal sein. Den Stein hat er nicht.“
Der andere nickte. „Er ist auch schon viel zu lange verschwunden. Den, der den Stein hat, finden wir hier nicht mehr. Obwohl ich ihn gerne gesehen hätte. Er soll die Form eines riesigen Tropfens haben und so hell leuchten wie die Sonne! Wusstest du, dass die Inder sich die merkwürdigsten Geschichten über diesen Juwel erzählen? Sie nennen ihn den Blutstein …“
„Märchen“, sagte der erste Mann und steckte sich ein Stück Kautabak in den Mund. „Womöglich gibt es den Blutstein überhaupt nicht. Der indische Kaufmann, dem er angeblich gestohlen wurde, hat ihn einfach nur erfunden, um uns auf Trab zu halten.“
„Da“, meinte der andere, „wäre ich mir nicht so sicher.“
Farhad Kamal rann der Schweiß inzwischen in Bächen den Rücken hinunter. Ab und zu fluchte er leise vor sich hin, weil er keine Wasserflasche mit auf seine Reise genommen hatte. Auch sein Magen fühlte sich so leer an wie ein schlaffer Sack, und seine Beine zitterten von der ungewohnten Anstrengung des Aufstiegs.
An einer Stelle, wo sich die Treppe neben einer besonders steilen Felswand emporschlängelte, riss ihn das Kreischen einer Gruppe von Affen aus seinen Träumen von kühlem Wasser und weißem Reis, und er blieb stehen, um sie zu beobachten. Sie jagten sich gegenseitig über den Felsen und versuchten mit viel Geschrei, gegenseitig ihre langen Schwänze zu erhaschen. Farhad rang nach Luft und sah den Affen voller Neid zu.
Wie gerne wäre er ihnen gleich den Berg hinaufgesaust, als handelte es sich um eine ebene Fläche! Wie gerne hätte er eine Abkürzung über die Felswand genommen, statt mühsam Schlangenlinie um Schlangenlinie des Weges hinter sich zu bringen! Was hätte er für die Geschicklichkeit ihrer langen Finger und Zehen gegeben, mit denen sie sich in den unsichtbaren Spalten des Gesteins festhielten.
Plötzlich löste sich einer der Affen aus der Gruppe und kam ohne Vorwarnung auf Farhad zugerannt. Farhad blieb erstaunt stehen. Ehe er reagieren konnte, streckte der Affe seine langen, dürren Arme nach ihm aus – und riss ihm im nächsten Moment die Silberkette vom Hals.
Ehe Farhad blinzeln konnte, stieß das Tier auch schon ein triumphierendes Kreischen aus und schoss mit seiner Beute davon wie ein Gewitterblitz.
„Halt!“, schrie Farhad und wedelte wütend mit den Händen. „Nein! Gib die Kette zurück! Sofort gibst du mir die Kette zurück!“
Der Affe sprang auf die Spitze eines Felsbrockens, stieß ein Geräusch aus, das einem wiehernden Lachen glich, und zeigte seine langen gelben Zähne.
Farhad näherte sich dem Affen und brüllte etwas Unverständliches, doch das Tier zeigte sich nicht beeindruckt. Es machte einen weiteren Satz – und landete in der Gruppe seiner Kameraden, die neugierig das seltsame glänzende Ding in seiner Hand beschnupperten. Während Farhad versuchte, die Affen zu erreichen, ohne die Felswand hinunterzustürzen, schien unter ihnen ein Streit darum zu entbrennen, wem die Kette gehören sollte. Offenbar legte ihre Rangordnung keine feste Regel für den Erwerb von silbernen Amuletten fest.
Farhad sah voll wachsender Verzweiflung, wie die Tiere mit wütendem Kreischen an dem Schmuckstück zerrten, mal der eine und mal der andere die Oberhand gewann und das Amulett an sich riss.
Er fand einen langen Stock am Wegesrand und hob ihn auf.
„Ihr habt ja keine Ahnung!“, schrie er – nur, um irgendetwas zu schreien –, „das Ramayana erzählt von einer Affenarmee, die Lord Rama hilft, seine Gattin Sita zu befreien! Aber ihr – ihr wisst nichts von dem mutigen Hanuman, der mit einem einzigen Sprung Ceylon erreichte! Ihr könnt keinem helfen. Nur Dinge klauen könnt ihr, nichts sonst! Nichts!“
Die Affen sahen ihn an, als wären sie belustigt über seinen Zorn. Und einen Moment lang hatte er das Gefühl, dass einer von ihnen ihm zublinzelte – ganz so, wie er in der vorigen Nacht bei der kleinen, orangefarbenen Statue von Hanuman das Gefühl gehabt hatte. Seltsam.
Und dann geschah es. Einer der Affen nutzte den Augenblick, in dem alle anderen Farhad anstarrten, und krallte sich das Amulett – und dabei zerbrach es in zwei Teile.
Farhad schrie auf.
Er packte den Stock fester, sprang auf den nächsten Felsen und begann, mit seiner notdürftigen Waffe um sich zu schlagen. Diesmal erreichte er die Affen.
Sie erschraken über den plötzlichen Angriff und flohen laut schimpfend – wobei der eine das Amulett fallen ließ. Farhad bückte sich und erwischte es gerade noch, ehe es die Felsen hinunterrutschen konnte. Da sah er, dass es keineswegs zerbrochen war.
Es war aufgeklappt wie ein Buch.
Farhad betrachtete es verwundert. Bisher war er viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, um den winzigen Verschluss an der Seite des Amuletts zu bemerken.