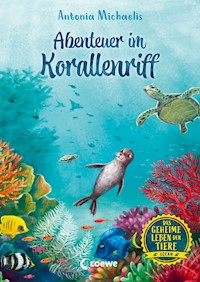9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die schüchterne Anna und der draufgängerische Tariq könnten verschiedener nicht sein. Doch an der Pferdeweide, auf der Apfelmütze und Wackelpo grasen, freunden sie sich langsam an. Anna soll reiten lernen, um weniger ängstlich zu sein. Tariq braucht ein Pferd, um seinen großen Bruder zu suchen. Denn der lebt, seit die beiden aus ihrem Heimatland allein nach Deutschland gekommen sind, irgendwo in einer anderen Stadt in einem Heim. Anna beschließt, mutig zu sein und ihn zu begleiten. Auf dem Rücken von Wackelpo und Apfelmütze beginnt ein wunderbares, heimliches Abenteuer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Zwei Kinder, zwei Pferde und das Abenteuer eines Sommers
Anna und Tariq – viel verschiedener als die beiden kann man kaum sein. Doch an der Pferdeweide, auf der Apfelmütze und Wackelpo grasen, freunden sie sich langsam an. Anna soll reiten lernen, um weniger ängstlich zu sein. Tariq braucht dringend ein Pferd, um seinen großen Bruder zu suchen. Denn der lebt, seit die beiden aus ihrem Heimatland allein nach Deutschland gekommen sind, irgendwo in einer anderen Stadt in einem Heim. Hals über Kopf beschließt Anna, ihn zu begleiten. Auf dem Rücken von Apfelmütze und Wackelpo beginnt ein wunderbares, heimliches Abenteuer …
0. Kapitel, in dem es blitzt und ein Baum zerbricht
Es begann mit einer Gewitternacht.
Der Donner rollte über die Wiesen, Regen peitschte die Küste. Vermutlich sagten selbst die Fische zueinander: »Was für eine ungemütliche Nacht!« Und in einem Stall, der sonst ganz gemütlich war, standen zwei Pferde.
Draußen heulte der Sturm, und die Bäume bogen sich, ihre wilden Schatten tanzten auf der Stallwand im Licht der Straßenlaterne.
Der alte Hansen schlief in seinem Bett wie ein Bär. Und der Kohl schlief auf dem kleinen Feld, und die Schnecken schliefen im Gemüsebeet. Aber die Pferde konnten nicht schlafen.
Es waren zwei: eine Stute mit einem ausladenden Hinterteil und ein Hengst mit einer weißen Blesse auf der Stirn. Das Pferd mit dem Hinterteil schnaubte unruhig.
»Ich mag kein Gewitter«, sagte es ohne Worte.
»Hab keine Angst«, sagte das andere, ebenfalls ohne Worte. Pferde brauchen keine Worte. »Ich mag das Gewitter. Es erinnert mich …«
Und in diesem Moment gab es einen Knall, und das Stalltor sprang auf. Der Riegel hatte sich gelöst, vielleicht, weil der Wind dagegengedrückt hatte.
»Es erinnert mich an damals«, wiederholte das Pferd mit der Blesse. »Als ich ein Fohlen war. Wild und frei! Wie der Donner, wie der Blitz! Später bin ich so brav geworden. All diese Jahre, in denen wir den Pflug zogen … Aber jetzt fühle ich mich plötzlich wieder jung! Komm!«
Und es stieß das Stalltor ganz auf und roch die Blitze, roch die Freiheit.
»Tu das nicht«, sagte das andere Pferd. Aber da war das mit der Blesse schon draußen, bäumte sich auf, wieherte wild: wie betrunken.
Das andere, vorsichtig, ging nur ein paar Schritte nach draußen. »Igitt«, sagte es. »Der Regen! Er ist nass!« Es war ein Pferd, das nicht gerne nass wurde. »Komm zurück!«, sagte es.
Aber das Pferd mit der Blesse kam nicht. Es sprang zwischen den Gemüsebeeten herum, als wäre es wahrhaft wieder jung, völlig verrückt.
Das Pferd mit dem ausladenden Hinterteil schüttelte den Kopf. Und da geschah es.
Die Birke, die neben dem Stall stand, bog sich im Sturm, knackte, ächzte – und brach mit einem lauten Krachen entzwei. Ein Gewirr aus Ästen und Blättern stürzte herab auf das Pferd.
Es scheute. Versuchte sich aufzubäumen. Konnte nicht. Da war dieses Gewirr auf ihm, hielt es fest wie eine riesige Hand. Und das Pferd explodierte in einer Panik, die es nie gekannt hatte. Es schüttelte sich, tobte, raste über den Hof, einmal im Kreis herum, wieherte seine Angst heraus – und endlich wurde es den großen Birkenast los, endlich stand es mit bebenden Flanken.
Aber in seinem Herzen hatte sich die Angst festgesetzt.
Als sie beide wieder im Stall standen, zitterte es noch immer.
»Was ist?«, fragte das andere Pferd, das draußen Unsinn gemacht hatte.
»Eine Hand hat mich festgehalten«, sagte das Angstpferd. »Die Hand eines Unsichtbaren im Gewitter. Er wollte mich töten!«
»Quatsch«, sagte das andere Pferd.
»Er wird wiederkommen«, sagte das Angstpferd störrisch. »Er wartet da draußen auf mich.«
Vor dem Stall legte sich der Sturm. Doch in dieser Nacht hatte sich alles verändert:
Eins der Pferde im Stall war wieder jung geworden und wild.
Das andere war ein Angstpferd geworden.
Und in einem Bett nicht weit, gar nicht weit weg, schlief ein blasses Mädchen mit hellem Haar und umklammerte einen alten Teddybären. Es zuckte im Schlaf manchmal zusammen, erschrocken. Es träumte.
Und unter einer Kellertreppe, anderswo, schlief ein Junge mit verschrammtem Gesicht, zusammengerollt wie ein Tier. Er schlief unter einer bunten Bettdecke, die er aus einem Bett mitgenommen hatte. Aber er hatte niemandem gesagt, warum er unter der Treppe schlief.
Er schlief mit geballten Fäusten. Ein Kämpfer.
All dies war der Beginn von mehr. Der Beginn einer Geschichte, gefährlich und wunderbar zugleich. Der Beginn eines Abenteuers.
1. Kapitel, in dem ein Papierpferd flieht und Pfannkuchen mit Tomatensoße und Schokolade vorkommen
Anna sah das Pferd zuerst.
Sie sah, wie es entstand.
Am Anfang war nur sein Kopf da: zurückgeworfen, ein wenig wild, ein wenig eigensinnig. Nervös spielende Ohren. Leicht geblähte Nüstern. Dann kam der Hals, elegant geschwungen. Dann die Mähne, flatternd im Wind.
Das Pferd galoppierte. Es galoppierte über das Papier eines linierten Schulhefts. Sein Schweif fegte über die krakelige Überschrift »Das Leben der Heuschrecke«, es versuchte eindeutig, den Heftrand zu erreichen. Zu entkommen.
Vielleicht, dachte Anna, wäre es gern durch das Fenster hinaus galoppiert in den warmen Sommertag. Über die Wiesen vor dem Schulhaus, den kleinen Pfad an der Steilküste entlang, über dem Meer. Und schließlich zum Wald.
»Malst’n da?«, fragte Stefan, und Anna zuckte zusammen.
Die Frage war nicht an sie gerichtet. Zum Glück, denn sie hasste es, wenn jemand sie etwas fragte.
Es war Tariq, der das Pferd in sein Heft gemalt hatte. Tariq, der vor ihr saß.
»Nee, echt jetzt, ’n Gaul, oder was?«, fragte Stefan und lachte.
Tariq drehte den Kopf und sah Stefan an.
Anna sah, wie er die Augen zusammenkniff. Er hatte dunkle Augen mit einem wilden Ausdruck wie die des Pferdes. Und stets verstrubbeltes schwarzes Haar und einen Riss im Hemd, an der Schulter.
»Das ist Pferd«, erklärte Tariq leise und bestimmt.
»Gaul, Pferd, alles eins«, sagte Stefan. »Seit wann kritzelst du so was in dein Heft? Bist du ’n Mädchen?«
Jannis hörte auf, »Das Leben der Heuschrecke« von der Tafel abzuschreiben, und guckte ebenfalls rüber.
»Süß«, sagte er. »Kann ich’s rosa ausmalen?«
»Lass mich Ruhe«, sagte Tariq. »Das ist mein Pferd. Ist echt.«
Stefan und Jannis sahen sich an und prusteten los.
Aber Anna verstand, was Tariq meinte. Das Pferd war echt. Es sah aus, als könne es aus dem Heft springen.
»Ist von da, wo ich wohne«, sagte Tariq.
Jetzt hatte sich auch Simone umgedreht. »Das Pferd ist aus dem Kinderheim?«, fragte sie.
Tariq schnaubte. »Pferd ist von Afghanistan.«
Anna sah, dass er die Fäuste geballt hatte, und machte sich klein. Sie wusste, was jetzt passieren würde. Tariq war erst seit zwei Monaten in der Klasse, aber sie wusste es, und die anderen hätten es auch wissen müssen.
»Afghanistan ist viel mehr besser wie hier«, sagte Tariq.
»Warum?«, fragte Jannis.
»Weil«, sagte Tariq.
»Dann setz dich doch auf dein Pferd und reite dahin zurück«, sagte Stefan. »Aber warte, da brauchst du noch ein schickes Reitkostüm. Und wir könnten dir Schleifchen ins Haar binden!«
Er griff nach einer Strähne von Tariqs schwarzem Haar.
Und da schlug Tariq zu.
Es war so klar gewesen, warum hatte Stefan nicht den Mund gehalten?
Jetzt blutete er aus der Nase, und mit einer komischen Verzögerung schrie er los. Tariq sprang auf und schlug direkt noch mal zu, diesmal sauste seine Faust in Jannis’ Gesicht, und dann stand er oben auf dem Tisch, sprang von da aus zum nächsten Tisch, alle schrien durcheinander, und Frau Winterblum, die sich bis jetzt mit dem Leben der Heuschrecke beschäftigt hatte, schrie auch.
»Stooopp! Hiergeblieben!«
Aber niemand blieb irgendwo. Tariq sprang über Tische, die anderen rannten ebenfalls los, und Anna wurde in dem Chaos irgendwie mitgerissen. Sie erreichte die Tür gleichzeitig mit Tariq.
Er sah sie einen Moment lang an. In seinen dunklen Augen loderte ein Feuer, das ihr Angst machte.
»Tariq, bleib stehen!«, schrie Frau Winterblum noch einmal.
Da schubste Tariq Anna zu Boden, die ihm im Weg stand, und hechtete hinaus in den Flur.
Die anderen, die ihm folgten, stolperten über Anna, sie waren wie eine Herde von Stieren, und sie drückte sich gegen den Türrahmen und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sah sie in Frau Winterblums besorgtes Gesicht.
»Himmel, Anna«, sagte Frau Winterblum und zog sie auf die Beine. »Hat er dich gegen den Türrahmen geschubst?« Sie holte ein Stofftaschentuch heraus und tupfte an Annas Schulter herum. An dem Taschentuch war Blut. Aber nur ein bisschen. »Tut es sehr weh?«, fragte Frau Winterblum.
Anna wollte den Kopf schütteln, aber er ließ sich nicht schütteln, sie stand einfach nur da und sah auf ihre Turnschuhe.
Die Turnschuhe waren gelb mit kleinen weißen Blumen, Anna kannte die Blumen sehr genau, denn sie sah diese Schuhe immer an, wenn Frau Winterblum mit ihr sprach. Wenn irgendwer mit ihr sprach. Sie konnte nicht in die Gesichter von Leuten sehen. Es ging nicht.
»Was war denn?«, fragte Frau Winterblum. »Warum ist Tariq schon wieder ausgetickt? Du sitzt doch hinter ihm, du weißt es, oder?«
Und Anna wollte nicken, aber ihr Kopf nickte nicht. Eins der weißen Blümchen auf den Schuhen war ganz leicht grünlich. Das war interessant.
»Na gut«, sagte Frau Winterblum. »Kinder?«, rief sie in den Flur. »Kommt alle wieder in die Klasse. Ich sage Herrn Müller Bescheid, damit er Tariq sucht.« Sie seufzte. »So geht es nicht weiter. Stefan? Jannis? Ab zum Direktor, lasst euch verpflastern. Wir reden später.«
Als Anna wieder auf ihrem Platz saß, war sie froh, dass Frau Winterblum sie nicht mitgeschickt hatte zum Verpflastern. Sie hasste das Zimmer des Direktors.
Sie sah aus dem Fenster. Draußen lief Herr Müller über den Hof, der Hausmeister, auf der Suche nach Tariq. Zum dritten Mal in dieser Woche. Sie hätte ihm sagen können, wo Tariq war, er saß in der Esche, hinten an der Mauer. Man sah ihn zwischen den Blättern nur, wenn man genau hinguckte, und er saß da im Wind, als säße er auf einem Pferd, das durch die Luft galoppierte. Ja, Anna hätte es den Erwachsenen sagen können – aber dann auch wieder nicht. Denn sie sprach nicht mit Leuten. Es ging nicht.
Nach der Schule, als die anderen alle nach Hause gegangen waren, stand Anna noch einen Moment vorm Schultor. Eine kleine graue Katze kam vorbei, und Anna bückte sich und streichelte sie.
»Frau Winterblum weiß genau, dass ich nichts sage, und trotzdem fragt sie mich immer Sachen«, sagte Anna zu der Katze. »Sie tut so, als könnte ich antworten.«
»Mau«, sagte die Katze und drückte sich gegen Annas Beine.
»Frau Winterblum tut ständig so, als ob«, sagte Anna. »Sie tut auch so, als ob Tariq ein ganz normaler Schüler ist. Ich glaube, sie braucht einen Psychologen.«
»Mii?«, fragte die Katze.
»Psy-cho-loge«, sagte Anna. »Ich war auch bei einem. Er hatte ein schönes buntes Zimmer mit Büchern, und er hat immer Brettspiele gespielt. Ich glaube, er wollte, dass ich mitspiele. Und dass ich was sage. Hab ich aber nicht. Was hätte ich sagen sollen?« Sie nahm die Katze auf den Arm und drückte sie kurz an ihre Wange. »Komisch«, flüsterte sie. »Bei dir weiß ich genau, was ich sagen soll.«
»Anna«, sagte Papa, der zu Hause in der Tür stand. »Deine Lehrerin hat angerufen.«
Anna seufzte. Sie sah die Sorge in Papas Augen.
»Sie hat gesagt, es gab Ärger mit einem Jungen aus deiner Klasse, und du … wurdest verletzt? An der Schulter?«
»Unsinn«, sagte Anna und lachte, damit die Sorge aus seinen Augen verschwand. »Sie regt sich immer gleich so auf. Es ist bloß ein Kratzer, hier, schau.«
Papa atmete langsam aus. »Dann ist ja gut. Es gibt Pfannkuchen.«
»Mit Käse und Tomatensoße und Schokocreme?«, fragte Anna.
Und Papa nickte, denn sie aßen Pfannkuchen immer so. Anna hatte das entschieden. Vor Jahren.
Der Tisch stand am offenen Küchenfenster. Draußen im Garten lärmten die Vögel in den Birnbäumen, die Blumen schäumten wie Wellen aus Farbe, und überall war Sommer. Aus der Werkstatt drüben kam Gehämmere. Musik schwebte über Papas Bienenstöcke heran, Papas Mitarbeiter Theo hämmerte lieber mit Radio.
Papa und Theo machten Möbel. Einmal im Jahr fuhren sie irgendwohin und pflanzten alle Bäume wieder an, die sie verbaut hatten, und früher hatte Anna gedacht, sie müssten dann die Möbel auseinandernehmen und die Bäume wieder zusammensetzen, aber natürlich pflanzten sie neue. Papa mochte Bäume. Mitten im Wohnzimmer wuchs einer. Durch die Decke. Es war ein bisschen ungewöhnlich.
»Weißt du was«, sagte Papa jetzt und wischte sich seinen Schokoladen-Tomatensoßen-Bart ab. »Es hat noch jemand angerufen. Der Reiterhof. Wir standen ewig auf dieser Warteliste, weißt du ja, aber jetzt haben wir einen Platz.« Er strahlte. »Wir dürfen hinfahren und uns alles ansehen. Heute.«
Anna schluckte den letzten Bissen ihres Pfannkuchens herunter. Auf einmal schmeckte er komisch.
»Müssen wir?«, fragte sie leise. »Ich meine, der Psychologe war auch ein Reinfall. Hast du selber gesagt.«
»Das hier ist etwas ganz anderes«, sagte Papa. »Reittherapie ist … sie sagen, es wirkt Wunder. Denk an diesen Jungen, der dich geschubst hat. Wenn du etwas sagen könntest … wenn du dich wehren könntest, dann wäre doch alles besser.«
Sie sah auf, sah ihm in die Augen. Sie waren grün und freundlich. Annas Augen waren braun. So, wie die von Mama gewesen waren.
»Glaubst du im Ernst, weil ich reiten lerne, kann ich auf einmal mit Leuten reden?«, fragte sie.
Papa zuckte die Schultern. Er sah so traurig aus. Da ging sie um den Tisch und umarmte ihn.
»Okay«, flüsterte sie. »Ich versuch’s.«
Tariq saß auf dem Dach des Kinderheims und sah hinunter.
Niemand wusste, dass er dort oben war.
Er war seinen geheimen Weg von der Schule hierhergekommen, über Dächer und durch Mauerlücken, er war gut darin, geheime Wege zu finden. Nicht gesehen zu werden. Das hatte er von Jamal gelernt.
Manchmal vermisste er Jamal so sehr, dass es wehtat. Was tat er in diesem Moment? Spürte er, dass sein kleiner Bruder auf einem Dach saß und an ihn dachte? Träumte er nachts, wie Tariq es tat? Von all dem, was sie gemeinsam erlebt hatten? Davon, wie sie sich versteckt hatten und gerannt waren? Von der Angst? Von der Erleichterung? Träumte er, wie Tariq, von zu Hause? Von den Pferden, die über die Ebene preschten, und den Bergen, die sich blau dahinter erhoben? Von den Augen ihrer Mutter? Von der sanften Stimme ihres Vaters?
Tariq holte ein Stück Kreide aus der Tasche. Er hatte es in der Schule geklaut. Dinge, die man dringend brauchte, weil man sonst starb, durfte man klauen, hatte Jamal gesagt.
Und Tariq brauchte diese Kreide.
Er malte ein Pferd auf eine der Dachschindeln. Und noch eins.
»Ich werde ein Pferd stehlen«, flüsterte er. »Weil ich es brauche. Weil ich sonst sterbe. Vor Sehnen. Und ich werde mit ihm davongaloppieren, so schnell wie unser Vater damals. So schnell wie der Wind.« Er nickte und malte noch ein Pferd. Dieses sprang.
»Und ich weiß, wo ich eins herkriegen kann«, flüsterte Tariq.
Nur einen Steinwurf entfernt stapfte der alte Herr Hansen hinter einem Pflug her, den zwei Pferde zogen. Zwei große, starke Arbeitspferde. Nicht die Sorte, auf denen man reitet.
Der alte Hansen summte vor sich hin und freute sich an dem satten dunklen Braun der Erdschollen, es war Zeit für die zweite Aussaat in diesem Jahr, der Boden war gut. Das Feld war klein, er brauchte keine großen röhrenden Dinger, in die man teuren Diesel kippen musste. Die Leute sagten, er wäre verrückt, weil er alles machte wie früher: mit der Hand, ohne Maschinen. Aber die Leute waren dumm.
Es beruhigte ihn, die Stute vor sich zu sehen, sie hatte einen schwankenden Hintern wie eine Bauchtänzerin … und dann schlug sie aus. Ganz plötzlich. Er sprang zur Seite, sah, wie sie mit den Vorderbeinen in die Luft stieg, panisch wiehernd. Wie sie ausbrach, das Geschirr zerriss, ihn umwarf, vorüberstürmte.
Und da saß er zwischen seinen Erdschollen. Und fluchte.
»Was zum Teufel … das hat sie doch noch nie …«, knurrte er. Der Hengst, noch immer eingespannt, sah ihn nachdenklich an. Eine Fliege summte um seine Nase. Er nieste.
»Du meinst, es war die Fliege?«, fragte der alte Hansen. »Sie hat sich vor einer Fliege erschreckt und ist deshalb so durchgedreht? Schon wieder?«
Jetzt stand die Stute drüben im Gemüsebeet, mit bebenden Flanken, sie war über die kleine Mauer gesprungen und hatte einen Teil der Tomatenpflanzen zertrampelt. Sie sah zu ihm hinüber, nervös mit den Ohren spielend.
»Himmel!«, sagte Hansen. »Was ist bloß mit dir los in letzter Zeit? Warum erschreckst du dich dauernd so?« Er schüttelte den Kopf und sah den Hengst an. »Und du? Guck nicht so unschuldig. Dachtest du, ich weiß nicht, wer nachts aus dem Stall abhaut und heimlich im Mondlicht das Obst von den Bäumen frisst?« Er schüttelte den Kopf. »Seit dem Gewitter seid ihr beide völlig verrückt.«
Dann brachte der alte Hansen die Pferde auf die Weide, weil an diesem Tag nichts mehr zu machen war, und setzte sich in seinen alten, abgewetzten Sessel. Seufzte. Und nahm den Katalog mit den Fotos der schönen rot und grün lackierten Landmaschinen.
2. Kapitel, in dem eine Figur aus einem Ü-Ei mit Anna reden will, sie bei der Waldweide jemanden trifft, den sie nicht erwartet hat, und Apfelmütze und Wackelpo ihre Namen bekommen
»Schöner reiten«, sagte Anna.
»Wie?«, fragte Papa und steuerte den alten grünen Lieferwagen durch das schmale, rosenumwachsene Tor.
»Steht über dem Tor. Schöner reiten«, wiederholte Anna. »So heißt das hier.«
»Hm«, machte Papa und parkte den Lieferwagen zwischen einem großen Stall und einem schicken Auto. Der Lieferwagen klappte seine Rückspiegel ein, weil die Lücke zu eng war. Es sah aus, als lege er die Ohren an.
Er hat auch Angst, dachte Anna. Wie sie.
Sie waren eine Stunde lang gefahren, aber Anna hatte das Gefühl, sie wären Lichtjahre entfernt von zu Hause. Von Pfannkuchen mit Tomatensoße und Schokocreme. Von dem Garten mit den etwas unordentlich wachsenden bunten Sommerblumen und dem hüfthohen Gras.
Hier war alles aufgeräumt und geschniegelt. Die Rosen wuchsen in einem schönen Bogen über das Tor, und die Fensterbretter des weißen Hauses und des Stalls waren hellrosafarben gestrichen und blitzsauber.
»Schöner reiten – Reitkurse und Therapie«, las Anna flüsternd. Die Schrift am Stall war ebenfalls dezent rosa. Ein bisschen verschnörkelt. Wie aus einem Märchen. Und dann trat eine Frau mit zwei Märchenpferden aus dem Stall und kam auf sie zu.
Das eine war ein schokoladenbraunes Pferd, schlank und groß, elegant. Vorn auf der Stirn hatte es einen Stern aus weißem Fell. Das andere Pferd war ein Pony, klein und mit fröhlichen Augen.
»Und das sind dann wohl Anna und ihr Vater«, sagte die Frau, die die Pferde hielt.
Sie stand jetzt genau vor Anna. Sie war groß und schlank und trug eine professionelle Reithose und professionelle Stiefel. Mehr sah Anna nicht von der Frau, denn sie guckte jetzt auf ihre eigenen Stiefel hinab, ihre alten grünen Gummistiefel mit den Froschaugen. Die Stiefel waren beinahe zu klein, aber Anna hatte Papa verboten, sie wegzugeben, weil sie sie mochte.
»Ich bin Heike von Heidenberg«, sagte die Frau sehr sanft. Als könnte Anna beißen, wenn sie unsanft mit ihr sprach.
»Guten Tag«, hörte Anna Papa sagen.
Anna sagte nichts. Es gab nichts zu sagen.
Außer vielleicht, dass Heike von Heidenberg klang wie der Name einer Figur aus einem Überraschungsei. Papa und Anna hatten eine Zeit lang Ü-Eier gesammelt. Aber das mit dem Ü-Ei und dem Namen zu sagen, wäre unhöflich gewesen.
»Anna, du darfst dir heute ein Pferd aussuchen«, sagte Heike aus dem Ü-Ei, ging in die Knie und sah Anna von unten herauf an. Das war ein Trick, ganz plötzlich blickte Anna ihr ins Gesicht, und sie merkte, wie sie rot wurde. Das Heike-Gesicht war genauso sanft wie die Heike-Stimme, sie trug kleine goldene Pferdeohrringe, und ihre Augen waren blau wie Veilchen. Das Haar hatte sie in einem geflochtenen Zopf um ihren Kopf geschlungen und eine winzige rosa Seidenrose hineingesteckt.
»Du kannst Lollipop haben, das ist unser kleines lustiges Pony hier«, erklärte sie. »Oder Balalaika, das ist unsere ruhigste Stute. Wen immer du wählst, ich bin sicher, ihr werdet die besten Freunde werden. Und du und ich, wir auch.« Sie lachte, und Anna versuchte, ihrem Blick auszuweichen.
Heike wartete auf eine Antwort. Schließlich lächelte sie und sagte: »Dann nehmen wir für den Anfang Lollipop, das ist mit der Größe praktischer«, und dann war da plötzlich ein junger Mann neben ihr, der sagte, er hieße Vincent und Anna könnte ihn Vince nennen, und nun würde sie gleich mal sehen, wie sich das anfühlte, auf einem Pferd zu sitzen. Er sagte noch mehr, sehr viel, aber Anna machte ihre Ohren zu, irgendwann musste er ja wieder aufhören zu reden. Sie konnte sich zumachen wie ein Haus seine Türen. Gewöhnlich gaben die Leute irgendwann auf.
Diesmal passierte etwas anderes. Ganz plötzlich packte Vincent Anna und setzte sie auf den Rücken des Ponys.
»Na also«, sagte er mit einem strahlenden Lächeln. »Jetzt bekommst du noch diese schicke Reitkappe auf.« Er setzte ihr eine Kappe mit rosa Blümchenmuster auf den Kopf und klickte sie unter ihrem Kinn zu. »Lollipop und ich zeigen dir den Hof, Anna.« Dann nahm er das Pony am Halfter und ging los, und Heike aus dem Überraschungsei ging auf der anderen Seite neben Anna und legte eine Hand auf ihren Arm und sagte: »Du machst das ganz wunderbar. Schau, da vorne ist unser Labyrinthgarten, da sind lauter kleine nette Wege und überall Rosen, Rosen wirken so beruhigend.«
Anna wollte ihr sagen, dass sie Dornen hatten. Aber sie sagte es nicht. Sie konnte nicht.
Sie dachte an Mama, die Rosen gemocht hatte, aber die wilde Sorte, die am Waldrand wuchsen. Sie dachte daran, wie sie an einem Morgen vor langer Zeit wilde Rosen gepflückt hatte für Mama. Wie sie sich dabei vertrödelt hatte. Und dann …
Auf einmal war alles zu viel. Heikes Hand auf ihrem Arm. Vincent, der schon wieder redete. Die verflixten Rosen. Anna rutschte vom Pony, das Pony wieherte vor Schreck und rannte los, und Anna rannte auch, es war ein einziges Durcheinander, überall waren Rosen und Dornen. Ihre Arme und ihr Gesicht waren zerkratzt, sie hatte ja gewusst, dass man besser Angst vor den Rosen hatte. Wie vor einer Menge Sachen, die harmlos aussahen. Sie kletterte über die Gartenmauer, schrammte sich die Knie auf, ließ sich auf der anderen Seite ins Gras fallen.
Dort rollte sie sich zusammen wie ein Igel.
So fand Papa sie eine halbe Stunde später. Er trug sie zum Lieferwagen. Sie hörte, wie er etwas zu Heike sagte, es klang entschuldigend, aber sie machte wieder die Ohren zu, und die Augen auch, bis sie zu Hause waren.
Später lag sie im Bett und hörte ihn in der Küche telefonieren und gleichzeitig den Abendbrottisch decken. Sie hatte keinen Hunger.
Papa hatte ihr die Schuhe ausgezogen und sie zugedeckt, und sie hatte nichts gesagt, nicht einmal zu Papa.
»Wie?«, sagte er ins Telefon. »Ja. Nein. Wissen Sie, Frau Winterblum, ich hatte so gehofft, dass die Pferde … Anna spricht ja mit Tieren. Ich? Nein, ich bin natürlich kein Tier, mein Gott, ich bin ihr Vater, natürlich spricht sie mit mir! Ich dachte, ein Pferd könnte … Aber ich fürchte, das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Sie hatte Angst vor dem Pferd. Wie immer. Wie vor allem.«
Er klang so enttäuscht. Und er hatte so unrecht! Sie hatte keine Angst vor dem Pferd gehabt. Es waren die Menschen gewesen mit ihren Stimmen und Gesichtern und ihren Erwartungen.
Und dann fasste sie einen Entschluss.
Wenn es Papa so wichtig war, dass sie ritt – dann würde sie reiten.
Sie stand auf und kletterte aus dem Fenster. Das Holz des Fensterbretts unter ihren bloßen Füßen war noch warm von der Julisonne. Es waren nur noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien. Und das nächste Jahr würde das letzte Jahr an der Gesamtschule sein. Danach musste sie in eine andere Schule gehen, weiter weg, in der Stadt. Vielleicht machte Papa sich deshalb Sorgen.
»Ich werde es ihm beweisen«, flüsterte sie in den Sommerwind. »Ich bin mutig. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man redet.«
Und sie lief durchs hohe Gras, an den Bienenstöcken vorbei, wo sie überhaupt keine Angst hatte, denn die Bienen hatten nie mit ihr reden wollen. Dann schnappte sie sich zwei nicht ganz reife Birnen und sprang mit einem Satz über den niedrigen Zaun, und kurz darauf war sie auf ihrem Fahrrad unterwegs durch die Felder in Richtung Wald.
Sie wusste, wo sie ein Pferd fand.
Die Weide war perfekt.
Sie befand sich bereits im Wald, auf einer Lichtung. Aber nicht allzu weit weg vom Waldrand. Nicht so weit, dass es auf dem Weg zu dunkel gewesen wäre. Sie war gerade weit genug im Wald, sodass man sie von den Feldern aus nicht sah.
In ihrer Mitte stand ein knorriger wilder Apfelbaum, und all das hatte etwas Verwunschenes. Verwunschene Pferde auf einer verwunschenen Wiese in einem verwunschenen Wald. Anna und Papa hatten die Pferde einmal beim Spazierengehen entdeckt, sie hatten am Zaun gestanden und ihnen beim Verwunschensein zugeguckt. Und jetzt, im Licht des unendlich langen Sommerabends, war es noch verwunschener.
Als Anna jetzt ihr Rad an den Zaun lehnte und auf das unterste Querholz kletterte, kamen ihr die Pferde vor allem groß vor. Sie waren, um ehrlich zu sein, Riesen. Arbeitstiere. Giganten mit breiten Rücken und plumpen Köpfen und Fellbüscheln über den Hufen. Anna legte die Arme oben auf den Holzzaun und sah ihnen eine Weile zu.
Schließlich hob ein Pferd den Kopf und erwiderte ihren Blick.
Anna zuckte zusammen. Das Pferd zuckte ebenfalls. Es machte einen kleinen Satz in die Luft, mit allen vier Beinen zugleich, und Anna musste lachen. Woraufhin das Pferd ein bisschen beleidigt aussah.
Es drehte sich um und ging davon, langsam, als hätte es sowieso gerade irgendwohin gehen wollen.