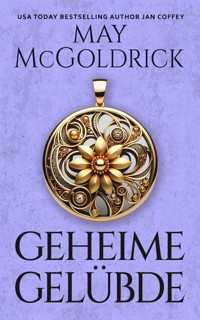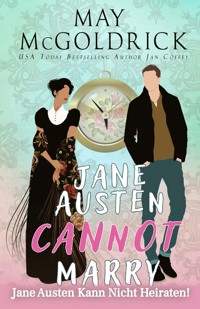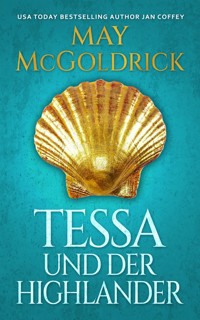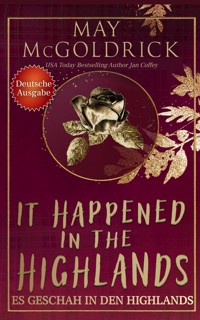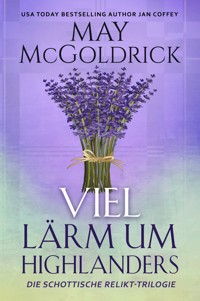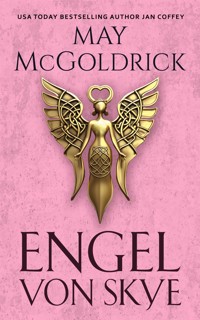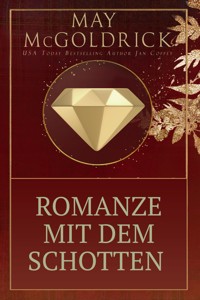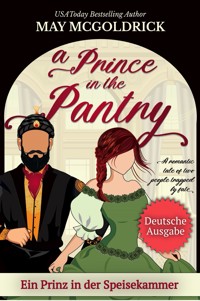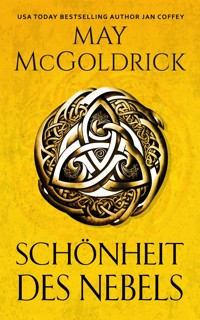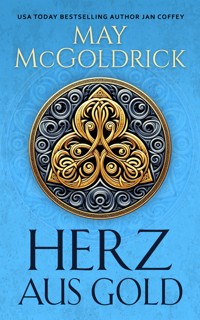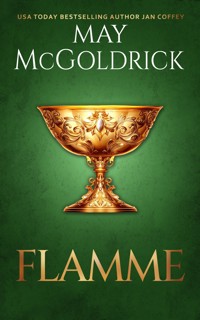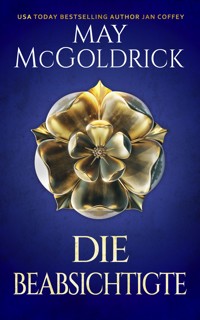
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: EIN ROMAN DES MACPHERSON-CLANS
- Sprache: Deutsch
EIN ROMAN DES MACPHERSON-CLANS Ein Roman voller Liebe, Intrigen und rücksichtslosem Ehrgeiz am Hof Heinrichs VIII. - die Geschichte zweier Highlander in einem fremden und feindlichen Land... Jaime Macpherson lernte auf der Isle of Skye die Bedeutung von Verrat kennen, als ihr geliebter Malcolm MacLeod eine andere Frau heiratete, um sein Erbe zu retten. Ihre Träume vom Glück zerschlugen sich und sie suchte Zuflucht im eleganten Palast des Herzogs von Norfolk. Dort findet Jaime Malcolm wieder, der als Gefangener im Kerker des Schlosses sitzt. In der eisigen Finsternis lernt sie, wieder zu lieben. Aber da sich England und Schottland im Krieg befinden, würde ihr kühner Plan, Malcolm zu befreien, ihr eigenes Leben gefährden ... obwohl ihre Leidenschaft sie auf ein Schlachtfeld aus Blut und Tränen führt, wo nur ein tapferes und wahres Herz sie retten kann ... "Die Liebe triumphiert in dieser reichhaltigen, romantischen Geschichte.- Nora Roberts "Niemand fängt den Zauber und die Romantik der britischen Inseln so ein wie May McGoldrick!"- Miranda Jarrett
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Beabsichtigte
The Intended
2nd German Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Danke, dass Sie sich für Die Beabsichtigte entschieden haben. Falls Ihnen dieses Buch gefallen hat, bitten wir Sie, es weiterzuempfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder sich mit den Autoren in Verbindung setzen.
Die Beabsichtigte (The Intended) © 2017 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung ©2025 von Nikoo und James McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers verboten: Book Duo Creative.
KEINE KI-TRAINING: Ohne die ausschließlichen Rechte des Autors [und des Verlags] gemäß dem Urheberrecht in irgendeiner Weise einzuschränken, ist jede Verwendung dieser Veröffentlichung zum „Trainieren“ generativer künstlicher Intelligenz (KI)-Technologien zur Generierung von Texten ausdrücklich untersagt. Der Autor behält sich alle Rechte vor, die Nutzung dieses Werks für das Training generativer KI und die Entwicklung von Sprachmodellen für maschinelles Lernen zu lizenzieren.
Erstmals veröffentlicht von Topaz, einem Imprint von NAL, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Vorschau auf FLAMME
Über den Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Für Larry und Gail
KapitelEins
Insel Skye, Schottland
April 1539
Das Hochzeitskleid war mit funkelnden Edelsteinen besetzt, doch die strahlenden Augen der Braut stellten sogar diese Pracht in den Schatten.
Dienstmädchen huschten zwischen unausgepackten Truhen im Raum umher, aber Jaime Macpherson stand regungslos und stumm neben ihrem Bett und starrte die sorgfältig ausgebreitete weiße Robe an, die symbolisierte, daß ihr Traum nun endlich in Erfüllung ging. Jahrelang hatte sie darauf gewartet, und nun war es soweit: sie würde den Mann heiraten, den sie seit ihrer Kindheit liebte.
Ein lautes Klopfen an der offenen Tür und die kräftige Stimme ihrer Zofe Caddy rissen Jaime jäh aus ihrer Verzückung, und plötzlich bemerkte sie das hektische Treiben ringsum.
»Wenn wir uns nicht beeilen, werden Sie Ihre eigene Hochzeit verpassen, Mylady«, rief die ältere Frau atemlos, und ihr hochrotes Gesicht legte beredtes Zeugnis von der allgemeinen Aufregung ab.
»Findet die Trauung etwa heute schon statt?« staunte Jaime. »Wir sind doch soeben erst angekommen. Woher wußte Malcolm, daß wir rechtzeitig hier sein würden? Wie …«
Caddy brachte ihre junge Herrin mit einer energischen Geste zum Schweigen. »Für Gerede bleibt uns keine Zeit, Mylady. Lord Malcolm ist schon unterwegs zur Abtei … und alle anderen sind es auch!«
Jaimes Herz klopfte zum Zerspringen. Malcolm machte sein Versprechen wahr und nahm sie zur Frau! Sie griff nach dem Brautkleid, drückte es an sich und wirbelte im Zimmer herum, blieb aber gleich darauf abrupt stehen. »Wie soll ich denn zur Abtei kommen, wenn alle schon aufgebrochen sind?« fragte sie bestürzt.
»Sie sind die Braut, Mylady, und unser Schiff wurde schon aus der Ferne gesichtet«, berichtete Caddy, die mit gerunzelter Stirn den Dienstmädchen strenge Anweisungen erteilte. »Der Festordner hat mir mitgeteilt, daß die Trauung zur Vesperzeit anberaumt ist, und Lord Malcolm hat Ihnen selbstverständlich eine Eskorte zur Verfügung gestellt, die Sie zu Ihrem Bräutigam bringen wird. Diese Männer haben es aber eilig, Dunvegan zu verlassen, und deshalb dürfen wir jetzt wirklich keine Zeit mehr vergeuden, Mylady!«
»Ja, du hast recht«, flüsterte Jaime aufgeregt.
Malcolm MacLeod, Oberhaupt seines Clans und Herr über Skye und andere Hebrideninseln, schaute zur Tür hinüber. Soeben hatte sein Bote die große Halle betreten, und er unterbrach seine Unterhaltung mit einigen Gästen und winkte den jungen Mann zu sich heran.
»Das Schiff hat angelegt, Mylord«, berichtete der Bote.
»Und? Hast du Lady Jaime getroffen?« fragte Malcolm ungeduldig. »Hast du ihr die Neuigkeiten mitgeteilt?«
Der Mann trat nervös von einem Bein aufs andere. »Ja, Mylord … das heißt, nein, Mylord … ich habe nicht mit ihr gesprochen … aber ich habe gesehen, daß Ihr Festordner David mit Lady Jaimes Zofe geredet hat. Bestimmt hat er ihr alles erzählt und … und …«
Sein verlegenes Gesicht brache Malcolm zu Bewußtsein, daß er den Burschen überfordert hatte. Er hätte Jaime persönlich informieren müssen, aber dazu war ihm leider keine Zeit geblieben.
»Gut, ich werde mich später selbst darum kümmern und …« Er verstummte und ließ den Boten stehen, um das Oberhaupt des MacDonalds-Clans zu begrüßen.
»Ich bin so aufgeregt, Caddy«, murmelte Jaime. »Mir ist richtig schwindelig!«
»Das ist ganz normal, Mylady«, beruhigte die Zofe ihre Herrin, »aber werden Sie bitte nicht ohnmächtig, bevor ich Ihnen das Kleid angezogen habe, sonst …«
Beide drehten sich erschrocken um, als hinter ihnen ein Aufschrei ertönte, und stellten fest, daß eine Perlenkette zerrissen war. Entsetzt beobachtete das für dieses Mißgeschick verantwortliche Dienstmädchen, wie die weißen Kugeln auf dem Boden in alle Richtungen hüpften und rollten. Es fiel auf die Knie, blickte flehend zu Jaime empor und brach in Tränen aus. »Es tut mir so leid, Mylady … Die Schnur …«
Jaime eilte auf das schluchzende Mädchen zu. »Ich weiß, die Schnur war viel zu alt. Mir selbst hätte das auch passieren können.«
»Aber … Mylady …«
»Denk nicht mehr daran«, sagte Jaime tröstend. »Komm, sammeln wir die Perlen zusammen auf.«
Tränenüberströmt lächelte das Mädchen ihr dankbar zu.
»Und dann kannst du mir helfen, diese Blumen in mein Haar zu flechten«, fuhr Jaime fort. »Sie passen sowieso besser zum Kleid als die Perlenkette, findest du nicht auch?«
Als Malcolm den kleinen Friedhof verließ, wo er lange am Grab seiner Mutter gekniet hatte, bot sich ihm ein erfreulicher Anblick: vor der Abtei drängte sich eine erwartungsvolle Menge – Dörfler und Mitglieder der verschiedenen Clans, alle festlich gekleidet.
Der junge Krieger ließ seinen Blick stolz über die vielen glücklichen Menschen schweifen und dachte auf dem Weg zur Kapelle, daß er bestimmt die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Die Dudelsäcke verstummten, und ein Raunen ging durch die Menge, als die Braut mit ihrer Eskorte durch das Tor der Abtei ritt. Alle gafften die schöne junge Frau an, der ein Ritter beim Absteigen von ihrem prächtigen rotbraunen Pferd half. Er geleitete sie auch die Treppe zur Kapelle empor, deren Tür weit geöffnet war. Trotzdem stolperte sie auf der obersten Stufe.
»Ist alles in Ordnung, Mylady?« fragte der Ritter, dessen Stimme tiefe Besorgnis verriet.
»Ja«, flüsterte die Braut. »Es ist nur die Aufregung. Führen Sie mich hinein.«
Goldene Sonnenstrahlen fielen durch die schmalen Fenster ein und zerteilten die Weihrauchschwaden. Die kleine Kapelle hatte sich mit Familienangehörigen und Freunden gefüllt, und das Brautpaar stand vor dem Altar und lauschte dem alten Priester, der die üblichen Gebete murmelte.
Das bleiche Gesicht der Braut schien zu leuchten, weil die Goldfäden, die zusammen mit weißen Blumen in ihr dunkles Haar geflochten waren, das Licht einfingen und widerspiegelten. Ihr weißes Hochzeitskleid schimmerte, und sie hatte einen großen Strauß Rosmarin im Arm – dem Symbol für Liebe und Treue.
Der Bräutigam sah sehr imposant aus: ein goldenes Band hielt seine langen braunen Haare im Nacken zusammen, und zum Kilt in den Farben seines Clans trug er ein weißes Seidenhemd und hohe weiche Stiefel. Seine Auserkorene errötete leicht, als er ihr einen flüchtigen Seitenblick zuwarf, und er schenkte ihr ein beruhigendes Lächeln, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Priester konzentrierte.
Ungeduldig warteten die Hochzeitsgäste auf das Gelöbnis. Mitglieder der beiden wichtigsten Clans von Skye – der MacLeod und der MacDonald – waren besonders zahlreich vertreten, aber auch der Macpherson-Clan bildete eine würdige Gruppe, und es war Alex Macpherson, der frühere Herr über diese Region, der jetzt neben Malcolm stand und den jungen Mann, den er und seine Frau Fiona wie einen eigenen Sohn aufgezogen hatten, mit väterlicher Zuneigung betrachtete.
Der Priester rezitierte die vorgeschriebenen Gebete in lateinischer und gälischer Sprache, und die hinter einem Eisengitter verborgenen Nonnen der Abtei respondierten. Endlich drehte er sich um und schritt die Altarstufen hinab, gefolgt von den Ministranten. Malcolm wandte sich seiner Braut zu, deren leicht verschleierte Augen vor freudiger Erregung leuchteten, und griff zärtlich nach ihren Händen.
Der Priester verstummte für einen Augenblick, und die Gemeinde hielt den Atem an. In der Kapelle war es plötzlich so still, daß sogar das Knistern einer Kerze deutlich zu hören war. Unwillkürlich schaute Malcolm zu der flackernden Flamme hinüber und dachte über die Bedeutung dieser Trauung nach. Ein wichtiger Schritt, ein längst überfälliger Schritt … Nein, korrigierte er sich sofort, ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Dieses Bibelzitat ging ihm durch den Kopf, während er wieder in das liebliche Gesicht seiner Braut blickte.
Als die schwere Eichentür knarrte, drehte er den Kopf zur Seite, konnte aber zunächst nicht sehen, wer eintrat. Ihm fiel nur auf, daß die Menschen, die in der Nähe des Portals standen, etwas zurückwichen, und daß sich in ihren Gesichtern tiefe Bestürzung widerspiegelte.
Nun sah auch Malcolm die bezaubernde junge Frau, die zögernd die Kapelle betreten hatte. Ihr Hochzeitskleid funkelte im Schein der tausend brennenden Kerzen, und ihr Gesicht verlor von einer Sekunde zur anderen jede Farbe, bis es fast so weiß wie die elegante Robe war.
Jaime zitterte wie Espenlaub. Sie verkrampfte ihre Hände vor der Taille und lehnte sich an die Tür, weil ihre weichen Knie nachzugeben drohten. Ihre Beine schienen sich völlig ihrer Kontrolle entzogen zu haben, so daß sie nicht einmal flüchten konnte. Alle Hochzeitsgäste hatten sich nach ihr umgedreht, und sie wurde von neugierigen Blicken durchbohrt. Mit dem Gefühl, als würde ihr Herz vor Schmerz in Millionen Splitter zerbrechen, starrte sie tränenblind zum Altar, wo er Hand in Hand mit einer anderen Frau stand.
»Ich hasse dich, Malcolm MacLeod«, flüsterte sie. »Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dich abgrundtief hassen!«
Mit letzter Kraft riß sie die Tür auf und stürzte aus der Kapelle ins Freie.
KapitelZwei
Kenninghall Palace, Norfolk, England
Juni 1540
Geschrei und dröhnende Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster lenkten Jaimes Aufmerksamkeit von den Kindergesichtern ab. Unwillkürlich warf sie einen Blick aus dem Fenster: ein Regenschauer hatte auf der Scheibe Tropfen hinterlassen, die jetzt in der Spätnachmittagssonne wie Diamanten funkelten. Lächelnd lauschte sie dem freudigen Tumult, der mit der Begrüßung der heimkehrenden Krieger verbunden war. Die kräftige Stimme von Thomas Howard, dem Herzog von Norfolk, der seinen zweiten Sohn willkommen hieß, übertönte den übrigen Lärm, aber Jaime sah keine Veranlassung, den Unterricht abzubrechen, denn sie würde abends beim Festbankett genügend Gelegenheit haben, Lord Edward Howard zu seinem neuesten Triumph zu gratulieren.
Die Finger an ihrer Laute, nickte sie den Schülern zu, die ihre Augen sofort gehorsam auf die Notenblätter richteten, mit Ausnahme der drei ältesten Jungen, die sehnsüchtig zu den Fenstern hinüberschauten. Pro forma hob Jaime zwar vorwurfsvoll die Brauen, aber im Grunde konnte sie die Unruhe der Burschen gut verstehen. Für die vier Mädchen, die mit ihren Instrumenten neben ihr standen, schien es hingegen nichts Wichtigeres als diese Probe zu geben. Mit großen aufmerksamen Augen beobachteten sie ihre Lehrerin.
»Noch einmal, dann machen wir für heute Schluß«, versprach Jaime. »Strengt euch also bitte alle an.« Sie lächelte einem kleinen rothaarigen Mädchen in der ersten Reihe der Sänger zu. »Kate, ich möchte, daß du ein bißchen kräftiger singst. Willst du es mir zuliebe versuchen?«
Das schmächtige Ding nickte schüchtern und zupfte verlegen an dem verblichenen Band, das ihr Kleidchen in der Taille zusammenhielt. »Ja«, flüsterte sie kaum hörbar, mit hochroten Wangen, und schaute nervös die beiden viel größeren und stämmigeren Mädchen zu ihrer Rechten und Linken an. Kate war das jüngste der neun Kinder des Falkners Evan, und Jaime wußte, daß dieses zierliche Geschöpf eine sehr hübsche Singstimme hatte. Als sie jetzt einen Finger hob, stimmten ihre Schüler ›I Will Give You Joy‹ an. Flöten und Lauten spielten in perfekter Übereinstimmung, und auch der Chor bot eine überzeugende Leistung – bis auf Kate, die ihre zitternden Lippen kaum bewegte. Mit einer gebieterischen Geste brachte Jaime alle zum Schweigen und zog die Kleine zu sich heran.
»Ich hab’s wirklich versucht«, murmelte Kate, »aber ich kann einfach nicht lauter singen.«
Jaime nickte verständnisvoll, legte ihr einen Arm um die Schultern und schaute aufmerksam in die grünen Augen des Mädchens. »Deine Mutter hat mir erzählt, wie gut dir das Band gefällt, das ich dir gestern geschenkt habe.«
»O ja«, berichtete Kate strahlend, »ich habe es nachts neben mein Bett gelegt, aber benutzen tu ich’s erst bei der Sommersonnenwende.«
»Dann stell dir jetzt mal folgendes vor«, fuhr Jaime ruhig fort. »Du kommst von unserem Unterricht nach Hause, und dein Band ist nicht mehr da.« Die entsetzte Miene des Mädchens verriet ihr, daß es sich diese Katastrophe lebhaft vorstellen konnte. »Du rennst aus dem Haus und siehst, daß dein Bruder Johnny dein Band einem Falken umgebunden hat. Eine Jagdgesellschaft will gerade aufbrechen, und dein Bruder will den Falken mitnehmen. Denk daran – die Stallknechte brüllen herum, und du kannst Johnny nicht mehr einholen … Ruf ihn, Kate! Los, ruf ihm zu, daß du dein Band zurückhaben möchtest!«
Das kleine Mädchen kreischte so durchdringend, daß alle sich die Ohren zuhielten, nur um gleich darauf schallend loszulachen. Auch Kate selbst kicherte, und Jaime tätschelte ihr grinsend die Wange. »Siehst du – deine Stimme ist kräftig, wenn du dir Mühe gibst!«
Nachdem sie das Lied noch einmal gesungen hatten, wobei Kates heller Sopran deutlich zu hören war, beschloß Jaime, ihre Schüler zu entlassen. Sie hatte kaum ausgesprochen, als die Tür des Musikzimmers aufflog und eine Blondine mit flatternden Haaren hereinstürmte.
Die Kinder rannten an ihr vorbei, und notgedrungen hielt Mary Howard ihnen die Tür auf. »Der keine Rotschopf hätte mich fast über den Haufen gerannt«, jammerte sie kopfschüttelnd. »Die Göre hatte es ja schrecklich eilig.«
»Ich glaube, sie muß sich vergewissern, daß ihr kostbares Band nicht verschwunden ist«, erklärte Jaime lächelnd, während sie die losen Notenblätter einsammelte und zu einem Tisch am Fenster trug.
Mary folgte ihr ungeduldig. »Hör doch endlich mit deiner blöden Musik auf, Dummchen! Hast du nicht mitbekommen, daß Lord Edward zurückgekehrt ist?«
Jaime warf ihrer aufgeregten Kusine über die Schulter hinweg einen amüsierten Blick zu, legte die Notenblätter sorgfältig aufeinander und beschwerte sie mit einem Gesangbuch. »O Mary, sollen wir jedesmal, wenn ein halbwegs ansehnlicher Mann angeritten kommt, völlig aus dem Häuschen geraten?«
»Puh, Jaime, du weißt doch genau, daß Lord Edward nur an dir interessiert ist! Und jetzt ist er nach einer großen Seeschlacht mit dem Feind nach Hause gekommen.«
Jaime hatte sich schon oft gefragt, warum die lebhafte Mary sie zu ihrer besten Freundin erkoren hatte, obwohl es im Palast des Herzogs von Norfolk jede Menge Nichten und Neffen der Howards ebenso wie Kinder anderer Adelsfamilien gab. Doch als sie nach dem Tod ihres Großvaters Thomas Boleyn nach Kenninghall eingeladen worden war, hatte Mary spontan Zuneigung zu ihr gefaßt, und daran hatte sich auch nichts geändert, als Edward Howard – ihrer beider Vetter – sich in Jaime verliebte.
Mary – selbst eine gute Partie und überaus reizvoll – rühmte sich, über jede Adelsfamilie und jeden Heiratskandidaten in ganz England genauestens Bescheid zu wissen. Sie rief Jaime oft ins Gedächtnis, daß Edward zwar nur der zweitgeborene Sohn des Herzogs, aber trotzdem ein begehrenswerter Junggeselle war: attraktiv, wohlhabend und ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Eines Tages müsse Jaime ja sowieso heiraten, argumentierte Mary, da sei es doch nur vernünftig, einen würdigen Mann zu erhören, der so beharrlich um sie werbe.
Jaime hatte ihrer Kusine nie widersprochen. An Edward gab es wirklich nichts auszusetzen, und als seine Frau brauchte sie nie mehr nach Schottland zurückzukehren. Sie wußte, daß ihre Eltern – Elizabeth und Ambrose Macpherson – dieser Verbindung zustimmen würden, freilich eher resigniert als freudig, doch nach jenem peinlichen Auftritt in der Abtei auf der Insel Skye, der Jaime zur Flucht aus ihrer Heimat veranlaßt hatte, würden sie verstehen, daß ihre Tochter ein ganz neues Leben beginnen wollte – fernab des geliebten schottischen Hochlands mit seinen wilden Gebirgszügen.
Jaime atmete tief durch und betrachtete aufmerksam das Porträt über dem Kamin, das Holbein im vergangenen Winter gemalt hatte: Edward und sein älterer Bruder Henry auf prächtigen Jagdpferden vor dem Palast, umgeben von ihren Hunden und Dienstboten.
Sie wußte, daß Edward sie begehrte – er machte gar kein Hehl daraus – und nur auf ein Zeichen von ihr wartete, das ihm beweisen würde, daß sie willens war, alles anzunehmen, was er ihr zu bieten hatte. Doch genau darin bestand die Schwierigkeit, dachte sie seufzend. Er wollte, daß sie ihm ihr Herz schenkte, und das war ihr bisher nicht gelungen.
Ihr Blick schweifte zu dem ordentlichen Stapel von Notenblättern. Musik … Am liebsten hätte sie sich für den Rest ihres Lebens nur mit Musik beschäftigt. Sie brauchte keine Liebe, um glücklich zu sein. Sie hatte kein Bedürfnis nach Leidenschaft. Sie sehnte sich nicht nach einem Ehemann.
Sie wünschte, Edward wäre weniger hartnäckig.
Marys Stimme riß sie aus ihren Gedanken. »Der Bote hat berichtet, das Schiff sei mit Schützen beladen, Kusine!« Sie packte Jaime am Ellbogen, drehte sie herum und musterte ihr schlichtes Kleid. »Was glaubst du, welches kostbare Schmuckstück Edward seiner geliebten Jaime diesmal mitgebracht hat?«
»Hör auf, Mary! Manchmal redest du wirklich dummes Zeug daher!«
»Nein, ich sage die Wahrheit! Als er zuletzt irgendwo in der Nordsee jene spanische Galeone kaperte, schenkte er dir das Wertvollste, was er erobert hatte – das Medaillon mit dem riesigen Rubin …«
»Ich wollte es nicht haben, Mary, und es gefällt mir nicht einmal. Ich brauche keine teuren Geschenke, und du weißt genau, daß ich das Medaillon kein einziges Mal getragen habe.«
Mary stieß einen tiefen Seufzer aus. »Oh, ich für meine Person hätte nichts dagegen, so verwöhnt zu werden … Aber vielleicht wird sein Geschenk deinem Geschmack diesmal eher entsprechen … schließlich hast du ja eine Schwäche für alles Französische!«
Jaime schüttelte den Kopf. »Nein, meine Liebe, du kannst sicher sein, daß ich kein noch so herrliches Kleinod annehmen werde, wenn es von einem französischen Schiff gestohlen wurde. Es ist mir einfach unmöglich, in den Franzosen Feinde zu sehen.«
Mary runzelte mißbilligend die Stirn. »Wenn du schon Lord Edwards Aufmerksamkeit nicht genügend zu schätzen weißt, solltest du wenigstens deine Vorliebe für die Franzosen verschweigen. Es ist schon schlimm genug, daß du eine halbe Schottin bist, aber solches Gerede grenzt an Verrat, da bin ich mir ganz sicher. Du mußt endlich kapieren, daß die Franzosen unsere Feinde sind.«
Jaime wußte, daß eine Diskussion mit ihrer Kusine sinnlos wäre. Mary war ein liebes Ding, aber sie hatte ihr ganzes Leben im Hause des Herzogs verbracht, und deshalb war ihr geistiger Horizont ziemlich beschränkt. Jaime selbst hatte hingegen die Möglichkeit gehabt, ihren Gesichtskreis zu erweitern, aber als Gast mußte sie mit kritischen Äußerungen vorsichtig sein.
»Meine liebe patriotische Kusine«, lächelte sie resigniert, um Mary zu beruhigen, »ich verspreche dir hoch und heilig, gefährliche Gesprächsthemen dieser Art zu meiden, um unserem heldenhaften Vetter Edward nicht die Stimmung zu verderben. Und jetzt sollten wir uns beide wohl schönmachen …«
Eine Stunde später betraten die beiden jungen Frauen in ihren schönsten Sommerkleidern aus leichter Seide, mit Samt und Gold verziert, die große Palasthalle, wo sich schon zahlreiche Gäste für das Bankett eingefunden hatten.
Abgesehen vom Königspalast Hampton Court konnte es kein englisches Schloß an Größe und Pracht mit Kenninghall aufnehmen, dem Heim des Herzogs von Norfolk. H-förmig erbaut, mit weiten Flügeln nach Norden und Süden, kündete es von der Macht der Familie Howard, der in Ostengland riesige Gebiete gehörten. Als Jaime diese Halle vor fast einem Jahr zum erstenmal betreten hatte, waren nur zwei Zwerge auf Ponys aufgetreten, um beim Abendessen mit einem imitierten Turnierkampf für Unterhaltung zu sorgen. Heute hingegen waren die Wände zu Ehren von Edwards erfolgreicher Heimkehr mit riesigen Blumengirlanden geschmückt, und man hatte ein Zelt mit einer Bühne für die geplanten Veranstaltungen aufgebaut. Jaime trennte sich von ihrer Kusine und trat in den Schatten dieses Zelts, um sich ungestört umschauen zu können. Obwohl die Halle ihr nun schon lange vertraut war, beeindruckte der Luxus sie stets aufs neue und erinnerte sie an die Häuser, die ihre Eltern in verschiedenen Städten auf dem europäischen Festland besaßen.
Ihre Eltern … Wehmütig dachte sie an die beiden geliebten Menschen, an Elizabeths Tränen und Ambroses innige Umarmung, als sie ihnen eröffnet hatte, daß sie Schottland verlassen wolle. Doch so schwer es ihnen auch gefallen war, ihre einzige Tochter in die Ferne ziehen zu lassen, hatten sie ihr doch zugestimmt, daß es unter den gegebenen Umständen das Beste für sie war.
Unwillkürlich schweiften ihre Gedanken wieder einmal zu all den Ereignissen zurück, die sie schließlich in jene kleine Kapelle auf der Insel Skye geführt hatten, und ihre Miene verdüsterte sich. Warum nur quälte sie sich zum abertausendsten Mal mit den Erinnerungen an Malcolm MacLeod, in den sie sich auf den ersten Blick verliebt hatte, als sie ihn vor vielen Jahren in Benmore Castle kennenlernte?
In jenem Sommer war so vieles auf sie eingestürmt … Kurz nach ihrer Ankunft in der Stammburg der Macphersons am Nordufer des Flusses Spey war ihr Bruder Michael geboren worden, und außerdem hatte sie von einem Tag auf den anderen eine große Familie gehabt – Großeltern, Vettern und Kusinen, lauter Menschen, die sie nie zuvor gesehen hatte. Auch Malcolm gehörte dazu – mit sechzehn schon fast ein erwachsener Mann, während sie ein vierjähriges Kind war. Sie waren nicht blutsverwandt, denn Malcolm war nur das Mündel ihres Onkels Alex Macpherson, aber sie fühlte sich sofort zu ihm hingezogen, weil er so freundlich und tapfer war, soviel Wärme und Güte ausstrahlte. Sie wollte unbedingt von ihm wahrgenommen und respektiert werden, sie wollte zu jenen Personen gehören, denen seine Zuneigung galt.
Damals hatte alles angefangen, dachte Jaime niedergeschlagen. Eine törichte, kindische Liebe … Vierzehn Jahre lang hatte sie geträumt und sich Illusionen gemacht, bis zu jenem schrecklichen Tag, als Malcolm eine andere Frau geheiratet hatte.
Fröstelnd verschränkte sie ihre Arme vor der Brust, so als könnte sie sich auf diese Weise gegen den Schmerz wappnen, den sie beim Gedanken an die brutale Konfrontation mit der Realität auch heute noch verspürte. Unvorstellbar, wie naiv, wie idealistisch und unschuldig sie gewesen war! Sie hatte jeden Moment genossen, den sie in seiner Nähe verbringen konnte, er war ihre Sonne gewesen, der absolute Mittelpunkt ihres Lebens … Und sie hatte sich eingeredet, daß er ihre Liebe erwiderte! Damit hatte sie sich getröstet, wenn er irgendwo in der Ferne weilte, ob er nun in St. Andrew’s und bei Erasmus von Rotterdam studierte, an den Grenzen harte Kämpfe ausfocht oder versuchte, seinem Volk auf den Hebrideninseln Frieden zu bescheren. Als sie selbst für drei Jahre nach Frankreich geschickt wurde, um eine gute Ausbildung zu erhalten, hatte sie geglaubt, daß Malcolm auf sie warten würde. Er war immer so liebevoll gewesen, hatte ihr so bereitwillig seine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Mittlerweile war ihr natürlich klar, daß sein Verhalten nie auf Verliebtheit hingedeutet hatte. Nein, sie war für ihn einfach das kleine Mädchen gewesen, das ihm auf Schritt und Tritt folgte …
Jaime legte ihre Hände auf die glühenden Wangen. Ihr schoß unweigerlich die Schamröte ins Gesicht, wenn sie sich daran erinnerte, wie verzweifelt sie einen richtigen Kuß von Malcolm ersehnt hatte, bevor sie an Bord des Schiffes nach Frankreich gehen mußte. Mit ihren fünfzehn Jahren hatte sie sich für eine erwachsene Frau gehalten, aber er war offenbar anderer Ansicht gewesen, denn er hatte sich mit guten Wünschen und einem brüderlichen Kuß auf die Stirn begnügt.
Die drei Jahre in Frankreich hatten ihr Wissen und ihren geistigen Horizont erheblich erweitert, doch wann immer sie Gedichte vortrug, sang oder ein Instrument spielte, kreisten ihre Gedanken um Malcolm. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin, weil sie von der Idee beflügelt wurde, daß er eine gebildete Frau brauchte, und sie schrieb ihm viele Briefe, die er regelmäßig beantwortete. Diese Korrespondenz bestärkte sie in dem Glauben, daß ihre Beziehung sich verändert hatte, daß Malcolm sie jetzt liebte. Er berichtete ihr ausführlich von seinem Leben und erkundigte sich teilnahmsvoll nach ihren Fortschritten. Tiefe Zuneigung sprach aus seinen Zeilen, das hatte sie sich bestimmt nicht nur eingebildet. Nein, das war völlig ausgeschlossen!
Und dann war alles sehr schnell gegangen. Kurz vor der ohnehin geplanten Abreise nach Schottland hatte sie zwei Briefe erhalten, einen von ihren Eltern, die ihr mitteilten, daß Malcolm sich zur Ehe entschlossen habe, und einen von ihm selbst, in dem er diesen Schritt damit begründete, daß er den ständigen blutigen Fehden in seinem Land ein Ende bereiten wolle, und dazu bedürfe es eines Erben.
Ihr schrecklicher Irrtum weckte in Jaime sogar rückblickend den Wunsch, daß der Boden sich auftun und sie verschlingen möge. Sie hatte keinen Augenblick daran gezweifelt, daß Malcolm sie zur Frau nehmen würde, und in blinder Begeisterung hatte sie Vorkehrungen für ihre Hochzeit getroffen.
Eine Traumhochzeit sollte es sein, und dann … Die Erinnerung an jenen gräßlichen Tag trieb ihr immer noch Tränen in die Augen. Ihre Eltern hatten sich allerdings großartig verhalten: nach dem peinlichen Auftritt in der Kapelle hatten Ambrose und Elizabeth das Fest sofort verlassen und Jaime nach Sterling gebracht, wo sie sich wie ein weidwundes Tier verkroch, bis sie erfuhr, daß ihr Großvater schwer erkrankt war. Ihr war klar, daß sie nicht in Schottland bleiben konnte, denn hier wäre sie gezwungen, Malcolm und seine Frau zu sehen, und es ginge einfach über ihre Kräfte mitzuerleben, wie eine andere sich in dem Glück sonnte, von dem sie selbst geträumt hatte. Nein, sie mußte Schottland verlassen und durfte nie zurückkehren.
Deshalb war sie zu ihrem Großvater nach Kent gereist, der jedoch kurze Zeit später starb. Hever Castle, sein Stammsitz, wurde von Offizieren des Königs beschlagnahmt, und Jaime war heilfroh und sehr dankbar, als ihr Großonkel, der Herzog von Norfolk, sie nach Kenninghall einlud, denn das ersparte ihr eine schmerzliche Rückkehr in die Heimat …
Hör auf damit, rief sie sich jetzt streng zur Ordnung. Zieh endlich einen Schlußstrich unter die Vergangenheit! Unter Aufbietung aller Willenskraft gelang es ihr, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die zu ihrem neuen Leben gehörten. Von ihrem Standort aus konnte sie sehen, daß Mary aufgeregt auf Lady Frances einredete. Die schöne Gemahlin des abwesenden Grafen von Surrey fing Jaimes Blick auf und lächelte ihr über die Halle hinweg zu. Edward war seltsamerweise nirgends zu sehen.
»Wärst du beeindruckt, wenn ich dir sagen würde, daß ich dir Perlenketten mitgebracht habe, die länger als jene Blumengirlanden sind?«
Jaime schüttelte den Kopf, ein belustigtes Lächeln auf den Lippen.
Edward stand so dicht hinter ihr, daß sein Waffenrock ihr Kleid streifte.
»Und wenn ich sagen würde, daß ich dir Saphire mitgebracht habe, die so groß und schwarz wie deine Augen sind?«
Sie spürte seinen heißen Atem an ihrem Ohr, und seine Lippen berührten ihren Hals. Mit einem großen Schritt nach vorne schaffte sie etwas Distanz, bevor sie sich umdrehte. Sein Auftreten war so selbstbewußt wie immer, sein Lächeln siegessicher.
»Du bist ein unverschämter Bursche, Edward Howard!« tadelte sie, brachte ihn damit aber nur zum Lachen.
»Ich bin ein armer, einsamer zurückgewiesener Freier, Jaime Macpherson«, konterte er, griff nach ihren Händen und ließ seine Blicke anzüglich über ihr tiefes Dekolleté schweifen, das die wohlgeformten Brüste großzügig zur Schau stellte. Diese unverfrorene Inspektion ihrer Reize trieb ihr leichte Röte in die Wangen, ebenso wie seine Bemerkung: »Für einen heimkehrenden Krieger bist du wirklich eine Augenweide!«
»Ich nehme an, Lord Edward«, erwiderte sie schlagfertig, »daß nach so langer Zeit auf See sogar der Anblick eines räudigen Köters eine erfreuliche Abwechslung wäre!«
»Ah … deine übliche Bescheidenheit!« Er ließ ihre Finger los, schob seine Hände unter die langen weiten Ärmel und streichelte ihre nackte Haut. Als Jaime zurückweichen wollte, packte er sie wieder bei den Händen. »Wie oft habe ich davon geträumt, nach Hause zu kommen, dein strahlendes Gesicht zu sehen und deine seidige Haut unter meinen Lippen zu spüren …«
»Fast könnte man den Eindruck gewinnen«, fiel sie ihm ins Wort, »als wärst du selbst ein brünstiger Köter!«
»Ja«, gab Edward ungerührt zu, während er ihre Finger an seine Lippen führte. »Allerdings bin ich kein Straßenköter, sondern ein edler Hund mit Stammbaum, ein bestens trainierter Jagd- und Kampfhund.« Er schaute ihr tief in die Augen. »Willst du dieses treue und mutige Tier, das zu deinen Füßen hechelt, nicht streicheln?«
»Ein törichter Welpe bist du, weiter nichts!«
»Wie wahr, meine Süße!« Er senkte die Stimme. »Aber das Jagdfieber ist mir angeboren … und du bist meine Beute!«
In der Hoffnung auf irgendeine Ablenkung schaute Jaime sich nervös in der Halle um. Immer noch strömten Gäste zur Tür herein, aber niemand schenkte ihr und Edward Beachtung, und er nutzte ihre vorübergehende Unaufmerksamkeit aus, um einen Arm um ihre Taille zu schlingen und sie in das Zelt zu ziehen. Bevor er sie an seinen muskulösen Körper pressen konnte, stemmte sie sich heftig ab.
»Nicht, Edward! Überall sind Leute!«
»Dann komm eben mit auf mein Zimmer!«
Jamie wurde scharlachrot. »Wir haben doch noch nie …«
»Es ist höchste Zeit, Jaime«, murmelte er heiser. Eine Hand glitt von ihrer Taille aufwärts und wölbte sich um ihre Brust. Sein Daumen rieb eine Brustwarze durch die dünne Seide hindurch. »Ich habe das Warten und diese jungfräuliche Ziererei satt! Ich will dich, und ich habe dir lang genug den Hof gemacht … Ich bin nicht der Mann, der bis zur Hochzeitsnacht wartet, um sich zu nehmen, was ihm sowieso gehört!«
»Edward!« Jaime grub ihre Finger in sein Handgelenk, um seinen Griff zu lockern. »Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin deine Kusine und keine Hafennutte, die du ins Bett zerren kannst, sobald das Schiff angelegt hat!«
Der junge Mann starrte in ihr blutleeres Gesicht, das eisige Kälte ausstrahlte. Als er sie losließ, wich sie einen Schritt zurück und griff nach der Zeltplane.
»Was ist nur in dich gefahren?« zischte sie. »So hast du dich doch noch nie benommen!«
Eine leichte Röte huschte über sein sonnengebräuntes Gesicht, aber gleichzeitig warf er herausfordernd den Kopf zurück. »Ich bin ein Mann, Jaime, ein Ritter, ein Krieger, kein Mönch!«
»Und ein Ritter des englischen Königs behandelt Frauen auf diese Art und Weise?«
Mit einem sarkastischen Lächeln auf den Lippen wollte er wieder nach ihr greifen, aber diesmal war sie darauf vorbereitet und schlug seine Hand weg.
»Du bist wirklich ein Unschuldslamm, Jaime Macpherson!« lachte Edward. »Aber nicht mehr lange, das schwöre ich dir.« Bevor sie flüchten konnte, packte er sie am Handgelenk und zog sie grob zu sich heran. »Ich bekomme immer, was ich will!« knurrte er. »Auf See hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, und ich bin zu der Ansicht gelangt, daß ich schon viel zu lange Rücksicht auf dich genommen habe.«
»Nicht, Edward«, flüsterte sie erschrocken, als er sie an sich preßte. Sein glasiger Blick, der die grauen Augen fast schwarz erscheinen ließ, machte ihr angst.
»O ja, ich habe beschlossen, daß es an der Zeit ist, dich Lust zu lehren.« Er senkte den Kopf, um sie zu küssen.
»Bitte …« Jaime versteifte sich fröstelnd und drehte abrupt das Gesicht zur Seite, so daß seine Lippen nicht auf ihrem Mund, sondern nur auf ihrem Hals landeten, doch anstatt von ihr abzulassen, knabberte er an einem Ohrläppchen und quetschte schmerzhaft ihre Brüste. Angeekelt versuchte sie sich loszureißen, aber er war viel stärker, und sie überlegte verzweifelt, ob sie laut um Hilfe rufen sollte.
»Bitte hör auf, Edward«, murmelte sie statt dessen flehend. »Bitte … Nicht jetzt … nicht hier …«
Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis Edward widerwillig seinen Griff um ihren Körper lockerte. Am liebsten wäre sie weggerannt, aber er ließ ihre Hand nicht los, sondern schob ihren Arm unter seinem Ellbogen hindurch, bevor er die Zeltplane zurückschlug.
»Du wirst beim Abendessen neben mir sitzen, mein widerspenstiger kleiner Rabe, und später, wenn all diese verdammten Störenfriede verschwunden sind, knüpfen wir vielleicht dort an, wo wir jetzt stehengeblieben sind …«
Das Festbankett war köstlich, aber Jaime konnte es nicht genießen. Schweigsam saß sie neben Edward, lauschte den Unterhaltungen nur mit halbem Ohr und war heilfroh, daß sie selten direkt angesprochen wurde.
Kaum jemand interessierte sich für die Fortschritte ihrer Musikschüler. Die Familie des Herzogs und seine Gefolgsleute hatten ihr anfangs radikale Ideen vorgeworfen, und sie vermutete, daß nicht wenige immer noch solche Vorurteile gegen sie hegten. Kurz vor ihrer Ankunft in Kenninghall war der Musiklehrer aus mysteriösen Grünen von einem Tag auf den anderen verschwunden, und Jaime, die eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung genossen hatte, übernahm begeistert den Unterricht.
Ihr Problem bestand darin, daß sie bei den Kindern nicht auf die Abstammung, sondern einzig und allein auf das Talent achtete. Als herauskam, daß der Sohn einer Waschfrau neben der Tochter eines Adligen sitzen durfte, hatte es einen Aufruhr gegeben, der sich erst legte, als der Herzog höchstpersönlich überraschend erklärte, er könne nichts Anstößiges im gemeinsamen Gesang aller Schichten sehen.
Jetzt – nach fast einem Jahr – hatte Jaime diese Schlacht endgültig gewonnen. Natürlich nahmen nach wie vor nicht alle begabten Kinder am Unterricht teil, weil es manchen hochgestellten Eltern unzumutbar erschien, ihre Sprößlinge eine Stunde am Tag dem angeblich schädlichen Einfluß des einfachen Volkes auszusetzen, aber viele kamen regelmäßig und waren mit großem Eifer bei der Sache.
Gegen Ende des Banketts, als die verschiedenen Desserts schon abgeräumt wurden, hörte Jaime plötzlich bestürzt, daß Edward und sein Vater über sie redeten. Die Flirtversuche des jungen Mannes hatte sie den ganzen Abend über weitgehend nicht beachtet, doch nun schien das Gespräch eine ernsthafte Wendung zu nehmen.
»Ja, Euer Gnaden«, bestätigte Edward dem Herzog, »ich habe die Absicht, dieser holden Maid morgen Norwich Castle zu zeigen.«
»Das ist kein erfreuliches Ausflugsziel für eine junge Dame, Edward.«
Jaime warf dem Krieger einen fragenden Blick zu. Ihr waren schon viele düstere Geschichten über diese Burg zu Ohren gekommen. Weniger als einen halben Tagesritt von Kenninghall entfernt, war das angeblich ein Ort des Todes und gräßlicher Foltern. Dorthin ließ Edward alle Gefangenen bringen, die ihm bei seinen Schlachten in die Hände fielen.
»Wirst du mich begleiten, Kusine?« fragte er lässig.
Sie wußte nicht, wie sie sich aus der Affäre ziehen sollte – sie wußte nur, daß sie nach dem Zwischenfall im Zelt nicht mit Edward allein sein wollte, nicht einmal für kurze Zeit. »Mein Unterricht«, stammelte sie unbeholfen. »Die Kinder haben morgen wieder …«
»Hol’s der Henker!« fiel Edward ihr ins Wort. »Die Bälger werden doch wohl einen Tag ohne dich überleben.«
»Mein Junge, auf diese Weise wirst du eine zarte Frau bestimmt nicht beeindrucken können«, mahnte sein Vater, dem Jaimes Zögern nicht entgangen war. »Eine Handvoll auf See gekaperter Gefangener sind kein hübscher Anblick. Ich bin sicher, daß einige der von dir eroberten Schmuckstücke Jaime viel mehr interessieren würden und …«
»Vater!« unterbrach Edward den Herzog mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Unsere Kusine hatte noch nie die Gelegenheit, Norwich zu sehen, das Machtzentrum unserer Familie, und ich halte es für wichtig festzustellen, ob die englische Hälfte des Blutes, das in ihren Adern fließt, sich für eine Stadt erwärmen kann, die immerhin zu den bedeutendsten von ganz England gehört. Eigentlich müßte das der Fall sein.«
»Du hast recht, mein Sohn.«
»Nun, Mylady?« wandte Edward sich wieder an Jaime, und seine grauen Augen funkelten herausfordernd. »Werden Sie mich und meine Offiziere morgen nach Norwich begleiten? Wenn wir im Morgengrauen aufbrechen, sind wir spätestens bei Sonnenuntergang zurück.«
Alle Augen am Ehrentisch waren auf Jaime gerichtet, und sie wußte, daß sie einer Prüfung unterzogen werden sollte. Edward hatte ein französisches Schiff gekapert und Gefangene nach Norwich Castle bringen lassen. Und jetzt wollte er ihre Loyalität auf die Probe stellen. Mary hatte sie gewarnt, es sei verräterisch, in den Franzosen keine Feinde zu sehen, und nachdem sie beschlossen hatte, in England zu leben, mußte sie diese Ansicht wohl oder übel akzeptieren. Sie mußte einen Schlußstrich unter die Vergangenheit ziehen und an ihre Zukunft mit Edward denken. Seine Methoden mochten rauh sein, aber sie konnte ihm nicht verübeln, daß er einen Beweis für ihre proenglische Einstellung haben wollte. Das war sein gutes Recht.
»Ja, ich begleite dich«, murmelte sie unglücklich. »Ich begleite dich nach Norwich.«
KapitelDrei
Die Straße von Kenninghall nach Norwich war breit und bequem, so daß der Ritt keine Probleme bereitete. Auf dem Hügel, der zu den Stadtmauern hinabführte, zügelte Jaime ihre lebhafte Schecke, schirmte ihre Augen mit der Hand gegen die Mittagssonne ab und betrachtete die geschäftige Stadt, die für ihre Tuchmacher und Kaufleute berühmt war. Die normannische Kathedrale bot einen prächtigen Anblick, aber die düstere graue Burg, die – auf einem Hügel erbaut – das Stadtbild beherrschte, wirkte bedrohlich. Sie gehörte dem Herzog von Norfolk, wurde aber seit Menschengedenken nur als Gefängnis benutzt. Trotz der Wärme lief Jaime ein kalter Schauer über den Rücken.
Edward, der bemerkt hatte, daß sie hinter den anderen zurückgeblieben war, machte auf seinem Jagdpferd kehrt, doch bevor er die Hügelkuppe erreicht hatte, galoppierte sie in einer Staubwolke an ihm vorbei und gesellte sich der kleinen Gruppe von Offizieren zu.
Sie wollte auf gar keinen Fall mit ihm allein sein, seit er in der großen Halle so ausfallend geworden war. Nach dem Bankett hatte sie sich, ohne die Darbietungen der Gaukler zu bewundern, auf ihr Zimmer zurückgezogen und die Tür verriegelt, und als es später klopfte, hatte sie vor Angst gezittert, aber es war nur Mary gewesen, die im selben Raum wie sie schlief. Während ihre Kusine sich auszog, hätte sie ihr gern von Edwards unerhörtem Benehmen erzählt, entschied sich dann aber doch dagegen, weil sie ihn nicht bloßstellen wollte – und weil sie das Gefühl hatte, selbst nicht ganz unschuldig an seinem Verhalten zu sein.
An diesem Vormittag war es ihr gelungen, nie mit Edward allein zu sein. Sie konnte sich die Fragen vorstellen, die er ihr stellen würde – Fragen, auf die sie beim besten Willen keine Antwort wußte. Möglicherweise hatte sie ihn in ihrer Naivität durch unbedachte Worte oder Taten zu der Ansicht verleitet, sie wäre zu einer intimen Beziehung bereit. Das war nicht der Fall, aber wie sollte sie ihm das klarmachen, ohne eine immerhin mögliche gemeinsame Zukunft zu gefährden?
Aus der Nähe wirkte die Burg noch furchterregender, und sobald sie das riesige Tor passiert hatten, sah Jaime eine erschreckende Anzahl von Männern, Frauen und Kindern, die im Hof zu leben schienen. Ein Dutzend Soldaten bahnte den Besuchern grob den Weg, und Edward erklomm rasch die Holzstufen des Zwingers.
Jaime blieb wie angewurzelt stehen. Die ausgemergelten Gesichter der Kinder, die ihr teures Reitkostüm ungläubig anstarrten, gingen ihr zu Herzen. Riesige traurige Augen, zerlumpte Jammergestalten …
Sie zuckte zusammen, als Edward umkehrte und sich ihr zugesellte, sichtlich verärgert über ihre Anteilnahme. Trotzdem fragte sie leise: »Was haben diese Menschen verbrochen?«
»Die meisten sind Feinde des Königs«, erwiderte er kurz angebunden. »Und die anderen haben irgendwelche Straftaten begangen.«
Er packte sie am Arm und führte sie in die Festung. Über eine steile Wendeltreppe gelangten sie in einen riesigen Raum, die frühere Festhalle.
Jaime betrachtete die gut hundert Männer, die in kleinen Gruppen herumstanden oder kraftlos auf dem Holzboden in schmutzigem Stroh lagen. Der bestialische Gestank verursachte ihr Übelkeit, aber sie biß die Zähne zusammen und trat entschlossen über die Schwelle.
»Vielleicht war es ein Fehler, dich hierher zu bringen«, sagte Edward spöttisch. »Kann eine zarte Blume die Härten der realen Welt verkraften?«
Sie bedachte ihn mit einem kalten Blick und ging einfach weiter. Neben den widerlichen menschlichen Ausscheidungen stieg ihr nun auch der Geruch von angebranntem Brei in die Nase, und als sie sich umschaute, sah sie, daß am Ende der Halle ein schmieriger Bursche hinter einem riesigen Eisenkessel stand und unappetitliche Hafergrütze auf dicke Scheiben von schimmeligem Brot häufte. Neben ihm leerte ein Junge Wasser in einen Pferdetrog, und die verdreckten, ausgehungerten Männer mußten sogar für diese karge Mahlzeit Schlange stehen, wobei einige den vornehmen Besuchern verstohlene Blicke zuwarfen. Angewidert drehte Jaime sich nach Edward um.
»Wer sind diese Gefangenen?« flüsterte sie.
»Einige haben gegen meinen Vater rebelliert, aber größtenteils handelt es sich um Ausländer. Als loyale Untertanen müssen wir unserem König behilflich sein, und die Verhöre all dieser Leute nehmen viel Zeit in Anspruch.«
»Und nach diesen Verhören bleiben sie lebenslänglich hier eingekerkert?«
»Nein, das wäre viel zu aufwendig.« Edwards Gesicht hatte einen griesgrämigen Ausdruck, und seine Augen wurden so dunkel wie Feuerstein. »Nur wenige überleben die Befragungen durch Reed, den Gefängniswärter. Er ist ein brutaler, aber notwendiger Mann. Seine Helfer sind entlang der ganzen Küste sozusagen meine Augen und Ohren. Er weiß alles, und was er nicht durch Schläue herausfindet, erfährt er durch Gewaltanwendung.«
Jaime erschauderte unwillkürlich. »Das ist ein gräßlicher Ort, Edward«, murmelte sie.
»Du hast recht, aber jede ruhmreiche Sache hat nun einmal ihre Kehrseite, auch im Krieg.« Er nahm sie beim Arm. »Und nur wer den Unrat kennt, weiß den Glanz richtig zu schätzen.«
»Zeig mir, wozu du mich hergebracht hast«, seufzte Jaime.
Edward deutete in die Mitte der Halle, wo fünf oder sechs Männer saßen und lagen. Das mußten seine neuen Gefangenen sein, und indem er sie ihr vorführte, wollte er ihre Loyalität auf die Probe stellen.
»Mylord!« Ein dicker Mann mit rundem Gesicht, der eine Keule in der Hand hatte, näherte sich, und Edward drehte sich unwillig um.
»Was gibt’s denn, Reed?« knurrte er.
»Na ja, Mylord, der Spanier in der Ecke dort drüben ist fast hin, und weil Sie heute zufällig vorbeigekommen sind, dachte ich, Sie würden vielleicht gern ein Wörtchen mit ihm reden. Jetzt, da er weiß, daß er’s nicht mehr lange macht, scheint er auspacken zu wollen, und das könnte für Sie durchaus interessant sein, Mylord.«
»Ausgezeichnet.« Edward wandte seine Aufmerksamkeit wieder Jaime zu und drückte ihr die Hand. »Warte hier auf mich. Diese Angelegenheit dürfte nicht lange dauern.«
Sie beobachtete, wie er mit dem Wärter die Halle durchquerte und einige Stufen hinabging. Reed schob einen zerfetzten Vorhang beiseite, und dahinter konnte sie im Fackelschein eine düstere Kammer erkennen, in der ein Mann an der Wand lehnte, die ringsum dunkle Flecken aufwies. War es nur das Blut des Spaniers, das diese Mauer besudelte, oder hatten hier schon viele Menschen gelitten? Um sich von dem Gedanken an unerträgliche Martern abzulenken, betrachtete sie die kleine Gruppe, der Edwards besonderes Interesse galt. Der Kleidung nach zu urteilen, mußten diese Gefangenen französische Adlige sein. Glaubte er, daß Jaime sie identifizieren könnte? Wollte er mit ihrer Hilfe hohes Lösegeld verlangen? Es war eine abstoßende Vorstellung, aber sie versuchte, Edwards Verhalten zu rechtfertigen, indem sie sich sagte, daß ihr jahrelanger Aufenthalt in Frankreich und das schottische Blut, das seiner Überzeugung nach in ihren Adern floß, tatsächlich Grund zu einem gewissen Mißtrauen boten.
Eine Peitsche pfiff durch die Luft, gefolgt von einem schrillen Schrei, und Jaime preßte eine Hand auf den Mund, um einen Schreckenslaut zu unterdrücken. In der Kammer beugte Edward sich über den geschundenen Spanier, trat jedoch gleich darauf etwas beiseite, damit Reed wieder zuschlagen konnte. Erschüttert kniff Jaime die Augen zusammen und wich unwillkürlich einige Schritte zurück.
Fast wäre sie über die ausgestreckten Beine eines liegenden Gefangenen gestolpert. Der Mann starrte mit leerem Blick zu ihr empor, schien sie aber kaum wahrzunehmen, sondern hustete – ein krampfartiger Anfall, der seinen ausgemergelten Körper schüttelte. Jaime entfernte sich hastig in Richtung der Franzosen.
In der Kammer knallte wieder die Peitsche – wieder und immer wieder! Doch außer ihr achtete kein Mensch auf die gellenden Schreie des gefolterten Spaniers. Man hätte meinen können, alle wären taub, aber wahrscheinlich war es ganz natürlich, daß man in dieser Hölle gegen das Elend anderer abstumpfte. Auch um den hustenden Mann, der jetzt Blut spuckte, kümmerte sich niemand. Jaime mußte hart schlucken, um gegen ihre Übelkeit anzukämpfen. Diese Unglückseligen starben vor ihren Augen!
Sie schnappte einige französische Wörter auf, und nachdem sie sich vergewissert hatte, daß Edward noch in der Kammer war, ging sie langsam auf sie zu, doch die Franzosen verstummten sofort, als sie näher kam.
Direkt vor ihr lag ein Mann im Stroh, und sie bückte sich bestürzt, denn seine rotgrau karierte Kleidung wies ihn als Mitglied des MacGregor-Clans aus. Ein Schotte! Edward hatte nie erwähnt, daß auch Schotten zu seinen Gefangenen gehörten. Die Augen des Mannes waren mit einem blutigen Tuch verhüllt, sein Gesicht und Bart mit Blut verkrustet. Noch bevor Jaime niederkniete, wußte sie, daß er tot war. Sie legte eine Hand auf die kalten, steifen Finger und betete lautlos für sein Seelenheil. Als sie sich wieder erhob, mußte sie feststellen, daß jemand sie am Rocksaum festhielt.
In blinder Panik dachte sie einen Moment lang, der tote Schotte wäre zu neuem Leben erwacht, aber natürlich war es eine andere große blutige Hand, die sich in den Stoff gekrallt hatte. Trotz ihrer Angst wollte Jaime nicht um Hilfe rufen. Diese Männer hatten schon genug gelitten! Sie mußte allein mit der Situation zurechtkommen.
Langsam drehte sie sich um und blickte auf den Mann hinab, der auf einem Bündel Lumpen im Stroh lag. Blutige Haare hingen ihm wie ein Vorhang über das Gesicht, und auch sein Reisecape war blutgetränkt. Ihr fiel auf, daß die kniehohen Stiefel aus bestem Leder waren, was darauf hindeutete, daß er zu der Schar französischer Adliger gehörte, die Edward in die Hände gefallen waren. Jaime vergewisserte sich rasch, daß niemand ihr und diesem sterbenden Gefangenen Beachtung schenkte. Glücklicherweise hielt Edward sich nach wie vor bei dem Spanier auf, und seine Offiziere standen in der Nähe der Kammer, in eine angeregte Diskussion vertieft. Trotzdem fing einer von ihnen ihren Blick auf, aber sie nickte ihm beruhigend zu und tat so, als interessierte sie sich für die Architektur der Halle. Sobald er wegschaute, zerrte sie verstohlen an ihrem Rock, aber der Mann ließ ihn nicht los.
Ein Schmerzensschrei lenkte Jaime vorübergehend ab. Sie sah, daß ein Offizier mit der flachen Schwertklinge nach einem liegenden Gefangenen schlug, der es gewagt hatte, seine Stiefel zu berühren. Fester denn je entschlossen, auf fremde Hilfe zu verzichten, bückte sie sich und riß kräftig an dem Stoff. Dabei berührte ihre Hand die des Mannes – und seine Finger packten sie blitzschnell am Handgelenk.
Nur unter Aufbietung aller Willenskraft gelang es ihr, keinen Laut von sich zu geben, aber ihr Herz klopfte zum Zerspringen, als der Gefangene den Kopf etwas hob und sie näher zu sich heranzog. Durch die wirren Jahre hindurch sah sie, daß er das Kinn bewegte.
»Jaime!« flüsterte er.
Ihr erstarrte vor Schreck das Blut in den Adern. Auch ohne sein Gesicht erkennen zu können, wußte sie, wer das war, denn diese Stimme hatte sie bis in die Träume hinein verfolgt. Malcolm.
Während er schwache Versuche unternahm, seine langen Haare zurückzuschütteln, wurde Jaime von einer Flutwelle verschiedener Gedanken und Gefühle überrollt. Wie kam er hierher? Wie konnte es nur möglich sein, daß sie ausgerechnet an diesem Ort des Schreckens jenem Mann begegnete, vor dem sie aus Schottland geflohen war.
»Jaime«, murmelte er wieder ihren Namen. »Ich dachte zuerst an eine Halluzination, aber du bist es wirklich!«
Ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken, und der alte Haß gewann allmählich die Oberhand über Verwirrung und Schock. Wie hatte sie ihn geliebt – und er hatte sie verschmäht und eine andere Frau geheiratet! Trotzdem konnte sie ihren Blick nicht von seinem leichenblassen, blutigen Gesicht losreißen, bis ein neuer Schrei aus der Kammer sie aufschreckte.
»Nicht umdrehen!« befahl Malcolm. »Niemand darf auf uns aufmerksam werden.«
»Du bist verletzt«, flüsterte Jaime, der ihre Stimme kaum gehorchen wollte. »Ich werde veranlassen, daß jemand deine Wunden behandelt.« Sie zog scharf die Luft ein, denn sein Griff um ihr Handgelenk hatte sich plötzlich so verstärkt, als wollte er ihr die Knochen brechen.
»Nein!« zischte er. »Sag keinem auch nur ein Wort. Du kennst mich nicht!«
»Aber du könntest sterben.«
»Dann laß mich sterben«, murmelte er heiser. »Den Tod nehme ich gern in Kauf, wenn diese Erpresser nur nicht erfahren, wer ich bin.«
Neben ihm kauernd, hatte Jaime das Gefühl, als würde ihr jede Sekunde das Herz brechen, und sie war vor Schmerz außerstande, mit ihm zu argumentieren.
»Jaime, ich will nicht gegen Lösegeld freikommen«, fuhr Malcolm eindringlich fort. »Meine Ehre lasse ich mir nicht rauben. Geh, Mädchen! Laß mich hier und vergiß, daß du mich gesehen hast. Aber später … benachrichtige später meine Familie … Erfüll mir diese Bitte, wenn du mich je geliebt hast …«
Jaime zog ihre Hand langsam aus seinem Griff, und er hielt sie diesmal nicht fest, aber seine dunklen Augen blieben unverwandt auf sie gerichtet, während sie aufstand und einen Schritt zurückwich. Es war ein flehender Blick, der sie nicht losließ, bis sie hinter sich Edwards Stimme hörte und auf dem Absatz herumwirbelte.
»Wie ich sehe, hast du die Bagatellen gefunden, die ich mit nach Hause gebracht habe.«
»Deine Schätze, meinst du wohl?« erwiderte Jaime nüchtern.
Edward hob die Brauen, sichtlich sehr interessiert, und sie drehte sich um und deutete auf den verwundeten Schotten.
»Der dort«, erklärte sie ruhig, die Augen trotzig auf Malcolms Gesicht gerichtet. »Das ist Malcolm MacLeod, das Oberhaupt des mächtigen MacLeod-Clans. Vom Grafen von Argyll einmal abgesehen, ist er der vermögendste Mann der Westlichen Inseln.«
Als Jaime sich wieder Edward zuwandte, konnte sie sogar im schwachen Licht des Gefängnisses erkennen, daß seine Augen aufgeregt funkelten.
»Dieser eine Mann wird dir ein königliches Lösegeld einbringen«, fügte sie hinzu. »Aber natürlich nur, wenn er am Leben bleibt.«
KapitelVier
»Verräterin!« schrie Malcolm mit einer Kraft, die maßloser Enttäuschung und jäh aufloderndem Haß entsprang. »Gemeine, schändliche Hure!«
Überraschend schnell kam er auf die Beine und stürzte auf Jaime zu, die seine Beschimpfungen gelassen über sich ergehen ließ, ohne zurückzuweichen.
»Fahr zur Hölle!« brüllte der Hochländer heiser und wollte sie bei der Kehle packen, doch bevor ihm das gelang, sauste Reeds schwere Keule auf seinen Schädel nieder, und er brach in die Knie. Während der brutale Wärter zum nächsten Schlag ausholte, trat Edward etwas vor und warf Malcolm mit einem Tritt in den Unterleib vollends zu Boden.
Jaime schaute zu, und ihre kalte, gleichgültige Miene verriet nichts von dem inneren Aufruhr, der in ihr tobte.
»Du … Miststück … falsche Hexe!« keuchte der Schotte und versuchte erfolglos aufzustehen. Reed hob drohend seine Keule, aber Edward fiel ihm in letzter Sekunde in den Arm.
»Halt, Reed, ich will diesen Kerl lebendig!«
Der Aufseher warf ihm einen erstaunten Blick zu, senkte jedoch gehorsam seine mörderische Waffe.
Es war Malcolm gelungen, wenigstens auf die Knie zu kommen, aber Jaime konnte sehen, welche Anstrengung ihn das gekostet hatte. Er bewegte sich, als wären seine Glieder aus Blei, sein Kopf schwankte hin und her, und frisches Blut tropfte auf sein zerrissenes Hemd. Doch sein Blick klärte sich ein wenig – jedenfalls genug, um Jaime wutentbrannt anzustarren. Die Hände zu Fäusten geballt, schaute sie ihm in die Augen.
»Ich Narr … habe dir vertraut … du hast uns alle …« Mit schmerzverzerrtem Gesicht rang er nach Atem. »Du … Hure … schmutzige englische Hure …« Malcolm wollte sie am Rock packen, aber Reeds Keule traf ihn dröhnend am Hinterkopf, und er brach bewußtlos zusammen.
Jaimes Aufschrei ging in Edwards Gebrüll unter, der den Wärter grob beiseite stieß. »Du Idiot! Als Toter ist er nichts wert!«
Am ganzen Leibe zitternd, kniete Jaime vor dem blutüberströmten Mann nieder und legte ihre Finger auf die Kopfwunden. Als es ihr nicht gelang, die Blutung nur mit den Händen zum Stillstand zu bringen, riß sie hastig ein Stück ihres Unterrocks ab und preßte das weiße Leinen auf die beiden Verletzungen. Sie wagte nicht aufzuschauen, denn die Tränen in ihren Augen hätten ihren Schmerz unweigerlich verraten.
»Ist er tot?« fragte Edward, eine Hand auf ihrer Schulter. Jaime legte behutsam zwei Finger an Malcolms Hals und spürte einen sehr schwachen, unregelmäßigen Puls.
»Noch nicht«, murmelte sie erleichtert. »Aber er blutet stark, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis du ihn verlierst. Es sei denn … es sei denn, ein Arzt kümmert sich schleunigst um ihn.«
Edward entfernte sich, und Jaime sah, daß er leise auf einen seiner Offiziere einredete. Was gesprochen wurde, konnte sie nicht verstehen, aber der Mann verließ eilig die Halle. Sie schöpfte etwas Hoffnung, riß einen weiteren Streifen von ihrem Unterrock ab und ersetzte damit das mittlerweile blutdurchtränkte Leinen. Dann drehte sie Malcolm vorsichtig auf die Seite und streifte ihm den Umhang ab. Darunter kam eine riesige ausgezackte Wunde auf dem Rücken und eine kleinere auf der Brust, direkt über dem Herzen, zum Vorschein. Jaime schnappte entsetzt nach Luft: ein Schwert hatte ihn von hinten durchbohrt! Es war ein Wunder, daß die Klinge sein Herz und seine Lunge verfehlt hatte, daß er überhaupt noch am Leben war. Angst schnürte ihr die Kehle zu.
Edwards Stiefel tauchten wieder neben ihr auf.
»Er blutet auch aus der Brust«, berichtete sie mühsam.
»Wir nehmen ihn mit«, verkündete Edward. »Hier, in Reeds Obhut, würde er die Nacht nicht überleben.«
Jaime sprang sofort auf. Sie durften keine Minute Zeit verlieren. Als sie sich Edward zuwandte, packte er sie am Oberarm. Seine grauen Augen hatten einen zärtlichen Ausdruck.
»Ich bin stolz auf dich, mein kleiner Rabe«, sagte er. »Du hast mir heute einen großen Dienst erwiesen.«
KapitelFünf
Der schlanke, elegant gekleidete Höfling kehrte den beiden anderen Männern im Zimmer den Rücken zu und warf einen Blick aus dem Fenster. Jaime Macpherson mit den rabenschwarzen Haaren lief durch den Garten, in Richtung der Stallungen. Wie seltsam, dachte er, denn die junge Frau drehte sich alle paar Schritte nervös um, so als hätte sie etwas zu verbergen. Das sah Jaime so gar nicht ähnlich!
»Hol mich der Teufel, Surrey, du bist ein Schwächling und ein Bücherwurm! Wenn ich es nicht besser wüßte, könnte ich schwören, daß du keinen Tropfen Howard-Blut in dir hast!«
Henry Howard, der Graf von Surrey, wandte sich vom Fenster ab und musterte seinen jüngeren Bruder gelangweilt. »Du kannst schwören, was du willst, Edward, aber ich glaube, du solltest langsam damit aufhören, die französischen Schiffe, die du kaperst, zu verschlucken. Sie liegen dir nämlich so schwer im Magen, daß es sich immer negativer auf dein Denkvermögen auswirkt.«
Surrey war weder groß noch muskulös wie sein Bruder, aber seine gelassene Miene und die lässige Haltung zeigten, daß dieser Mann in sich ruhte und es deshalb nicht nötig hatte, dauernd den Helden zu spielen.
Edwards Augen schleuderten Blitze. »Also wirklich, Henry, anstatt mir zu meinem neuesten Sieg zu gratulieren, kritisierst du an meinen Erfolgen herum!«
Daß Surrey nur amüsiert mit den Schultern zuckte, stachelte Edwards Wut weiter an und veranlaßte ihn zu neuen heftigen Angriffen.
Der Herzog von Norfolk konnte sich kaum ein Grinsen verkneifen, während er seine beiden Söhne beobachtete. Edward glich einem Kampfhahn, was Henry jedoch nicht im geringsten beeindruckte. Seelenruhig durchquerte er das Arbeitszimmer und lehnte sich gemütlich an das kunstvoll geschnitzte Eichenpaneel neben dem Kamin.
Wie konnten zwei Brüder nur so völlig verschieden sein, dachte Norfolk wieder einmal. Sein Ältester hatte nie Gefallen am Soldatenleben gefunden, obwohl es ihm erwiesenermaßen nicht an Mut fehlte. Statt dessen begeisterte er sich seltsamerweise für die Poesie. Schlimm genug, daß er Vergils Aeneis für seine Freunde übersetzte, doch daß er sich sogar an die Liebesgedichte dieses schamlosen Kerls namens Petrarch heranwagte, ging wirklich über die Grenzen des Anstands hinaus!
Hingegen war Edward ein Mann nach dem Geschmack des Herzogs – stolz, ungeduldig, ehrgeizig, erfüllt von unbändigem Tatendrang. Wie Norfolk selbst, der in seiner Jugend an der legendären Schlacht von Flodden Field gegen die aufständischen Schotten teilgenommen und an vorderster Front gekämpft hatte, wollte auch Edward sich kriegerisch hervortun. Eine Invasion in Frankreich war sein sehnlichster Wunsch, aber vorerst mußte er sich damit begnügen, französische Schiffe zu erobern. Ja, dachte der Herzog, sein jüngerer Sohn würde eines Tages ein ausgezeichneter Heerführer sein. Das einzige, was ihm dazu noch fehlte, war etwas Geduld – die Fähigkeit, alle Alternativen zu erwägen.
Der Streit zwischen den Brüdern drohte zu eskalieren, und Norfolk beschloß einzugreifen.
Schon in ihrer Kindheit waren hitzige Wortgefechte oft in Tätlichkeiten ausgeartet, und er wollte nicht, daß sie jetzt mit Schwertern aufeinander losgingen.
»Schluß jetzt!« rief er streng und klopfte mit den Knöcheln energisch auf den Tisch neben seinem Stuhl. »Wir wollen erfahren, was sich in letzter Zeit bei Hofe getan hat. Das ist wesentlich wichtiger als diese törichte Diskussion darüber, ob Edward nun ein Schiff zuviel versenkt hat oder nicht.«
Beide Männer gehorchten ihrem Vater aufs Wort, und Surrey machte eine elegante Verbeugung. »Verzeihung, Euer Gnaden«, sagte er lächelnd, fuhr aber gleich darauf ernst und mit besorgter Miene fort: »Gut, kommen wir zur Sache, Vater! Das Wichtigste vorweg – der König ist mit mir sehr unzufrieden, weil ich – wie du ja weißt – ganz offen ausgesprochen habe, was ich von seinen Bemühungen um Catherine halte.«