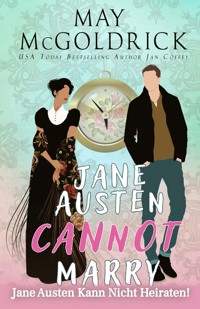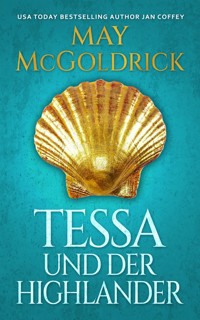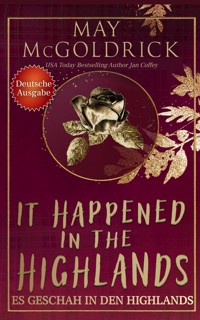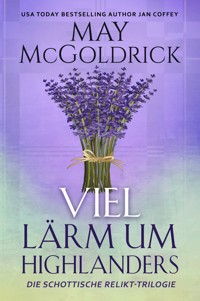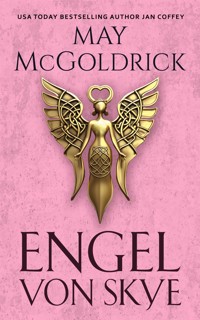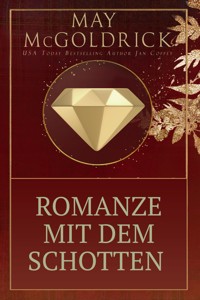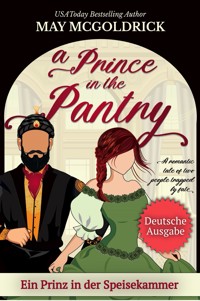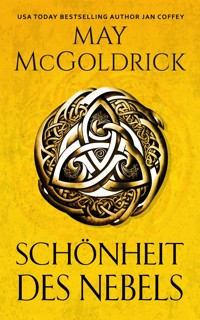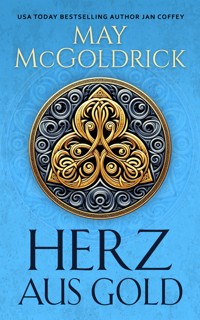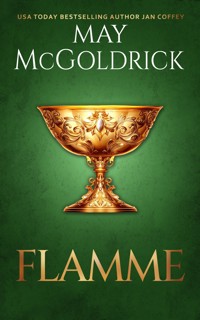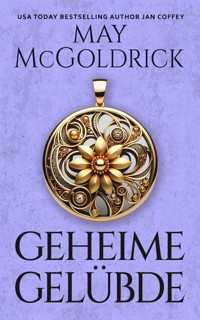
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pennington Familie Serie
- Sprache: Deutsch
Geheime Gelübde USA TODAY BESTSELLER! Vorgeschichte zur Schottischen Traum-Trilogie VORGESCHICHTE ZUR PENNINGTON-FAMILIENSERIE ZU SCHÜTZEN Auf einer verzweifelten Reise nach Amerika verspricht Rebecca Neville der sterbenden Frau des Earl of Stanmore, ihren neugeborenen Sohn James aufzuziehen und zu versorgen. In der Neuen Welt angekommen, beginnt Rebecca ihr neues Leben als Mutter... ZU SCHÜTZEN Zehn Jahre später erfährt der Earl of Stanmore vom Schicksal seiner Familie. Er schickt seinen jungen Erben in die Kolonien, damit er ihn als Adligen des Königreichs aufziehen kann. Rebecca hat nicht die Absicht, ihr Gelübde zu brechen und kehrt mit James nach England zurück, um sich einer Zukunft ohne ihren geliebten Schützling zu stellen. Aber sie muss sich auch ihrer turbulenten Vergangenheit stellen... ZU LIEBEN Auf den ersten Blick lässt der furchteinflößende Stanmore Rebecca zurückschrecken. Doch hinter seiner kalten, attraktiven Fassade und der scheinbaren Gleichgültigkeit gegenüber der Notlage seines Sohnes brodeln die Gefühle. Denn hinter Stanmore und seinen Motiven steckt mehr, als es den Anschein hat. Der rätselhafte Lord muss sein eigenes Versprechen einhalten, und seine Leidenschaft für Rebecca lässt sich nicht leugnen... Über The Promise... "McGoldricks Begabung für die Charakterisierung reicht von der mutigen Heldin und dem verwundeten Helden des Buches bis hin zu einer faszinierenden Reihe von Nebenfiguren, darunter ein teuflischer Schurke und eine wunderbar intrigante Mätresse. Dieser lebendige georgianische Historienroman ist perfekt für Leser, die eine schöne Mischung aus Geschichte und Leidenschaft mögen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
The Promise
Geheime Gelübde
2nd German Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Urheberrecht
Vielen Dank, dass Sie dieses Buch gelesen haben. Wenn es Ihnen gefällt, empfehlen Sie es bitte weiter, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder mit den Autoren in Kontakt treten.
Geheime Gelübde (The Promise) Urheberrecht © 2010 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung © 2024 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
Erstmals veröffentlicht von NAL, einem Imprint von Dutton Signet, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc. September 2001.
Umschlag von Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Über den Autor
KapitelEins
London, England
Juli 1706
Die nervös über den Arbeitstisch flatternde Hand kippte das Tintenfass um, dessen Inhalt sich über die Tischplatte ergoss und den Rock der jungen Frau beschmutzte, als sie sich rasch vorbeugte, um ein weiteres Ausfließen der Flüssigkeit zu verhindern.
»Gott erbarme Dich«, wisperte Rebecca mit angehaltenem Atem, als sie die Tinte schnell mit einigen alten Papierfetzen auftupfte. Das plötzliche Auftauchen des Dienstmädchens an der Tür machte ihre wachsende Pein nur noch größer. »Ah, Lizzy, du bist … du bist zurück.«
»Sir Charles braucht Sie jetzt, Miss … und er wartet nicht gern.« Der Blick des Dienstmädchens streifte durch den Raum und bemerkte den Schaden. »Sie machen sich besser sofort auf den Weg, bevor der Herr ernstlich böse wird, wenn ich Ihnen das sagen darf. Sie wollen doch nicht, dass er Sie persönlich holt. Hier, lassen Sie mich das machen.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schob Lizzy Rebecca zur Seite und wischte die verschüttete Tinte auf. Einen Augenblick lang starrte Rebecca auf den Lumpen, den ihr das Dienstmädchen in die Hand gedrückt hatte.
»Ist … ist Lady Hartington wieder da?«
Ein wissendes Grinsen schlich sich in Lizzys junges Gesicht, als sie die Tischplatte reinigte. »Lady Hartington hat das Haus erst vor einer Stunde verlassen, um in die Oper zu gehen. Es dürfte wohl einige Stunden dauern, bevor sie zurückkehrt.«
Erfolglos versuchte Rebecca, den Fleck von ihrer Handfläche abzuwischen. »Ich … ich denke … ich sollte jetzt lieber nach den Kindern sehen. Ich glaube … die kleine Sara fühlte sich während unserer Lesestunde nicht sehr wohl.«
»Maggie ist bei ihnen, Miss. Schließlich ist das ihre Aufgabe.« Lizzy richtete sich von ihrer Putzarbeit auf und begegnete Rebeccas Blick. »Hören Sie, es hat keinen Zweck, es hinauszuschieben. Am besten gehen Sie jetzt und bringen es hinter sich. Früher oder später bekommt er seinen Willen.«
Es hinter sich bringen! Die Worte hallten ihr im Kopf wider. Es hinter sich bringen!
Aber ihr wurde nur aufgetragen, zu Sir Charles hinunter ins Bibliothekszimmer zu gehen. Allein. Während seine Frau an diesem Abend ausgegangen war. Während seine Kinder nur ein Stockwerk über ihm in ihren Schlafzimmern schliefen.
Rebeccas Körper wurde von einem heftigen Zittern geschüttelt. Sie verbarg die bebenden Hände in den Falten ihres Rocks und ging auf die Tür zu.
»Ich … ich muss mich zuerst um den Rock kümmern.«
»Das ist ihm gleichgültig. Er schert sich doch nicht um das, was Sie anhaben.« In Lizzys Worten klang bittere Erfahrung mit.
Tränen brannten Rebecca in den Augen, als sie aus dem Zimmer floh.
Aber an Flucht war nicht zu denken. Im Flur, der zum Haupthaus führte, lief sie dem Butler in die Akute. Verzweifelt versuchte Rebecca, sich zusammenzureißen, als sie die Knöpfe auf der dunklen Weste des Mannes anstarrte.
»Sir Charles wartet, Miss.«
Es war ihr unmöglich, dem alten Mann in die Augen zu blicken. Sie wusste, dass das, was Lizzy gesagt hatte, der Wahrheit entsprach. Sie hatte es selbst gespürt. Seit vierzehn Tagen, nach Sir Charles’ Rückkehr vom Kontinent, fühlte sie sich ständig von ihm beobachtet. Mehrere Male hatte er das Zimmer aufgesucht, in dem sie seine Kinder unterrichtete, hatte sich über sie gebeugt und sich an sie gepresst. Seine Absichten waren unmissverständlich.
Wieso sollten sie sich geändert haben?
Die ständige Anwesenheit seiner Frau und der anderen Dienstboten im Haus, so hatte sich Rebecca hoffnungsvoll eingeredet, verschaffte ihr Sicherheit – zumindest so lange, bis Mrs. Stockdale ihrer Bitte nachgekommen war. In ihrem Brief hatte sie ihre alte Lehrerin gebeten, sich nach einer neuen Stellung für sie umzusehen. Auch wenn ihr Schreiben mit der neuen Postkutschenlinie auf direktem Weg nach Oxford befördert wurde, hatte Mrs. Stockdale den Brief vielleicht noch nicht erhalten.
»Sie müssen jetzt zu ihm gehen.«
Die junge Frau zwang sich, dem Butler ins Gesicht zu sehen. »Ich kann nicht. Ich glaube … ich werde in meinem Zimmer bleiben, bis Lady Hartington zurückgekehrt ist.«
Die Falten auf der Stirn des Mannes vertieften sich. »Sir Charles wird darüber nicht erfreut sein. Er ist der Herr des Hauses. Sie sollten doch wissen, dass es das Beste ist, seinem Wunsch zu folgen.«
»Lady Hartington hat mich als Lehrerin seiner Kinder eingestellt. Die Kinder sind alle im Bett. Damit ist meine Arbeit für heute beendet.«
»Wenn Sie nicht in das Bibliothekszimmer hinuntergehen, wird Sir Charles zu Ihnen kommen. Er duldet keinen Ungehorsam … und das muss ich Ihnen sagen … während der Jahre, in denen ich bei dieser Familie gedient habe, bin ich mehrmals Zeuge seiner Zornausbrüche gewesen …« Er brauchte den Satz nicht zu beenden. Die Warnung war eindeutig.
Ein gallenbitterer Geschmack stieg ihr in der Kehle auf. Halt suchend stützte sich Rebecca mit einer Hand an der Wand ab. Es dauerte einen Augenblick, bis sie ihre Sprache wiedergefunden und Kraft gesammelt hatte. Als sie sprach, klang ihre Stimme viel klarer und selbstsicherer, als sie erwartet hatte, obwohl ihr nicht so zumute war.
»Ich werde nicht zu ihm hinuntergehen, Robert. Ich glaube … ich gehe in mein Zimmer und packe meine Sachen zusammen. Ich werde Sir Charles heute Abend den Dienst kündigen … auf der Stelle.«
Der Butler sah sie einen Augenblick ungläubig an. Dann, nur für einen Sekundenbruchteil, leuchtete in den Augen des Alten so etwas wie Respekt auf, bevor er sich verbeugte und sie vorbeigehen ließ. Aber das wohltuende Gefühl, das ihr Roberts lobende Zustimmung gegeben hatte, hielt nur bis zum nächsten Gedanken an.
Weggehen … heute Nacht … aber wohin?
Ein wildes Chaos herrschte in ihrem Kopf, als sie weitereilte. Wo sollte sie hingehen? Ihre Sachen würde sie im Handumdrehen gepackt haben. Als Lehrerin brauchte sie keine umfangreiche Garderobe, außerdem hatte sie aus Oxford nur wenig mitgebracht. Wohin sollte sie gehen, schutzlos, mitten in der Nacht, ohne Kutsche oder Begleitung? Die Ungewissheit lähmte sie.
Aber eines war klar. In diesem Haus auch nur einen Moment länger als notwendig zu bleiben, das kam nicht in Frage.
So lange Rebecca Neville denken konnte, hatte sie in Mrs. Stockdales Institut für Mädchen neben dem Pfarrhaus von St. George in Oxford gelebt. Bis vor einem Monat, als sie die Schule mit achtzehn Jahren verließ, hatte sie nie eine Nacht woanders verbracht. Bevor sie in London in das Haus von Sir Charles Hartington zog, hatte sie keine andere Bleibe gekannt als das Zimmer, das sie im zweiten Stock der Schule bewohnte.
Soweit ihr bekannt war, hatte sie keine Angehörigen. Rebecca hatte nur einen anonymen Wohltäter, über den sie so gut wie nichts wusste. Mrs. Stockdale hatte ihr nur berichtet – das war alles, was sie preisgeben durfte –, dass Geld für Rebeccas Ausbildung und Unterhalt zweimal im Jahr von einer Londoner Anwaltskanzlei geschickt wurde. Als Heranwachsende hatte sie stets in der Vorstellung gelebt, London sei voll von freundlichen und großzügigen Wohltätern.
Rebecca nahm ihren Umhang vom Haken an der Wand. Trotz der warmen Sommernacht schlang sie ihn eng um sich. Dann öffnete sie das kleine Portemonnaie und zählte schnell das Geld. Drei Pfund, fünf Shilling und einige Kupfermünzen. Nicht einmal ein Notgroschen. Das hatte auch Mrs. Stockdale gemeint, als Rebecca fortging, um ihre erste Stelle anzutreten. Jedenfalls wurde das Fahrgeld nach London in Höhe von vier Pfund und acht Shilling von ihrer Arbeitgeberin, Lady Hartington, übernommen. Bei einem Gehalt von zehn Pfund im Jahr plus Zimmer und Verpflegung, so hatte sich Rebecca ausgerechnet, würde sie nicht mehr brauchen. Eines hatte Mrs. Stockdale allerdings versäumt. Sie hatte Rebecca nicht vor der Gefahr gewarnt, die Männer wie Sir Charles Hartington darstellten.
Das kleine Fenster stand offen und ließ die Dunkelheit herein. Ein Windhauch, immer noch ausnehmend warm, wehte durch ihr Zimmer, auch wenn sie es nicht bemerkte. Rebecca fröstelte, innerlich wie äußerlich.
Sie steckte die Geldbörse in ihre Reisetasche und blickte sich in der kleinen, aber sauberen Kammer um, die sie vor kaum einem Monat so hoffnungsvoll betreten hatte.
Die meisten Mädchen in Rebeccas Alter, die Mrs. Stockdales Schule in Oxford besuchten, waren im Sommer vergangenen Jahres zu ihren begüterten Familien zurückgekehrt. Als sie den davonfahrenden Kutschen nachblickte, wurde ihr wieder schmerzhaft bewusst, dass sie die einzige Schülerin war, die kein Zuhause hatte. Es gab keine Zukunft, die vor der Haustür des Instituts auf sie wartete. Sie rechnete es ihrer alten Lehrerin hoch an, dass sie niemals mit einem Wort angedeutet hatte, sie solle sich eine Stellung suchen. Der jungen Frau aber war schon längst klar geworden, dass sie ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen musste. Sie konnte nicht ewig auf Kosten ihres großzügigen Gönners leben.
Das Geräusch von Schritten, die den Flur entlangkamen, schreckte Rebecca aus ihren Gedanken auf. Sie ergriff die Reisetasche und eilte zur Tür. Der Flur war leer, bis auf die beiden Zimmermädchen, die sie fassungslos anstarrten, als sie an ihnen vorbeieilte. Sie hörte sie tuscheln, als sie den Gang entlanggingen.
Auch wenn ihr Herz raste, Rebeccas Füße waren schwer wie Blei, als sie das getäfelte Treppenhaus hinunterging. Die Schenke in Butchers Row. Das Bekleidungsgeschäft am St. James Square, wo man, wie sie gehört hatte, dringend Dienstboten brauchte. Diese Arbeitsmöglichkeiten schossen ihr in ihrer Verzweiflung durch den Kopf und bekräftigten ihren Entschluss.
Sie würde eine Anstellung finden. Wenn nicht als Lehrerin, dann als Dienstmädchen. Sie würde alles tun. Jetzt brauchte sie nur noch einen Platz für die Nacht finden. Am Morgen würde sie sich dann bei den Geschäften, die ihr einfielen, um Arbeit bemühen. Es müsste noch so viele mehr geben. Sie war sicher, dass sie Erfolg haben würde, wenn sie nur bis zum nächsten Morgen durchhielt.
»Ich habe Robert nicht geglaubt, als er mir von Ihrem ungehörigen Vorhaben erzählte.«
Sie stand nur wenige Schritte von der Treppe entfernt, die zum Erdgeschoss führte. Sie hatte die Haustür im Blickfeld. »Bleiben Sie stehen, wo Sie sind.«
Ihre Schritte stockten bei diesem Befehl. Ein kalter Angstschauer fuhr ihr den Rücken hinunter, als sich Sir Charles von hinten näherte. Sie hielt ihre Tasche fester und versuchte ihren panischen Schrecken zu verbergen, als sie sich ihm halb zuwandte.
»Ich wollte nicht ungehörig sein, Sir. Ich habe ihn nur davon in Kenntnis gesetzt, dass ich Ihr Haus verlasse.«
»Bei Einbruch der Nacht? Wo Diebesbanden und junge Streuner durch die Straßen ziehen? Sie werden nur in einem Fass enden, in dem man sie einen Abhang hinabrollt. Vielleicht würde man auch viel, viel Schlimmeres mit Ihnen tun.« Rebecca unterdrückte einen Aufschrei, als er näher kam. Die Stimme war leise und die Andeutung unmissverständlich. Der Geruch von Brandy und Zigarren hing in der Luft. »Sie halten mich wohl nicht für einen Gentleman, Miss Neville? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich ein so reizendes Wesen wie Sie schutzlos auf die Straße lasse?«
»Ich verlange keinen Schutz, Sir.« Sie versuchte weiterzugehen, aber der Mann packte sie plötzlich am Arm und hinderte sie an der Flucht. »Sir Charles, bitte lassen Sie mich los.«
»Nicht bevor wir den Grund für Ihre übereilte Entscheidung geklärt haben, Miss Neville.«
Langsam zog er sie zum Bibliothekszimmer. Mit einem Aufschrei rammte sie die Füße in den Boden, riss sich los und wirbelte herum. »Nein, Sir! Ich wünsche, dass Sie mich auf der Stelle gehen lassen!«
Die blassblauen Augen des Mannes blitzten gefährlich auf. Die Wangen röteten sich. Ein Wutanfall bahnte sich an. Rebecca machte einen Schritt zurück und hielt die festumklammerte Reisetasche schützend vor sich.
»Was haben Sie in der Tasche?«
Seine Frage überraschte sie, und sie blickte verständnislos auf die Tasche. »Meine … meine Sachen.«
»Höchst unwahrscheinlich, würde ich sagen.« Er packte Rebeccas Ellbogen mit einem mörderischen Griff, und bevor sie auch nur ein Wort hervorbringen konnte, zog er sie gewaltsam zur Bibliothek. Ein Dienstmädchen erschien am Ende des Flurs. Laut rief er ihr zu: »Du! Hol Robert und die anderen. Ich will, dass ihr das Haus nach fehlenden Gegenständen absucht. Das Silber und das Tablett. Die Juwelen meiner Frau. Ja, überprüft auch den Schmuck meiner Frau?«
Mit einem groben Stoß wurde Rebecca in Sir Charles’ Bibliothekszimmer befördert. Als sie sich entrüstet umdrehte, fiel die Tür laut knallend ins Schloss. Sie hielten beide ihre Reisetasche fest. Sie ließ sie los und wich von dem Mann zurück. Mit einem zufriedenen Blick drehte er den Schlüssel im Schloss um. Rebecca floh zur entferntesten Wand, bis sie mit den Schultern die Lederrücken der Bücher auf den Regalen berührte. Sie sah den Ausdruck in seinem Gesicht. Ihr graute vor ihm. Rebeccas Augen suchten nach einem Fluchtweg. Es gab keinen.
»Sir Charles, in dieser Tasche befindet sich nichts, was Ihnen oder Ihrer Frau gehört.«
»Liebe Miss Neville. Sie sind nicht nur jung und zart, sondern auch ein Dummkopf.«
»Wenn Sie so gering von mir denken, Sir, warum lassen Sie mich dann nicht gehen?«
Mit einem Auflachen warf er ihre Reisetasche zur Seite und zog seinen Rock aus. »Nichts liegt mir ferner als das, meine Liebe. Ein junges Blut wie Sie muss noch so manches fürs Leben lernen, und Sie haben das große Glück, dass ich Ihr Lehrmeister sein werde.«
Halb starr vor Angst zwang sie sich, die wenigen Schritte bis zu dem prächtigen Schreibtisch aus Mahagoni zu gehen. Tränen brannten ihr in den Augen, als sie sah, wie die Hände zu den Knöpfen seiner Weste griffen. »Warum ich? Sie … Sie können jede haben, die Sie wollen! Sie haben eine Frau! Bitte, bitte … nicht ich!«
Ein hartes Lachen ließ die Zähne aufblitzen, als er langsam das Zimmer durchquerte, wie ein Raubtier auf der Jagd. »Sie, meine Liebe, sind diejenige, die ich haben muss. Sie kommen nämlich – nun, wie soll ich das sagen? – von einem sehr guten Stamm.«
Sie schob ihm einen Stuhl in den Weg und ging noch einige Schritte zurück, als er um den Tisch herumging. »Da irren Sie sich! Ich bin ein Niemand. Nichts Besonderes! Bitte, Sir Charles! Es kann doch nicht befriedigend für Sie sein, wenn Sie ein Nichts wie mich ruinieren.«
»Ein Nichts?«, wiederholte er und öffnete die Knöpfe seiner engen Kniehose. »Ein Nichts sind Sie vielleicht, was Titel und Vermögen anbetrifft, das ist richtig. Aber was Ihre Abstammung anbelangt …« Er schüttelte den Kopf. »Nein, meine Liebe. Da sind Sie weit von einem Nichts entfernt.«
Rebecca zuckte heftig zusammen, als das Vorderteil seiner Kniehose aufging und das erigierte Geschlecht sichtbar wurde. Mit einem Gesicht starr wie eine Maske kam er weiter auf sie zu.
»Kommen Sie nicht näher, Sir Charles. Ich flehe Sie an? Es ist ein Irrtum, wenn Sie mich für etwas Besonderes halten!«
Er blieb einen Moment stehen und sah sie über den Tisch an.
»Irrtum?« Er schüttelte den Kopf. »Ihr Geheimnis ist gelüftet, Miss Neville. Um die Wahrheit zu sagen, herauszufinden, wer Sie wirklich sind, war für mich nicht sehr schwierig. Stellen Sie sich vor, die Tochter der berüchtigten Schauspielerin Jenny Greene unter meinem Dach! Eine gute Mutter ist sie trotz alledem, das muss ich ihr zugestehen, ihre Tochter so lange aus dem Bannkreis ihres schlechten Rufs herauszuhalten. Noch dazu so nahe bei London.«
Rebecca begriff das Gesagte kaum. Ihre Gedanken überschlugen sich vor Angst. Sie konnte nur an Flucht denken. Sie ging ein paar Schritte vom Schreibtisch zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Marmorverkleidung des Kamins stieß.
»Als ich Sie das erste Mal sah, ahnte ich es bereits. Die gleichen blauen Augen. Der gleiche ungestüme Blick. Das gleiche goldrote Haar … die Farben des Sonnenuntergangs.« Die Augen wanderten über ihren Körper. »Ich wusste es.«
Die Hände suchten den Zwischenraum hinter ihr ab. Der Mann war um vieles größer als sie. Und um vieles kräftiger. Er stand jetzt in der Mitte des Zimmers. Es gab keinen Ausweg.
»Als junger Bursche saß ich im obersten Rang im Theater am Haymarket, ungestüm nach Ihrer Mutter schmachtend. Ich sah die Gecken, die zusätzlich dafür bezahlten, um die gefeierte Jenny nach den Vorstellungen in der Garderobe zu besuchen. Ich litt Folterqualen und lechzte nach ihrem Lächeln.«
Er kam näher. Das herausstehende Glied passte nicht zu der beiläufigen Art, die er jetzt angenommen hatte. Sie hielt den Atem an, blickte zur Seite, als er die Hände ausstreckte und das Band ihres Strohhütchens aufzog. Er ließ es zu Boden fallen, nahm eine herabfallende Haarsträhne und rieb sie zwischen den Fingern, während sie seinen bohrenden Blick auf ihrem Gesicht fühlte.
»Volle Lippen, die mich zu einem Kuss reizten.« Der Blick des Mannes wanderte abwärts, die Stimme war ein heiseres Flüstern. »Brüste, die nach meinem saugenden Mund lechzten.«
Rebecca schrie auf, als seine Hände unter ihren Umhang griffen, ihre Taille umfassten und sie grob an seine Brust zogen. Sie starrte ihn an. Sie spürte sein Geschlecht, das sich hart gegen sie drängte.
»Schließlich hatte ich meinen Spaß mit Ihrer Mutter. Ich habe sie eine Woche nach Beendigung ihrer Spielzeit am Covent Garden Theater aufgesucht und sie genommen. Nach zwei Gläschen Gin wurde sie geschwätzig wie eine Elster. Der Rest war einfach, und ich konnte sie mühelos dazu bringen, mir von Ihnen zu erzählen. Ich musste sie haben … schon um der alten Zeiten willen. Aber auch, weil ich die Mutter mit der Tochter vergleichen wollte.«
Rasch wandte sie den Kopf ab, als er versuchte, seinen Mund auf den ihren zu pressen. Sie schlug ihn auf die Brust, um ihn von sich zu stoßen. Er lachte.
»Sie war willig. Leicht zu haben. Nicht so aufregend wie du. Natürlich ist sie jetzt nicht mehr die Frau, die sie einmal war.« Er drückte ihre Brüste. Es schmerzte, und ihr blieb nichts anderes übrig, als ihr Schluchzen zu unterdrücken … und zu beten. »Ich wusste, dass du besser bist. Viel besser.«
Sie spürte, wie die Schleife ihres Umhangs am Hals aufging. Sie blickte ihn wild an. Er hatte den Ausdruck eines Tiers in seinem Gesicht, als er sie am Kragen ihres Kleids packte.
»Wie viel?« Ihre Stimme war nur mehr ein heiseres Krächzen. Sie stieß die Worte hervor. »Sie haben meine Mutter bezahlt. Wie viel wollen Sie mir zahlen?«
Ernüchterung trat in seine Augen, als er sie mit widerlich geschürzten Lippen überrascht anblickte. »Eine Hure … wie die Mutter.«
»Wie viel?«, wiederholte sie nachdrücklich und war erstaunt, wie gut sie sich verstellen konnte. »Ich werde in Ihrem Hause bleiben und Ihre Kinder weiter unterrichten. Und … ich werde Ihnen zu Diensten sein.«
Wie ein Raubtier bleckte er die Zähne, aber er ließ den Kragen ihres Kleids los. »Wie viel verlangen Sie?«
Sie schob ihn von sich und trat einen Schritt zur Seite. Er ließ es zu, hielt sie aber mit eisernem Griff am Arm fest. »Ihre Frau hat mich für ein Gehalt von zehn Pfund im Jahr eingestellt. Erhöhen Sie es auf zwanzig.«
Einen Augenblick lang sahen die blassblauen Augen sie argwöhnisch an. »Und Sie werden alles tun, was ich Ihnen befehle?«
Sie schluckte kurz. »Ja. Was Sie wünschen.«
»Sind Sie Jungfrau?«
Sie starrte auf sein Hemd und nickte. »Ja.«
Schweigen breitete sich im Zimmer aus, während sie auf eine Antwort wartete. Dann atmete sie erleichtert auf, als er einen Schritt zurücktrat und den Arm losließ. »Das verspricht sehr … sehr unterhaltsam zu werden.«
Er ging einen weiteren Schritt zurück, stützte die Hände auf die Hüften und begutachtete sie eingehend. Sie blickte ihm ohne mit einer Wimper zu zucken fest ins Gesicht.
»Ausgezeichnet. Ich zahle Ihnen die Differenz. Und meine Frau erfährt von unserer Vereinbarung nichts.«
Sie nickte.
»Dann befehle ich Ihnen jetzt, sich zu entkleiden … ganz langsam. Und wenn Sie fertig sind, möchte ich, dass Sie sich auf den Schreibtisch legen.«
Entsetzt blickte Rebecca auf den dunklen Mahagonitisch. Dann schweifte ihr Blick ab und blieb einen Moment auf seinem Geschlecht haften. Es war bekleckst, geschwollen und furchtbar mächtig. Hastig drehte sie sich zum Kamin um.
»Wie Sie wünschen«, sagte sie und bückte sich, um ihr Strohhütchen aufzuheben.
Es lag da, genau da, wo sie gehofft hatte. Es war ihre einzige Chance.
Sie handelte jetzt ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Blitzartig packte ihre Hand den Schürhaken. Die eisigen Finger schlossen sich um den Messinggriff. Dann wirbelte sie mit einer fließenden, schnellen Bewegung herum und schlug die Messingstange mit einem widerlich dumpfen Geräusch auf den Schädel von Sir Charles Hartington, als er nichts ahnend an seinem Schreibtisch lehnte.
KapitelZwei
Sie hatte den Mann getötet.
Rebecca ließ den Schürhaken fallen und hielt sich die Hand vor den Mund, um einen Schreckensschrei zu unterdrücken. Die dunkelrote Flüssigkeit quoll aus Sir Charles’ Schädel und sickerte in den Teppich. Er lag ausgebreitet da, mit dem Gesicht zum Boden. In ihrer Hast, zur Tür zu gelangen, stolperte sie über einen ausgestreckten Fuß und landete auf Händen und Knien neben ihm. In panischem Schrecken sprang sie auf die Beine. Beim Anblick des warmen Bluts an ihren Händen stockte ihr der Atem. Dann starrte sie fassungslos von den blutverschmierten Händen auf den regungslosen Körper des Mannes, der sie angegriffen hatte.
Sie war überzeugt, den Mann getötet zu haben.
»Nein!«, schluchzte sie und fuhr mit den Handflächen immer wieder über ihren Rock. »Nein!«
Die Finger zitterten heftig, als sie die Tür aufschließen wollte. Angstvoll blickte sie über die Schulter. Alles, was sie von der Tür aus von ihm sehen konnte, war der Kopf mit dem gepuderten, hellen Haar, das jetzt mit den dunkelroten Schatten seiner eigenen Sterblichkeit gezeichnet war.
Endlich bewegte sich der Schlüssel im Schloss. Rebecca taumelte auf den Flur. Mit wackligen Knien brachte sie nur wenige Schritte zum Treppengeländer zustande, bevor sie sich krümmte und heftig auf dem geblümten Teppich erbrach.
»Miss Neville … Rebecca.«
Sie hob die Augen und sah verschwommen, wie der Butler die Treppe herunterkam. Das Dienstmädchen Lizzy folgte ihm.
»O mein Gott! Was haben Sie getan?«
Rebecca hatte keine Gelegenheit, Robert zu antworten, als das Dienstmädchen an der Tür zum Bibliothekszimmer in lautes Geschrei ausbrach.
»Blut!«
Und noch lauter.
»Mord!«
Rebecca hielt sich die Ohren zu und schüttelte den Kopf, während sie sich wieder aufrichtete. Um sie war ein aufgeregtes Durcheinander und Schreie, aber sie konnte nicht antworten. Ihre Kehle war wie zugeschnürt, nicht ein Laut kam heraus. Nur ein verzweifeltes Japsen nach Luft.
Und dann rannte sie.
Sie spürte, wie Hände nach ihr griffen. Hörte Rufe hinter sich. Sie blieb nicht stehen. Sie flog die Treppe hinunter zur Haustür, riss sie auf, bevor man sie fassen konnte.
Auf der Straße sah sie in den gelben Lichtkegeln der Laternen Gesichter aufblitzen. Wieder Stimmen und Rufe. Sie rannte weiter, so schnell ihre Füße sie trugen. Sie war nicht einmal einen Häuserblock entfernt, als sie gellend das Wort Mord hörte. Das trappelnde Geräusch rennender Fußtritte kam näher. Noch mehr Schreie.
An der Kreuzung lief Rebecca um die Ecke, stolperte über einen hohen Rinnstein und taumelte auf die Durchfahrtsstraße. Nachdem sie das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, wollte sie quer über die Straße auf die andere Seite rennen, um die schützende Dunkelheit des gegenüberliegenden Parks zu erreichen. Eine in voller Fahrt auf sie zukommende Kutsche ließ sie erstarren. Sie konnte sich nicht bewegen, konnte nicht atmen. Wie gelähmt blieb sie stehen und sah die Hufe der Pferde auf sich zugaloppieren.
Das war also das Ende. Man würde sie nicht hängen. Sie würde als Mörderin auf der Flucht niedergetrampelt werden. »Aus dem Weg! Aus dem Weg, du Närrin!«
Rebecca sah, wie der Kutscher mit den Pferden kämpfte, aber sie konnte sich nicht von der Stelle rühren. Die Kutsche wich nach links aus. Die Pferde bäumten sich auf. Sie spürte, wie sie eine Hand wegzog, als die Räder der Kutsche vorbeidonnerten.
Im nächsten Augenblick fand sie sich auf der Straße sitzend wieder. Gesichter starrten auf sie herab, erschrocken, mit aufrichtiger Besorgtheit, aber keiner der Umstehenden beschuldigte sie.
Plötzlich war sie wieder bei Verstand. Sie sah die Kutsche in kurzer Entfernung stehen. Der Kutscher schrie auf sein Pferdegespann ein und versuchte das Gefährt wieder in Fahrt zu bringen. Aus dem winzigen Fenster lugte das aschfahle Gesicht einer jungen Frau heraus.
Als sich ihre Blicke trafen, wusste Rebecca instinktiv Bescheid. Dieses Gesicht drückte Verzweiflung aus. Diese Frau war ebenso in Not wie sie. Mühsam kam sie auf die Beine und lief mit ausgestreckter Hand zur Kutsche.
»Helfen Sie mir!«, rief sie. »Bitte, nehmen Sie mich mit!«
Aus dem Augenwinkel sah sie eine Traube Menschen um die Ecke biegen.
»Mörderin! Haltet die Frau!«
Die Kutsche rollte bereits an, als Rebecca sah, wie die Tür aufschwang. Sie konnte die leisen Anweisungen aus dem Wageninneren kaum vernehmen, sie sah aber, wie der Kutscher sich nach ihr umblickte.
Mit frischer Kraft lief Rebecca auf die offene Tür zu und sprang in die Kutsche, während der Kutscher mit der Peitsche knallte. Das Gefährt fuhr mit einem heftigen Ruck an und sauste gleich darauf durch die Straßen der Stadt, die schreiende Menge weit hinter sich lassend.
Die blasse Frau im Wagen zog die Vorhänge zu. Dunkelheit umgab die beiden Insassen. Es dauerte eine Weile, bis Rebecca wieder zu Atem kam. Als sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, hörte sie, wie der Kutscher den Pferden ein Kommando zubrüllte. Die Kutsche wurde langsamer, als sie um eine Ecke bog.
Die Frau, die ihr gegenübersaß, blickte Rebecca forschend an. Auf ihrem Schoß, unter dem eleganten Umhang, hielt sie ein kleines Bündel, »Ich bin unschuldig«, hörte sich Rebecca hervorstoßen. »Mein Name ist Rebecca Neville. Ich … ich habe bis vor einem Monat im Institut von Mrs. Stockdale in Oxford gelebt.«
Die Augen ihrer Retterin betrachteten Rebecca weiterhin schweigend. Die Frau war jung … nicht älter als Rebecca. Ihre Kleidung wies sie als wohlhabend aus. Aber ihr blasses, verhärmtes Gesicht zeigte Angst und Verzweiflung, was Rebecca jetzt noch deutlicher erkennen konnte.
»Ich … ich war als Lehrerin eingestellt worden … von Lady Hartington … für ihre drei Kinder … und dann kam ihr Mann …« Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. Sie wischte die Tränen mit dem Rücken des beschmutzten Ärmels ab. »Er wollte … er stürzte sich auf mich … seine Frau war nicht im Haus … Ich habe mit dem Schürhaken zugeschlagen. Ich habe ihn getötet … und jetzt sind sie hinter mir her. Aber er hat versucht, mich … mich …«
Sie konnte nicht weitersprechen. Sie barg das Gesicht in den Händen, beugte sich vor und gab sich ihrem Elend hin, während die Kutsche rumpelnd von einer Seite zur anderen schwankte. Dann wurde ihr ein zartes Taschentuch in die Hand gedrückt. Rebecca nahm es dankbar und wischte sich die Tränen ab.
»Es tut mir Leid. Ich hätte Sie nicht damit belästigen sollen …«
»Haben Sie Angehörige?« Die Stimme der Frau klang freundlich, aber schwach, als ob sie starke Schmerzen hätte.
»Nein … obwohl ich heute Abend etwas anderes erfahren habe.« Sie schüttelte hoffnungslos den Kopf. »Ich habe keinen Menschen, zu dem ich gehen kann. Mein Leben lang bekam ich immer nur zu hören, dass ich eine Waise sei.«
»Ganz gleich, was er getan hat, man wird Sie hängen.«
Rebecca starrte auf die Hände im Schoß. Die Flecken von Sir Charles’ Blut, gemischt mit der Tinte, die sie vorher verschüttet hatte, bildeten ein groteskes Muster auf dem Rock, während sich das Weiß des Taschentuchs in grauenvollem Kontrast dazu abhob, sogar in der dunklen Kutsche.
»Ich hätte nicht anders gehandelt, auch wenn ich mir der Folgen bewusst bin.«
Rebecca tupfte erneut die Tränen ab. Ein Laut war vom Schoß der Frau zu hören. Leise und klagend. Rebeccas Augen weiteten sich, als sie sah, wie ihre Retterin den Umhang beiseite schob und ein in Decken gewickelter Säugling zum Vorschein kam.
»Er ist wach.« Ein Ausdruck der Zärtlichkeit erhellte das Gesicht der jungen Frau, als sie auf das Kind in ihren Armen blickte.
»So klein!«, flüsterte Rebecca und beugte sich vor, um das Kind anzusehen.
»Er kam erst heute Morgen zur Welt.«
Rebeccas Augen richteten sich auf das blasse Gesicht. »Sind Sie … die Mutter?«
Die Frau lächelte schwach. »Ich bin Elizabeth Wakefield. Ja, ich bin die Mutter.«
Die Kutsche machte einen Ruck, und Rebecca legte eine Hand auf Elizabeths Knie, als sich die Frau vor Schmerz zusammenkrümmte.
»Ihnen geht es nicht gut. Sie haben das Bett zu früh verlassen.«
»Es … es geht mir gut genug … um mich um meinen Sohn zu kümmern.« Sie strich mit dem Finger über die Stirn des Säuglings. »Ich habe ihn James genannt.«
Viele andere Fragen stürmten durch Rebeccas Kopf, Fragen, die wichtiger waren als der Name des Kindes. Wo war ihr Mann, zum Beispiel, und warum war Elizabeth mitten in der Nacht allein mit ihrem neugeborenen Sohn unterwegs? Aber die unendliche Traurigkeit, die diese Frau umgab, hielt Rebecca von weiteren Fragen ab. Hingebung und Liebe leuchteten in den Augen der Frau auf, als sie auf ihr Kind blickte.
Stattdessen setzte Rebecca sich zurück und dachte über ihre eigene Situation nach. Wie unbedeutend war doch ihr ganzes Leben gewesen! Wie schnell würde es zu Ende gehen, wenn man sie für den Mord an Sir Charles Hartington zum Galgen verurteilte! Unwillkürlich strich sie mit der Hand über die Kehle. Ob es wohl sehr schmerzhaft sein würde?
Wieder hefteten sich ihre Augen auf die Mutter und das Kind gegenüber. Hatte es in ihrem eigenen Leben jemals einen solchen Augenblick gegeben? Hatte sie ihre Mutter jemals so liebevoll in den Armen gehalten und …
Sie schüttelte den Kopf und schaute weg. Die aufwallenden Gefühle drohten sie zu überwältigen. Für diese Gedanken war es zu spät, schalt sie sich. Auch wenn Jenny Greene tatsächlich ihre Mutter war, hatte es keinen Zweck mehr, darüber nachzusinnen.
Bereits als kleines Mädchen war Rebecca mit Mrs. Stockdales ständigen Ermahnungen über den Wert der Tugenden aufgewachsen, die ein heranwachsendes Mädchen begleiten sollten. Sie war zur Frau herangereift, erzogen in dem ausgeprägten Bewusstsein für richtig und falsch, und was noch wichtiger war, im Wissen um die Brüchigkeit der weiblichen Keuschheit. Ihr schien sogar, dass die Lehrerin die junge Rebecca im Vergleich zu den anderen Schülerinnen häufiger ermahnte, ihr ungewöhnliches Aussehen zu verstecken und die widerspenstigen feuerroten Haarflechten zu zähmen und zusammenzubinden. Nein, nichts sollte sie jemals vom schmalen Pfad der Tugend und Sittsamkeit abbringen.
Jetzt ergab alles einen Sinn. Mrs. Stockdales Hartnäckigkeit war nur das Ergebnis ihrer Befürchtungen, Rebecca wäre aus einem schlechten Holz geschnitzt. Tja, fragte sich Rebecca mit Bitterkeit, was würde ihre ehemalige Lehrerin wohl von ihrer Tat heute Nacht halten?
Schaukelnd hielt die Kutsche unvermittelt an. Rebeccas Herz setzte einige Schläge aus. Sie umklammerte die Knie und starrte auf den geschlossenen Wagenschlag. Sie konnte den fauligen Gestank von Fisch und modrigem Holz riechen und schloss daraus, dass sie sich in der Nähe der Themse befanden. »Ich nehme an … das ist das Ende.«
»Auf mich wartet hier ein Boot.«
Elizabeth blickte ihr Gegenüber forschend an.
»Ich nehme von hier ein Boot nach Dartmouth, wo ich mit James an Bord eines Schiffes gehe, das uns nach Amerika bringt.«
Rebecca hielt den Atem an.
»Mir … mir geht es nicht gut. Und wir reisen allein.« Eine Träne rollte über Rebeccas Wange, als sie in das Gesicht ihres Schutzengels blickte.
»Ich möchte mit Ihnen kommen.«
KapitelDrei
Philadelphia, Provinz Pennsylvania
April 1770
»In unserer Schule können wir keinen tauben Jungen unterrichten, Airs. Ford. Das ist einfach nicht möglich.«
Rebecca zwang sich, auf der Holzbank sitzen zu bleiben, und blickte den Direktor der Friends School gereizt an. »Jamey ist nicht taub, Mr. Morgan. Er hört schlecht, ja, das ist richtig, wenn Sie an seinem schlechten Ohr stehen. Aber er ist nicht taub.«
Der Mann mittleren Alters rückte die Brille auf der Nase zurecht und schaute auf die Papiere auf seinem Schreibtisch. »Meine beiden Lehrer haben sich mit Ihrem Sohn beschäftigt – einzeln und gemeinsam. Jeder sagt, dass Ihr Sohn nicht ein Wort hören kann. Der Junge kann nicht einmal sprechen, sagen sie.«
»Er ist erst neun. Er war … ziemlich nervös an dem Tag, an dem ich ihn hierher brachte.«
Der Direktor schüttelte den Kopf. »Mr. Hopkinson berichtet mir, er habe den Jungen letzte Woche an der Werft mit anderen Jungen herumtollen sehen, und James habe seinen Gruß in keinster Weise erwidert.«
»Wie viele neunjährige Buben kennen Sie, die mit einem Erwachsenen sprechen würden, wenn sie gerade Unsinn treiben?«
»So, dann hat Ihr Sohn auch Unfug im Sinn?«
Rebecca seufzte verzweifelt und entrollte die Papiere, die sie auf ihrem Schoß hielt. »Ich habe von Buben und Spielen gesprochen. Jamey ist kein Unruhestifter, Mr. Morgan. Er ist ein sehr heller, lebhafter Junge, aus dem ein vielversprechender Schüler wird. Sehen Sie sich nur diese Blätter an, Sir.« Sie legte die Bögen auf den Schreibtisch des Mannes. »Das sind Beispiele seiner Handschrift. Er kann auch lesen.
Und ich habe ihn bereits im Rechnen unterrichtet. Er ist genauso gut wie viele Ihrer Schüler.«
Der Direktor nahm die Blätter und sah sie kurz durch. »Und jetzt sagen Sie mir, Sir, wie könnte ich ihm diese Dinge beibringen, wenn er taub ist?«
»Mrs. Ford …« Er machte eine Pause, rollte bedächtig die Papiere zusammen und reichte sie ihr. »Sie sind eine talentierte Lehrerin. Für viele Schüler waren Sie ein großer Gewinn in den vergangenen Jahren, in denen Sie sie unterrichtet haben. Mehrere Eltern können Sie nicht hoch genug loben für das, was Sie für ihre Sprößlinge getan haben. Was aber Ihren Sohn anbelangt …«
Rebecca nahm die zusammengerollten Bögen aus der Hand des Mannes.
»… was Jamey anbelangt, so machen Sie besser weiter, wie Sie begonnen haben. Vielleicht ist es die Bindung, die zwischen einer Mutter und einem Sohn besteht, die es Ihnen möglich macht, das Handicap Ihres Sohnes zu überwinden. Es sind Sie … und nur Sie … auf die er zu reagieren scheint.«
»Aber es gibt noch vieles andere, das ich ihn nicht lehren kann. Es ist nicht gut, wenn er nur von mir unterrichtet wird.«
»Auf Grund dessen, was Sie mir hier gezeigt haben, hat Ihr Sohn bereits überschritten, was ein Arbeiter oder ein Handwerker an Ausbildung fürs Leben braucht. Durch Sie hat er bereits ein gutes Niveau erreicht.«
»Nein, Mr. Morgan! Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn meint, Arbeiter oder Handwerker zu werden, sei das Beste, was er aus seinem Leben machen könne.« Rebecca bemühte sich, ihren wachsenden Zorn zu zügeln. »Auch wenn er auf einem Ohr taub und eine Hand missgestaltet ist, werde ich meinen Sohn so erziehen, dass er werden kann, was er möchte. Wenn er sich für den Beruf des Arztes entscheidet, dann bitte. Wenn er Anwalt oder Geistlicher werden möchte, dann werde ich ihm sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumen. Ich werde dafür sorgen, dass Jamey jede Chance wahrnehmen kann, die sich einem Jungen bietet, der in Pennsylvania aufwächst.«
»Ihre Absichten sind bewundernswert, Mrs. Ford.«
Sie warf dem Direktor einen wütenden Blick zu und beugte sich auf der Bank nach vorn. »Ich bin nicht gekommen, um bewundert zu werden, Mr. Morgan. Ich bin hier, um Verständnis, Offenheit und Gleichheit zu finden … Werte, für die Sie, wie Sie sagen, und die Society of Friends stehen. Ich bin hier, weil ich meinen Sohn auf Ihre Schule schicken möchte.«
Das Gesicht ihres Gegenübers rötete sich leicht. Der Blick senkte sich auf seine Hände. »Ich bedaure, Mrs. Ford. Wir haben Ihr Ersuchen lange und gründlich erwogen. Aber mit nur zwei Lehrern und meiner Person unterrichten wir bereits über einhundert Schüler. Ich sehe wirklich keine Möglichkeit, wie wir an dieser Schule jemanden mit den Schwierigkeiten Ihres Sohnes betreuen können.«
Rebecca starrte eine Weile auf die angehende Glatze des Direktors, auf die schmale Brille, die weiter auf die Nase heruntergerutscht war. Sie stand unvermittelt auf.
»Guten Tag, Sir.«
Die Nachmittagssonne tauchte den Turm der Christ Church in flüssiges Gold, als Rebecca auf die High Street hinaustrat. Obwohl ihr kaum danach zumute war, erfreute sie dieser Anblick. Mit der einen Hand Jamies Papiere festhaltend und mit der anderen die Bänder ihrer Handtasche, bahnte sie sich ihren Weg durch das geschäftige Treiben, das trotz der länger werdenden Schatten am Nachmittag nicht nachließ.
»Ein schöner Tag, Mrs. Ford.«
»Ja, ganz recht, Mrs. Bradford.« Rebecca zwang sich zu einem höflichen Lächeln. Um ihre Verärgerung über den Direktor zu verbergen, beschleunigte sie ihre Schritte.
Sie würden umziehen. Wenn das die einzige Möglichkeit war, um Jamie auf eine Schule zu schicken, dann sollte es so sein. Sie war bereit, alles dafür zu tun. New York. Boston. Ganz gleich, wo. Und was die Arbeit betraf, die sie hier gefunden hatte … in anderen Städten würde es auch viele Möglichkeiten geben.
Rebecca überhörte das Geschrei der Verkäufer, die ihre Waren feilboten, von Fleischpasteten zu Äpfeln und Dr. Franklins Gazette. Als sie in die Strawberry Alley einbog, achtete sie nicht einmal auf das Gebrüll eines Fuhrknechts, der sein langsames Ochsengespann um die Kurve in die High Street lenkte, sondern setzte mit eiligen Schritten ihren Weg auf der schlammigen, überfüllten Straße fort.
Sie hatte neu angefangen – vor zehn Jahren mit Jamie in Philadelphia. Die Menschen kannten sie, achteten sie. An Arbeit mangelte es ihr nie, sei es als Lehrerin, Näherin oder Aushilfe in der Bäckerei, wenn Mrs. Parker sich um ihren schwer kranken Mann kümmern musste.
Sie ging unter den bemalten Schildern vorbei, die reihenweise an hübschen Backsteinhäusern hingen und verkündeten, dass hier ein Weber, ein Glasbläser, ein Schuhmacher, ein Metzger seinem Gewerbe nachging. Ja, hier gab es genügend Arbeit … aber wenn sie gehen musste … nun, in einer anderen Stadt würde sie auch Arbeit finden … in einer anderen Kolonie. Überall, nur musste sie eine Schule finden, die Jamies Unzulänglichkeiten in Kauf nahm und ihn wie einen normalen Jungen behandelte.
Vorsichtig überquerte Rebecca die Straße – sie wich Pfützen, Dreck und Fuhrwerken aus – und ging auf das rote Backsteinhaus zu, in dem sich Mrs. Parkers Bäckerei befand. Dort, über der sich ständig ausbreitenden Familie Butler, hatten sie und Jamey zwei gemütliche kleine Zimmer unter der Dachschräge gemietet.
Sie nickte Annie Howe zu, als die dünne, schielende Hilfe vom Gasthaus Zum sterbenden Fuchs mit einem Arm voll Brot aus der Bäckerei kam.
»Oh, Mrs. Ford. Ein Herr hat heute Nachmittag im Gasthaus nach Ihnen gefragt.«
Rebecca blieb am Treppenabsatz stehen. »Danke, Annie. Dieser Herr … hat er eine Lehrerin gesucht?«
»Er hat nichts darüber gesagt, Ma’am. Aber das nehme ich nicht an. Er ist vor zwei Tagen in der Stadt angekommen und will mindestens ein paar Tage im Gasthaus bleiben. Verlangte ein Zimmer für sich allein, stellen Sie sich das vor!«
»Haben Sie vielen Dank, Annie.« Rebecca öffnete die Haustür.
»Er ist Anwalt, wissen Sie … aus England.«
Der Magen zog sich Rebecca zusammen, als der Fuß mitten in der Bewegung auf der Türschwelle erstarrte. Langsam wandte sie sich zu Annie um. »Wer … nach wem hat er gefragt?«
Annie verlagerte das Gewicht der Brote auf ihrem Ami. »Nach Ihnen. Er fragte nach Ihnen. Nach der Mutter von dem Jungen mit der verkrüppelten Hand. Um ehrlich zu sein, mein erster Gedanke war, dass Ihr Jamey irgendetwas Dummes auf der Werft angestellt hat. An Ihrer Stelle würde ich dem Jungen einmal am Tag den Hintern versohlen, ob er es verdient oder nicht. Ich wollte mit Ihnen sowieso schon darüber sprechen. Ich hab ihn da unten selbst beobachtet, Mrs. Ford. Glauben Sie mir, ich würde nicht einmal einem Hund etwas anhängen, ich meine, schließlich ist er noch ein Kind, aber Sie haben keine Ahnung, wie wild er sich da unten gebärdet, wenn er die feinen Leute, die von den Schiffen kommen, mit seiner Kralle erschreckt und dann mit diesen Bengeln, die unter Ihnen wohnen, davonrennt.« Die Frau blickte bedeutungsvoll zu den Fenstern der Butlers hinauf.
Die Übelkeit im Magen legte sich etwas. »Danke, dass Sie mir das alles gesagt haben, Annie. Ich werde mit ihm ausführlich darüber sprechen.«
»Eine starke Weidenrute quer über seinen Hintern, das braucht er, wenn Sie mich fragen, Mrs. Ford. Wenn Ihr Mann noch am Leben wäre …«
»Schon gut. Ich werde ihn mir vornehmen. Danke.« Rebecca wollte nicht warten, um sich noch mehr anzuhören, und winkte ihr kurz zu, bevor sie die Tür schloss und die enge Stiege zu den oberen Stockwerken hinaufstieg.
Es war nichts Neues, was Annie gesagt hatte. Sie wusste das alles. Jamey hatte in diesem Frühjahr etwas über die Stränge geschlagen. Aber es war so viel los. Rebecca hatte mehrere Stellen, wo sie arbeitete, und am Tag blieben nur eine begrenzte Anzahl Stunden, in denen sie ihn unterrichten, beobachten oder schelten konnte. Außerdem wollte sie ihn nicht allzu sehr schelten, schließlich musste er sich ja auch austoben.
Aber das war noch ein Grund, warum sie eine Schule für ihn finden musste. Er brauchte einen Ort, wo er eine Richtung finden konnte, in die er seine Energie leitete. Er brauchte eine Möglichkeit, um den wachsenden Trotz charakterlich in etwas Positives umzuformen.
Wie erwartet, stand Molly Butlers Tür offen, als Rebecca vorbeiging. Die Nachbarin – hochschwanger mit dickem Bauch – winkte sie in das vordere Zimmer. An der Wand gegenüber prasselte ein Feuer im Kamin. Molly drehte ihr den Rücken zu und rührte in einem Topf, der an einem eisernen Haken über der Feuerstelle hing. Zufrieden blickte sie die Frau mit den rosigen Wangen an, als sie sich schwerfällig auf einen Stuhl neben dem Feuer setzte. Ein Zwillingspärchen, zwei Mädchen im Kleinkindalter, schliefen aneinander geschmiegt in einem kleinen Beffchen in der Ecke.
»Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich kann es von deinem Gesicht ablesen.«
Rebecca ließ die Papierrolle und die Tasche auf den Tisch fallen, bevor sie zu einem der beiden zur Straße blickenden Fenster ging. »Das ist nicht die einzige Schule. Es gibt noch andere.«
»Du weißt, ich liebe ihn wie ein eigenes Kind, aber nicht für deinen Jamey. Das glaube ich nicht.«
Sie wollte jetzt nicht diskutieren und ließ die Bemerkung unbeantwortet.
»Ich sehe, dass du bereits nachdenkst.«
Rebecca blickte in Mollys Richtung und lächelte. »Du kennst mich, Molly. Ich denke immer.«
Als sie sich neben ihre Freundin setzte, schnitt die schwangere Frau eine Scheibe von dem Brotlaib ab, der auf einem kleinen Tischchen an der Wandbank lag. Ohne sie zu fragen, schob sie den Tisch vor Rebecca hin und stellte den kleinen Topf mit Apfelbutter neben das Brot. »Du hast noch nichts zu Mittag gegessen, mein Schätzchen, und wenn ich sehe, wie blass du bist, wette ich, dass du heute Morgen auch nichts bekommen hast.«
»Jamey ist noch nicht da?«
»Mach dir keine Sorgen um ihn. Tommy und George sind bei ihm. Und wenn der ältere Bruder dabei ist, dann stellen die beiden Lausejungen nur halb viel Unfug an.«
Thomas, der Älteste der vier Butlerkinder, war zwölf und für sein Alter ziemlich erwachsen. Er ging Mr. Butler gelegentlich zur Hand, wenn er montags und donnerstags Passagiere von der Strawberry Alley zur Trentoner Fähre brachte, der ersten Station auf ihrer Reise nach New York. George hingegen war in Jameys Alter und ebenso ungebärdig und wild.
»Rebecca, ich bin der Meinung, du solltest dir den Rat meines Mannes noch einmal durch den Kopf gehen lassen, dass Jamey allmählich sein eigenes Geld verdient und in einer Schmiede oder etwas in der Art anfängt …«
»Unmöglich.« Rebecca schüttelte heftig den Kopf und blickte auf die Brotscheibe vor ihr. »Ich werde dem Direktor von Germantown schreiben. Es ist sehr gut möglich, dass sie ihn dort aufnehmen.«
»John sagte mir, sie haben dort bereits über zweihundert Schüler, auch wenn sie dort mehr Verständnis für Jameys Situation haben …«
»Ich muss es versuchen, Molly.«
Molly schüttelte den Kopf. »Ausgerechnet du, eine Frau, die bereits nervös wird, wenn ihr Sohn einen halben Tag außer Reichweite ist. Wie willst du es durchstehen, wenn er bei fremden Menschen in Germantown wohnt? Und noch schlimmer, wie willst du das bezahlen?«
Rebecca biss ein Stück Brot ab. Sie brachte es nicht übers Herz, Molly von ihren Umzugsplänen zu berichten. Die beiden Frauen waren Freundinnen, seit Rebeccas und Jameys Ankunft in Philadelphia. In diesem Haus hatten die beiden Familien fast zwei Jahre gelebt. In diesem Zimmer hatte Rebecca von ihrer Freundin so viel über Kindererziehung gelernt.
Aber sie verband mehr. Viel mehr. Wie viele Abende hatten Rebecca und Jamey am Tisch der Butlers mitgegessen? Wie viele Weihnachtsfeste hatten sie zusammen gefeiert? Vom ersten Augenblick an hatten sie gewusst, dass ihre Seelen verwandt waren. Und wenn Jamey als kleines Kind vor Fieber glühte, saß Molly mit ihr an seinem Bettchen. Und als Molly kurz vor der Entbindung ihrer Zwillinge stand, hatte Rebecca und Jamey Tommy und George vierzehn Tage lang bei sich aufgenommen.
Da John Butler wegen seines Kutschfahrdiensts nach Trenton zur Fähre nach New York so oft nicht zu Hause war, hatte sich zwischen den beiden Frauen eine Freundschaft entwickelt, die sich mit den Jahren noch vertiefte. Außer Jamey waren die Butlers die einzige Familie, die Rebecca in ihrem Leben gekannt hatte.
Aber heute fühlte sie sich zu müde und entmutigt, um ihrer Freundin zu sagen, dass sie notfalls bereit war, nach Germantown umzusiedeln.
»Du brauchst jetzt nichts zu essen. So blass wie du aussiehst, solltest du hinaufgehen und dich vor deinem Nachmittagsunterricht hinlegen. Ich lass dir etwas von dem Eintopf bringen, wenn er fertig ist.«
Rebecca schüttelte den Kopf. »Mir geht es gut … wirklich.«
Sie stand rasch auf, als sie Tommy und George von der Straße her rufen hörte. Sie ging zum Fenster und sah die Jungen, die zu ihr hinaufblickten.
»Ist Jamey schon zurück?«, rief der ältere Junge, als sie das. Schiebefenster öffnete.
Rebecca beugte sich aus dem Fenster. »Ich dachte, er wäre mit euch beiden gegangen.«
»So war es auch«, sagte George. »Aber dieser fein gekleidete Gentleman hat uns an der Kreuzung Front Street und High Street aufgehalten. Sagte, er will Jamey allein sprechen.«
Molly kreischte über Rebeccas Schulter und weckte die beiden Mädchen auf. »Soll das heißen, ihr habt Jamey mit einem fremden Mann allein gelassen?«
»Nee, Mama«, beschwichtigte sie Tommy schnell. »Aber wir konnten nicht verstehen, was der Makaroni gesagt hat, auch nicht, als er ein paar Schritte von uns entfernt stand. Dann platzten zwei Schornsteinfeger dazwischen und schubsten uns an die Wand. Als die dämlichen Rußschlucker endlich abzogen, haben wir nur noch gesehen, wie Jamey den Mann von sich gestoßen hat und wegrannte. So schnell hab ich ihn noch nie rennen sehen … höchstens damals, als wir uns in den Glockenturm der Christ Church geschlichen haben und beim Runtersteigen beinahe erwischt worden wären …«
»Ihr habt was gemacht?«
Rebecca zog sich ruckartig vom Fenster zurück und machte Molly Platz, damit sie ihre Jungen über die letzte Missetat ausfragen konnte. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Was hatte Annie von dem Anwalt erzählt, der sich nach ihr erkundigt hatte? Das heißt, er hatte sich eigentlich nach Jamie erkundigt.
Sie musste ihren Sohn finden.
Ohne ein weiteres Wort huschte Rebecca zur Tür hinaus und wollte die Treppe hinunterlaufen. Sie hatte nicht einmal zwei Stufen genommen, als sie seine zusammengesunkene Gestalt auf der untersten Stufe sah.
»Jamey!«, rief sie und kauerte sich neben ihn. Sie nahm sein Gesicht in die Hände und hob es hoch, bis sie ihm im gedämpften Licht des Treppenhauses in die Augen sehen konnte. »Was ist los, Jamey?«
Tränen standen in seinen Augen. Er wischte sie mit dem Rücken eines Ärmels ab. Bevor Rebecca weiter fragen konnte, warf er die Arme um sie und barg das Gesicht in ihrem Schoß.
»Er darf mich nicht mitnehmen, Mama. Du erlaubst nicht, dass er mich fortbringt! Bitte, Mama!«
»Das würde ich niemals tun.« Sie hob seinen Kopf, bis er sie anblickte. »Hörst du mich? Ich verspreche dir, ich werde niemals zulassen, dass man dich von mir trennt!«
Sie drückte ihn an die Brust, wiegte ihn hin und her, während ihm die Tränen über die Wangen flossen.
Molly erschien an der oberen Treppe. »Gott sei gedankt, er ist zurück. Ich werde meinen beiden Schlingeln das Fell über die Ohren ziehen … Was ist los?«
An Stelle einer Antwort schüttelte Rebecca den Kopf. »Es ist alles gut, Molly. Sag den Jungs, er ist da.«
Sie packte ihn bei der Hand und führte ihn die Stufen zu ihrer kleinen Dachwohnung hinauf. Molly folgte ihnen mit dem Topf Apfelbutter und dem Brot.
Jamey schüttelte nur den Kopf, als Molly ihm beides anbot, und floh in Rebeccas winziges Schlafzimmer.
»Irgendetwas stimmt nicht«, flüsterte Rebecca Molly zu, bevor sie zu ihrem Sohn ging.
Jamey lag zusammengerollt auf ihrem Bett und umklammerte ihren alten Schal.
»Möchtest du mir sagen, was vorgefallen ist?«
Er antwortete nicht. Sie setzte sich neben ihn auf das Bett, fasste ihn unter dem Kinn und drehte das Gesicht zu sich, bis die großen blauen Augen sie ansahen.
»Was ist passiert, Jamey? Wer war der Mann, der dich auf der Straße angesprochen hat?«
Neue Tränen schimmerten in den Augen des Jungen. »Was wollte er?« Ihr Ton wurde milder. »Was hat er gesagt?«
Sie streichelte das sandblonde Haar und strich es ihm aus der Stirn. Dann zog sie ein Taschentuch aus dem Ärmel und wischte ihm die Tränen ab.
»Er kannte bereits meinen Namen, Mama. Aber … er sagte James zu mir.«
»Was noch, mein Herz?«
»Er fasste mich am Arm und starrte auf meine Hand.«
»Schsch«, besänftigte sie ihn, als mehr Tränen die Wangen hinabrollten. Das war nicht das erste Mal, dass man ihn als Kuriosität betrachtete. Zugegeben, sie hatte aus jedem dieser Vorfälle einen Kampf gemacht – einen Kampf gegen Unwissenheit –, aber sie erinnerte sich nicht, dass Jamie jemals so heftig darauf reagiert hatte wie jetzt.
»Ich hab dich lieb, Mama. Ich verspreche, immer artig zu sein.« Schluchzer mischten sich in die Worte. »Ich verspreche, nie mehr so zu tun, als ob ich nicht hören kann. Wenn du mich wieder zur Friends School zurückbringst, gebe ich dir mein Wort, dass ich mich gut benehmen werde. Ich werde ihre Fragen beantworten und alles tun, was sie von mir verlangen. Bloß schicke mich nicht fort.«
»Ich hab dich auch lieb. Und ohne mich wirst du nirgendwo hingehen. Aber ich muss wissen«, fügte sie ernster hinzu, »was dieser Mann zu dir gesagt hat, Jamey.«
Aber bevor er antworten konnte, erschien Molly in der Tür. Rebecca sah überrascht auf.
»Da ist jemand, der dich sprechen möchte.«
»Lass dir den Namen geben, und schick ihn wieder weg.«
Die Freundin schüttelte den Kopf und bedeutete Rebecca, in das andere Zimmer zu kommen.
Ein heftiges, erdrückendes Gefühl überfiel sie, so wie damals in dem Bibliothekszimmer in London. Sie strich mit der Hand über Jameys Stirn, bevor sie sich zwang aufzustehen. Ihre Bewegungen waren langsam, fast schmerzhaft, als sie die Tür hinter sich schloss.
Molly zeigte auf die Tür, die zum Stiegenhaus führte. Rebecca atmete tief durch und öffnete sie.
»Mrs. Ford?«
Sie nickte dem elegant gekleideten Herrn im Flur zu. »Ich bin Sir Oliver Birch, Ma’am, vom Middle Temple in London. Ich bin im Auftrag des Earl of Stanmore hier.«
»Und was ist der Grund Ihres Hierseins, Mr. Birch?«
»Ich möchte James Samuel Wakefield, den zukünftigen Earl of Stanmore, abholen und zurück nach England begleiten.«
Rebecca starrte ihn einen Moment an, bevor sie die Tür mit voller Kraft zuschlug.
KapitelVier
London
Die weiße Seide glitt über den muskulösen Rücken ihres Liebhabers. Als er das Hemd über die breiten Schultern streifte, verzog Louisa die Lippen zu einem koketten Schmollmund. Wie eine Katze räkelte sie sich zwischen den zerwühlten Laken des riesigen Betts und sah ihm beim Ankleiden zu.
Auch wenn ihr Körper befriedigt war, schmälerte der vertraute Anblick Stanmores, der jedes Mal sofort nach dem Liebesakt ihr Bett und das Haus verließ, ihr Vergnügen. Sogar jetzt hatte sie den metallisch herben Geschmack der Enttäuschung im Mund, aber sie zwang sich, reizvoll und heiter auszusehen und ihre Bitterkeit zu verbergen.
Sie war sich nicht zu schade, ihn zum Bleiben zu bewegen, aber sie weigerte sich, einer so schicksalhaften Neigung nachzugeben. Dazu war sie viel zu klug. Louisa Nisdale hatte nicht die geringste Lust, auf die lange Liste von Stanmores abgelegten Liebschaften gesetzt zu werden. Sie hatte die ganzen drei Jahre ihrer lächerlichen Ehe und die ersten beiden Jahre ihrer Witwenschaft investiert, um den Mann – wenn auch aus sicherer Entfernung – und seine Ruhelosigkeit genauestens zu beobachten. Samuel Wakefield, der Earl of Stanmore, verachtete offensichtlich Frauen, die ihm zu Füßen lagen. Den Männern seines Standes gegenüber war er unglaublich arrogant, vor allem denjenigen gegenüber, die ihn für Aktivitäten gewinnen wollten, die er als frivol ansah. Trinken, Spielen und Herumhuren waren unter seiner Würde, wie es schien. Er erweckte jedenfalls den Eindruck, dass er die Ausschweifungen seiner übrigen Standesgenossen nicht unterhaltsam fand.
Nein, der Earl of Stanmore nahm seine politischen Aufgaben ernst. Als Held der französischen Kriege in Amerika war er jetzt ein überzeugtes Mitglied des House of Lords.
Sein Auftreten war hoheitsvoll, und er war stolz auf seine Vorfahren, die ihren Königen seit der Zeit Wilhelm des Eroberers gedient hatten.
Aber was viel mehr Bedeutung hatte, Lord Stanmore war seinen Freunden gegenüber unglaublich großzügig. Und das war eine Tugend, die Louisa sehr an ihm zu schätzen wusste – besonders im Hinblick auf ihre ungezügelte Spielleidenschaft und Verschwendungssucht. Sie fand, dass es ein köstliches Spiel war, und hielt sich viel darauf zugute, Lord Stanmore als Gönner und Liebhaber gewonnen zu haben … und Anzeichen eines Endes waren nicht in Sicht.
Von ihren Gedanken beflügelt, stieß Louisa die Decken weg und rollte zur Bettkante. Von hier aus konnte sie Stanmores schönes Gesicht im Spiegel sehen, als er sich das Halstuch im Schein der Kerzen umband. Eine wohlige Hitze breitete sich in ihr aus, als sie sah, wie sich seine Augen verdunkelten, als sie über ihren nackten Rücken und ihre Hüften wanderten. Sie stützte sich auf einen Ellbogen und bot ihm den vollen Anblick ihrer Brüste.
»Lady Morningtons Einladung für Freitag Abend …« Sie raffte ihre lange blonde Haarmähne mit einer Hand zusammen und rollte auf die Kissen zurück. Seine Augen folgten ihren Bewegungen im Spiegel. Sie neigte den Kopf und stieß den Rest der Laken von den Beinen. »Könntest du es so einrichten, dass du mich hier um halb sieben abholst? Mir ist es lieber, mit dir zu kommen und …«
»Ich habe Lady Mornington bereits abgesagt.«
»Aber sie ist eine so gute Freundin von mir. Sie wird sehr enttäuscht sein, wenn wir nicht kommen.«
Er ging vom Spiegel weg und langte nach seiner Weste. »Ich habe damit nur meine eigene Absicht kundgetan. Dir steht es natürlich frei, das zu tun, was du möchtest.«
»Ich verstehe nicht, was du gegen sie hast. Das ist die fünfte Einladung dieser reizenden Person, die du im letzten Monat abgesagt hast.«
»Und wenn es die fünfzehnte wäre, ich würde immer noch absagen. Ich habe kein Interesse, weder an Spielsalons noch am Glücksspiel selbst.«
»Aber sie bietet ihren Gästen doch noch ganz andere Dinge. Sie ist eine geachtete …«
»Ich bin an dieser Einladung nicht interessiert.«
Louisa bemerkte die Veränderung in seiner Stimme. Es war nur eine feine Nuance, kaum merklich, aber sie hatte diesen Ton schon einmal gehört und erkannte ihn wieder. Stanmore erhob seine Stimme nicht, aber der gefährliche Unterton war nicht zu überhören.
»Ah, schön …«, lenkte sie ein, glitt anmutig vom Bett herunter und ging langsam auf ihn zu, während er seine Jacke anzog.
Sie wusste, dass sie ihm etwas Zeit lassen musste, bis sich sein Aufbrausen wieder gelegt hatte. Zeit, damit sich seine Augen wieder auf ihren Körper heften konnten und seine Schönheit aufnahmen. Aber der Earl schien zerstreut, wenn nicht desinteressiert, und das alarmierte sie mehr, als sie sich eingestehen wollte.
Louisa Nisdale war jedoch eine Spielernatur. Sie griff nach ihrem Negligé aus feinster Seide und schlang es lässig um den Körper.
»Weißt du was, Stanmore, ich habe eine viel bessere Idee.« Sie fuhr mit einem Finger über die straffe Haut seines Nackens und zwang ihn dadurch, ihr ins Gesicht zu blicken.
Sie schmiegte sich in seine Arme und rieb sich verführerisch an ihm. Er richtete sich über ihr auf. Das Negligé öffnete sich. Ein Gefühl heißer Erregung durchströmte sie, als ihre zarte Haut den feinen Stoff seiner Jacke berührte, sich ihr cremefarbenes Fleisch an das schwarze Tuch presste und sie die Wärme seiner Schenkel durch seine engen Wildlederhosen fühlte. »Du und ich … Samstag Abend … im Vergnügungspark von Ranelagh. Wir streifen durch die Arkaden, unter denen kleine Teegesellschaften gegeben werden, und du kannst mir all die schlimmen Dinge zuflüstern, die du mit mir machen möchtest. Und ich flüstere dir …«
»Nein, ich denke nicht.« Freundlich, aber bestimmt stieß er sie von sich und wandte sich zur Tür.
Rasch streckte sie den Arm aus und packte ihn am Ärmel. »Wir brauchen auch gar nicht wegzugehen«, schlug sie vor und bemühte sich, die in ihrer Stimme aufsteigende Panik zu unterdrücken. »Vielleicht bleiben wir auch hier … wir können …«
»Ich werde die Stadt verlassen und einige Tage in Hertfordshire verbringen. Vielleicht sehe ich dich irgendwann in der nächsten Woche, Louisa.«
Sie starrte ihn einen Augenblick fassungslos an. Nimm mich mit, hätte sie beinahe ausgerufen, als er sich hinabbeugte und sie auf die Stirn küsste. Aber sie riss sich zusammen, schluckte die Worte hinunter und schlang stattdessen die Arme um ihn und bot ihm die Lippen zum Kuss.
Wieder löste er sich von ihr und ging zur Tür. Sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss.
»Ich verstehe. Du bist ungeduldig, weil du nicht länger warten möchtest. Es ist jetzt schon einige Monate her, nicht wahr?«
Er blieb ruckartig an der Tür stehen und blickte sie an. Seine Augen waren schwarz, aber in ihren Tiefen entdeckte sie das gefährliche Glimmen.
Sie fühlte sich unbehaglich. Sie war einen Schritt zu weit gegangen, aber sie wusste, dass sie sich jetzt behaupten musste.
»Was genau ist schon einige Monate her, Louisa?«
Seine Stimme war noch leiser geworden, und sie zog das hauchdünne Gewand fester um sich.
»Ich … ich habe so einiges gehört.« Sie konnte den Blickkontakt nicht länger aufrechterhalten, also nahm sie stattdessen den seidenen Gürtel des Negligés und machte eine Schau daraus, ihn kunstvoll um die Taille zu knoten. »Ich möchte nur, dass du weißt … nun, dass ich Verständnis habe … und dass ich da bin, wenn du mich brauchst.«
Sie schenkte ihm ein Lächeln, ein überzeugendes, wie sie hoffte.
»Was genau hast du gehört?«
Mit den Händen strich sie an ihren Oberarmen auf und ab, um das Frösteln abzuwehren, das sie plötzlich überkam. Er wartete auf ihre Antwort.
»Die ganze Zeit kommen mir Gerüchte zu Ohren, du hättest jemanden in die Kolonien geschickt … nun, um deinen Sohn zurückzuholen. Alle reden davon. Du weißt ja, wie die Leute reden. Jeder weiß, wie schwer es für dich sein muss … nach zehn Jahren und … natürlich, wenn Elizabeth sich zur Rückkehr entschließt, also … nun …«
Die Worte kamen ihr nicht über die Lippen, als sie die Härte in Stanmores dunklen Augen sah. Sein Gesichtsausdruck war grimmig und furchterregend. Unwillkürlich tat sie einen Schritt zurück.
»Deinetwegen … ich war deinetwegen besorgt.«
»Besorgt?« Er schüttelte unmerklich den Kopf. Seine Stimme war kalt und bestimmt. »Wir haben uns miteinander vergnügt, Louisa, glaube aber nicht, dass mehr zwischen uns ist. Ziehe keine falschen Schlüsse aus unserer Beziehung.« Er wandte sich unvermittelt um und öffnete die Tür. »In Zukunft, Madam, werdet Ihr Euch nicht um meine Angelegenheiten kümmern. Weder jetzt noch später.«
Louisa Nisdale blickte ihm nach und sank am Rand des Betts zusammen. Lange starrte sie auf die Tür, dann erhob sie sich. Diese Schlacht hatte sie verloren, aber nicht den Krieg.