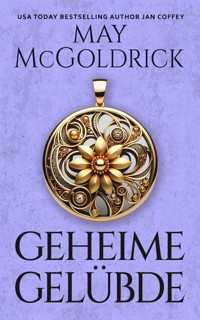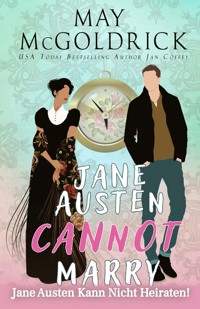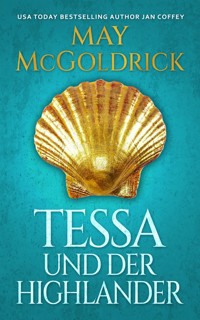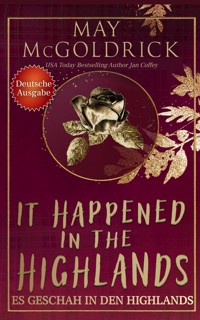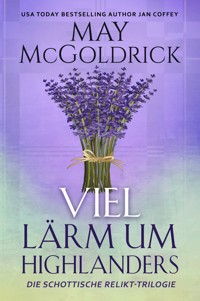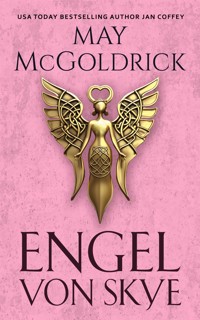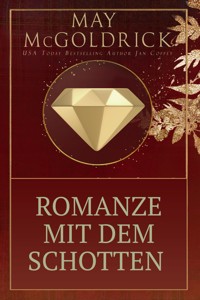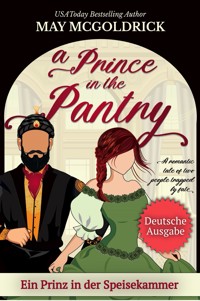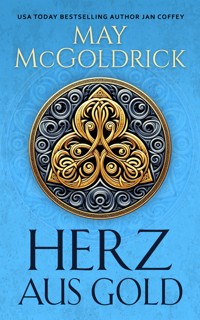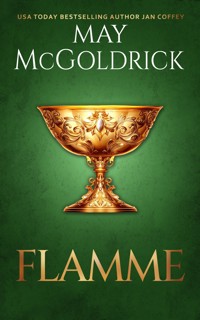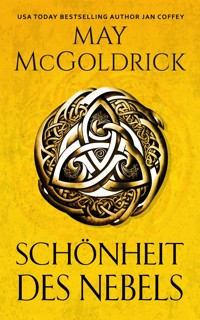
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: EIN ROMAN DES MACPHERSON-CLANS
- Sprache: Deutsch
Ein rauer Highlander, der die Braut seines Königs zurückholen soll, trifft auf eine geheimnisvolle Schönheit, die auf dem Meer treibt... Maria war mit siebzehn Jahren zwangsverheiratet und kurz darauf zur Witwe gemacht worden. Jetzt, fünf Jahre später, hatte ihr Bruder unbemerkt einen anderen Ehemann für sie ausgewählt - den jungen König von Schottland. Maria, die nie Leidenschaft oder Liebe gekannt hatte, weigerte sich, sich zu fügen, und schwor, in die Freiheit zu fliehen. Doch das Schiff, für das sie sich entschied, ging im aufkommenden Nebel unter und überließ die dunkelhaarige Schönheit der Gnade von Wind und Gezeiten, während sie auf ein erschütterndes Schicksal zusteuerte. Denn es war kein anderer als der Highland-Häuptling John Macpherson, der auf dem Weg war, die Braut seines jungen Königs nach Hause zu holen, der die schöne Maria aus dem Meer rettete. Fast von dem Moment an, als sie sich begegneten, entflammte zwischen ihnen eine Anziehungskraft. Maria genoss diese wenigen gestohlenen Tage, wohl wissend, dass ihre Liebe nicht von Dauer sein würde, sobald der stolze Highlander ihre wahre Identität entdeckte. Maria wusste, dass es sie zwar befreien würde, wenn sie ihrem Herzen folgte, dass sie damit aber das Leben ihres Geliebten einbüßte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
The Beauty of the Mist
SCHÖNHEIT DES NEBELS
2nd German Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Urheberrecht
Falls Ihnen dieses Buch gefällt, sollten Sie es weiterempfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder sich mit den Autoren in Verbindung setzen.
Schönheit des Nebels (Beauty of the Mist) © 2017 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung ©2024 von Nikoo und James McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
Erstmals erschienen bei Topaz, einem Imprint von Dutton Signet, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc. März 1997
Cover Art von Dar Albert. WickedSmartDesigns.com
An unsere Eltern
Dafür, dass Sie die Schönheit des Lebens mit uns teilen.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Über den Autor
Prolog
Antwerpen, Niederlande
März 1528
Die Schotten sollen nur kommen.
Wie die Flügel eines verwundeten Raben flatterte der Mantel um die dahineilende Gestalt. Atemlos hielt Maria, Königin von Ungarn, inne und preßte sich erschöpft in den dunklen Toreingang des Ziegelgebäudes. Das flackernde Licht der Fackel, das die Straße beleuchtete, glänzte auf dem nassen Kopfsteinpflaster, und die junge Königin versuchte, noch tiefer mit dem Schatten zu verschmelzen. Sie lauschte angestrengt, konnte aber keinen Laut von möglichen Verfolgern in der kalten Nachtluft hören. Ihre jadegrünen Augen blitzten auf, als sie einen Blick zurück auf die düsteren Mauern des Schlosses warf, das sich über den Dächern der schlafenden Stadt erhob.
Als sie sich der anderen Seite zuwandte, sah sie den einen, schon vollendeten Turm der Kathedrale, der vor ihr in den Himmel ragte. Sie war nicht mit den gewundenen Straßen und Gassen dieser Stadt vertraut – so wenig wie mit denen irgendeiner Stadt –, und der Turm diente ihr als Orientierungspunkt, dem sie folgen sollte.
Dicht um sie herum drängten sich bedrohlich Häuser und Läden. Die kalte, feuchte Luft drang beim Laufen in die Lunge, aber sie zwang sich weiterzurennen. Schon wurde der Himmel heller. Ihre Füße flogen über das rutschige Pflaster.
Am Ende der verwinkelten Gasse wurde sie langsamer, bevor sie auf den offenen Platz trat, der die Kathedrale umgab. Hinter den steinernen Mauern der im Dämmerlicht schwarz wirkenden riesigen Kirche lag der Hafen. Sie mußte ihn erreichen, bevor sich im Schloß das Leben rühren würde, bevor die Ebbe käme.
Am Hafen wartete bei einem der Kais ein Langboot. Es würde Maria zu ihrer Tante bringen. Zu dem stolzen, seetüchtigen Schiff, das sie weit weg von dieser schrecklichen Heirat bringen sollte.
Sie lief über den leeren Platz und drückte sich eng an die Mauern der Kathedrale. Gleich würde sie den Hafen erreichen. Sie roch schon das Brackwasser des Flusses.
Die Schotten sollen nur kommen, dachte sie trotzig. Sie sollen nur kommen.
KapitelEins
Schloß Stirling, Schottland, März 1528
Auch ein goldener Käfig ist ein Käfig.
John Macpherson, Lord of the Navy, stand mit dem Rücken gegen das schwelende Feuer und beobachtete in gespanntem Schweigen, wie der junge König mit dem fuchsroten Haar in seinem ruhelosen Auf und Ab vor einem der Fenster haltmachte, das sich zum Innenhof von Schloß Stirling hin öffnete. Als er dem Blick des jungen Mannes folgte, sah er einen vereinzelten Raben, der sich über die Mauern des Schlosses in den grauen schottischen Himmel erhob.
Am anderen Ende des Gemachs strich sich Archibald Douglas, Earl of Angus, über den langen schwarzen Bart, nachdem er den letzten der offiziellen Briefe gelesen hatte. Der mächtige Graf faltete behutsam das Dokument zusammen und sah zu dem schwarzgekleideten jungen Mann am Fenster hinüber, bevor er das Pergament mit ein paar Tropfen Wachs verschloß.
John sah, wie ein Lächeln über das Gesicht des Lordkanzlers zog, als er das königliche Siegel vom Tisch hob und es vorsichtig in das weiche Wachs preßte.
»Mit diesen Briefen sollte Sir John keine Schwierigkeiten haben, wenn er Ihre Braut abholt, Kit … Ich meine, Euer Majestät«, verbesserte sich Archibald, nachdem der König ihm einen kurzen Blick zugeworfen hatte.
John Macpherson verbarg seine wachsende Wut hinter einer unbeweglichen Miene. Er wollte abwarten, was geschehen würde. Der König hatte ihn zum Hof beordert, um ihm Instruktionen für einen Auftrag von höchster Wichtigkeit zu geben. Aber schon nach einigen Minuten in der Gegenwart dieser beiden Männer wußte er, daß die schrecklichen Gerüchte, die er während seiner Abwesenheit vom Hof gehört hatte, der Wahrheit entsprachen. Archibald Douglas, Earl of Angus, Anführer des mächtigen Douglas-Clans, Lordkanzler von Schottland, Mitglied des Kronrats und ehemaliger Gatte von Königin Margaret, hatte König James, seinen Stiefsohn, völlig in der Hand.
Der Kanzler wandte sich dem schweigenden Mann zu.
»Sir John, Kaiser Karl erwartet Euch vor Ende des Monats in Antwerpen. Ich muß wohl nicht betonen, daß es eine große Ehre ist, wenn er seine Schwester, Maria von Ungarn, unserer Obhut für diese Reise anvertraut.«
»Jawohl, Mylord«, antwortete John und sah dabei den König an.
»Seine Majestät wird Ostern auf Schloß Falkland verbringen«, fuhr Angus fort. »Aber falls Ihr mich brauchen solltet, ich bin im Süden und werde die dortige Grenze zu England von dem herumstreunenden Pack säubern.«
Der König wandte sich John zu, und ihre Blicke trafen sich. John Macpherson sah, wie es in den Augen des jungen Mannes aufblitzte. Dasselbe furchtlose Glitzern, das er schon vor Jahren an dem vaterlosen Jungen bemerkt hatte. James war noch ein kleines Kind gewesen, als sein Vater in einer Schlacht gegen die Engländer auf dem Flodden Field gestorben war. Der Kronprinz war einer mutigen Frau und einer Handvoll treuer Anhänger anvertraut worden. Sie hatten ihn in den Highlands versteckt, während einige Adelige alles für seine Rückkehr vorzubereiten versuchten. Und dann war er zurückgekehrt, in die Arme der Königinmutter. Noch nicht einmal zwei Jahre alt, wurde der kleine Kit zu James V. gekrönt, König von Schottland und den Inseln des Westens.
An diesem Tag hatte John Macpherson ihn das erstemal gesehen. An dem Tag seiner Krönung. Ein Kind, das auf dem Thron eines im Chaos versinkenden Landes saß. Aber jedem, der vor ihm gekniet war und ihm vor Gott seine Treue geschworen hatte, war bewußt gewesen, daß dieser Junge ein Stuart war. Schweigsam, ernst und unbewegt hatte Kit während der Zeremonie allen gezeigt, daß er das Blut, den Mut und die Klugheit seiner Vorfahren besaß. In ihm würde sich die Tradition fortsetzen. Er war der neue König, der eines Tages Schottland vor seinen Feinden retten würde. Der Schottland vor sich selbst retten würde.
John sah, wie der König auf ihn zuging, nicht darauf achtend, daß der Kanzler unverwandt weitersprach.
Der Lordkanzler. Jener Mann, der die verwitwete Königin nur geheiratet hatte, um das Machtvakuum zu füllen, das in Schottland nach dem verheerenden Verlust auf dem Flodden Field bestand. Jeder in Schottland wußte, daß die Macht der Familie Douglas durch diese Vereinigung wachsen sollte, und das tat sie tatsächlich. Seit der Heirat war der junge König ein Spielball in den Händen des Earl of Angus, der schließlich die absolute Macht innehatte – indem er in dessen Namen herrschte.
Seit die Königin sich nun beim Papst um eine Annullierung ihrer Ehe bemühte, verstärkte der Lordkanzler, so hatte John gehört, seinen Druck auf den jungen König und überwachte ihn mit Argusaugen.
Wie alle wußte John, daß es niemanden gab, der mächtig genug war, den Lordkanzler herauszufordern. Vor nicht einmal einem Jahr hatten das ein paar Tausend Mann am Linlithgow versucht und waren gescheitert. Als sie blutig niedergemetzelt auf dem Schlachtfeld lagen, hatte Angus auch noch behauptet, er habe nur die Krone beschützt.
John straffte die Schultern, als der rothaarige König vor ihn trat. Er überragte den jungen Mann um Haupteslänge. Unverwandt sahen sich die beiden in die Augen.
»Hältst du mich für schwach, Jack Heart?« fragte der König leise.
Jack Heart. John lächelte. Schon lange hatte er seinen Spitznamen nicht mehr gehört – seit den Tagen, als der kleine König sich noch in der Obhut der Königinmutter befunden hatte. Damals war James in seinen Freiheiten lange nicht so eingeschränkt gewesen, und John hatte dem Jungen beigebracht, in den Bugwellen der Queen’s Ferry zu segeln. Sie hatten einen ganzen Sommer miteinander verbracht, und in dieser Zeit hatte der junge König den Spitznamen aufgeschnappt, mit dem die Matrosen der Schiffe von den Macphersons John gerufen hatten. Zwischen den beiden war er zum Zeichen der Zuneigung geworden. Nur noch wenige erinnerten sich an diesen Namen, und noch weniger Männer hätten es gewagt, den Lord of the Navy so vertraulich anzusprechen.
Außer Kit.
»Du stimmst also zu.«
»Nein«, sagte John. »Ihr seid nicht schwach, junger Mann. Ihr sitzt nur in der Falle.«
»Mein Vater hätte sich anders verhalten.«
»Dein Vater war in deinem Alter weder von seinen Leuten abgesondert noch gefangengehalten worden«, fuhr John mit größerer Entschiedenheit fort. »Und sosehr ich ihn als König liebte, auch er hatte seine Fehler.«
»Aber er war ein Soldat. Mein Vater hatte Mut. So wie du.« James starrte auf den Tartan des Kommandanten. »Niemals hättest du dich in dieses Schicksal gefügt, wenn du in meiner Lage gewesen wärst.«
»Aber, Mylord …«
»Jack Heart«, fiel ihm der junge König ins Wort, »du warst nicht einmal ein Jahr älter als ich, als du dich – neben meinem Vater bis zu den Knöcheln im Schlamm stehend – auf dem Flodden Field behauptetest. Du bist mutig, Jack, und du hast Entschlußkraft. Ich bin und habe nichts von alledem und noch vielem mehr, das weiß ich, mein Freund.«
»Das meint Ihr vielleicht, Mylord. In den Herzen aller treuen Schotten seid Ihr der König, seid Ihr unsere Zukunft.«
James blickte zu John auf, und in seinen Augen lag Wehmut. »Ich möchte mein Volk nicht enttäuschen.«
»Ihr werdet es nicht enttäuschen, Sir«, antwortete John mit fester Stimme, als er die Verzweiflung des jungen Mannes bemerkte. Der König reichte ihm mittlerweile schon fast an die Schulter. Aber er war noch so jung. Vielleicht zu jung, um das Böse zu bekämpfen, welches da an seiner Seite thronte. »Ihr werdet die … Schwierigkeiten überwinden, und damit werdet Ihr die Herzen aller Schotten gewinnen. Ihr werdet den Thron ganz übernehmen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann werden die Berichte über Euren Mut, die Geschichten Eures Großmuts, die Erzählungen von Eurer Güte alles in den Schatten stellen, was von Eurem Vater und den Vätern Eures Vaters gesagt wird. Erinnert Euch immer daran, Kit: Euer Volk sieht die Verheißungen der Zukunft, darum will es Euch, und darum verehrt es Euch.«
James sah ihn vertrauensvoll an. »Ich will mein Bestes geben, um mein Volk nicht zu enttäuschen. Ich werde mich aus dieser Falle befreien.«
»Wie ein richtiger Fuchs eben.« Aus Johns Worten sprach seine Zuneigung.
»Wie mein Vater.« Der König sprach leise. Und dann war das Gesicht des jungen Mannes plötzlich wie verwandelt. »Gut, Jack. Dann bringst du sie also zu mir.«
»Wenn das Euer Wunsch ist.« John hielt inne und warf einen raschen Blick zu dem Kanzler hinüber, der sie vom anderen Ende des Gemachs her argwöhnisch musterte. »Natürlich könnten wir andere Mittel und Wege ersinnen, um dieses … um diesem unglücklichen Zustand ein Ende zu bereiten.«
Der junge König lächelte traurig und sah auf seine noch unschuldigen Hände hinunter. »Wenn es nur so einfach wäre. Aber wenn wir diesen Weg gehen würden, hieße das, daß andere meinen Kampf führen müßten. Solche wie du, Jack Heart. Wäre ich dagegen frei …«
John wartete, daß er fortfuhr, aber Kit wechselte unvermittelt das Thema.
»Er hat mir und dem Rat sein Wort gegeben, sich nach dieser Heirat nach und nach zurückzuziehen.« Der junge Mann blickte kurz über die Schulter. »Das ist das Beste. Ich wünsche nicht, daß noch weiteres Blut unschuldiger Schotten vergossen wird, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, diese schreckliche Sache zu einem Ende zu bringen. Dafür bin ich ganz allein verantwortlich, Jack. Es liegt in meiner Hand. Dir mag das vielleicht unwichtig erscheinen, aber für mich ist es das nun einmal nicht. Ich habe zum erstenmal die Gelegenheit, meine Entschlossenheit und meine Stärke zu zeigen, und das ist mir alles wert.«
»Aber Ihr seid noch so jung … Ihr habt eingewilligt, eine Frau zu heiraten, die Ihr nicht kennt, die Ihr kein einziges Mal gesehen habt!«
»Ich tue es für Schottland. Und es wird mich meinem Volk näherbringen.« Die Augen des jungen Mannes leuchteten bei diesem Gedanken auf. »Später werde ich genug Zeit haben, Streitigkeiten zu schlichten … wenn ich erst einmal frei bin. Jack, bitte, ich will diese Möglichkeit ergreifen, es bedeutet mir sehr viel.«
John nickte. Wie konnte er seinem König eine so dringende Bitte abschlagen?
»Bring sie her, Jack.« Der junge Mann ergriff seinen Arm. »Ich werde sie heiraten. Es ist Gottes Wille.«
Energisch schritt der Kanzler durch den Raum und reichte John den versiegelten Brief. Archibald Douglas’ Stimme war kalt, sein Blick durchdringend.
»Es darf ihr nichts geschehen, Sir John.«
John nickte dem Kanzler knapp zu, und nach einem letzten vielsagenden Blickwechsel mit dem König verbeugte er sich vor beiden und verließ das Gemach.
KapitelZwei
Die Nordsee, vor der Küste Dänemarks
Marias Hände waren blutig gerieben.
Unbeholfen schob sich die junge Frau die Ruder unter die Arme und drückte mit den Fingern vorsichtig auf die schmerzenden blutigen Stellen an den Handinnenflächen. Plötzlich ergriff eine kleine Woge das Boot, eines der Ruder schnellte in die Höhe und traf sie hart unter dem Kinn.
»Also zum Matrosen bist du ganz sicher nicht geboren, Kleine.« Isabel versuchte sich in beißendem Sarkasmus, auch wenn ihre alternden Augen schwer vor Müdigkeit waren.
Maria blickte traurig auf die vor ihr sitzende Frau. Blutverlust, Kälte und Erschöpfung forderten ihren Tribut.
»Ich glaube, es wäre besser, wenn du schliefest, Tante.«
Isabel streckte die müden Beine aus und versuchte, die Taubheit aus ihren Händen zu schütteln, die sich allmählich in ihrem Körper ausbreitete.
»Ich kann nicht schlafen. Ich will auch gar nicht schlafen. Nicht mit einer solchen Anfängerin an den Rudern. Wenn es mein Schicksal sein soll, die Beute irgendeines halbgefrorenen Nordseefischs zu werden, dann möchte ich das bei Gott mitbekommen.« Isabel seufzte. »Lange kann es nicht mehr dauern, das spüre ich. Der Lärm deiner Ruderversuche genügt, um das Gesindel selbst bei diesem Nebel geradewegs zu uns zu führen. Hörst du sie nicht schon? Glaubst du vielleicht, die haben unser Schiff gestürmt, nur um uns dann davonkommen zu lassen?«
Maria verdrehte die Augen und versuchte weder ihre Angst noch die feuchte, bis in die Knochen kriechende Kälte zu beachten. Unter Schmerzen schloß sie die Finger um das feuchte Holz der Ruderschafte und spannte die verkrampften Schultern, um das kleine Boot wieder durch den nicht enden wollenden Nebel zu stoßen.
»Denk nur daran, womit du deine Zeit verbracht, ach, schlimmer noch, verschwendet hast!« fuhr Isabel fort. »Die Zeit, die du dazu aufgewendet hast, elegante Gobelins zu sticken, hättest du besser dazu verwandt, etwas Sinnvolles zu lernen! Etwas über das Meer! Wie man sich verhält, wenn man in Seenot …«
Maria seufzte. Jedes Wort ihrer Tante schien noch mehr Kraft aus ihren Armen zu ziehen. Jeder Ruderschlag. Die junge Frau versuchte, ihren Schmerz und die wachsende Hoffnungslosigkeit nicht zu beachten. Sie zwang sich, sich nur auf das Geräusch der auf das trübe schwarzgrüne Wasser schlagenden Ruder zu konzentrieren. Aber es schien nichts zu helfen, Isabels Redefluß konnte sie sich nicht entziehen.
Schiffbrüchig. Angreifbar.
Diese Gedanken brachen mit einer kalten, noch nie erfahrenen Klarheit über der jungen Frau herein. Maria unterdrückte ihre Tränen und blickte über die Schulter auf den Spanier, der am Bug des Bootes hingestreckt lag. Wie leicht wäre es, wie dieser sich hinzulegen, die Augen zu schließen und der Natur ihren Lauf lassen. Der Matrose hatte sich schon seit längerem nicht mehr bewegt oder auch nur gestöhnt. Sie fragte sich, ob er überhaupt noch lebte. Er sah so friedlich aus. Die Musketenkugel, die ihre Tante verwundet hatte, hatte sich danach in die Brust des armen Mannes gebohrt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Maria an seiner Statt gewesen wäre. Vielleicht hätte sie dann ihren Frieden, weit weg von der Kälte und dieser kaum zu bezwingenden Müdigkeit. Sie schüttelte den Kopf und versuchte, den Gedanken zu verdrängen.
Als ihr Blick auf die Tante fiel, überlegte Maria einen Moment lang, ob sie diese nicht bitten sollte, nach dem Matrosen zu sehen. Aber dann fürchtete sie, daß es schon gefährlich wäre, die Tante auch nur zu bitten, die Ruder zu halten, um sich selbst um ihn zu kümmern. Schon der Gedanke, wie stark dann das Boot ins Schaukeln geraten könnte, hielt sie davon ab. Das würde für sie alle möglicherweise in einer Katastrophe enden.
Ihre Tante hatte recht gehabt. Sie war kein Matrose.
»Ich glaube, wir sind im Kreis gerudert«, murmelte Isabel mißmutig.
»Da hast du wahrscheinlich recht. Du kannst also auch noch fehlende Navigationskenntnisse der Liste meiner Mängel hinzufügen«, flüsterte Maria und betrachtete das Blut auf dem Ruderschaft, das von ihren Händen stammte. Die Finger waren steif und taub und die Muskeln verkrampft, so daß sie kaum noch Kraft in den Armen verspürte.
Vergeblich versuchte John Macpherson durch den dichten Nebel zu spähen, der die Great Michael einhüllte. Er sah die Nebelschwaden, die durch die Takelage zogen und selbst das bunte Banner verschwinden ließen, das – wie er wußte – zusammengefallen von der Spitze des Hauptmastes hing. Bei dem wechselhaften Märzwetter ließ sich nicht vorhersagen, wann sich der Nebel auflösen würde.
Nicht lange nach Sonnenaufgang waren sie in eine Flaute geraten, und das Schiff war bald in dem aufziehenden Nebel verschwunden. Seine drei anderen Schiffe hatte John etwa vor einer halben Seemeile das letztemal auf dem unbewegten Meer dümpeln sehen.
Der Morgen war schleppend vorübergegangen, bis sie plötzlich gedämpften Kanonendonner vernommen hatten – irgendwo im Süden wurde anscheinend ein erbitterter Kampf ausgefochten. Aber seit einigen Stunden hatten John und seine Mannschaft nichts mehr gehört.
Als hätte er seine Gedanken erraten, kam David Maxwell, der Schiffsnavigator, die Schiffstreppe herauf und stellte sich neben seinen Kommandanten. »Wären wir nicht in diesen dicken Nebel geraten, Sir John, wären wir jetzt vielleicht in ein nettes kleines Getümmel verwickelt.«
»Stimmt, David«, gab John mit einem Seitenblick zurück. »Es wäre eine Situation, die wir auf dieser Fahrt nicht suchen.«
»Dann mag in diesem teuflischen Nebel vielleicht doch auch göttlicher Wille liegen, was?«
»Vielleicht, David.« Der Highlander verstummte, um gleich darauf den untersetzten kleinen Mann zu begrüßen, der sich zu ihnen gesellte. Wieder beschlich John der Gedanke, daß er sich während der ersten Tage dieser Reise nicht umdrehen konnte, ohne fast mit Sir Thomas Maule zusammenzustoßen. Colin Campbell, der Earl von Argyll, hatte ihn vorgewarnt, aber John wollte seine Reisepläne deshalb nicht ändern. Schließlich war Sir Thomas auch ein brauchbarer Mann, sah man von seiner krankhaften Angst um die Aufgaben ab, die er für die seinen hielt. John wollte den alternden Ritter nicht von dem ehrenvollen Auftrag ausschließen, die nächste Königin Schottlands nach Hause zu bringen.
Dachte John darüber nach, dann war ihm klar, daß das Problem nicht durch Sir Thomas ausgelöst wurde. Die Schwierigkeit lag vielmehr darin, daß die junge Frau, die Sir Thomas auf dieser Reise begleitete, keine andere als Caroline Douglas war – jene Caroline, die bekanntlich John Macphersons Geliebte gewesen war. Soweit es John betraf, wußten die Menschen aber auch, daß die wechselvolle Affäre zwischen beiden schon längst beendet war, als die Lady die Hand von Sir Thomas Maule angenommen hatte. Für John war Caroline jetzt nur noch eine alte Bekannte.
»Nun, Navigator«, erkundigte sich der untersetzte Mann, »wie weit südlich waren diese Kanonenfeuer deiner Meinung nach heute morgen entfernt?«
»Es ist schwer zu sagen, Sir Thomas«, antwortete David vorsichtig. »Wie jeder Seemann Euch bestätigen kann, birgt der Nebel Tücken in sich. Dieser Kampf kann sich in fünfundzwanzig Seemeilen oder auch nur in fünf Seemeilen südlich abgespielt haben. Ich würde meine Heuer auf keine genaue Schätzung setzen.«
»Nun, ich hätte aber eine etwas präzisere Auskunft erwartet, Bursche. Aber vielleicht fehlt dir noch die Erfahrung.« Sir Thomas Maule wandte sich dem Kommandanten des Schiffes zu. »Und Sir John? Würdet Ihr Euch trauen, die Entfernung zu schätzen?«
»Es tut mir leid, ich muß David zustimmen«, antwortete John mit einem Blick auf das verärgerte Gesicht des Navigators. »Wir wären leichtsinnig, alle Vorsicht außer acht zu lassen, in dem Glauben, sie seien weit weg. Wer auch immer sie sind, die Möglichkeit besteht, daß sie Blut geleckt haben und ihre Kampfeslust unstillbar ist. Die Annahme, sie seien ganz in der Nähe, wäre aber ebenso unklug, sofern wir dadurch die Nerven verlören und unsere Männer ganz sinnlos mit Sonderwachen erschöpfen würden. Der Nebel wird uns erst einmal von ihnen abschirmen. Wenn er sich auflöst und Wind aufkommt, dann haben wir noch genug Zeit für die Entscheidung, ob wir kämpfen müssen. Auf jeden Fall sind wir für alle Möglichkeiten gewappnet.«
»Wenn wir in anderer Mission unterwegs wären, Sir John«, nickte Thomas Maule ernst und klopfte sich mit dem Schwert ans Bein, »hätte ich nichts gegen einen kleinen Kampf einzuwenden.«
»Nur kann man die Kämpfe auf See nicht mit denen an Land vergleichen«, erklärte David, noch immer verärgert. »Der stärkste Arm und das gewaltigste Schwert sind nichts wert, wenn Ihr den schwankenden Schiffsboden unter den Füßen nicht gewohnt seid.«
John unterdrückte ein Grinsen. Die Fahrt von Edinburghs Hafen bei Leith hatte für seine Männer schon zu lange gedauert. Die meisten von ihnen konnten zwar den hübschen Gesichtern der Frauen und Töchter der Edelmänner etwas abgewinnen, hatten aber wenig Respekt gegenüber deren Ehemännern und Vätern. Die Anwesenheit einiger adliger Landratten an Bord hatte auf der Great Michael schon zu einer Reihe von Problemen wegen der rauhen und unverblümten Sprache der Seeleute geführt, auch wenn bisher alle Unannehmlichkeiten ausgemerzt werden konnten. Aber John ahnte, daß es bei der Rückfahrt nach Schottland zu Schwierigkeiten mit der Disziplin kommen würde, denn dann hatten sie eine Königin und ihr Gefolge an Bord, für die sie die Verantwortung trugen.
»Für uns, die wir bis zu den Knöcheln im Schlamm stehend auf dem Flodden Field gekämpft haben«, gab der untersetzte Krieger zurück, »wird kein Schiffsdeck der Welt jemals Anlaß zur Besorgnis sein.«
»Ihr habt ganz recht, Sir Thomas«, mischte sich John ein, um den drohenden Streit noch einmal abzuwenden. »Aber wie Ihr selbst sagt: Wenn dies eine andere Mission wäre. Aber so, wie die Situation sich darstellt, braucht Ihr Euer Schwert nicht zu zücken, sondern könnt es beruhigt an der Seite stecken lassen. Vielleicht werden wir hier ja auch eine ganze Weile festgehalten.« Er wandte sich seinem Navigator zu. »Danke, David.«
Auf diesen Wink seines Kommandanten hin verneigte sich David Maxwell kurz vor den beiden Edelleuten und entfernte sich. John sah dem Navigator nach, dessen weiße Feder auf der leuchtendblauen Kappe lustig auf und ab wippte, während er mit jedem Matrosen, dem er begegnete, einige Worte wechselte.
»Diesem Burschen«, begann Sir Thomas, »fehlt ja jeglicher Respekt vor Rang und Namen, seid Ihr nicht meiner Meinung?«
John sah immer noch seinem Mann nach. »Wir alle haben Fehler, Sir Thomas. David Maxwells Zunge mag so scharf sein wie die Klinge Eures Dolchs, und er hat vor niemandem Angst. Aber er ist auch Schottland treu wie keiner, daher mag er vielleicht auch ein bißchen stolz auf sich und seine Kameraden sein.« Er wandte sich um und blickte den untersetzten Kämpfer neben sich an. »Diese Seefahrer haben genauso ein Recht, Krieger und Helden genannt zu werden, wie jene Männer, die auf dem Land kämpfen. Aber den meisten gesteht man das nicht zu.«
Sir Thomas rieb sich mit seinen dicken weißen Fingern gedankenverloren das Kinn.
»Und wenn man wie Ihr ein Mann ist, der sein ganzes Leben in den Dienst seines Landes gestellt hat«, fuhr John fort, »dann weiß man, wie man einen jungen Mann wie diesen anspornt.«
Der ältere Mann nickte verhalten.
»Er ist der beste Navigator, den ich kenne.« John blickte wieder auf das Nebelmeer hinaus. »Er war bereits in der Neuen Welt, er ist um Afrika gesegelt und bis nach Indien. David Maxwell ist schon ein erfahrener Mann, Sir Thomas.«
Er konnte nichts darauf erwidern. Sir Thomas merkte, daß er ganz geschickt eine Rüge erhalten hatte. Die Macphersons im allgemeinen und dieser im besonderen hatten eine Art, einem das Gefühl zu geben, nicht ganz bei Verstand zu sein.
Sir Thomas wandte sich um und sah zwei weißen Seevögeln zu, die wie ein Geisterpaar aus dem Nebel auftauchten. Sie flogen durch die Takelage und ließen sich auf der Großrah nieder. Dort saßen die beiden Vögel und blickten unruhig umher, als würden sie ihrem unerwarteten Glück, ein solches Schiff entdeckt zu haben, nicht trauen. Ohne Warnung schrie einer von den beiden plötzlich, pickte auf den anderen ein und vertrieb ihn schließlich von seinem Platz. Der eine Vogel blickte den anderen wütend an, als der sich nicht weit von ihm wieder niederließ.
Sir Thomas war nicht ganz wohl zumute, neben dem hünenhaften Kommandanten zu stehen. Er wußte um das Problem; es war das nagende Bedürfnis, sich mit John Macpherson zu messen. Schließlich verglich seine Frau sie bei jeder Gelegenheit miteinander. Es tat ihm weh, die Wahrheit anzuerkennen; er war ihr gegenüber so hilflos – ihm fehlten einfach das gute Aussehen, die Gestalt und die Stärke eines John Macpherson. Vor allem beneidete er ihn um dessen Jugend. Macpherson war in der Blüte seiner Jahre. Der alternde Krieger haßte diesen Mann. Er hatte das Bedürfnis, gegen ihn zu kämpfen und dem schönen Gesicht Narben zuzufügen. Aber wie sollte er das bewerkstelligen? Mit welcher Begründung?
Die Züge von Sir Thomas verfinsterten sich, und er zwang sich, seine Gefühle tief in sich zu begraben. Sie führten zu nichts.
Warum seine schöne junge Frau ihn – einen alternden Mann mit einer Tochter ihres Alters – diesem jungen und einnehmenden Krieger vorgezogen hatte, konnte er sich nicht erklären. John Macpherson hatte vor Jahren das Bett mit Caroline geteilt, und sosehr Sir Thomas es auch versuchte, er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich Caroline jedesmal, wenn er sie zu Bett trug, John Macpherson an seiner Statt vorstellte.
Sir Thomas hatte auch die Gerüchte bei Hof gehört. Daß es nur eine Sache der Zeit sei, bis Macpherson seinen Verlust spüren und die langjährige ehemalige Geliebte wieder umwerben würde. Aber das schien sich nicht zu bewahrheiten. Der Mann hatte nie auch nur die Spur einer solchen Absicht gezeigt. Caroline war in ihrer Kajüte geblieben und Sir John an Deck. Und selbst das ärgerte Sir Thomas in gewisser Weise. Drei Tage lang waren sie nun schon auf See, und die beiden hatten noch keine Anstalten gemacht, sich wiederzusehen.
Die Situation quälte ihn, und er wünschte, sie wären niemals mit auf Fahrt gegangen.
John Macpherson sah schweigend zu, wie die Wache abgelöst wurde. Sechs Männer tauchten vom Vordeck auf, grüßten den Kommandanten, bevor sie flink die tropfnassen Taue der Takelage zu ihren Posten hinaufkletterten. Einige Augenblicke später stiegen die Matrosen, die abgelöst worden waren, den Weg zum Deck herunter, um in den Mannschaftsquartieren zu verschwinden.
Mit Ausnahme von Sir Thomas hatte die Delegation von Edelleuten, die auf der Great Michael segelte, kaum je einen Fuß auf Deck gesetzt. Das war John Macpherson allerdings nur recht.
Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er ihnen unten begegnet war, merkte er, daß ihre Gespräche aus demselben müßigen Geplauder bestanden, das er von jedem europäischen Hof kannte. Das letztemal, als der Highlander unter Deck gewesen war, hatte einer der wortführenden Adligen seine Meinung über Maria von Ungarn und ihre angebliche Unfähigkeit, Kinder zu gebären, lautstark geäußert. Ein schlechtes Zeichen, hatte der Edelmann geraunt, und die anderen am Tisch hatten genickt. Die zukünftige Königin, hatte er mit einem Kopfschütteln gesagt. Unfruchtbar, da gab es keinen Zweifel. Und was würde dann aus dem Geschlecht der Stuarts werden?
John hatte nur mit den Achseln gezuckt. Die Vorhersagung gehörte bestimmt nicht mit zu seinen Pflichten.
Der Highlander verabscheute solches Geschwätz und war angewidert gegangen. Mit Sir Thomas im Schlepptau natürlich.
John beugte sich über die Reling und warf einen prüfenden Blick auf den Schiffrumpf. Er dachte über den Ritter nach. Er wußte, daß Sir Thomas ihn nicht aus den Augen ließ. Das konnte er auch ohne weiteres verstehen. Schließlich kannte er ja Carolines Spielchen. Er hatte sich schon gefragt, ob sie ihren unglücklichen Ehemann nicht schon längst bis zur rasenden Eifersucht getrieben hatte. Nachdem er sie so gut kannte, wäre John aber auch nicht um eine angemessene Antwort verlegen, sollte die Zeit kommen und das Spiel auch für ihn beginnen.
Über sein Gesicht huschte ein Schatten. Er wußte, daß es hart auf hart kommen konnte, daß vielleicht Blut fließen würde, wenn Sir Thomas es nicht anders wollte. Wenn er diese Mission hinter sich bringen sollte, ohne mit Caroline Maule aneinanderzugeraten, käme das einem Wunder gleich.
»Sir John, vielleicht könnt Ihr mir erklären, wie es kommt« – Sir Thomas fuhr mit seinen klobigen Händen gedankenverloren über die Reling –, »daß Karl, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der mächtigste Monarch neben Suleiman, dem Prächtigen, sich damit einverstanden erklärt, daß wir seine Schwester holen und ihrem neuen Gemahl zuführen.«
»Tradition, nehme ich an«, antwortete John nach einer kurzen Pause, erleichtert, daß der neben ihm stehende Mann ein unverfängliches Gesprächsthema angeschnitten hatte. »Zudem ist es eine Frage der Übereinkunft. Denn sollte ihr etwas zustoßen, würde es zum Krieg kommen, um die Lage zu bereinigen und um die Forderung nach Rückgabe der ersten Mitgiftzahlung durchzusetzen, die der Lordkanzler in einer Truhe auf Schloß Stirling unter Verschluß hält.«
Sir Thomas zögerte einen Augenblick, suchte nach den richtigen Worten. »So etwas kann leicht … zu einer häßlichen Angelegenheit werden, nicht wahr?« fragte er schließlich und seufzte tief. »Ich meine natürlich eine Heirat.«
»Dieser Ansicht sind viele, Sir Thomas.«
»Aber es muß nicht sein.« Der Mann starrte noch immer auf seine Hände. »Nachdem ich das Ganze nun zum zweitenmal mitmache, betrachte ich es von einer anderen Warte aus.«
John nickte unverbindlich.
»Ich bin geneigt zu glauben, daß nicht nur königliche Heiraten, sondern die meisten Verlobungen – selbst in den niedersten Ständen – durch finanzielle Erwägungen zerstört werden.« Sir Thomas wandte sich um und musterte den Krieger. »Was ist Eure Ansicht zu diesem Thema, Sir John?«
Der Kommandant wußte, worauf Sir Thomas abzielte, und er war bereit, ihm eine ehrliche Antwort zu geben.
»Ich persönlich habe mit der Ehe keinerlei Erfahrung, Sir Thomas. Und doch glaube ich, daß Ihr recht habt. Nur gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Und ist eine Ehe erst einmal geschlossen, vermag vielleicht die Liebe jenes echte Band zu schaffen.«
»Ja, ja. Aber was meint Ihr – was unterscheidet eine glückliche von einer unglücklichen Ehe? Was ist es, das manchem die Gunst erweist, auf Dauer glücklich zu sein?«
John starrte auf das Meer; noch immer stiegen die Nebelfetzen um das Schiff auf. In diesem Nebel lag wahre Schönheit, auch wenn er die Erledigung seines Auftrages verzögerte. Könnte er nur die Fragen von Sir Thomas beantworten! Sein Gesicht verfinsterte sich.
»Ihr sprecht mit dem Falschen, Sir Thomas.«
Keine Antwort. Wenngleich Carolines Name noch nicht gefallen war, hatten die beiden Männer noch nie so offen miteinander über sie gesprochen.
»Ihr seid der einzige von Euch Brüdern, der noch nicht geheiratet hat«, sagte Sir Thomas ohne Umschweife.
John wandte sich um und sah ihn an. »Das ist richtig.«
»Wenn Ihr tatsächlich glaubt, was Ihr soeben gesagt habt, was hat Euch dann davon abgehalten? Nach allem, was man hört, bekommt den Macphersons die Ehe ganz ausgezeichnet. Sie scheinen zu den besagten Ausnahmen, den wenigen Glücklichen zu gehören.« Die Augen des älteren Kriegers blickten durchdringend. »Warum also Ihr nicht?«
Der Highlander schwieg. Zu gern hätte er eine Antwort auf diese Frage gehabt und den Mann damit beruhigt. Aber er hatte keine. Wie sollte er von dem Glück seiner Brüder sprechen, ohne so zu klingen, als beneide er sie um all ihre Freuden?
Er hätte Caroline um ihre Hand bitten können. Viele hatten dies von ihm erwartet. Ihre Affäre hatte sich trotz Höhen und Tiefen über nahezu sieben Jahre erstreckt. Aber dennoch, als sie eine Entscheidung von ihm gefordert hatte, war es ihm unmöglich gewesen, um ihre Hand anzuhalten, und so hatte er sie gehen lassen.
Sie war weder Fiona, noch war sie Elizabeth. Solche Frauen, wie seine Brüder das Glück hatten, sie geheiratet zu haben, gab es nur selten, und das wußte er nur zu genau. Caroline war nicht wie sie, und was zwischen ihnen gewesen war, unterschied sich grundlegend von dem, was er von seiner Familie her kannte. Sie hatten Momente der Leidenschaft geteilt, das wohl, aber um wahre Liebe hatte es sich zwischen ihnen niemals auch nur annähernd gehandelt. Ihre Leidenschaft war allerdings wohl kaum das passende Gesprächsthema für ihn und Sir Thomas.
»Darauf kann ich nur antworten«, erwiderte John schließlich, »daß ich … bislang noch nicht bereit war für eine Ehe. Noch nicht.«
»Also keine geheimen Pläne?« fragte Sir Thomas mit ruhiger Stimme.
John erwiderte seinen Blick. Überraschenderweise war in dem offenen Gesicht keinerlei Feindseligkeit zu erkennen. John war sich durchaus bewußt, daß der andere ein Recht hatte zu fragen.
»Nein. Keinen einzigen.«
Das laute Kreischen eines Seevogels hoch über ihnen brachte die ältere der beiden Frauen wieder zurück in die Gegenwart.
Isabel beugte sich nach vorn und warf einen besorgten Blick auf ihre Nichte. Mein Gott, was hatte sie getan? Der zerrissene und blutverschmierte Umhang, der über den Schultern der jungen Frau lag, war in einem weit besseren Zustand als diese selbst. Isabel sah die Wunde auf Marias Stirn und eine weitere an ihrem Kinn, die vom Ruder herrührte. Sie sah die blasse Haut und die blutleeren Lippen. Marias Augen hatten ihren Glanz verloren und lagen tief in ihren Höhlen. Isabel konnte kaum glauben, daß sie jener Königin gegenübersaß, die für ihre makellose Schönheit berühmt war. Innerlich verwünschte sie sich, daß sie Maria nahegelegt hatte, dem Willen ihres Bruders, was diese sinnlose Heirat anging, keinesfalls nachzugeben, falls es sie unglücklich machte. Isabel verwünschte sich, ihre Nichte in diese Lage gebracht zu haben und am Ende gar in diesem dahintreibenden Alptraum sterben zu müssen.
Karl, wo bist du? rief sie stumm. Begegne der Torheit deiner Tante doch einmal in deinem Leben mit Entschlossenheit! Such nach uns, mein Junge. Such nach deiner Schwester. Bitte Karl.
Als sie schließlich zu sprechen anhob, schlug sie einen viel sanfteren Ton an.
»O Maria, ich wünschte, ich könnte dir eine Hilfe sein. Aber sicherlich wird uns eines der anderen Langboote unserer Galeone bald aufgreifen.«
Überrascht über den Tonfall der Tante, blickte Maria auf. Dann lächelte sie. Sie wußte, daß die ältere Frau trotz all der rüden Worte und des barschen Auftretens, das sie üblicherweise zutage legte, einer der warmherzigsten Menschen war.
»Das würde ich auch gern glauben. Aber wir rudern schon seit Stunden durch diesen Nebel.« Sie blickte um sich. Seit sie sich von dem sinkenden Schiff entfernt hatten, hatten sie rein gar nichts mehr erkennen können. Keine Menschen, keine Boote, nicht einmal treibende Wrackteile. Nichts. »Wir wissen nicht einmal, wo wir sind oder welche Richtung wir einschlagen sollten!«
»Sei nicht kindisch, Maria«, schalt Isabel. »Du hast uns auf einem Kurs gehalten, der so gerade wie der Flug eines Pfeils ist. Das hast du wirklich ausgezeichnet gemacht, wenn man bedenkt, daß du zum erstenmal am Ruder sitzt. Wir müßten bald die Küste von Dänemark erreichen.«
Maria schenkte ihrer Tante ein schwaches Lächeln. »Oder in ungefähr einem Monat in England landen!«
»Also weißt du, Kind.« Isabel schimpfte ihre Nichte halbherzig, während sie versuchte, irgend etwas in dem dichten Nebel auszumachen.
Maria betrachtete den Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Tante. Zumindest war Isabel inzwischen klargeworden, in welcher Lage sie sich befanden, und sie hatte aufgehört herumzumurren. Es schien, als würde sie das erstemal, seit diese Katastrophe über sie hereingebrochen war, sich der Gefahr bewußt werden, in der sie sich befanden. In der Hölle des brennenden Schiffes, als die Männer die Langboote in Panik heruntergelassen hatten, war keine Zeit gewesen nachzudenken. Sie hatten das französische Kriegsschiff weniger als einen Tag, nachdem sie in Antwerpen abgelegt waren, gesichtet, und da hatte auch schon die Jagd begonnen. Es war ein Fehler gewesen, die spanische Flagge zu hissen – die Flagge der Silberflotte war den Franzosen Anlaß genug, sie anzugreifen. Jeder Pirat und Freibeuter in der Nordsee wußte von den Gold- und Silberschätzen, die die Spanier aus der Neuen Welt mit sich führten.
Während des ersten Kanonenfeuers hatte der Kapitän das kleine Schiff gewendet, um nach Norden zu fliehen. Er hatte gehofft, daß ihnen der Wind auf dem offenen Meer ausreichend Geschwindigkeit verleihen würde. Aber das französische Schiff war schneller gewesen. Von da an verloren sich Marias Erinnerungen in dem Durcheinander des Gefechts. Schüsse, Schwerter, die Schreie der Männer. So viel Blut. Sie rieb ihre Wange gegen ihre Schulter, um die Tränen wegzuwischen, die ihr in den Augen standen.
»Es tut mir leid, Maria.«
Die junge Frau hielt inne und sah ihre Tante an.
»Das alles tut mir leid. Daß ich dich fortgebracht habe.« Isabel ließ sich zurücksinken und sah zur Seite. »In meinem Alter, so sollte man meinen, müßte ich weiser sein, mehr über die Dämonen wissen, die auf der Welt umherziehen.«
»Aber du bist weise. Ich weiß deine Klugheit sehr zu schätzen.«
Isabel wandte ihren Blick wieder ihrer Nichte zu und lächelte sanft. »Ich hätte mich nicht in deine Zukunft einmischen sollen. Ich hätte dich das angenehme Leben weiterführen lassen sollen, an das du gewohnt bist.«
Maria lehnte sich über die Ruder, versuchte, ihrer Tante direkt ins Gesicht zu sehen. Das war nicht die Frau, die sie kannte. Aus diesen Worten sprach die Angst vor dem, was ihnen bevorstehen mochte. Gedanken über das Ende. »Sag so etwas nicht, Isabel. Wir beide wissen, daß das, was du getan hast, richtig war.«
»Nein, das war es nicht. Kannst du das denn nicht verstehen?« Sie weinte. »Dies hier ist der letzte Beweis. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben zwischen Antwerpen und Spanien hin und her gesegelt bin? Hunderte von Malen. Und nur einmal, vor zwanzig Jahren, wurde ein Schiff, mit dem ich reiste, angegriffen. Aber dieses Mal …«
»Du hattest einfach immer Glück. Das ist alles. Und ich habe dieses Glück eben nicht.« Maria versuchte all ihre Kräfte zu sammeln. Sie durfte nicht zulassen, daß sich Isabel Vorwürfe machte. Sie mußte ihr Leben in ihre eigene Hand nehmen. Sehen, was die Welt ihr zu bieten hatte. Das war es, was sie schon seit langem tun wollte. »Liebste Isabel, vielleicht werden wir hier auf dem Meer unseren Tod finden, vielleicht werden wir auch die Beute eines Fisches, wie du es so unverblümt genannt hast, aber du sollst die Wahrheit erfahren. Ich würde lieber einen solchen Tod sterben, als noch einmal ein Leben, das Karl für mich ausgehandelt hat, einfach hinzunehmen.«
»Lieber sterben als Königin von Schottland zu werden …« Isabel verdrehte ihre Augen. »Übertreibst du nicht ein wenig, Kind?«
»Nein, das tue ich nicht«, antwortete Maria entschieden. »Diese Flucht … dieses Abenteuer … mit dir zu Mutters Schloß in Kastilien zu segeln … Das ist das erstemal in den dreiundzwanzig Jahren meines Lebens, daß ich etwas tue, das auf meinem freien Willen beruht. Schottland ist nicht mein einziger Grund. Aber kannst du dir vorstellen, wie quälend es ist, wenn andere Menschen das eigene Leben seit dem dritten Lebensjahr verplanen? Mir wurde vorgeschrieben, mit wem ich mich anfreunden sollte und mit wem nicht, was ich tun und was ich unterlassen sollte, wohin ich gehen und wohin ich nicht gehen durfte. Wen heiraten und wen nicht. Und letzteres nicht nur einmal, sondern jetzt auch noch ein zweites Mal!«
Isabel konnte ihr Lächeln nicht länger unterdrücken.
»Ich weiß, meine Liebe. Aber trotz all der Pflichten, die man dir auferlegt hatte, hast du dir deinen Willen bewahrt. Zu jeder Stunde!«
»O nein!« Maria konnte die Tränen, die ihr über die Wangen liefen, nicht länger aufhalten. »Und keinesfalls bei eben dieser zweiten Heirat, die Karls Wunsch, auf jedem Thron in der christlichen Welt einen Habsburger sitzen zu sehen, entspricht. Dieses Geschäft mit den Schotten … ich konnte nichts dagegen tun, als läge ich unter Stein begraben, als wäre ich nicht einmal mehr imstande, mich zu rühren. Ich kann das alles nicht noch einmal durchmachen.«
Isabel sagte nichts, blickte sie nur an. Sie hatte es gewußt. Maria hatte sich stets mit allem einverstanden erklärt und sich untergeordnet – war es da nicht vorauszusehen gewesen, daß sie gegen eine zweite Verheiratung aufbegehren würde? Wieder mit einem Heranwachsenden, einem sechzehnjährigen König! Für jeden außer Karl war allein der Gedanke daran unfaßbar. Karl konnte die Trostlosigkeit, die eine solche Verbindung mit sich brachte, nicht nachfühlen, aber sie, Isabel, sehr wohl. Und aus diesem Grunde war sie mit Maria geflohen.
»Wenn wir dies mit Gottes Hilfe überleben«, sagte Isabel, »wird dein Bruder nach dir suchen, das weißt du, nicht wahr? Wenn wir das Glück haben und Kastilien erreichen sollten, wird er nicht davor zurückschrecken, das Schloß eurer Mutter zu belagern.«
Maria nickte. »Natürlich, er erwartet, daß ich die von ihm getroffene Vereinbarung einhalte. Diese schreckliche Ehe auf mich nehme.«
»Doch was willst du dann tun, mein Kind?« fragte Isabel. »Wir müssen uns einen Plan ausdenken.«
Maria war die ganze Zeit gerudert und bemerkte erst jetzt, wie das Blut von ihren Händen auf die graue Wolle ihres Kleides tropfte. Sie würde nicht nach Schottland gehen, sie konnte es nicht. Sie würde James V. nicht heiraten. Sie würde ihrem schlauen Bruder, der meinte, die Welt nach seiner Laune gestalten zu können, nicht gehorchen.
»Ich werde einfach so tun, als sei ich wahnsinnig geworden. Sie werden denken, daß ich wie meine Mutter bin. Sie nennen sie ja nicht umsonst Johanna die Wahnsinnige. Es wird nicht lange dauern, und sie werden auch mir diesen Beinamen verleihen. Keiner wird daran einen Zweifel hegen. Wie die Mutter so die Tochter. Ich werde toben und brüllen und nachts den Mond anheulen. In meinem Wahn werde ich außer mir sein. Ich werde meine Kleider zerreißen, mir Knochen ins Haar stecken und nackt im Regen herumlaufen.«
Beide schwiegen. Maria blickte auf und sah den schreckerfüllten Ausdruck im Gesicht ihrer Tante. Isabel wollte etwas sagen, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Nur ein Krächzen. Ihr Mund öffnete und schloß sich wieder.
»Ja, Tante?«
»Schnell!« Isabels Stimme war bloß ein Flüstern. »Schnell, kehr um und rudere. Rudere, als sei der Teufel hinter dir her!«
Maria drehte sich um und blickte auf ein riesiges Schiff, das in wenigen Metern Entfernung wie ein Geisterschiff aus dem Nebel auftauchte. Sie hatte noch nie ein so großes Schiff gesehen. Doch als ihr müder Verstand endlich den Grund für die Angst ihrer Tante erkannte, war es schon zu spät. Das kleine Boot krachte mit aller Wucht gegen den schwarzen Rumpf des Schiffes.
Maria war einfach weiter in die einmal eingeschlagene Richtung gerudert.
Sie war eben kein Matrose.
KapitelDrei
Wie eine Schlange, die auf ihre Beute zuschnellte, fiel die Leine des Matrosen gegen das dahintreibende Langboot.
Das kleine Boot schlug hilflos gegen den Rumpf des Schiffes. An Bord der Great Michael hatten sich die Seeleute entlang der Reling aufgereiht oder hingen in der Takelage und versuchten etwas in dem dichten Nebel auszumachen, um eingreifen zu können. Die Besatzung des Langboots machte keinerlei Anstalten, auf das Schiff zu klettern. Die schottischen Seeleute warteten voller Ungeduld und warfen ihrem Kommandanten fragende Blicke zu, was als nächstes zu tun sei.
»Woher, zum Teufel, kommt dieser Kahn?« brüllte John Macpherson, während er sich einen Weg zur Reling bahnte. »Sieht so aus, als wäre es ein einzelnes Boot, Mylord«, antwortete sein Navigator. »Und nur drei Mann Besatzung.« »Bringt sie hoch!«
»Sollte man das tatsächlich wagen?« mischte sich von hinten eine Stimme ein.
John wandte sich der großen blonden Frau zu, die sich an seine Seite schob. Caroline.
»Was, wenn sie bewaffnet sind?« fuhr sie fort. »Und wäre es nicht möglich, daß sie erst freundlich tun und uns dann, während wir schlafen, die Gurgel durchschneiden?«
Ohne ihr eine Antwort zu geben, wandte John seinen Kopf und warf Sir Thomas einen mißbilligenden Blick zu.
»Komm bitte, Caroline«, sagte ihr Mann sanft, nahm seine Frau am Ellbogen und zog sie von der Reling weg, um zu verhindern, daß der Kommandant doch noch etwas Unhöfliches erwiderte. Dies war weder die rechte Zeit noch der rechte Ort für einen Streit. »Ich denke, das hat Sir John zu entscheiden.«
Dieser blickte wieder am Rumpf seines Schiffs hinab, während einige seiner Männer sich an Tauen zu dem Boot herunterließen.
»Frauen, Mylord!« rief ihm einer der Matrosen zu. »Zwei Frauen und ein Mann.«
Auf diesen Ruf hin stürzte ein Haufen überraschter Männer an die Reling. John lehnte sich nach vorn und sah zu, wie sich ein weiterer Matrose herunterließ. »Bring sie hoch! Sofort!«
»Es sind verdammte Spanier, Mylord!«
»Und wenn sie die Abkömmlinge des Teufels sind!« gab John wütend zurück.
»Der Mann ist tot, Mylord«, rief der Matrose und deutete auf den Mann am Bug des Bootes. »Er hat ein Loch in seiner Brust, so groß wie meine Faust.«
»Bring sie hoch!«
»Auch den Toten?«
»Mann Gottes!« schäumte John ungeduldig. »Natürlich auch den Toten!«
Als die Matrosen die Wut in der Stimme ihres Kommandanten vernahmen, begannen sie eilig mit der Bergung.
John trat einen Schritt zurück, nachdem seine Männer sich endlich in Bewegung gesetzt hatten, und überließ dem Maat alles weitere. Er drehte sich um und bemerkte erst jetzt, daß sich die Delegation um ihn versammelt hatte. Das erstemal, seit sie in See gestochen waren, hielten die Edelleute etwas für unterhaltsam genug, um sich aus den bequemen Kajüten locken zu lassen. Wie ein Haufen neugieriger Kinder drängelten sie sich nach vorn, um einen besseren Blick auf die Neuankömmlinge werfen zu können.
Und genau das paßte ihm ganz und gar nicht. Seine Männer konnten eine solche Ablenkung im Moment nicht brauchen.
John ging zu Sir Thomas, der mit Caroline und seiner Tochter Janet am Hauptmast stand, und flüsterte ihm einige Worte zu. Der alternde Krieger setzte sich daraufhin sogleich in Bewegung. John wußte, daß der Ritter genau danach suchte – nach einer Gelegenheit zu handeln und von Nutzen zu sein.
John drehte sich wieder zur Reling und ignorierte die Flut von Klagen, die auf Sir Thomas’ barsche Aufforderung hin, sich wieder unter Deck zu begeben, losbrach.
Er reagierte auch nicht auf die Hilfsangebote derjenigen, die auf Deck geblieben waren, sondern dankte vielmehr im stillen, daß ihnen auf dieser Reise ein Gefecht bislang erspart geblieben war. Nicht daß die Great Michael einem Angriff nicht Widerstand leisten konnte, aber John war sich sicher, daß das Durcheinander auf Deck viel schwerer in den Griff zu bekommen wäre als ein Angriff des Feindes.
Als er sich einen Weg durch die Menge bahnte, sah John, wie David und der Maat einer älteren Frau vorsichtig über die Reling auf Deck halfen. Von dem blutgetränkten Mantel zu schließen, mußte sie eine Verletzung erlitten haben. John hielt den Atem an, als sie den Arm eines Matrosen ergriff und versuchte, einige Schritte zu machen. Aber sie vermochte sich nicht aufrecht zu halten und stützte sich mit all ihrem Gewicht auf den Matrosen, bis sie schließlich auf das Deck niedersank.
Hastig ging John auf die Frau zu und kniete sich neben sie.
»Sie ist verletzt«, hörte er hinter sich eine erschöpfte Frauenstimme sagen. »An der Schulter.«
John drehte sich zu der anderen Überlebenden um, die soeben an Bord gebracht worden war. Ihm fiel auf, daß sie, sobald sie an Bord war, höflich, aber bestimmt die Hilfe seiner Männer zurückwies. Sie schwankte, als sie sich der älteren Frau näherte, fing sich aber schnell wieder. Da kann man ja Mitleid bekommen, wenn man die Kleine sieht, dachte er und ließ seinen Blick über ihre nassen, mitgenommenen Kleider und den zerzausten Haarschopf gleiten. Auch auf ihrem Kleid waren dunkle Flecken zu sehen, die sicher von einer Wunde herrührten, aber der Zustand der jungen Frau schien weniger ernst zu sein als der der Älteren. Nach ihrer Verfassung zu schließen, hatten die beiden Frauen eine schlimmere Prüfung hinter sich, als nur im kalten Nebel rudern zu müssen.
John wandte seinen Blick von der jungen Frau ab und zog behutsam den blutgetränkten Mantel von der Schulter der älteren, um sich die Wunde anzusehen. Die beiden müssen Überlebende des Gefechts sein, das sie am Morgen gehört hatten, dachte er. Die ältere hatte, nach den Verbrennungen auf der Haut um die Wunde zu schließen, einen Musketenschuß abbekommen. Aber die Wunde war nicht lebensbedrohlich, entschied er, solange sie sich nicht entzündete.
»Schiffsmaat«, rief er über seine Schulter, »hol den Arzt aufs Deck, er soll einen Blick auf diese Wunde hier werfen.«
Dann stand er auf und wandte sich der anderen Frau zu, die nun direkt neben ihm stand.
Maria beobachtete, wie er sich erhob, und ihr stockte der Atem. Während er neben Isabel hockte, hatte der Mann bei weitem nicht so einschüchternd ausgesehen wie jetzt. Sein finsterer Blick überschattete sein dunkles Gesicht; zudem überragte er jeden Mann um ihn herum um Haupteslänge. Schnell wandte sie ihren Blick von ihm ab und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihre Tante. Sie wagte nicht, ihn ein weiteres Mal anzusehen.
»Und Ihr?« fragte er kurz angebunden. »Irgendwelche Verletzungen?«
»Nein«, gab sie zurück, drehte sich weg und fiel beinahe um, als sie sich zu ihrer Tante hinabbeugen wollte.
John sah auf die schmale, tropfnasse Gestalt zu seinen Füßen, und Mitleid regte sich in ihm. Er hatte das Zittern in ihrer Stimme wohl vernommen. Sie hatte etwas Kindliches, Unsicheres an sich, und er fragte sich, woher sie die Kraft genommen hatte, auf hoher See zu überleben.
Das graue Wollkleid, das die Frau unter ihrem Mantel trug, mußte einmal sauber gewesen sein, aber jetzt war es von dunklen Flecken und Meerwasser verschmutzt. Als habe sie seine Gedanken gelesen, zog die junge Frau ihren schweren Mantel enger um sich und machte es dadurch nahezu unmöglich, Rückschlüsse auf ihre Person zu ziehen.
Maria hatte ihre Finger auf die kalte, schlaffe Hand ihrer Tante gelegt und kämpfte gegen das Verlangen an, vor dem Blick des hinter ihr stehenden Hünen davonzulaufen. Obwohl sie ihm ihren Rücken zugewandt hatte, konnte sie spüren, wie sich seine Augen in sie bohrten. Einen kurzen Augenblick lang hatte sie gedacht, der Seemann wüßte, wer sie war, aber dann lenkte ihre Tante wieder ihre Aufmerksamkeit auf sich, als sie in ihrer Bewußtlosigkeit leise vor sich hin zu murmeln begann. Es war nicht von Belang, was dieser Mann wußte oder nicht – daran konnte sie so oder so nichts ändern; als erstes mußte sie sich um Isabel kümmern. Das war das einzige, was von Bedeutung war.
Sie scheint sehr jung zu sein, dachte John, aber ein eigentümliches, bittersüßes Gefühl stieg in ihm auf, als ihm klar wurde, daß fast jede Frau, die er in letzter Zeit kennengelernt hatte, sehr jung zu sein schien. Die Aufmerksamkeit, die sie der anderen Frau schenkte, deutete darauf hin, daß sie miteinander verwandt waren. Mutter und Tochter vielleicht.
»Auf Eurem Mantel ist Blut. Seid Ihr sicher, daß Ihr nicht auch verwundet seid?«
»Nein, das bin ich nicht«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Das muß das Blut des Matrosen sein, nicht meines.«
Sie wandte ihm nicht einmal ihren Blick zu, während sie sprach, aber er konnte sehen, daß sie erschauderte. Der Schock, dachte John. Frierend und durchnäßt in einem Boot auf dem Meer zu treiben würde den stärksten Mann auf die Probe stellen.
»Sind noch andere Boote auf dem Wasser?« fragte er. »Gibt es noch weitere Überlebende?«
»Wir haben keine gesehen«, flüsterte sie.
»Wie lange wart Ihr in dem Boot?«
»Lange.«
»Wie lange?«
Sie antwortete nicht, sondern zuckte nur mit den Schultern.
»Ist Euer Schiff untergegangen?«
Wieder gab sie ihm keine Antwort. So interessant sie auch sein mochte – John war es doch inzwischen müde, seine Worte an den Hinterkopf der Frau zu richten.
»Wo bleibt denn der verdammte Arzt?« rief er gereizt über seine Schulter hinweg und kniete sich neben die Verletzte, der jungen Frau gegenüber, und blickte diese an.
»Er kommt, Mylord«, antwortete der Schiffsmaat, als er durch die Reihen der Umstehenden trat.
»Wer hat Euch angegriffen, und wie viele Schiffe waren an dem Gefecht beteiligt?« fragte John und zwang sich, ruhig zu bleiben.
Maria starrte auf die geschlossenen Augen ihrer Tante. Zumindest durfte sie sich ausruhen. Maria war noch immer nicht in der Lage, ihren Blick auf den Mann zu richten. Sie fühlte sich verwundbar und verloren und bemühte sich, das Zittern zu verbergen, das durch ihren Körper lief. Sie mußte sich nicht umdrehen, um zu wissen, daß Dutzende von Neugierigen jede ihrer Bewegungen beobachteten, jedes ihrer Worte aufschnappten. Wie ein Reh fühlte sie sich – gejagt, verletzt und schließlich gefangen. Was würden sie mit ihnen machen? Der Hüne, der die Fragen stellte, war eindeutig der Kommandant, die anderen hatten offensichtlich Angst vor ihm. Sie wußte, daß auch sie Angst haben sollte. Er hatte sie Abkömmlinge des Teufels genannt.
»Ich muß das wissen.« Seine Stimme klang schärfer, als er beabsichtigt hatte. John berührte vorsichtig die Schulter der jungen Frau. »Wie viele Schiffe waren es?«
»Nur eines.« Kurz sah sie ihn an, senkte aber sogleich wieder die Lider.
Ihre Augen hatten die Farbe von heller Jade, dachte John und ertappte sich dabei, wie er sie anstarrte. Wie schön sie waren. Die Blässe ihres Gesichts unterstrich die überwältigende Wirkung des Grüns ihrer Augen.
»Es war ein französisches Schiff«, fuhr sie fort. »Nur eines.«
John nickte. Mit ihrem Gesicht vor Augen fand er keine Worte. Er ließ seinen Blick zu ihren bloßen Händen gleiten und sah, wie diese zitterten, als sie versuchte, den Mantel der älteren Frau zu fassen. Schnell blickte er wieder in ihr Gesicht. Sie war tatsächlich jung, sehr jung. Unter den bleichen, schmutzigen Wangen und dem schwarzen Haarschopf war eine verschreckte junge Frau zu erkennen.
Das dünne, trunkene Gerassel einer Stimme war hinter der Reihe der um sie stehenden Männer zu vernehmen. Der Arzt, ein Angehöriger des Douglas-Clans und ein Mann, von dem sich John sicher war, daß er als Angus’ Spion diente, kam mit unsicheren Schritten auf sie zu. Er war ein aufgedunsener Mönch mit trüben Augen und einem größeren Interesse an Wein und einem weichen Bett als an dem Wohlergehen seiner Männer und ihren Seelen. In John stieg die Wut auf, als er sah, wieviel Zeit sich der Mönch ließ, um seinem Befehl nachzukommen.
»Wir werden später einige Worte miteinander wechseln«, knurrte er, während der Arzt sich durch die Menge drängelte. Ohne den Mann eines weiteren Wortes zu würdigen, rief er den Maat zu sich heran. »Die Frau ist schon lange genug hier draußen an der feuchten Luft. Bring sie nach unten, der Arzt kann sich dort um sie kümmern.«
»Darf ich etwa nicht bei ihr bleiben?« fragte Maria und stellte sich neben den Kommandanten. Es war nicht auszumachen, ob ihre Worte eine Bitte oder eher ein Befehl waren.
Dieses Mal trafen sich ihre Augen, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor Maria verlegen ihren Blick senkte.
»Ja«, antwortete John, »natürlich. Meine Männer werden für alles Nötige sorgen. Ich werde Euch baldmöglichst aufsuchen. Ihr seid mir noch immer eine Antwort auf meine Fragen schuldig.«
Sie nickte, stand dann schweigend da und wartete darauf, daß die Männer ihre Tante forttrugen.
Maria hatte nur wenig Platz und konnte nirgendwo in der kleinen Kammer direkt neben Isabels Kajüte ihre nassen, verschmutzten Kleider ausbreiten. Ein Schiffsjunge war gleich nach ihr in die Kajüte gekommen und hatte ihr wortlos ein Kleid aus Wolle und leinene Leibwäsche überreicht. Maria war froh über diese aufmerksame Geste, wenngleich sie nicht wußte, wem sie dafür zu danken hatte. Sie hatte viele Männer und Frauen auf Deck herumstehen sehen, die nach der neuesten Mode bei Hofe gekleidet waren. Während sie darüber nachdachte, war sie überrascht, wie viele Frauen sich an Bord befanden. Bestimmt war es eine dieser Frauen, der sie ihren Dank schuldete.
Die nasse Wäsche in Händen, blickte sie sich hilflos suchend in ihrer Kajüte um. Von dort, wo sie stand, konnte sie ein leises Gemurmel aus der Kajüte ihrer Tante hören, die glücklicherweise das Bewußtsein wiedererlangt hatte, und dann das Geräusch schlurfender Schritte, die auf den Korridor hinaustraten.
Sie legte ihre Kleider sorgfältig zusammen in eine Ecke des Raumes. Auf einem Brett an der Wand stand eine kleine Waschschüssel mit einem Wasserkrug, und Maria säuberte vorsichtig die schmerzenden Blasen auf ihren Handinnenflächen und Fingern. Sie wickelte sich Verbandsstreifen um die Hände und versuchte erfolglos die Enden des Verbands festzustecken. Ihre Hände schmerzten so sehr, daß sie zu fast nichts mehr zu gebrauchen waren. Abgesehen davon hatte sie, was das Anlegen von Verbänden betraf, keinerlei Übung. Ärgerlich schüttelte sie ihren Kopf. Selbst an den einfachsten Aufgaben scheiterte sie.
Enttäuschung und Müdigkeit nagten an Maria, als sie unter Tränen die weiten, tannengrünen Ärmel des Kleides bis über die Handgelenke zog. Nachdem sie sich die Tränen von ihrer Wange gewischt hatte, öffnete sie die schmale Tür und trat in Isabels geräumigere Kajüte.
Der Blick ihrer auf dem Bett liegenden Tante wandte sich ihr sofort zu. Die ältere Frau legte einen Finger auf die Lippen, um Maria vom Sprechen abzuhalten. Die junge Frau kam ihrem Wunsch nach und blieb im Hintergrund stehen, während der Gehilfe des Arztes die blutigen Verbandsstreifen von dem kleinen Tisch auflas.
»Ihr hattet Glück, Mylady«, schnarrte der Arzt, als er die Kajüte wieder betrat. »Die Kugel hat Euch nur einen Kratzer zugefügt. Aber Euer Matrose hatte keine Chance.«
»Er ist also tot«, sagte Isabel.
»Jawohl. Er steht jetzt vor seinem Schöpfer.« Er warf der älteren Frau einen Blick zu. »Sir John möchte den Namen des Mannes wissen. Für die Gebete, wenn wir ihn dem Meer übergeben.«
»Ich … ich kenne ihn nicht«, sagte Isabel verlegen und sah Maria an.
»Sein Name war Pablo«, sagte die junge Frau leise. Maria hatte ihn danach gefragt, als sie seinen Platz an den Rudern eingenommen hatte. Aber sie wußte, daß seine Seele längst bei seinem Schöpfer war, bevor die Gebete der Matrosen ihn erreichen konnten.
»Pablo«, wiederholte der Mann kurz und drehte sich zu Isabel um. »Gut, gut. War das eigentlich Euer Schiff, das da unterging?«
Isabel schüttelte den Kopf. »Nein, es war nicht unser Schiff.« Sie hatte nicht vor, diesem Mann mehr zu erzählen, als unbedingt notwendig war.
»Ja, dann.« Der Mann ging zur Tür, blieb aber noch kurz vor Maria stehen und deutete auf eine kleine Schüssel mit einer Flüssigkeit und etwas sauberem Verbandsmaterial. »Ich lasse Euch das da. Ihr solltet den Verband wechseln, wenn er anfängt, schlecht zu riechen. Sir John wird übrigens gleich hier sein. Er scheint voller Ungeduld darauf zu warten, daß Ihr ihm seine Fragen beantwortet. Und macht Euch keine Sorgen um Eure Mutter, meine Liebe. Ihr wird es bald wieder gutgehen.«
»Sie ist nicht …« Maria verstummte plötzlich und fing sich dann wieder, »in Lebensgefahr, oder?«
»Nein, meine Kleine«, der Mönch seufzte erschöpft, bevor er sich wieder der Tür zuwandte. »Ich habe ihr etwas zum Schlafen gegeben. Später werde ich den Burschen noch einmal zu Euch schicken. Wenn Ihr mich braucht, so laßt mich einfach rufen.«
Ohne jede weitere Höflichkeitsbekundung schlurfte der Mann in den dunklen Korridor hinaus, den Burschen in seinem Schlepptau.
Maria wartete, bis sich die Kajütentür hinter den beiden geschlossen hatte, und eilte sodann an das Bett ihrer Tante. »Es sind Schotten!« sagte sie mit sorgenvoller Stimme. Isabel klopfte neben sich auf das Leintuch, und Maria setzte sich ohne Zögern hin.
»Ja, ich weiß, meine Liebe«, stimmte ihr Isabel zu und betrachtete die elegante Ausstattung der Kajüte. »Und nicht nur irgendwelche Schotten. Zweifellos gehört dieses Schiff zu der Flotte, die dein Bruder angefordert hat, um dich zum König zu geleiten.«