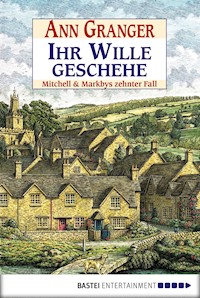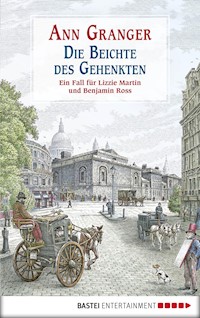
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Viktorianische Krimis
- Sprache: Deutsch
Als Inspector Benjamin Ross ins Gefängnis von Newgate gerufen wird, ist er skeptisch. Ein Mann, der gehenkt werden soll, will eine Aussage machen. Doch als dieser ihm dann von einem 17 Jahre alten Mord berichtet, dessen Zeuge er wurde, ist er so überzeugend, dass Ben Zweifel kommen. Könnte der Mann nicht doch die Wahrheit sagen? Und ist er vielleicht unschuldig? Der Fall lässt Ben nicht los, und bald macht er sich mit seiner Ehefrau Lizzie auf die Spuren eines Mordes, die zwar längst erkaltet sind - aber offenbar noch immer für Unruhe sorgen. Und für Gefahr ... Inspector Benjamin Ross' und Lizzie Martins fünfter Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Als Inspector Benjamin Ross ins Gefängnis von Newgate gerufen wird, ist er skeptisch. Ein Mann, der gehenkt werden soll, will eine Aussage machen. Doch als dieser ihm dann von einem17 Jahre alten Mord berichtet, dessen Zeuge er wurde, ist er so überzeugend, dassBen Zweifel kommen. Könnte der Mann nicht doch die Wahrheit sagen? Und ist er vielleicht unschuldig? Der Fall lässt Ben nicht los, und bald macht er sich mit seiner Ehefrau Lizzie auf die Spuren eines Mordes, die zwar längst erkaltet sind – aber offenbar noch immer für Unruhe sorgen. Und für Gefahr …
ÜBER DEN AUTOR
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen »Wer sich in Gefahr begibt« und »Neugier ist ein schneller Tod«knüpft sie mit«Stadt,Land, Mord«, dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.
ANN GRANGER
DIE BEICHTEDES GEHENKTEN
EIN FALL FÜR LIZZIE MARTIN UND BENJAMIN ROSS
Kriminalroman Übersetzung aus dem Englischen von Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Testimony of the Hanged Man«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Ann Granger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Raum-Deinzer, Hersbruck
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Einband-/Umschlagmotiv: © David Hopkins/Phosphor Art
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-0601-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
ANMERKUNG DER AUTORIN
In einem in meinem Besitz befindlichen Reiseführer aus dem Jahre 1818 heißt es über Putney: »Eine Ortschaft in Surrey, vier und eine Dreiviertelmeile südwestlich von London malerisch am Ufer der Themse gelegen, verbunden durch eine Holzbrücke mit Fulham auf der anderen Seite.« Diese Holzbrücke war im Jahre 1729 gegen den Widerstand der Fährleute errichtet worden, die ihren Lebensunterhalt schwinden sahen.
Fünfzig Jahre später, 1868, als die vorliegende Geschichte Ben Ross und seine Frau Lizzie nach Putney führte, war die alte Holzbrücke immer noch in Gebrauch. Es hatte sich manches verändert, da Putney nun eine wachsende Gemeinde war, doch im Grunde genommen war es nach wie vor ein Dorf. Trotz einiger bitterarmer Viertel war es bei den Wohlhabenden stets beliebt geblieben, und es rühmte sich einer Reihe von großen Häusern inmitten noch größerer Gärten. Trotzdem sollte es fast bis zum Ende des Jahrhunderts dauern, bis die Holzkonstruktion einer gemauerten Brücke wich. Das Wachstum der Bevölkerung hatte es schließlich erforderlich gemacht, und das war nicht die einzige Veränderung im Ort gewesen.
Das Problem beim Verfassen eines historischen Romans besteht darin, den Geist eines Ortes wieder zum Leben zu erwecken, ohne die Bedürfnisse des Handlungsstrangs zu vernachlässigen. Ich mag den einen oder anderen Fußweg dort platziert haben, wo es in Wirklichkeit nie einen gab. Doch wer will das mit Bestimmtheit sagen? Wie dem auch sei, ich hoffe, ich habe die »Atmosphäre« von Putney heraufbeschworen, ohne die Fakten allzu sehr zu verbiegen.
Abschließend möchte ich Reverend Ailsa Newby sowie Michael Bull von der St. Mary’s Putney Parish Church meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Beide waren so freundlich, mir bei meinen Nachforschungen zum viktorianischen Gemeindefriedhof zu helfen.
KAPITEL EINS
Inspector Benjamin Ross
»Zum ersten Mal habe ich Francis Appleton gesehen, als wir beide oben in Oxford waren, vor fast vierzig Jahren«, berichtete James Mills. »Es war ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag, wie ich mich erinnere, und ich ging am Cherwell spazieren, nicht weit von der Magdalen Bridge. Es waren noch viele andere Leute unterwegs, die die Sonne genossen und über die Wiesen des Colleges schlenderten, genau wie ich, außerdem befuhren die unterschiedlichsten Boote den Fluss, Ruderboote, Kähne und so weiter. Einige davon wurden mit deutlich mehr Geschick manövriert als andere.«
Mills hielt inne, und sein Blick wurde abwesend, als er an eine lang zurückliegende Szene dachte. Durch das kleine Fenster kam nur wenig Licht, und die Kerze, die auf dem Tisch flackerte, ließ unsere Schatten fantastisch über die Wände tanzen. Er hatte Gewicht verloren im Gefängnis, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte auf der Anklagebank im Old Bailey. Aber er war immer noch ein kräftiger Mann und ausgesprochen robust für seine mehr als sechzig Jahre.
Ich hoffte, dass der Henker am nächsten Tag keinen Pfusch ablieferte. Ich empfand kein Vergnügen bei dem Gedanken, dass Mills gurgelnd und mit den Füßen zappelnd am Strick baumeln würde, während das Leben langsam aus ihm herausgepresst wurde.
Calcraft, der Henker von Newgate, war berüchtigt, weil er eine so hohe Zahl an Hinrichtungen durchgeführt hatte und die Todesqualen der Verurteilten dabei deutlich länger gedauert hatten. Wenn er mit der Vollstreckung des Urteils betraut war, hatte ich nicht viel Hoffnung, dass Mills ein schnelles und schmerzloses Ende fände. Ich hatte Berichte gehört, denen zufolge Calcraft sich an die Beine der Verurteilten gehängt hatte, um die Dinge am Ende zu beschleunigen. Wahrscheinlich betrachtete er das als Gefälligkeit den Gefangenen gegenüber. Ich hatte meine eigene Meinung dazu.
Es war nicht der einzige Grund, warum ich an diesem Abend dem Ruf ins Newgate-Gefängnis nur mit großem Widerwillen gefolgt war. Der Gestank des Gefängnisses brauchte stets ein paar Tage, um wieder zu verfliegen. Er hatte die Angewohnheit, alles zu durchdringen. Die Säure von ungewaschenen Menschen, der fettige Gestank von dem Zeug in den großen Kesseln, das als Essen durchgehen sollte, die abgestandene Luft durch den Mangel an Ventilation, und über alledem die nackte Verzweiflung, denn die hat ihren ganz eigenen Geruch. All dies sickert in die Kleidung, die Haut und die Haare. Selbst nachdem alles gründlich gereinigt worden ist, hängt einem der Geruch noch im Kopf fest. Der Gestank und die Atmosphäre in der Zelle des Verurteilten, wo ich mit Mills saß, waren sogar noch finsterer und unangenehmer. Es war, als säße der Tod selbst bei uns in seinen verrottenden Lumpen und als bedächte er uns mit seinem grausigen Grinsen, während wir redeten.
Mills zuckte und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die trostlose Umgebung, in der er sich gegenwärtig befand. »Hören Sie mir überhaupt zu, Inspector?«, fragte er gereizt.
Ich versicherte ihm, dass dem so sei, und bat ihn, seine Geschichte ohne weitere unnötige Verzögerungen fortzusetzen.
»Ah«, erwiderte Mills mit freudlosem Lächeln. »Sie möchten wieder nach Hause zu Ihrer Frau – ich nehme an, Sie haben eine? – und Ihrer Familie. Sie sitzen sicher am eigenen Tisch, eh?«
Beinahe hätte ich ihn angeplärrt, dass ich es in der Tat vorzöge, gemütlich zu Hause zu sitzen anstatt an diesem elenden Ort, den ich auf seine dringende Bitte hin aufgesucht hatte. Aber das sagte ich nicht, weil mich Mills mit seiner ruhigen Art irgendwie verlegen machte. Ich konnte ja jederzeit von hier weggehen, aber er nicht. Als er sah, dass ich unruhig wurde, fuhr er mit seinem Bericht fort.
»Wie auch immer, Inspector Ross, ich war gerade dabei, Ihnen zu erzählen, wie ich Appleton kennengelernt habe. Dort saß ich nun, unten am Fluss, und ließ den lieben Gott einen guten Mann sein. Da tauchte unter der Brücke ein Stechkahn auf, den ein junger Bursche, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, direkt auf mich zustakte. Er war ungefähr in meinem Alter, etwas über zwanzig, blond und von athletischer Statur. Ich gestehe freilich, dass ich der Insassin dieses Kahns mehr Aufmerksamkeit widmete. Ein Mädchen, ein ungewöhnlich hübsches Mädchen überdies, lag halb im Kahn und lachte zu ihm hoch. Sie trug ein weißes Musselinkleid, ziemlich tief ausgeschnitten, wenn ich mich recht entsinne. Das war vor der späteren hässlichen Mode, als die Frauen anfingen, sich hinter Reifröcken zu verbarrikadieren. Damals jedoch hatten die Frauen Kleider mit weit geschnittenen Röcken an über Petticoats, die beim Gehen wunderbar raschelten. Sie trug lange weiße Handschuhe und einen breitkrempigen Hut aus italienischem Stroh, weiß mit blauen Bändern, der sie vor der Sonne beschirmte. Darunter rahmten lange dunkle Locken ihr Gesicht ein. Sie hatte außerdem einen Sonnenschirm. Oh, ich wage zu sagen, dass sie genau das war, wonach sie aussah: eine der vielen jungen Frauen aus der Stadt mit ungezwungenen Manieren und noch ungezwungenerer Moral. Es gab zu jener Zeit genug von ihnen in Oxford, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Trotz ihrer weißen Kleidung und Handschuhe lachte sie ihn so ungeniert an, bedachte ihn mit solch schelmischen Blicken und zwirbelte den Schirm so geschickt – ich kann sie heute noch vor mir sehen! Er grinste sie an wie ein Seemann auf Landgang. Ich beneidete ihn auf der Stelle.«
Er hielt inne und kicherte wieder. »Ich habe sie nie wiedergesehen, zu meinem großen Bedauern. Appleton hingegen sah ich ein paar Tage später am Broad entlanghasten, womöglich, weil er zu spät zu einer Vorlesung kam. Er war allein. Der Student, mit dem ich unterwegs war, kannte ihn und rief seinen Namen. Er stellte uns vor, und so lernte ich Francis Appleton offiziell kennen. Es war ein schlimmer Tag.«
»Und nun haben Sie mich darum gebeten, heute Abend hierherzukommen, damit Sie mir selbst in diesem späten Stadium des Verfahrens noch schnell erzählen können, dass Sie ihn nicht letzten Michaeli aufs Schändlichste ermordet haben – und dass ich den falschen Mann verhaftet habe.«
»Oh nein, Inspector Ross, ganz und gar nicht!« Mills hob protestierend eine Hand. »Sicher nicht. Sie haben den Richtigen verhaftet. Ich gestehe freimütig, dass ich ihm die Kehle durchgeschnitten habe, mit einem Tranchiermesser – dem gleichen Messer, mit dem wir die Gans zerlegt haben, die zuvor aus der Garküche vorbeigeschickt worden war. Die kalten Reste unserer Mahlzeit standen noch auf dem Tisch. Ich schnappte mir das Messer in einem Anfall von heißer Wut und stieß es ihm in die Kehle. Das brachte ihn nicht auf der Stelle um, also musste ich weitermachen, wie es der Teufel so will. Ich hackte auf seine Luftröhre ein, während er gurgelte und um sich schlug und blutiger Schaum aus seinem Mund sprudelte. Endlich traf ich die Arterie, und das war es dann auch. Wer hätte schon gedacht, dass es so schwer ist, einen Mann umzubringen? Oh ja, Inspector, ich bin ein Mörder, und morgen früh werde ich den kurzen Weg aus meiner Zelle zum Galgen von Newgate antreten. Wenn ich richtig informiert bin, hat man ihn im Hof errichtet, innerhalb der Gefängnismauern, nicht mehr draußen auf der Straße. Ist das richtig?«
»Das ist richtig. Sie gehören zu den Ersten, die von dem neuen Gesetz profitieren, demzufolge Hinrichtungen nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden dürfen.«
Als ich mich dem Gefängnis genähert hatte, war mir sogleich das Fehlen der schwarz gestrichenen Barrieren aufgefallen, die noch vor Kurzem am Tag vor einer Hinrichtung aufgestellt wurden, um den Mob unter Kontrolle halten zu können, der sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollte. Überhaupt fehlten die frühen Gaffer, die sich die besten Plätze sichern wollten und die Nacht vor der Hinrichtung mit Trinken und Spielen verbrachten. Die Menge würde sich trotzdem einfinden, sobald die Dämmerung den Himmel erhellte, dessen war ich mir sicher. Selbst wenn sie die eigentliche Vollstreckung nicht sehen konnten, würde sie das anlocken, was hinter den Mauern vorging. Sie würden darauf warten, dass jemand herauskam und die Nachricht von der erfolgreichen Exekution an das Tor nagelte. Dann würden sie wahrscheinlich in lauten Jubel ausbrechen. Ich fragte mich, ob der Henker Calcraft seine Technik vielleicht endlich verbessern würde, nachdem er nicht länger vor Publikum auftreten durfte. Er war zweifellos eine Art Selbstdarsteller, und die Menge hatte sich stets an seinen zappelnden, baumelnden Opfern ergötzt, wenn sie am Galgen langsam verendet waren.
»Profitieren?« Mills bedachte mich mit einem amüsierten Blick.
Zu meiner Verärgerung wurde mir bewusst, dass mein Gesicht meine Verwirrung verriet. »Verzeihen Sie«, sagte ich steif. »Das war kein mit Bedacht gewähltes Wort. Ich wollte damit nur sagen, dass Sie den Mob nicht sehen müssen, der Sie ausbuht.«
»Was für ein menschenfreundlicher Bursche Sie doch sind, Inspector.« Mills nickte gnädig. Dann runzelte er die Stirn. »Draußen wurde ein Mann gehängt, kurz nachdem ich hierhergebracht worden war. Das war im Mai. Ich habe die Menge vor Entzücken jubeln hören. Sie haben sogar gesungen.«
»Das muss Barrett gewesen sein, der für seine Mittäterschaft bei den Bombenanschlägen von Clerkenwell büßen musste«, informierte ich ihn. »Es waren fast zweitausend Zuschauer draußen. Ich bin nicht überrascht, dass Sie den Lärm gehört haben.«
»Ah, richtig, Barrett der Fenier. Er brachte zwölf Menschen um, die er überhaupt nicht kannte und die ihm nichts getan hatten. Ich habe nur den einen getötet, der mir sehr geschadet hat …« Mills lächelte mich an, doch seine Augen waren kalt. »Natürlich bin ich erleichtert, dass ich nicht vor einer betrunkenen grölenden Menge aufgehängt werde, die begeistert klatscht, während sie mich beim Baumeln beobachtet.«
Er lehnte sich zurück. »Ich habe gehört, wie sie heute den Galgen im Hof errichtet haben, mit einer Menge Sägen und Hämmern. Der Lärm ging durch Türen und Wände, und ich wage zu behaupten, dass jeder hier drin es hören konnte. Der Gefängniskaplan – ein äußerst ermüdender Bursche – hat mich heute Abend bereits besucht. Er schwadronierte irgendwelchen Mist von Reue und Buße. Ich sagte ihm, ich hätte bereits gebeichtet und wüsste nicht, was ich noch bereuen sollte! Er bestand darauf, dass ich es müsste. Ich sagte ihm, das Einzige, was ich wirklich bereue, zutiefst bereue, sei, dass ich mein Vertrauen, mein Geld und mein Schicksal in die Hände eines Mannes gelegt hätte, den ich für meinen ältesten und engsten Freund gehalten hatte. Eines Mannes, von dem ich niemals vermutet hätte, dass er mich betrügen, mein Vermögen und meinen guten Namen ruinieren, Scham und Schande über meine Frau und meine Kinder bringen und uns alle bettelarm machen könnte …«
Er wurde erregt. Von meiner Ankunft bis zu diesem Augenblick war er unnatürlich ruhig gewesen. Ich darf Ihnen verraten, dass mich diese äußerliche Ruhe und Ernsthaftigkeit weitaus mehr außer Fassung gebracht hat als sein jetziges Verhalten. Andere in seiner Lage hätten gegeifert und lamentiert. Er war, zumindest äußerlich, die ganze Zeit vollkommen gelassen gewesen. Ich empfand einiges Mitgefühl für den armen Kaplan.
»So«, erwiderte ich ungehalten. »Und warum genau haben Sie mich nun vom anderen Ende Londons herkommen lassen und um mein Abendessen gebracht? Damit ich mir Ihr Geständnis noch einmal aus erster Hand anhöre? Ich brauchte keine Bestätigung von Ihren Lippen. Ich war und bin sicher, dass Sie schuldig sind, seit dem Moment, als ich Sie verhaftet habe.«
Mills entspannte sich ein wenig und hob eine Hand, um meinen Protest abzuwinken. »Es tut mir leid, dass Sie Ihr Abendessen verpasst haben. Man hat mich gefragt, ob ich einen besonderen Wunsch als Henkersmahlzeit hätte. Ich erwiderte, dass ich keinen Appetit hätte, und verlangte lediglich nach einem guten, starken Kaffee, den man mir dann auch brachte. Vielleicht hätte ich nach einem Hackbraten fragen und Sie damit überraschen sollen. Allerdings hab ich denen gesagt, dass ich in der Tat eine letzte Bitte hätte und dass sie Ihnen eine Nachricht schicken sollten und Sie bitten, mich hier zu besuchen, weil ich Ihnen was zu sagen hab. Ich konnte ja schließlich nicht zu Ihnen kommen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den Weg auf sich genommen haben.«
»Dann kommen Sie doch endlich zur Sache!«, belferte ich. Ich nahm an, dass er sich irgendwie an mir rächen wollte, indem er meine Zeit verschwendete. Eine dürftige Rache, keine Frage, doch in seiner Lage konnte er ja nicht viel mehr erreichen.
Ich sollte mich irren.
Sein Verhalten änderte sich erneut. Er wurde forsch und geschäftsmäßig. »Was ein Mann auf seinem Totenbett erklärt, im Angesicht seines nahen Endes, das hat doch wohl Bestand vor einem Gericht, oder?«
»Ich habe keine Erfahrung in diesen Dingen. Ich hatte noch keinen Fall wie diesen, wo ich der verhaftende Beamte war. Doch ich habe gehört, dass es so ist«, antwortete ich vorsichtig. »Wegen der besonderen Umstände, würde ich vermuten. Ich bin kein Anwalt. Ich nehme an, es hängt davon ab, was gesagt wird, ob es vor Zeugen geschieht und ob der Sprecher, obwohl er den Tod vor Augen hat, von nüchternem Verstand ist und nicht dabei durchzudrehen …«
»Ich bin von nüchternem Verstand, Inspector, und ich bin nicht durchgedreht, oder? Ich möchte Sie informieren, dass ich einen Mord beobachtet habe.« Erneut hob er eine Hand, um meinem Aufbegehren zuvorzukommen. »Nein, nicht den, den ich begangen habe. Ich habe jemand anders bei einem Mord beobachtet. Es kam mir zum damaligen Zeitpunkt nicht gelegen, darüber zu sprechen. Doch es lastet auf meinem Gewissen.«
Er zögerte und legte die Stirn in Falten, bevor er fortfuhr. »Nennen Sie es Gewissen, Inspector. Ich denke, ich sollte Ihnen davon berichten, um mich zu entlasten. Ja, so ist es passender ausgedrückt.«
»Sprechen Sie weiter«, forderte ich ihn auf, ohne meinen Unglauben zu verbergen. Er konnte immer noch ein Spiel mit mir spielen, um sich zu rächen. Er wusste, dass meine Neugier mich dazu treiben würde, weitere Fragen zu stellen. Er wollte womöglich weniger sein Gewissen entlasten, als mir meinen Seelenfrieden rauben. »Wo und wann?«, verlangte ich zu erfahren. »Wer war der Mörder? Wer das Opfer?«
»Geduld, Inspector, Geduld, ich bitte Sie. Vielleicht glauben Sie mir nicht. Doch ich habe mir die größte Mühe gegeben, trotz meiner ungünstigen gegenwärtigen Umstände ruhig zu bleiben, denn ich möchte, dass Sie das, was ich zu sagen habe, als Erklärung auf dem Totenbett betrachten, Sir. Zugegeben, ich sitze an diesem Tisch und liege nicht auf dieser abscheulichen Pritsche dort drüben in der Ecke. Außerdem erfreue ich mich guter Gesundheit, während wir hier reden, angesichts meines Alters. Nichtsdestoweniger betrachten Sie mich bitte als einen Sterbenden. Schließlich gehe ich morgen früh zum Galgen, und das kommt ja wohl auf das Gleiche heraus.«
Der Gefangene schüttelte die unangenehme Vorstellung ab. »Ich möchte, dass Sie das, was ich Ihnen zu sagen habe, ernst nehmen, Inspector. Schreiben Sie es auf, und ich unterzeichne es, genau so, wie es bei einer Aussage gegenüber der Polizei sein sollte.«
Ich gestehe, dass sein Ernst mich beeindruckte. Ich wusste nicht, wie ich auf seine Worte reagieren sollte. »Also schön, wie Sie meinen«, war alles, was ich hervorbrachte. Auch wenn ich mich fragte, ob ich möglicherweise ein wenig voreilig damit war.
Es war alles, was er hören wollte.
»Nun, dann fangen wir an«, bestimmte er und schob mir ein Blatt Papier, ein Fass Tinte und eine Feder hin, die er eigens zu diesem Zweck, wie mir nun klar wurde, bereitgelegt hatte. »Ich, James Mills, bei klarem Verstand und im Bewusstsein, morgen früh meinem Schöpfer gegenüberzutreten, erkläre hiermit …« Plötzlich unterbrach er sich stirnrunzelnd. »Wir brauchen einen Zeugen. Der Wärter soll hereinkommen.«
Also wurde der Wärter, der draußen vor der Tür gewartet hatte, hereingerufen. Ich denke, er hatte ohnehin am Gitterrost gelauscht, denn sein Gesicht verriet Eifer und Neugier, als er eintrat.
»Am späten Nachmittag des fünfzehnten Juni achtzehnhundertzweiundfünfzig kam ich zu Pferde von einem Geschäftsbesuch in Putney zurück«, fuhr Mills fort. »Es war ein Dienstag. Sehen Sie, das Datum ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich ritt über die Heide. Das kann ein sehr einsamer Ort sein. Die kriminellen Elemente, die dort vor sechzehn Jahren ihr Unwesen getrieben haben, sind immer noch nicht ganz ausgerottet, also hielt ich die Augen nach Räubern und Vagabunden offen. Bei gutem Wetter sind normalerweise genug respektable Menschen dort draußen unterwegs, die sich ertüchtigen oder so wie ich die Heide durchqueren. Zuvor, auf dem Hinweg, hatte ich sogar einen Viehtreiber gesehen, der Rinder in Richtung Hauptstadt brachte, zum Schlachthof in Smithfield. Aber der Juni ist ein launischer Monat. An jenem Tag war es schwül und stickig heiß gewesen. Auf dem Rückweg jedoch kam, wie es das Pech wollte, ein plötzliches Sommergewitter auf. Der Himmel öffnete seine Schleusen, und herunter fiel ein schwerer Regen, begleitet von starkem Wind und mächtigen Blitzen und Donnerschlägen. Die Heide lag verlassen da. Sämtliche Reisenden hatten gezwungenermaßen Unterschlupf gesucht, und ich wusste, dass ich das Gleiche tun musste, schon um mein verängstigtes Pferd unter Kontrolle zu halten. Eine Gruppe von Bäumen, nicht allzu weit entfernt, bot die nächste sichere Zuflucht, und ich wandte mich in diese Richtung.
Es stellte sich als kleines Wäldchen heraus. Ich stieg am Rand ab und führte mein Pferd unter die Zweige, doch sie boten kaum Schutz. Da merkte ich, dass in der Nähe ein Haus stand, direkt vor uns, auf der anderen Seite des Wäldchens. Ich band mein Pferd an einen geeigneten Zweig und machte mich zu Fuß auf den Weg, in der Hoffnung, dass es sich um eine Taverne handeln würde, denn ich hatte mir ausgerechnet, dass ich nicht weit von der Straße nach Portsmouth entfernt sein konnte. Falls ich mich nicht irrte, würde ich mein armes Tier holen, und wir wären beide in Sicherheit an einem trockenen Platz.
Doch es stellte sich heraus, dass es ein Privathaus war, in einem Stil erbaut, der auf den Anfang des letzten Jahrhunderts schließen ließ. Das Dach war tief heruntergezogen, und die Fenster waren klein. Aus dem Schornstein kamen dicke Rauchschwaden, wenn der Regen nicht gerade senkrecht herabprasselte und das Feuer unten im Kamin ablöschte. Der Himmel war dunkel – nicht weil es spät gewesen wäre, sondern wegen des Wetters –, und alles wirkte düster. In einem der unteren Räume brannte eine Lampe, und ihr Licht fiel flackernd durch das Fenster. Ich näherte mich der Haustür und betätigte den Klopfer, doch niemand kam, um zu öffnen, und ich nahm an, dass mich wegen des Lärms, den der Sturm und der Regen verursachten, keiner hören konnte. Also umrundete ich das Haus bis zu dem erhellten Fenster und spähte ins Innere …«
»Sie müssen einen Moment warten, bis ich mit dem Schreiben nachgekommen bin«, bat ich ihn. Ich hatte seinen Bericht hingekritzelt, so schnell ich konnte, doch das Kerzenlicht war nicht sehr hell und die Tinte schlecht gemischt. Es bestand die nicht geringe Gefahr, dass ich die Hälfte des Berichts mit Klecksen unleserlich machte.
Mills hörte genau zu, als ich ihm vorlas, was ich bisher aufgeschrieben hatte. Schließlich nickte er zufrieden.
Der Wärter, den wir als Zeugen hinzugerufen hatten, saß fasziniert da und atmete schwer.
»Ich sah also durch das kleine Fenster ins Innere des Hauses«, fuhr Mills schließlich fort. »Vor mir lag ein kleines Wohnzimmer mit niedriger Decke und frei liegenden Balken, entsprechend dem alten Stil. Ich erinnere mich an eine Standuhr an der Wand zu meiner Rechten. Im Kamin brannte ein Feuer.«
»Üblicherweise folgt so ein Gewittersturm auf heißes, schwüles Wetter, wie Sie es vorhin auch erwähnt haben«, unterbrach ich ihn. »Und trotzdem brannte im Kamin ein Feuer?«
»Ich sage nur, was ich gesehen habe«, entgegnete Mills gereizt. »Und ja, in der Tat, im Kamin brannte ein Feuer. Der Regen fand tatsächlich seinen Weg durch den Schornstein, und die Flammen flackerten immer wieder, wurden größer oder schrumpften im nächsten Moment beinahe zu einem Nichts zusammen. Bitte vergessen Sie nicht, das Feuer war nicht die einzige Lichtquelle im Zimmer. Es gab außerdem eine Öllampe auf einem kleinen Tischchen. Ihr Leuchten war es, das mich von draußen angezogen hatte. Glauben Sie mir, ich konnte alles in diesem Zimmer sehr deutlich erkennen. Das ist wichtig. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, und ich bilde mir nichts ein!«
»Und was haben Sie gesehen?«, fragte ich. »Wenn Sie sich nicht kurz fassen, habe ich bald kein Papier mehr.« Doch trotz meiner scharfen Worte hatte mich seine Geschichte bereits in den Bann gezogen. Ich fühlte mich auf die wind- und regengepeitschte Heide versetzt, und ich hörte das Zischen der Regentropfen auf dem ausgetrockneten, gebleichten Boden, und in Gedanken presste ich das Gesicht an die nassen Fensterscheiben. Was mochte Mills so Furchtbares gesehen haben, dass er nicht dem Tod ins Angesicht sehen wollte, ohne sein Gewissen vorher zu erleichtern?
Mills schien unbeeindruckt von meinem Drängen und meiner Ungeduld. Er wusste, dass er den Fisch – mich – am Haken hatte, und zog ihn jetzt langsam an Land.
»Nun, ich sah einen älteren Gentleman, der in seinem Sessel saß und schlummerte. Er hatte weißes Haar, und an der Armlehne lehnte ein Stock. Das Feuer war zweifelsohne auf seinen Wunsch hin entfacht worden. Ich klopfte gegen die Scheibe, jedoch ohne rechte Hoffnung, ihn zu wecken. Dann, noch während ich überlegte, was zu tun wäre, wurde die Zimmertür plötzlich geöffnet, und eine junge Frau kam herein. Ich hatte gehofft, dass jemand kommen würde, vielleicht eine Magd, um das Feuer zu schüren. Doch diese Frau war eine junge Lady, keine Dienstbotin, ganz bestimmt nicht. Sie war ein hübsches Ding, vielleicht zwanzig Jahre alt, in einem dunklen Hausmantel, violett oder malvenfarbig, mit einem Spitzenkragen und Spitzenmanschetten. Ihr Haar war zu Locken gedreht, wie es damals Mode war, wenn Sie sich erinnern? Sie stand für einen Augenblick in der offenen Tür und sah den schlafenden alten Gentleman an, dann ging sie zum Kamin.
Vielleicht war sie gekommen, um nach dem Feuer zu sehen. Doch als sie im Zimmer war, blieb sie für eine oder zwei Minuten vor dem Sessel des alten Gentlemans stehen und starrte ihn an. Glauben Sie mir, Ross, in ihrem Gesicht war keine Spur von Sorge oder Zuneigung. Ihr Ausdruck war voller Bitterkeit. Es überraschte und schockierte mich zugleich. Nichtsdestoweniger rann mir der Regen auf die unangenehmste Weise in den Nacken, und so hob ich erneut die Hand, um an die Scheibe zu klopfen. Ich hoffte, dass mein plötzliches Erscheinen, mein Gesicht in der Scheibe sie nicht erschrecken würde. Wenn sie schrie, würde der alte Mann aus dem Schlaf schrecken, und es hätte sicher ein großes Aufhebens gegeben. Doch bevor ich klopfen konnte, bewegte sie sich auf eine plötzliche, bestimmte Weise, als wäre sie zu einem Entschluss gekommen. Sie trat zu einem zweiten Sessel neben dem ersten und nahm ein Kissen hoch. Ich dachte im ersten Moment, sie wollte es dem alten Burschen bequemer machen, und verhielt in der Bewegung, um ihr die Zeit dazu zu gewähren. Das war mein unbeabsichtigter Fehler.«
Mills stockte. Der Atem des Wärters ging unnatürlich laut und rau. Ich schrieb die letzten Worte nieder und nickte Mills zu als Zeichen, dass er mit seinem Bericht fortfahren möge.
»Sie … sie drückte dem alten Mann das Kissen auf das Gesicht«, sagte Mills tonlos. »Mit voller Absicht und so, dass er ersticken musste.«
»Ich will verdammt sein …!«, entfuhr es dem Wärter.
»Sind Sie sicher, Mr. Mills?«, fragte ich nach.
»So sicher, wie dass der Henker seine Knoten übt, während wir hier sitzen und reden. Sie drückte das Kissen mit beiden Händen auf das Gesicht des Alten und nahm es erst nach einer ganzen Weile wieder hoch, um nachzusehen, ob er noch atmete. Sie hielt ihm sogar die nackte Hand vor Mund und Nase, um zu fühlen, ob sein Atem noch ging.«
»Hat er denn keinen Widerstand geleistet?«
»Ich bezweifle, dass er gemerkt hat, was geschah. Er schrak zusammen und hob kurz die Hände, als sie das Kissen auf sein Gesicht presste. Er machte ein oder zwei schwache Gesten, dann war es auch schon vorbei.«
»Und Sie?«, fragte ich. »Sie unternahmen nichts, um das zu verhindern?«
Mills zuckte mit den Schultern. »Ich war wie erstarrt vor Entsetzen. Abgesehen davon, was hätte ich denn tun können? Ich war draußen, im Regen.«
»Sie hätten rufen können, gegen die Scheibe schlagen, sie einschlagen, falls nötig.«
Mills winkte ärgerlich ab. »Ja, ja, das ist alles sehr schön gesagt, hinterher redet es sich leicht. Im Nachhinein ist alles immer ganz wunderbar einfach. Aber es geschah so unerwartet, so plötzlich, und so schnell … Es war das Allerletzte auf der Welt, was ich erwartet hätte. Schließlich nähert man sich nicht einem respektablen Haus und rechnet damit, gleich einem Mord zuzusehen. Sicherlich hätte ich meine Anwesenheit kundgetan, mit aller Dringlichkeit, ganz wie Sie es beschreiben, hätte ich auch nur die leiseste Ahnung von ihrer Absicht gehabt.«
Ich nickte, um ihm zu zeigen, dass ich seinen Einwand akzeptierte. Mills atmete tief durch. »Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass ihr Werk vollendet war, verließ sie rasch den Raum. Sie hatte die Tür bei ihrem Eintreten offen gelassen, und nun schloss sie sie hinter sich. Ihr Opfer lag allein im Zimmer – bis auf mich, den Zuschauer, der alles beobachtet hatte, das Gesicht an die nasse Scheibe gepresst, starr vor Schock und Entsetzen. Der Kopf des Alten rollte schlaff zur Seite. Ein Arm fiel an der Seite des Sessels herab und schlug gegen den Gehstock, der dort lehnte. Er war tot, Ross, und ich steckte hübsch in der Klemme.«
»Sie hätten zu Ihrem Pferd zurückkehren, aufsteigen und zur nächsten Ansiedlung reiten können, um Alarm zu schlagen«, schlug ich vor.
»Das hatte ich auch vor, Inspector. Ich schwöre es! Ich rannte zu der Stelle zurück, wo ich mein Pferd gelassen hatte, zog das elende Geschöpf aus seinem spärlichen Unterschlupf ins Freie und kletterte hastig in den Sattel. Doch im Sturm, während der Suche nach Schutz, hatte ich die Orientierung verloren, und der Schock des Erlebten machte es nicht besser … Ich muss eine ganze Weile im Kreis geritten sein, und als ich endlich eine gerade Linie zustande brachte, fand ich mich fast am Fluss wieder, bevor ich den Turm der St. Mary’s Church und die Häuser und Geschäfte von Putney erblickte.«
»Wo Sie immer noch hätten Alarm schlagen können oder sich an die Behörden wenden.«
»Sie verstehen das nicht, Inspector. Während ich unterwegs war, hatte ich genügend Zeit, über das nachzudenken, was geschehen würde, sollte ich Alarm schlagen und schreien. Zunächst einmal hat eine Reihe rechtschaffener, wohlsituierter Bürger Häuser in der Gegend, und diese Leute wollen sicherlich nicht in etwas so Unangenehmes wie einen Mord hineingezogen werden! Aus diesem Grund wäre es nicht ganz einfach geworden, an eine Tür zu klopfen und jemanden zu informieren. Ich war nicht sicher, wohin ich mich wenden sollte.«
»An die Metropolitan Police!«, brauste ich auf. »Ich akzeptiere, dass Sie in Putney möglicherweise keinen Beamten finden konnten. Aber, in drei Teufels Namen, Mann, Sie waren schon bei der Brücke angekommen! Sie hätten nichts weiter tun müssen, als sie zu überqueren und dem erstbesten Constable zu berichten, was Sie gesehen hatten!«
»So, wie Sie das sagen, klingt es furchtbar einfach«, sagte Mills aufgebracht. »Nehmen wir einmal an, ich hätte einen Constable gefunden – gleich auf welcher Seite der Brücke. Es hätte trotzdem Fragen gegeben, Verzögerungen. Man hätte von mir verlangt, mit einem der Beamten an den Ort der Tat zurückzukehren, und ich wusste nicht mal mit Sicherheit, ob ich ihn überhaupt wiedergefunden hätte! Sie hätten vielleicht geglaubt, dass ich sie zum Narren halte! Und wenn wir das Haus wirklich gefunden hätten – und den toten alten Gentleman darin –, was dann? Noch mehr Fragen. Noch mehr Verzögerungen. Angenommen, sie hätten meinen Geschäftsfreund in Putney gebeten, für mich zu bürgen? Irgendwann hätte die ganze elende Angelegenheit den Weg in die Presse gefunden, und die Reporter hätten sich wie die Geier auf mich gestürzt! Sie hätten auf meiner Türschwelle ihr Zelt aufgeschlagen und wären nicht ohne meinen Augenzeugenbericht wieder gegangen! Das konnte ich nicht zulassen. Die geschäftliche Angelegenheit, wegen der ich in Putney gewesen war, war von sehr … delikater Natur. Ich konnte auf keinen Fall öffentlich einräumen, dort gewesen zu sein.«
Der Wärter und ich wechselten einen Blick. Ich schätze, wir dachten beide das Gleiche – dass es kein Geschäftsbesuch war, der Mr. Mills nach Putney geführt hatte, sondern ein amouröses Abenteuer. Er schien schon immer eine Schwäche für schöne Frauen gehabt zu haben. Die Lady, die er in Putney besucht hatte, war zweifelsohne verheiratet gewesen, möglicherweise mit einer Persönlichkeit von einiger Bedeutung. Mills Bemerkung über wohlhabende Menschen, die Häuser in der Gegend unterhielten und nicht mit Mord belästigt werden wollten, war gefallen, weil er einen ganz bestimmten Haushalt im Sinn gehabt hatte.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, fuhr er trotzig fort: »Der alte Mann war tot. Ich konnte ihn nicht wieder zum Leben erwecken, ganz egal, was ich getan hätte. Ich musste an meine eigenen Umstände denken …«
»Und jetzt möchten Sie, dass ich in einem Mordfall ermittle, der sechzehn Jahre zurückliegt? Der Tod des alten Gentlemans hätte vielleicht damals untersucht werden sollen.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe danach für eine ganze Weile aufmerksam die Zeitungen gelesen. Ein Fall wie dieser, wäre es zu Ermittlungen gekommen, wäre von der Presse aufmerksam beobachtet worden, aus offensichtlichen Gründen. Der Tod des alten Gentlemans wurde auf natürliche Umstände zurückgeführt, welcher Art auch immer, und das wurde auf seinem Totenschein vermerkt.«
»Umso schwieriger, jetzt noch zu ermitteln!«, erklärte ich. »Die Nachrichten könnten die Presse damals nicht erreicht haben, und das Fehlen eines Berichts in den Zeitungen muss nicht notwendigerweise heißen, dass es keine Ermittlungen gab. Doch nehmen wir an, ein Fachmann – ein Arzt oder ein Coroner – habe zum damaligen Zeitpunkt über die Todesart entschieden. Es wäre durchaus möglich. Dann müsste der fragliche Fachmann, sollte er noch am Leben sein, bereit sein zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht haben könnte oder gemacht hat. Und warum sollte er das tun? Was, wenn er darauf beharrt, dass es keinen Irrtum gegeben hat? Es ist viel zu spät, um die Leiche zu exhumieren, selbst wenn wir eine richterliche Anweisung erhalten könnten. Mehr noch, nach so langer Zeit – wen sollte es noch interessieren?«
Diesmal war Mills’ Grinsen entschieden wölfisch. »Ich dachte eigentlich immer, mein lieber Inspector Ross, die Polizei würden diese Dinge interessieren?«
Ich seufzte. »Haben Sie die Adresse des fraglichen Hauses?«
»Selbstverständlich nicht!«, brüllte er beinahe. »Es befand sich mitten auf Putney Heath, auf der Heide! Es stand in der Nähe eines Wäldchens, und es ist schätzungsweise vor hundert, hundertzwanzig Jahren gebaut worden. Ich habe es Ihnen beschrieben, so gut ich kann.«
»Und Sie erwarten allen Ernstes, dass ich es finde?«
»Ich habe Ihnen den Zeitpunkt genannt, an dem der Mord geschah«, entgegnete Mills. »Sie kennen den ungefähren Ort. Gütiger Himmel, Mann! Sie sind der Detective! Muss ich Ihnen erzählen, wie Sie Ihre Arbeit machen sollen? Das Haus war alt, und es ist gut möglich, dass es früher eine Taverne war, doch vor sechzehn Jahren war es ein stattliches Wohnhaus. Vielleicht das eines wohlhabenden Gentlemans aus der Stadt, der sich in den Ruhestand zurückgezogen hatte? Wie dem auch sei, der Raum war vornehm möbliert, und die Frau war eine junge Lady …«
Der Wärter lachte schallend. »Eine schöne junge Lady, wenn Sie mich fragen! Was soll das für eine Lady sein, die einen alten Mann mit einem Kissen erstickt?«
Mills bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick, bevor er sich wieder mir zuwandte. »Ich möchte meine Aussage jetzt unterschreiben. Sie auch, Inspector, und dieser Kerl hier – als Zeugen.« Er deutete auf den Wärter.
Wir unterschrieben alle.
»Sie können jetzt gehen.« Mills klang plötzlich müde. »Ich habe meine Aussage gemacht und mein Gewissen erleichtert. Was weiter geschieht, liegt an Ihnen.«
Ich erhob mich, faltete die Aussage und steckte sie sicher in meine Brusttasche. »Gibt es sonst noch etwas, das ich für Sie tun kann? Möchten Sie vielleicht ein Buch?«
»Nein, nein!« Mills schüttelte den Kopf. »Oder vielleicht doch, mehr Kaffee, wenn das möglich wäre.« Er sah zu mir hoch. »Ich will nicht einschlafen«, sagte er. »Nicht jetzt. Ich schlafe bald lang genug.« Er stockte. »Außerdem beobachtet Er mich.«
»Ich muss Sie beobachten!«, begehrte der Wärter auf. »Es ist meine Aufgabe, das zu tun! Kerle wie ihr versuchen doch ständig, den Henker um seine Arbeit zu bringen.«
Er sah mich an und fuhr erklärend fort: »Sie rennen sich den Kopf an der Wand ein oder reißen ihre Hemden in Stücke und knüpfen ein Seil daraus, um sich selbst zu erhängen, wenn man nicht aufpasst.«
»Nicht er«, sagte Mills zu mir und zeigte auf den Wärter. »Er!« Er deutete auf die Wand.
»Durchgedreht«, flüsterte mir der Wärter vertraulich zu und tippte sich mit einem schmutzigen Zeigefinger an die Schläfe. »Das passiert auch ständig, wissen Sie?«
Doch ich wusste, wen Mills sehen konnte.
»Bringen Sie ihm mehr Kaffee«, sagte ich leise zu dem Wärter, und er nickte.
»Oh, Ross!«, rief Mills mir hinterher, als ich im Begriff stand, die Zelle zu verlassen. Ich hielt inne und drehte mich um. »Eine Sache noch, wegen dieses Hauses. Es ist mir gerade eingefallen. Es hatte eine Wetterfahne am Schornstein. Sie wirbelte herum und herum in diesem Gewittersturm. Sie war geformt wie ein Tier, ein rennender Fuchs, möchte ich meinen, mit weit hinter sich ausgestreckter Rute.«
Der Wärter zog die Tür zu und verriegelte sie. Dann sah er mich fragend an.
»Was halten Sie von dieser Geschichte, Sir?«
»Ich muss auf der Stelle mit dem Direktor sprechen«, erwiderte ich.
»Gott behüte, Sir, der Direktor ist zu Hause. Wahrscheinlich sitzt er beim Abendessen oder genießt ein Glas Weinbrand nach einem langen Arbeitstag.«
»Ich muss ihn dennoch stören. Er muss davon erfahren, auf der Stelle, noch heute Abend. Morgen ist es zu spät, wie Sie sich denken können.«
»Jepp«, pflichtete mir der Wärter bei und nickte weise. »Morgen ist es zu spät.«
KAPITEL ZWEI
Der Gefängnisdirektor war in der Tat zu Hause, und als wäre mein unangemeldetes Eindringen zu so später Stunde nicht peinlich genug, hatte er auch noch Gäste zum Dinner. Der Abend war so weit fortgeschritten, dass die Ladys sich schon zum Plaudern zurückgezogen hatten, während die Männer sich bei Port und Zigarren entspannten. Das war der Moment, in dem ich völlig derangiert vor seiner Tür erschien und darum bat, ihn sprechen zu dürfen. Zu seiner Ehre sei gesagt, dass er sich tatsächlich bereit erklärte, mich für zehn Minuten in seinem Arbeitszimmer zu empfangen.
Da saß er nun vor mir in seinem glänzend weißen Vorderhemd und den weißen Manschetten unter dem makellosen schwarzen Frack, das Gesicht gerötet von gutem Essen und gutem Wein und vom Luxus eines wärmenden Feuers im Kamin an einem kühlen Septemberabend. Ein Aroma von Zigarrenrauch umgab ihn, und ich fühlte mich an eine Erzählung von Charles Dickens erinnert, Eine Weihnachtsgeschichte, eines der Lieblingsbücher meiner Frau Lizzie. Es war nicht die Jahreszeit und ganz sicher kein Heiligenkranz über der Stirn des Mannes, doch alles in allem fühlte ich mich sehr stark an den Geist der gegenwärtigen Weihnacht erinnert.
Und hier saß ich nun, ein Geist der vergangenen und zukünftigen Weihnacht in einem und faselte von einem alten Mord und einer kurz bevorstehenden Exekution.
Er hörte mich geduldig an, nahm Mills’ Aussage in die Hand, las sie durch und legte sie schließlich mit einem Seufzer wieder hin. »Mein lieber Freund«, sagte er. »Mir scheint, Sie hatten einen äußerst schwierigen Abend. Darf ich Ihnen vielleicht ein Glas Weinbrand anbieten?«
»Das ist wirklich zu freundlich von Ihnen«, erwiderte ich kläglich. »Doch ich muss leider ablehnen. Ich komme ohnehin spät genug nach Hause, auch ohne nach Alkohol zu riechen.«
Er kicherte. »Nun gut, hören Sie, Inspector Ross. Sie hatten vollkommen recht, sich sogleich an mich zu wenden. Aber ich bitte Sie nun, gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, Ihrem viel zu späten Abendessen und Ihrem warmen Bett. Denken Sie nicht mehr an diese Angelegenheit. Offen gestanden gibt es ohnehin nichts, was man hier tun könnte.«
»Mills sollte am Morgen erneut vernommen werden«, protestierte ich. »Er muss unter strenger Bewachung nach Putney gebracht werden, um uns bei der Suche nach dem fraglichen Haus behilflich zu sein …«
Der Gefängnisdirektor hob eine gepflegte Hand und winkte ab. »Mein lieber Inspector Ross, es gibt kein Haus. Es gibt keinen Mord, den Mills durch ein Fenster hindurch beobachtet haben könnte. Was hat der gute Dr. Johnson noch gleich gesagt? Wenn ein Mann weiß, dass er in den nächsten zwei Wochen gehängt werden soll, konzentriert es seinen Verstand auf wunderbare Weise. Mr. Mills’ Fantasie scheint jedenfalls beflügelt worden zu sein.«
Ich stieß einen protestierenden Laut aus.
Aber er schüttelte nur den Kopf. »Sehen Sie, Ross, dieser Gefangene soll gehängt werden, sobald der Morgen graut. Er mag sich bis zum jetzigen Zeitpunkt wacker gehalten und seine Angst verborgen haben, doch jetzt steht der Augenblick bald bevor. Er ist willens, alles zu tun, um der gefürchteten Strafe zu entgehen, ein paar Stunden oder Tage zu gewinnen … es mag wenig genug erscheinen, doch nicht für einen Mann in seiner Lage.
Nehmen wir doch einmal an«, fuhr er fort, »dass Mills, anstatt seine Aussage in der Todeszelle zu machen, vor sechzehn Jahren als freier Mann mit sauberen Händen zur Polizeiwache marschiert wäre und berichtet hätte, was sich seiner heutigen Einlassung zufolge in Putney abgespielt hat. Selbst damals hätte der aufnehmende Beamte, wie Sie mir sicherlich beipflichten werden, zunächst einmal versucht festzustellen, was das für ein Mann ist, der eine so schwerwiegende und befremdliche Anschuldigung vorbringt. Ist er als Zeuge glaubwürdig? Ist sein Leumund einwandfrei? Ist er in seinem Geschäft geachtet und erfolgreich? Ist er klar im Kopf, oder neigt er dazu, zu fantasieren und eigenartig zu reagieren? Erst wenn der Beamte zu dem Schluss gekommen wäre, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, dem Mann nicht zu glauben – und wenn er überdies nüchtern erschienen wäre und nicht aufgebracht oder wütend –, erst dann hätte die Polizei ihre Ressourcen und das Geld der Steuerzahler auf eine Ermittlung verwendet. Habe ich nicht recht, Inspector?«
»Ja …«, räumte ich widerwillig ein.
»Nun dann, wie würden Sie diese Fragen heute Nacht beantworten, im Hinblick auf Mills, den Mörder? Ist er glaubwürdig?«
»Ich verstehe Ihre Argumentation, Sir«, antwortete ich. »Vielleicht sollte ich seine Geschichte mit äußerster Vorsicht aufnehmen. Dennoch kann ich nicht einfach einen Zeugen ignorieren, der mir von einem Mord erzählt, selbst wenn er sechzehn Jahre zurückliegt.«
»Und ich kann den Innenminister nicht um diese späte Stunde wegen so einer Geschichte stören!« Er wedelte mit Mills’ Aussage vor meiner Nase herum. »Das hier ist die Ausgeburt eines verzweifelten Mannes! Ihr Wunsch, Ihrer Pflicht nachzukommen, gereicht Ihnen zur Ehre, Inspector. Doch ich habe Erfahrung im Umgang mit Männern auf dem Weg zum Galgen. Sie geraten schließlich in Panik, was nur natürlich ist. Sie verhalten sich wie Ertrinkende, schlagen blind um sich und ergreifen jeden Strohhalm, der ihnen helfen könnte, nicht unterzugehen und am Leben zu bleiben. Glauben Sie mir, mein lieber Inspector Ross, es gibt nichts zu tun. Es existiert kein Verbrechen, das aufzuklären wäre.«
Vielleicht sah er, dass ich immer noch nicht überzeugt war. Er beugte sich vor und fuhr in ernstem Ton fort: »Dieser Mills ist ein gerissener Bursche. Ich habe ihn in den letzten Wochen ein wenig kennengelernt und gestehe, dass er ein faszinierender Charakter ist. Der letzte Mann, sollte man meinen, der sich in eine solche Bredouille bringt. Sie, Ross, haben ihn ebenfalls kennengelernt während Ihrer Ermittlungen und der Verhandlung, die zu seiner Verurteilung geführt hat. Aber das ist nur die eine Hälfte der Geschichte.« Der Direktor hob einen Finger. »Die andere ist – er hat Sie ebenfalls kennengelernt!«
Das war allerdings wahr. Ich spürte, wie ich errötete. Der Direktor lehnte sich zurück, um seine Theorie weiter zu erläutern, und machte eine ausholende Geste mit der Hand durch die Luft, wie ein Zauberkünstler. »›Ross ist ein gewissenhafter Beamter‹, sagt sich Mills in seiner Todeszelle. ›Wenn ich ihm dieses Ammenmärchen nur plausibel genug auftische, wird er es als seine Pflicht betrachten, etwas zu unternehmen, und versuchen, meine Exekution zu verschieben.‹ Und er hatte recht! Sie haben etwas unternommen. Sie sind mit seinem Jägerlatein zu mir gekommen. Ich habe im Gegenzug meiner Pflicht genügt und seine Aussage gelesen. Ist es nicht so?«
Ich spürte, wie mein Gesicht mehr und mehr brannte, und hoffte inbrünstig, dass er es auf das Feuer im Kamin schieben würde. Doch er wusste natürlich ohnehin, dass er recht hatte. Manch ein gerissener Halunke oder Mörder hat versucht, eine Schwäche bei dem ermittelnden Beamten zu finden, die er zu seinem Vorteil nutzen könnte. Mein Selbstvertrauen sank rasch in sich zusammen, und ich fühlte mich wie ein Narr. Ich hätte klüger sein müssen, als Mills Glauben zu schenken. Natürlich versuchte er das Grauen hinauszuzögern, das ihn am nächsten Morgen erwartete. »Es … es tut mir leid, Sir, dass ich Sie damit belästigt habe«, sagte ich zerknirscht.
»Nun aber halblang, mein lieber Inspector! Sie haben sich vollkommen richtig verhalten. Ihr Gewissen ist sauber, und Sie haben sich keinen Vorwurf zu machen.«
Stille senkte sich zwischen uns herab, unterbrochen lediglich vom Knistern des Feuers. Ich sah widersprüchliche Emotionen im rötlichen Gesicht des Direktors, als er die Aussage in seinen Händen ein weiteres Mal überflog.
Vielleicht bereitete ihm sein Gewissen keine Schwierigkeiten, doch die Sorge um seine zukünftige Karriere beunruhigte ihn umso mehr. Schließlich hatte er soeben einem Gesetzesbeamten in einer brillanten Rede nahegelegt, eine Meldung über einen Mord zu ignorieren. Es war die Sorte von hochfliegender Entscheidung, die sich möglicherweise gegen ihn wenden und ihm empfindlich schaden könnte.
In versöhnlicherem Tonfall fuhr er daher fort: »Nun denn, bei genauerer Betrachtung, jetzt, nachdem Sie mir alles berichtet haben, nehme ich an, ich bin verpflichtet, etwas zu unternehmen. Ich sage Ihnen, was ich mache, Ross. Ich schreibe gleich morgen früh einen Bericht an das Innenministerium, füge diese Aussage bei und sende sie an den Minister persönlich, durch einen Boten. Ich werde den Kurier entsprechend instruieren. Sodann haben Sie und ich, wir beide, alles in unserer Macht Stehende getan und können die Angelegenheit vergessen.«
Der Innenminister wird anordnen, den Bericht in die Akten zu nehmen oder gleich ins Feuer zu werfen, dachte ich, doch das sagte ich nicht laut. Und weil er eine Menge Dinge im Kopf hat, um die er sich kümmern muss, wird er die ganze Sache schnell vergessen. Selbst wenn er sie ernst nimmt, ist es zu spät, weil Mills dann längst tot sein wird.
Ich dankte dem Gefängnisdirektor für seine Geduld, entschuldigte mich ein letztes Mal für die Störung und erhob mich, um zu gehen. An der Tür zu seinem Büro drehte ich mich noch einmal um. »Der Henker wird Calcraft sein, nehme ich an?«
Für einen Moment schien er verlegen zu sein, denn er wich meinem Blick aus, als er antwortete. »Ja, ja, Calcraft. Er ist nun einmal der Henker von Newgate.«
»Er ist ein Stümper«, sagte ich. »Entweder ist er inkompetent oder sadistisch. Er gehört gefeuert. Das ist meine persönliche Meinung.«
»Er steht dicht vor seiner Pensionierung«, erwiderte der Direktor knapp. »Er hat Newgate und den anderen Gefängnissen lange Jahre beste Dienste geleistet und eine Arbeit verrichtet, die nicht jedermann gerne machen würde. Sie, Inspector, William Calcraft und ich, wir alle dienen auf unterschiedliche Weise der Gerechtigkeit in unserem Land. Unsere persönliche Meinung ist in dieser Hinsicht nicht von Belang. Es geht um Pflicht und Pflichterfüllung. Das ist es, was uns leitet. Gute Nacht, Inspector Ross!«
Als der Butler die Straßentür hinter mir schloss, hörte ich männliches Gelächter vom Salon her. Der Gefängnisdirektor war zu seinen Gästen zurückgekehrt und hatte Mills wahrscheinlich bereits vergessen.
Ich machte mich zu Fuß auf den Heimweg, während ich unschlüssig hin und her überlegte, was zu tun wäre. Sollte ich die Angelegenheit auf sich beruhen lassen? Immerhin hatte ich getan, um was Mills mich gebeten hatte, und die Sache gemeldet. Man hatte mir versprochen, etwas zu unternehmen – selbst wenn es zu spät sein würde. Was konnte ich sonst noch tun? Das persönliche Gespräch mit einem übergeordneten Vorgesetzten suchen? Es gibt eine Hierarchie bei der Polizei, und man darf sie nicht ohne Weiteres umgehen. Dienstweg, nennt man das. Es bedeutete, dass ich meinen direkten Vorgesetzten, Superintendent Dunn, stören musste, der jetzt sicherlich zu Hause in Camden war, und ihn bitten musste, seinerseits seinen direkten Vorgesetzten zu umgehen und den Commissioner der Metropolitan Police zu stören.
Es würde einige Zeit dauern, bis ich bei Dunn ankam, selbst wenn ich eine Droschke nahm. Dunn war ein fairer Mann und ein guter Beamter, doch er war auch ungeduldig und von Natur aus respektvoll gegenüber seinen Vorgesetzten. Ich würde ihn informieren müssen, dass der Direktor von Newgate versprochen hatte, am nächsten Morgen den Innenminister zu kontaktieren. Das würde Dunn ausreichend alarmieren. Es würde allerdings auch dagegen sprechen, dass er Sir Richard Mayne belästigte, den Commissioner. Sir Richard war ein bedeutender Mann. Doch es war auch bekannt, dass er keine sonderlich gute Beziehung zum Büro des Innenministers hatte. Das war die Folge einiger Wirrungen im Verlauf der Ermittlungen wegen des Bombenattentats von Clerkenwell, begangen von ebenjenem Barrett, dessen Hinrichtung die letzte öffentliche gewesen war, vor einer johlenden Menge, die selbst Mills in seiner Zelle vernommen hatte. Kurz gesagt, ich musste erst gar nicht den weiten Weg bis nach Camden zurücklegen, um zu wissen, dass Dunn die Angelegenheit genauso wenig Sir Richard vortragen würde, wie er zum Innenminister gehen und persönlich an dessen Tür klopfen würde. Ich konnte nicht mehr tun, als ich bereits getan hatte. Abgesehen davon war es durchaus möglich, dass der Gefängnisdirektor recht hatte. Dass Mills mir ein Märchen aufgetischt hatte von einem ungelösten Mordfall, um seine eigene wohlverdiente Exekution hinauszuzögern. »Ja«, sagte ich laut zu mir selbst. »Das ist es. Das muss es sein!«
Meine Stimme hallte durch die klare Nachtluft. Ich hatte das Ufer erreicht und schlenderte am Fluss entlang. Ich passierte soeben die Pfeiler und Bögen der Waterloo Station. Die Flut stand hoch, und das Wasser schwappte gegen das Korsett aus Stein und Beton, das wenige Meter entfernt seine Einfassung bildete. Ich roch den sauren Gestank durch den Qualm der großen Maschinen auf der anderen Seite der Mauer hinweg. Außer mir war niemand unterwegs, und ich erwartete keine Antwort auf meine Worte. Doch mein Ohr fing einen ganz schwachen Laut unter einem der hohen Bögen auf. Es war eine Frauenstimme, daran konnte kein Zweifel bestehen, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Sie sprach zu leise, und ihre Worte galten nicht mir, wie ich annahm. Also keine Prostituierte, die am Fluss entlangpatrouillierte und in mir einen möglichen Kunden erspäht zu haben glaubte, sondern jemand anders.
Die Bögen unter der Station waren bekannt als Unterschlupf für heimatlose Gestalten. Wäre die Stimme männlich gewesen, hätte ich sie einer jener verlorenen Seelen zugeschrieben und mich nicht weiter darum gekümmert. Doch es war eine weibliche Stimme, und zu meiner gesteigerten Neugier – und nicht geringen Bestürzung! – hörte ich ein kleines Kind einen schrillen Schreckenslaut ausstoßen, wie ein ruheloses Kind in unruhigem Schlaf. Ich näherte mich den Gewölbebögen und spähte vorsichtig in die Dunkelheit hinein.
Dort bewegte sich etwas, zweifellos aufgeschreckt durch mein Erscheinen. Ich hörte das Rascheln von Bekleidung. Das Kind quiekte erneut.
»Wer ist da?«, fragte ich.
Niemand antwortete. Nichts bis auf das Geräusch von schnellem Atem. Ich nahm eine Schachtel Lucifers aus meiner Tasche und strich eins davon an. In seinem flackernden Licht bemerkte ich das verängstigte Gesicht einer Frau. Sie kauerte am Boden, eingehüllt in eine Art Decke oder Umhang. Bevor die Flamme des Lucifers erlosch, sah ich die Kauernde sich bewegen, und ein kleiner nackter Fuß kam zum Vorschein.
»Haben Sie keine Angst«, bat ich sie inständig. »Ich bin Polizeibeamter – nicht in Uniform, aber dennoch ein Gesetzesbeamter. Mein Name ist Inspector Ross. Ich komme von Scotland Yard.«
»Ich bettle nicht, Sir«, flüsterte sie anstelle einer Antwort.
»Das weiß ich. Sie suchen lediglich Zuflucht, doch das gilt vor dem Gesetz immer noch als Landstreicherei. Es gibt Stellen, zu denen Sie gehen dürfen, wenn Sie keinen anderen Schutz finden. Sie sollten sich um Aufnahme in einem Obdachlosenasyl oder einem Armenhaus bemühen, um ein Bett für die Nacht zu ergattern.«
»Waren Sie schon einmal in so einem Haus, Sir?«, flüsterte sie zur Erwiderung. »Das waren Sie nicht, sonst würden Sie nicht so etwas vorschlagen.«
Ich hatte tatsächlich nie Veranlassung gehabt, ein solches Haus aufzusuchen. Doch als jüngerer Beamter hatte ich einmal auf der Suche nach einem flüchtigen Gesetzesbrecher ein Obdachlosenheim für Männer durchsucht. Ich erinnerte mich, wie grauenhaft dieser Ort war, ohne Luft, voller Gestank, vollgestopft mit betrunkenen, kranken und verzweifelten Männern jedes Alters. Ich hatte sogar die Tür zum Abort in einer Ecke des Schlafsaals geöffnet, um nachzusehen, ob sich der Gesuchte dort versteckte, und ich werde den Anblick der offenen Grube voll menschlicher Exkremente sicher nie vergessen.
»Aber Sie haben ein Kind bei sich«, gab ich dennoch zu bedenken. »Sie können doch nicht hierbleiben.«
»Wir sind hier sicher«, entgegnete sie beharrlich.
»Was hat Sie in diese Situation gebracht?«, fragte ich als Nächstes, so mitfühlend ich konnte.
»Mein … mein Ehemann hat uns verlassen«, antwortete sie beinahe unhörbar leise. »Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ich hatte kein Geld, um die Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen … wir mussten die Wohnung verlassen, in der wir untergebracht waren.«
»Dann melden Sie sich doch bei der Gemeinde!«, rief ich aus.
»Die Gemeinde schickt mich ins Armenhaus und nimmt mir mein Kind weg!« Sie schlang die Arme um das Bündel unter ihrem Umhang. »Bitte, Inspector Ross, verhaften Sie mich nicht wegen Landstreicherei! Ich tue doch hier niemandem etwas!«
»Aber es ist kein geeigneter Ort …« Ich brach ab. Ein Armenhaus war genauso wenig ein geeigneter Ort für ein Kind. »Ich lasse Sie heute Nacht hier«, sagte ich. »Aber morgen früh kommen Sie zum Scotland Yard und fragen nach mir oder Sergeant Morris. Wir sorgen dafür, dass Sie in einer geeigneten Einrichtung unterkommen.«
Ich konnte mich auf Morris verlassen und würde ihn vorwarnen, aber ich hoffte, dass Superintendent Dunn niemals herausfände, dass ich im Dienst Arbeiten verrichtete, die eigentlich die Aufgabe von Wohltätigkeitseinrichtungen waren.
»Wie heißen Sie überhaupt?«
Sie zögerte. »Jane Stephens, Sir«, antwortete sie schließlich.
»Haben Sie keine Familie? Außer Ihrem flüchtigen Ehemann?«
»Sie wohnen weit weg von hier, Sir.«