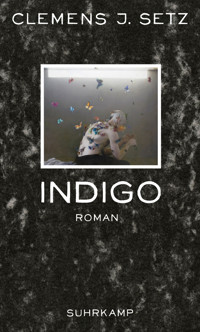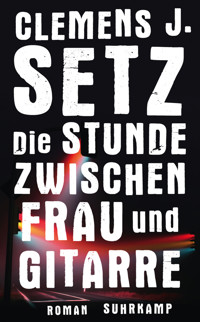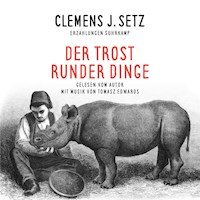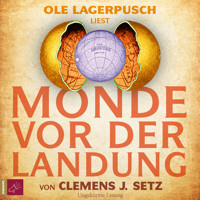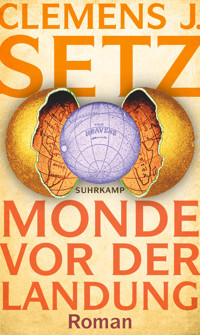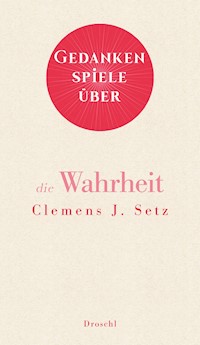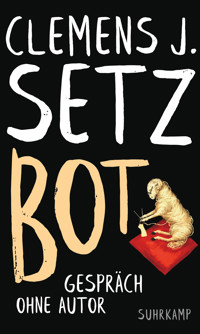12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum denken sich Menschen Kunstsprachen wie Esperanto, Volapük oder Blissymbolics aus? Clemens J. Setz erzählt anekdotenreich vom Antrieb und der Besessenheit ihrer Erfinder, getreu dem Motto: »Erzähl die beste Geschichte, die du kennst, so wahr wie möglich.«
Und diese Geschichte handelt unter anderem von Charles Bliss und seiner Symbolsprache, von Kindern mit Behinderung, die sich mit Blissymbolics zum ersten Mal ausdrücken können. Davon, wie Clemens J. Setz einen Sommer lang Volapük lernt und selbst eine eigene Sprache entwickelt. Es geht um die vermutlich einzige Volapük-Muttersprachlerin, die je gelebt hat, und um die Plansprache Talossa für die gleichnamige Mikronation, die ein Teenager 1979 in seinem Schlafzimmer ausrief. Um Klingonisch und High Valyrian, eine Sprache, die für die Fernsehserie Game of Thrones geschaffen wurde. Und um Esperanto, die größte Erfolgsgeschichte in der Welt der Plansprachen. Stets ist es die eigenartige Vermengung von tiefer existenzieller Krise und Sprachenerfindung, die Setz aufspürt und die ihn in ihren Bann schlägt – und so ist dieses Buch auch die persönliche Geschichte des Sprachkünstlers Clemens J. Setz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Clemens J. Setz
DIE BIENEN UND DAS UNSICHTBARE
Suhrkamp
I decided not to be silent when the battery dies
Mustafa Ahmed Jama
Nibuds kömons suvo lü stopöp su lubel – tü minuts degtel. Nek spidon tope, do nibuds binons mödiks. Busse kommen oft zu der Haltestelle auf dem Hügel – alle zwölf Minuten einer. Niemand will allzu rasch an diesen Ort gelangen, aber die Busse dahin sind zahlreich.
aus Ralph Midgleys Sprachkurs Volapük in Action
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
Intro
Erstes Kapitel Das Tänzeln
1
2
3
4
Zweites Kapitel Die schwer verfilmbare Geschichte des Mr Bliss
Drittes Kapitel Liber Pictorum
1
2
3
Viertes Kapitel Mein Sommer im Volapük
1
. Tagebuch
2
. Ek, water. Ek, writer
3
. Die Einwohner des Landes Prashad
4
.
Childhood Bedroom Dream:
Eine Parabel
5
. Tagebuch, Monate später
6
. Nachtrag
7
. Das Ende
Fünftes Kapitel Umzaka. Die Nonsens-Dichtung und ihr Double
1
. Unter Ausschluss der Zuhörerschaft
2
. Die Sphinx von Soweto
3
. Drei Versuche
4
. Walla, Herbeck, Mach – die
Linguae Ignotae
von Gugging
5
. The Ballad of Austin Creek
6
. Gifts from God
7
. Sadasa Ulna
8
. Arli’s Poems
Sechstes Kapitel Die große Befreiung: Esperanto
1
. Die Reise
2
. Herkunft
3
. Wie man Esperanto lernt
4
. Meister der Esperanto-Dichtung
5
. Ĉie amikoj, überall Freunde
6
. Über Liebe und Ländergrenzen
7
. Märchenerzähler und Anarchist
8
. Dunkelblonde Locken
9
. Baldur Ragnarsson: Nachdenklichkeit im Universum
10
. Deportation und Verfolgung
11
. Die Tragödie der Küken und anderer Tiere: Eroschenkos chinesische Jahre
12
. Das Genie: Jorge Camacho
13
. Eroschenko verschwindet
14
. Die Kunst des Kabei
15
. Von Päpsten, Programmierern und imaginären Grenzen: Der Fall des Quenya
16
. Das eigentliche Genie: Spomenka Štimec
17
. Eroschenkos späte Jahre
CODA Was ist das Gegenteil von Hase?
Dank
Nachweis der zitierten Gedichte
Bildnachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Intro
»Mustafa, du wurdest in Somaliland geboren, ein Land, das offiziell nicht existiert. Mit wie viel Jahren bist du nach Schweden gekommen?«
»Ich bin 1979 geboren. Nach meiner Geburt war ich fünf Minuten lang tot. Wir sind nach Schweden gekommen, als ich drei Jahre alt war, nach vielen Reisen, die meine Eltern unternahmen, in Somalia und auch außerhalb. Sie suchten nach Hilfe für mich.«
»Erinnerst du dich noch an deine Ankunft?«
»Ja und nein. Ich habe noch etwa zehn Prozent meiner Erinnerungen von damals.«
»Wann konntest du zum ersten Mal kommunizieren?«
»Mit fünf. Ich spielte mit anderen Kindern, und da war ein Lehrer, der gab mir Süßigkeiten und sagte: Komm in dieses Zimmer hier und lerne diese Bliss-Symbole. Heute bin ich diesem Lehrer enorm dankbar, denn zu diesem Zeitpunkt versuchte ich natürlich, zu sprechen wie alle anderen Kinder, aber es war kaum möglich.«
»Wie war es, als du zum ersten Mal Dinge sagen konntest?«
»Es war nicht immer wie heute. Heute beherrsche ich die Symbole fließend. Mein Unterricht begann mit den Zeichen für Mann und Papa. Dann folgten die Begriffe Bruder, Schwester und so weiter.«
»Wie lange dauerte es, bis du sie fließend beherrscht hast?«
»Zehn Jahre, tägliche Übung.«
»Träumst du heute in Bliss-Symbolen?«
»Natürlich.«
»Und wie hast du begonnen, in ihnen zu dichten?«
»Ich habe zuerst Gedichte gelesen, und später gewann ich Poesie immer mehr lieb, sie wurde zu einer Leidenschaft. Irgendwann begann ich, selbst Gedichte zu verfassen. Und wenn ich kurz für alle Somalis sprechen darf: Dichtung spielt in unserem Leben eine sehr zentrale Rolle. Es ist kein Zufall, dass der britische Reiseschriftsteller Gerald Hanley geschrieben hat: Somalia ist das Land der Dichter.«
»Das wusste ich nicht.«
»Der Bruder meines Großvaters war ebenfalls Dichter. Als Kind las ich schwedische Lyriker und hörte mir somalische Poesie auf Audiokassetten an. Beides hat mich sehr geprägt. Die somalische Dichtung ist stark metaphorisch ausgerichtet. In einem bestimmten Gedicht kann es zum Beispiel so klingen, als würde der Dichter über Mutter Natur sprechen, dabei handelt es von etwas vollkommen anderem, das noch niemand kennt.«
»Gibt es einen Unterschied im Denken zwischen Bliss-Symbolen und Schwedisch?«
»Ja, eindeutig. Bliss ist viel klarer. Bliss gibt dir die Bedeutung selbst, ohne das Drumherum. Nur die Bedeutung und sonst nichts. Du siehst, was die Welt wirklich ist. Zum Beispiel das Wort für Hospital. Haus plus Kranke Person.«
»Ich war von deinem Gedichtband tief beeindruckt. Wird es in der nächsten Zeit vielleicht ein neues Buch von dir geben?«
»Ich weiß nicht, ob und wann ich wieder etwas veröffentlichen will. Vielleicht, wenn ich im Grab bin.«
»Ich hoffe, es wird noch davor geschehen.«
»Ich habe eigentlich vor, alles Weitere postum zu veröffentlichen. Die Vorstellung, dass Journalisten kommen und mein Werk kommentieren, ist mir sehr zuwider. Es würde mir nur wehtun. Aber vielleicht, wenn ich Glück habe, wird es herauskommen, wenn ich alt und grauhaarig bin.«
»Ich würde jedenfalls gerne mehr von dir lesen. Deine Gedichte treffen einen direkt im Kehlkopf.«
»Lob mich lieber nicht zu viel, sonst entwickle ich am Ende noch writer’s block.«
»Nun ja, in meinem Buch werde ich deine Gedichte vermutlich schon etwas loben.«
»Okay. Ich werde versuchen, nicht darauf zu achten.«
Erstes Kapitel
Das Tänzeln
This is not the best we can do. Noises with your mouth.
Joe Rogan, JRE Podcast #1383
1
Es ist eine alte Geschichte. Der italienische Dichter Tommaso Landolfi (1908–1979) erzählt uns ihre archetypische Grundgestalt in seinem Dialogo dei massimi sistemi aus dem Jahr 1937. Ein Mann, nur bekannt unter dem Namen Y, erlernt von einem englischen Kapitän, der gelegentlich in Ys Trattoria herumhängt und mit seiner Bewandtheit in den orientalischen Sprachen angibt, das Persische. Y erweist sich als gelehriger Schüler. Persisch scheint wie gemacht für sein Gehirn. Alle neuen grammatikalischen Strukturen saugt er mit geradezu schlafwandlerischer Selbstverständlichkeit in sich auf. In kürzester Zeit beherrscht er die Sprache so gut, dass er Poesie in ihr verfasst. Sein kleines dichterisches Werk erfüllt ihn mit großem Stolz. Es erscheint ihm als der direkteste, unverstellteste Ausdruck seiner Seele.
Nach Jahren kommt er auf die Idee, einmal einen klassischen persischen Dichter zu lesen. Vielleicht denkt er an Hafis, an Firdausi, an Rumi. Er besorgt sich ein Buch, schlägt es auf und sieht Blöcke vollkommen fremdartiger Zeichen vor sich. Nun, denkt er, vielleicht hat ihm der Kapitän die persische Schrift falsch beigebracht. Aber auch ein Blick in eine persische Grammatik stellt ihn nur vor Unverständliches. Das, was der Kapitän ihm da beibrachte, war nicht Persisch.
Also sucht der arme Mann alle linguistischen Quellen durch, die sich auftreiben lassen, spricht mit Gelehrten und Professoren, versendet Textproben, aber niemand kennt die Sprache, in der er dichtet. Sie erinnert an nichts Bekanntes. Der wunderliche Kapitän muss sie sich ausgedacht haben.
Y schreibt einen Brief an den Kapitän und erhält von diesem ein ungeheuerliches Antwortschreiben: »Geehrter Herr! Ich habe Ihren Brief erhalten. Eine Sprache wie die von Ihnen beschriebene ist mir, trotz meines beachtlichen linguistischen Wissens, völlig unbekannt. (…) Was die bizarren Schriftzeichen angeht, die Sie beigefügt haben, so ähneln diese zu einem Teile dem aramäischen, zu einem anderen dem tibetischen Zeichensystem, aber seien Sie versichert, dass sie weder die eine noch die andere Sprache abbilden.«
Der nun vollends verzweifelte Y begibt sich zu einem Kritiker, um herauszufinden, was von den Gedichten zu halten ist, die er in der seltsamen, sozusagen jungfräulich geborenen Fantasiesprache verfasst hat. Kein Mensch auf der Welt könne sie lesen, aber er habe seine ganze Seele in sie gegossen. Er wüsste zumindest gerne, ob diese nun überhaupt noch darin enthalten sei. »Das Traurige an der Sache ist«, sagt er, »dass diese verfluchte Sprache, die keinen Namen trägt, sehr, sehr schön ist – und dass ich sie von Herzen liebe.« Der Kritiker weist darauf hin, dass eine Sprache nicht notwendigerweise von anderen verstanden werden müsse, um ein Träger für Poesie zu sein. Man könnte auch sagen, der Dichter sei in diesem Fall so etwas wie der grenzenlos mächtige König in einem nur von ihm selbst verwalteten und bewohnten Reich, unangefochten von der Vergänglichkeit und den Missverständnissen des Ruhms. Er lebe, in gewisser Hinsicht, das ideale Leben. Am Ende verliert der arme Y den Verstand. So zumindest legen es seine Mitmenschen aus, wenn sie ihn dabei beobachten, wie er immer wieder seine mit unverständlichen Zeichen vollgekritzelten Zettel in die Büros der Literaturzeitschriften trägt.
In der Geschichte, vor allem der des 20. Jahrhunderts, hat es sehr viele Ys und einige wenige Kapitäne gegeben. Auch Kritiker waren vorhanden. Dieses Buch wird einige von ihnen versammeln: begnadete Dichter, einsam in ihrem Reich ausharrende Könige, vorübergehend Verlorene, Unsichtbare und Verfolgte, Roboter und Verbrecher, Helden und Welterlöser.
2
Ein zum Sprechen anhebender Mensch hat, so scheint es, etwas Magisches. Dieses Magische aber verwandelt sich schnell in tragische Verwunschenheit, ja mitunter sogar in einen Fluch, wenn der Betreffende irgendwo ganz für sich allein mit Wörtern im Gehirn hantiert, ohne Aussicht auf einen ihm verständnisvoll lauschenden Mitmenschen, der dieselbe Sprache spricht.
Werner Herzog berichtet, dass er bei den Dreharbeiten zu Wo die grünen Ameisen träumen in Port Augusta, im Süden Australiens, einen Aboriginal-Mann kennenlernte, der der letzte Sprecher einer von anderen Idiomen vollkommen isolierten Sprache war. Der Mann konnte sich niemandem verständlich machen. Er lebte in einem Pflegeheim, in dem man ihm den Kosenamen »Der Stumme« gegeben hatte. Seine Nachmittage habe der Mann, so Herzog in einem Gespräch mit Paul Cronin, damit zugebracht, Münzen in einen leeren Getränkeautomaten zu drücken und dann ihrem klimpernden Durchrieseln durch den Apparat zu lauschen. Wenn der Mann schlief, holten die Pfleger die Münzen aus dem Automaten und legten diese zurück in seine Tasche, wobei diese magische Rückkehr seiner Münzen bei weitem nicht das beunruhigendste Element im Alltag des Mannes gewesen sein dürfte.
Die Stelle in Franz Kafkas Werk, die mich seit meiner Jugend immer am meisten bewegt hat, findet sich gegen Ende der kurzen Erzählung Eine Kreuzung. Ein Mann besitzt ein eigentümliches Tier, halb Katze und halb Lamm. Es ist ein Familienerbstück. Seine Doppelnatur bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Es scheint nicht nur Lamm und Katze, sondern auch, in gewisser Weise, Mensch sein zu wollen. »Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und hält seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden, und nicke. – Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher.«
Es ist dieses Tänzeln, von dem mein Buch handelt. Es ist unsere eigentliche Natur.
Der fünfjährige Franz Kafka mit einem Gefährten
Das Chaos beginnt immer da, wo dieses Tänzeln des Verstandenwerdens nicht mehr existiert. So wie etwa in der entsetzlichen Lebensgeschichte des letzten, notdürftig »Ishi« (»Mann«) genannten Mitglieds der Yahi, eines nordamerikanischen Ureinwohnerstammes, der seinen echten Namen niemandem mehr sagen konnte, weil man diesen nur innerhalb des Stammes zu bestimmten Zeiten verwendete. Einen Stamm und »bestimmte Zeiten« gab es aber nicht mehr. Es gab nur mehr beinah außerirdische Wesen, die sich um ihn scharten. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre als lebendiges Exponat im Anthropologischen Museum in Berkeley, wo er sich filmen und von dem freundlich um ihn bemühten, aber nur einen sehr entfernt verwandten Dialekt beherrschenden Wissenschaftler Alfred Kroeber über alles Mögliche befragen ließ. Er starb 1916 an Tuberkulose.
Es geht ein außerordentlich starkes Grauen aus von allen diesen Geschichten, in denen ein menschlicher Kopf, von Natur aus randvoll mit Ausdrucksmöglichkeiten, sozusagen über Nacht in einen Zustand vollständiger Anschluss- und Kontaktlosigkeit versetzt wird. Nie wieder wird er tänzeln.
Gelegentlich sind es sogar selbst auferlegte Gründe, die zum Verlust einer ganzen Welt werden.
Die australische Aboriginalsprache Mati Ke hat nur mehr zwei lebende Sprecher, Patrick Nudjulu und Agatha Perdjert, wird aber zwischen diesen beiden nicht mehr gebraucht. Denn sie sind, wie es das Unglück will, Bruder und Schwester. Unglück deshalb, weil das strenge Stammestabu der Mati Ke es verbietet, dass Brüder und Schwestern nach der Pubertät miteinander kommunizieren. Als Erwachsener mit seinen Geschwistern in Kontakt zu treten wäre für sie, so zumindest wird es in der mit diesem Fall beschäftigten Fachliteratur erklärt, so obszön wie für unsereins Inzest. Aber andererseits, sie sind ja die einzigen lebenden Mitglieder ihres Stammes, es wäre also gar niemand mehr übrig, der sie für die Übertretung des Tabus bestrafen könnte! Sie wären, genau genommen, so frei wie die beiden letzten Menschen auf der Erde. Aber so läuft es nicht. Weltende hin oder her, sie ziehen es vor, sich bis zu ihrem Tod streng an das Tabu zu halten, und sitzen in ihren Dörfern, reden auf Englisch und schweigen auf Mati Ke.[1]
Der große französische Autor Emmanuel Carrère schrieb ein ganzes Buch, Un roman russe (2007), inspiriert von dem Fall eines ungarischen Soldaten, der 1944 in Russland gefangen genommen, für geisteskrank gehalten, unter anderem weil er kein Russisch verstand und auch keine Anstalten machte, es zu erlernen, und in eine psychiatrische Anstalt in der Kleinstadt Kotelnitsch gebracht wurde, wo er unglaubliche 53 Jahre lang eingesperrt blieb, ohne je ein Wort Russisch zu sprechen. Erst im Jahr 2000 wurde er, bereits weitgehend erstarrt und nur noch murmelnd, zurück nach Ungarn gebracht, wo er seine letzten Jahre in der Pflege seiner Schwester zubrachte und sogar wieder zu sprechen begann. Das Rätsel, weshalb er niemals Russisch erlernte, wurde nie gelöst. Carrère fährt nach Kotelnitsch und studiert die Krankenakten. Aus ihnen geht hervor, dass der Soldat in den fünfziger Jahren noch die Wände, Türen und Fenster der Anstalt mit ungarischen Sätzen vollgeschrieben hat. Danach heißt es Jahr für Jahr über ihn monoton: »Er spricht nur Ungarisch.« Eine einzige Interaktion mit improvisierter Gebärdensprache wird verzeichnet, sie fällt ins Jahr 1965. Dann bis in die Neunziger: »Zustand des Patienten unverändert.« Gegen Ende wird ihm ein Bein amputiert.
Noch seltsamer als die aus inneren oder äußeren Zwangshaltungen erzeugten Fälle von Sprachvereinsamung sind jene, die künstlich, mit voller Absicht und bei klarem Verstand, sozusagen als vorübergehender Luxus, eingeleitet werden. Alle möglichen Menschen in der Geschichte erfanden sich eine eigene Sprache, erlernten sie und beschäftigten sich intensiv mit ihr und standen dann da: allein. Worauf sie in den meisten Fällen eine mal milde und scherzhafte, mal leidenschaftliche und verzweifelte Missionsarbeit begannen, einen Werbefeldzug oder sogar einen Glaubenskrieg, der immer einen einzigen Zweck hatte: die Erschaffung weiterer Sprecher.
Einige der bekannteren Kunstsprachen, die auf eine erfolgreiche Missionsarbeit verweisen können, heißen Esperanto, Klingonisch, Volapük, Blissymbolics, Lojban. All diesen Sprachen werden wir uns über ihre Poesie und über ihre Dichter annähern. In Esperanto und Blissymbolics existieren sogar heute lebende native speaker. Die zahlreichsten Dichter besitzt Esperanto. 1887 erfand der Warschauer Augenarzt Ludwik Zamenhof eine Sprache und formulierte ihre Regeln und ihren Daseinszweck in einer Broschüre. Er nannte seine Kreation »Lingvo Internacia«, und sich selbst nennt er »Doktoro Esperanto«, was in seiner Sprache so viel wie »Doktor Hoffnungsvoll« bedeutet. Die Sprache wird bald nach seinem Künstlernamen benannt. Bereits in ihrem Geburtsjahr erlernt ein späterer Freund Zamenhofs, Antoni Grabowski, die Sprache und beginnt, hymnische Gedichte in ihr zu verfassen. 1889 wird in Nürnberg bereits die erste ganz in ihr verfasste Zeitschrift gedruckt. Um 1900 bilden sich auf der ganzen Welt Esperanto-Vereine. 1907 erscheint der erste 500-seitige Roman. Heute ist die Esperanto-Dichtung extrem zahl- und artenreich, verfügt über eigene literaturgeschichtliche Strömungen und Epochen, und selbst die Dichte ihrer genial begabten Poeten ist, das muss man zugeben, auffallend hoch.
Was aber genau tut ein Dichter, der in einer von einem einzigen Menschen erfundenen Sprache schreibt? Ist es wirklich dasselbe wie Schreiben in naturgewachsenen Sprachen? Will ein Dichter nicht von so vielen Menschen wie möglich gelesen und verstanden werden? Nein. Zumindest nicht unbedingt. Und doch bleibt der Fall ein auf den ersten Blick recht verwirrender. Als Esperanto nur ein paar Sprecher hatte – wie fühlte es sich da für Antoni Grabowski an, die später so berühmten Gedichte darin zu verfassen? Für wen schrieb er? Für die Zukunft? Oder für seine unmittelbaren Freunde? Oder für sich?
Der arme Y aus Landolfis Geschichte glaubte ja, in Gesellschaft anderer persischer Sprecher zu dichten, und erst, als er Anschluss an diese suchte, fiel er in die Hölle. Ein Gedicht aus seiner Feder lautet:
Aga magéra difura natun gua mesciún
Sánit guggérnis soe-wáli trussán garigúr
Gúnga bandúra kuttavol jerís-ni gillára.
Lávi girréscen suttérer lunabinitúr
Guesc ittanóben katír ma ernáuba gadún
Vára jesckílla sittáranar gund misagúr,
Táher chibíll garanóbeven líxta mahára
Gaj musasciár guen divrés kôes jenabinitúr
Sòe guadrapútmijen lòeb sierrakár masasciúsc
Sámm-jab dovár-jab miguélcia gassúta mihúsc
Sciú munu lússut junáscru garulka varúsc.
Sehen wir uns diese Seite ruhig einige Augenblicke genauer an. Ein großer Teil dieses Buches wird so aussehen. Textblöcke aus unverständlichen Wörtern. Und die Leserinnen werden sich, so vermute ich, in zwei Kategorien teilen: Die eine liest sich zumindest ein paar Zeilen der unbekannten Buchstabenfolgen durch, betont sie vielleicht sogar laut, einfach um zu sehen, ob darin irgendetwas Unerwartetes versteckt ist, ein Anflug von Vertrautem oder Deutbarem, während die andere den Text einfach als homogen-fremdartigen Block wahrnehmen wird, als Gesamtes, als Bild.
Y, das heißt Landolfi, liefert uns freundlicherweise auch eine Übersetzung:
Mit müdem Gesicht, das vor Glück weint,
erzählte mir die Frau aus ihrem Leben
und versicherte mich ihrer brüderlichen Zuneigung.
Und die Pinien und Lärchen in der Straße bogen sich anmutig
vor dem Hintergrund des warmrosa Sonnenuntergangs
und einer kleinen Villa mit Landesfahne,
und sie erinnerten an das furchige Gesicht einer Frau, die nicht begriff,
dass ihre Nase glänzte. Und dieser Glanz blitzte
lange Zeit zu meinem Vergnügen, voller Ironie und Biss,
ich fühlte ihn hüpfen und springen, so wie ein kleiner alberner Fisch
in den Schattentiefen meiner Seele.
Der Kritiker findet das sehr gelungen. Y aber weist darauf hin, dass die Übersetzung nichts, rein gar nichts von der Anmut des Originals zu erhalten vermag. Er ist und bleibt allein mit seiner einmal erfolgreich in Worte gefassten Essenz.
Walter Benjamin schrieb: »Das sprachliche Wesen des Menschen ist also, daß er die Dinge benennt. Wozu benennt? Wem teilt der Mensch sich mit? – Aber ist diese Frage beim Menschen eine andere als bei anderen Mitteilungen (Sprachen)? Wem teilt die Lampe sich mit? Das Gebirge? Der Fuchs? – Hier aber lautet die Antwort: dem Menschen. Das ist kein Anthropomorphismus.« Und schließlich kommt er auf die Formel: »Im Namen teilt das geistige Wesen des Menschen sich Gott mit.«
Wem aber, so können wir heute fragen, teilt sich der mit, der allein für sich eine von seinen Mitmenschen ungeteilte Sprache spricht? Gibt es ein zu Gott hin bezogenes Benennen der Welt ohne den Umweg über die in die Kommunikation einbezogenen Mitmenschen? Ich hoffe es. Aber ich sehe dafür auf der Erde bislang kein beweiskräftiges Zeichen.
3
Frederic ging in meine Volksschulklasse. Er war gehörlos. Aus mir unbegreiflichen Gründen war er »ohne Sprache« gelassen worden. Niemand hatte ihm die österreichische Gebärdensprache beigebracht. Man ging wohl irgendwie davon aus, dass er sich schon von selbst so etwas wie Lippenlesen und die »normale« Stimmsprache aneignen würde. Wie weit verbreitet diese institutionelle Form von Kindesmissbrauch damals gewesen ist, weiß ich nicht. Ich bin mir aber sicher, sie geschah, ähnlich wie gewisse heutige Formen des Missbrauchs, unter dem Leitgedanken der Fürsorge.
Eines Tages fiel Frederic ohne Vorwarnung über mich her und würgte mich. Eine Weile versuchte ich, ihn abzuschütteln, aber er war stärker, vielleicht vergingen zwanzig Sekunden, dann bekam ich Tunnelblick, und ein innerer Alarm heulte, mein Herz bäumte sich in meinem Brustkorb auf, und ich sah alles in einer Mischung aus Rot und Grau. Jemand zerrte ihn von mir fort.
Das Schlimme war nicht, dass er mir wehgetan hatte, sondern dass man ihm hinterher einfach nicht begreiflich machen konnte, was überhaupt vorgefallen war, die Lehrerin hielt ihn am Arm fest und verdrehte diesen wohl auch ein wenig, und Frederic schrie und zerrte und weinte, er hatte keine Ahnung, warum man ihn bestrafte. Er hatte noch nie im Leben mit einem anderen Menschen ein Gespräch geführt. Während sie ihn festhielt, brüllte die Lehrerin auf ihn ein. Ich sehe die Szene noch heute klar vor mir. Ihre laute Stimme, ihre ermahnenden Worte, ihre eindringliche Erklärung seines Vergehens.
Melanie, eine andere Klassenkollegin, war ebenfalls gehörbehindert, aber sie verfügte über einen Hörrest, so nannte man das, und sie verstand zumindest ein wenig von unserer schwer greifbaren, hauptsächlich im Reich der Schallwellen vor sich gehenden Leitkultur. Sie beruhigte den verwirrten Frederic nach seiner Bestrafung, denn ihr war, unfairerweise, die Aufgabe zugefallen, auf ihn aufzupassen. Aber auch sie »verstand« ihn natürlich nicht, konnte nicht »übersetzen«, wie die gründlich sinnverwirrten Pädagogen sich das damals vielleicht gedacht hatten. Noch heute erfüllt es mich mit mörderischer Wut, wenn ich mir die wohleingenisteten Autoritäten vorstelle, die beschlossen hatten, die beiden gehörbehinderten Kinder weitgehend sprachenlos zu halten. Mögen sie irgendwann denselben Schmerz erleben, den sie verursacht haben.
In Susan Schallers faszinierender Studie A Man Without Words begegnen wir einem in den USA lebenden gehörlosen Mexikaner namens Ildefonso, der völlig ohne Sprache aufwuchs und erst im Erwachsenenalter unter Schallers Anleitung in einem äußerst mühseligen Prozess die Gebärdensprache erlernte. Das bewegendste Kapitel findet sich ganz am Ende des Buches, wo Schaller ihren früheren Schüler nach einigen Jahren wieder besucht und daran erinnert wird, dass Ildefonso bei weitem nicht der einzige sprachenlos existierende Mensch in der Stadt ist. Da ist zum Beispiel Ildefonsos eigener Bruder, Mario. Und Ildefonsos zahlreiche Freunde. Eines Tages geht Schaller zu ihnen und erlebt »einen Raum voller sprachenloser Menschen«, die stundenlang per szenischer Pantomime miteinander kommunizieren.
Eine Aussage wie etwa »Als ich über die Grenze zwischen Mexiko und den USA kam, hatte ich große Angst« dauert buchstäblich Stunden, um mitgeteilt zu werden. Die Anwesenden verwenden keine gemeinsamen grammatikalischen Strukturen, kein Vokabular. Was immer jemand ausdrücken will, er muss es jedes Mal aus dem Nichts völlig neu erschaffen, durch geduldige pantomimische Wiederholung einzelner Sachverhalte und Szenen. Es gibt kein Reservoir vereinbarter Zeichen. Jede Äußerung ist ein Turmbau.
Was die USA und was Mexiko ist, ist den im Raum versammelten Menschen nicht klar. Dass man hier, in den USA, allerdings unerwünscht lebt, haben sie sehr wohl begriffen. Es werden Menschen deportiert, das heißt, sie fehlen eines Tages einfach. Diese unheimliche Tatsache wird ebenfalls häufig pantomimisch vorgespielt. Durch lange geduldige Beobachtung haben sie gelernt, »that little cards worked to repel green men«. Deshalb haben sie Karten zu sammeln begonnen, alle möglichen Arten. Schaller bekommt diese »like pieces of gold« gehüteten Zauberartikel gezeigt und stellt fest, dass nur ein paar wenige davon so etwas wie Ausweispapiere darstellen. Alles, was gelernt oder mitgeteilt werden muss, braucht in dieser Community enorm viel Zeit. Kleinste Unterschiede in den sich türmenden Storywiederholungen sind ausschlaggebend für Art und Richtung einer bestimmten Information. Susan Schaller wird von Ildefonso mehrmals auf diese winzigen Unterschiede hingewiesen. Doch auch ihm fallen sie nicht mehr so selbstverständlich auf wie früher. Heute muss er sich konzentrieren. Susan Schaller berichtet, dass Ildefonso selbst nach einer Weile über Verständnisschwierigkeiten klagte: Er konnte den Pantomimen nicht mehr ohne weiteres folgen. Sein Gehirn fand den Vorgang auf einmal quälend langsam, vielleicht in etwa so, als bekäme man die Einzelbilder eines Films als gesonderte Kärtchen vorgelegt.
Die Gruppe der Freunde betrachtet Ildefonso inzwischen als eine Art Genie, weil er mit »normalen« Menschen zu reden gelernt hat. Er übersetzt während des Treffens häufig zwischen den Sphären der Sprache und der Sprachenlosigkeit. – Ein sehr merkwürdiger Satz, dieser letzte. Er klingt wie Nonsens. Ich vermute, dass ich, der Sprache im klassischen Sinn besitzt, mir die Innenwelt der von Schaller besuchten Männer nicht vorstellen kann, also ist meine Wortwahl für Ildefonsos Übersetzungsarbeit nur meine ungenaue Approximation. Oder ist uns die Welt der Sprachenlosigkeit doch immer nahe und vertraut? Und woher genau rührt das Grauen, das uns aus der Vorstellung völliger Sprachenlosigkeit jedes Mal entgegenweht?
4
Noch heute laufe ich oft an dem Gebäude vorbei, das sich Hirtenkloster nennt, auf dem Weg zur malerisch-verwahrlosten Weinzödlbrücke im Norden von Graz. Wir befinden uns in meinem liebsten Bezirk dieser Stadt, und die meisten Nebenstraßen hier enthalten Dinge aus meiner Vergangenheit. Das Hirtenkloster ist der Ort, wo ich im Alter von acht oder neun Jahren zum ersten Mal einer Gruppe von mehrfach bzw. schwer behinderten Kindern begegnete. Wochenlang hatten wir in der Volksschule eine Art Theaterrevue einstudiert. Meine Rolle war die eines Fernsehansagers. Auf der Bühne saß ich in dem hohlen Gehäuse eines TV-Geräts und sagte einige auswendig gelernte Sätze. Ihren genauen Inhalt weiß ich nicht mehr, es ging irgendwie darum, dass meine Figur ein kecker Betrüger war, der die Menschen dazu bringen wollte, ihm all ihr Geld zu überlassen. Ich weiß noch: Die mir ihrem Sinn nach nicht ganz greifbaren Wörter pfänden und delogieren kamen vor. Mitten in meiner Darbietung aber geschah es, dass eines der Kinder im Zuschauerraum entsetzlich zu schreien begann. Es klang wie ein langgezogenes Krähen. Ich hatte so etwas noch nie gehört. Ich bekam wahnsinnige Angst, aber ich konnte meinen Text perfekt auswendig und schnatterte ihn fehlerlos zu Ende. Hinter der Bühne dann brach ich vor Verwirrung in Tränen aus. Ich verstand nicht, was mit dem Kind passiert war, dass es so schreien musste.
Man führte mich seitlich an der Bühne zurück in den Saal. Und da, direkt neben einem von Tageslicht erfüllten Fenster, sah ich einen Jungen, der im Rollstuhl saß. Ich glaube, selbst diese Tatsache machte mir ein wenig Angst, aber auf seinem Kopf befand sich etwas, das mich faszinierte und das die kindische Furcht zumindest für die Dauer einiger staunender Sekunden überwand: eine Einhorn-Mütze. Ein teleskopartiger Zeigestock an der Spitze der Stirn. Ja, der Anblick beruhigte mich. Ein Einhorn, das war etwas Witziges und Freundliches.
Schnell aber wurde mir klar, dass die Einhorn-Vorrichtung die Funktion eines Zeigestocks erfüllte. Man hatte sie dem Jungen wie eine Grubenlampe vor die Stirn geschnallt, und er deutete mit dem unbegreiflichen Utensil auf einem riesigen vor ihm ausgebreiteten Brett herum, das wie das Periodensystem der Elemente (in dessen herrliche Symmetrien ich mit sechs oder sieben unglücklich verliebt war) aussah, bloß mit weit mehr Kästchen und mehr Farben.
Gerade hatte ich noch den einhornhaften Stock als etwas Versöhnliches und Verkleidungsartiges wahrgenommen, doch nun, da ich ein wenig mehr von seinem Verwendungszweck begriff, kam das rätselhafte Grauen zurück: Der Junge konnte offenbar nur durch Herumdeuten auf einem Brett voller Zeichen kommunizieren! Er besaß keine Stimmsprache, er konnte nicht schreiben, er konnte vermutlich nicht mal flüstern. Wie sehr schäme ich mich heute für die sinnlose Angst, die ich empfand; in meiner dümmlichen Vorstellung stand ich vor einem unfreiwillig verkrümmten, halb in etwas Nähmaschinenartiges verwandelten Menschen, und da in allen meinen Kindheitsängsten auch immer ein Identifikations- oder Verwandlungswahn mitschwang, fürchtete ich sogar, meine eigene Mitteilungsfähigkeit augenblicklich zu verlieren, wenn ich weiter in seine Sphäre geriete. Ich weiß noch, vor ihm ausgebreitet waren diese vielen kleinen Quadrate, auf jedem von ihnen ein Bild. Ich habe seither versucht zu recherchieren, was aus dem Jungen mit dem Zeigestock in den späten achtziger Jahren im Grazer Hirtenkloster geworden ist, aber bislang ohne klares Ergebnis. Die Zeichen, die vor ihm ausgebreitet lagen, waren keine Buchstaben. Auch keine Bilder. Es waren Symbole, und zwar solche wie diese:
Fast dreißig Jahre später begegnete ich dem Zeichenbrett und dem Zeigestock wieder. Man nennt diese Sprache Blissymbolics. Sie wurde von einem Mann namens Charles Bliss erfunden. Seine Geschichte wird, so traue ich mich zu wetten, mit Sicherheit verfilmt werden. Und der Film wird, mit seinen 90 oder 100 Minuten, zweifellos entsetzlich sein. Kommen wir ihm also, solange wir noch können, zuvor.
Zweites Kapitel
Die schwer verfilmbare Geschichte des Mr Bliss
In Czernowitz, am östlichen Rand des Österreichisch-Ungarischen Reichs, wurde im Jahr 1897 Karl Kasiel Blitz geboren. Im selben Jahr erhielt die Stadt ihre erste Straßenbahn. Schon damals, in den letzten Augenblicken des vorletzten Jahrhunderts, war die Weltgeschichte ein unruhiges Knäuel. Als Karl ein Jahr alt war, wurde Kaiserin Elisabeth I. am Genfer See ermordet. Karls Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Der Vater war Elektriker. Der erste magische Gegenstand, dem der kleine Karl begegnete, waren die Schaltkreise und Diagramme auf den Bauplänen seines Vaters. Diese teilten sich seinem Gehirn ohne Entzifferungsmühe, ja sogar ohne inneres Verstehenwollen mit und erzeugten dort Sinn. Währenddessen hüllten in regelmäßigen Abständen eisige, von der russischen Steppe kommende Stürme die Stadt vollständig in Schnee. Die Menschen bewegten sich wenig, sprachen untereinander nur das Nötigste. Wenn Eis und Schnee tauten, kam es gelegentlich zu Pogromen. Oft zogen Kinderscharen durch die Straßen, und wenn sie Karl erspähten, riefen sie ihm zu: »Hep! Hep!«, wobei H. E. P. für Hierosolima est perdita stand, Jerusalem ist verloren. Es dauerte eine Weile, bis der Junge diese in die Buchstaben eines an sich recht harmlosen Schnapplautes eingenähte antisemitische Hassbotschaft zu entschlüsseln lernte, und womöglich wuchsen bereits da in ihm erste Zweifel an der angeblichen Unschuld aller mit dem menschlichen Stimmapparat artikulierten Sprachen heran.
Das zweite magische Ereignis seines Lebens folgte wenige Jahre darauf. In der Stadt gab es 1908 einen Laterna-magica-Lichtbildvortrag des österreichischen Nordpolreisenden Julius Payer, der von 1872 bis 1874 zusammen mit Carl Weyprecht eine Expedition an die äußersten Ränder der bekannten Welt geleitet hatte. Der kleine Karl saß im Dunkeln, und vor ihm, begleitet nur von leisen Papiergeräuschen, erstand in dem andächtig stummen Raum etwas Unvorstellbares und nie Erahntes: die Polarnacht. Zuerst die Fahrt von Tromsø gen Norden, dann das Schiff, das im Packeis einfrieren und zusammen mit diesem zum Pol driften sollte. Dann die entbehrungsreichen und endlosen Winter in der menschenzermalmenden Kälte. Bewegte sich das Schiff? Vermutlich. Aber nach zwei Jahren, großer Gott, war das Schiff immer noch an Ort und Stelle eingefroren, und keine Aussicht auf Entkommen. Meterhohe Eistrümmer ringsum, eine »geisterbleiche Landschaft« (Payer), zusammengefügt aus nichts als dem menschlichen Leben feindlich gesinnten Elementen. Payer und Weyprecht befahlen der Mannschaft, zu Fuß übers Eis zu marschieren, mit den mitgezerrten Booten wollten sie von der Eiskante bis nach Nowaja Semlja gelangen. Und Karls Bewusstsein löste sich vollständig in dem heldenhaften Schicksal dieser Männer auf. Er war bei ihnen, in ihrer unwirklichen Mondwelt, von Skorbut befallen, erschöpft, umringt von Eisbären. Dann das allerschlimmste Bild. Nach zwei Monaten ihrer Flucht übers Eis sahen die Männer auf einmal wieder ihr eigenes Schiff! Nein, keine Luftspiegelung. Die nordwärts verlaufende Eisdrift hatte sie einfach wieder »nach Hause«, in die Nähe der »Tegetthoff« gebracht. Sie waren verloren. Sie wollten zurück aufs Schiff, wo der Tod wartete. Aber Kapitän Weyprecht erlaubte dies nicht. Payer zeigte den Gästen sein Gemälde mit dem Titel Nie zurück!. Auf ihm sieht man Weyprecht, wie er den Männern eine Ansprache hält, und sie alle lauschen ihm gebannt. Die Männer sollen nicht mehr zurück zum Schiff blicken!, sagt er. Er selbst ist der Einzige, der diesen ab nun geltenden Durchhaltespruch Nie zurück! missachtet, denn er blickt sie an – und damit auch in die Richtung des ihnen geisterhaft auf den Fersen gefolgten Schiffes. Karl erlebte dieses Bild als Offenbarung. – Ich stehe heute vor ihm. Es hängt im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Es ist ein ruhiger Vormittag, außer mir ist niemand im Saal. Payer war nach seinem Todesabenteuer am Nordpol nachvollziehbarerweise Maler geworden. Für den Rest seines Lebens hielt er fest und beschrieb.[2]
Karl wurde nicht Maler, aber an jenem Tag, da er von seinem Vater zu dem Vortrag Payers und damit in die tödliche Polarnacht mitgenommen wurde, habe er begriffen, so erzählte er viele Jahrzehnte später (ich höre seine Stimme, die sich auf einer alten Audiokassette erhalten hat), dass ihm ein ganz ähnliches Schicksal auf Erden zugedacht sein würde: sein Heim zu verlassen für Abenteuer, für die Entdeckung neuer Länder und Kontinente, für die Überwindung des Unmöglichen, der allerletzten menschlichen Grenzen. Vielleicht würde auch er dereinst verlorene Menschen aus Isolation und Verdammung führen, zurück in die bekannte Welt.
1920 lernte er die fünfzehn Jahre ältere, verheiratete Claire Adler kennen. Eine erste Ehe mit der ebenfalls aus Czernowitz stammenden Rosika Kottler wird kurze Zeit später wieder geschieden. 1922 schloss er sein Ingenieurstudium an der Technischen Universität Wien ab. Für kurze Zeit arbeitete er dann in einer Firma als Chemiker, später im Patentamt, und ich glaubte lange, dass man sich diese Zeit seines Lebens als eine verhältnismäßig sichere und glückliche denken durfte. Dem war allerdings nicht so. Blitz stand kurz vor dem Selbstmord, versank immer tiefer in Depressionen und wurde zwischenzeitlich aus einer Firma entlassen, die elektrische Lampen herstellte. Im Mandolinenspiel brachte er es allerdings zu einer von vielen Zeitgenossen gerühmten Meisterschaft. Einmal spielte er sogar mit dem Philharmonischen Orchester unter der Leitung Franz Schrekers.[3] Ab 1933 lebten Karl und Claire, deren Mann kurz zuvor gestorben war, zusammen. Karl kaufte sich eine Kamera und fing an, künstlerische Filme zu drehen. Sein erster Film hieß Sehnsucht nach dem Süden und wurde 1936 in der Wiener Urania gezeigt. Ein für 1938 geplanter Film mit dem Titel Die unvollendete Symphonie wurde allerdings niemals fertiggestellt. Denn nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland ging auf einmal alles sehr schnell. Am 18. März 1938, nur sechs Tage nach dem Anschluss, kam Karl in seine Firma und fand alle Räume voller tatbereiter SS-Männer. Einer seiner Mitarbeiter, ein gewisser Slavik, zeigte mit dem Finger auf Karl Blitz. Man brachte ihn in das Polizeigebäude Rossauer Lände im Alsergrund, genauer ins Schub- und Gefangenenhaus Hahngasse. Claire, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit ihm verheiratet, gab sich als seine Vermieterin aus (ihr Altersvorteil gegenüber Karl verlieh ihr in diesem Punkt eine gewisse Glaubwürdigkeit) und ging zu allen möglichen Behörden, um etwas über seinen Verbleib herauszufinden. Sie erwirkte, dass ihm ein Kleiderpaket ausgehändigt wurde. Karls Mutter in Czernowitz erwartete unterdessen die üblichen maschinengeschriebenen Briefe ihres Sohnes, also wurde Karls Schwager dazu überredet, Briefe in Karls Stil zu verfassen und sogar dessen Unterschrift zu fälschen, damit die Mutter nicht erfuhr, in welcher Gefahr ihr Sohn schwebte.
Während der Haft vertrieben sich die Gefangenen das endlose Warten mit Schachspielen (die Figuren wurden aus Brot geknetet) und mit dem Fragen nach der genauen Uhrzeit. Ein Häftling besaß nämlich, aufgrund eines Versehens der Wärter, noch seine Uhr, und nun fiel ihm die Aufgabe zu, alle paar Augenblicke auf Nachfrage die Zeit zu verkünden. Nach und nach zermürbte dieses Ritual den ohnehin schon zum Zerreißen angespannten Geist des Häftlings, also fertigte Karl kurzerhand aus einem Stück Karton ein Zifferblatt, sodass der Häftling mit der Uhr alle fünf Minuten die genaue Zeit darauf einstellen konnte. Karl unterrichtete seine Mithäftlinge in Geografie, Physik, Chemie und Einsteins Relativitätstheorie.
Der 15. Juni 1938 war ein Tag wie jeder andere. Jüdische Häftlinge wurden in Züge gepfercht und nach Dachau deportiert. Diesmal war Karl unter ihnen. Bis zum September blieb er in diesem Lager, dann kam er nach Buchenwald. Claire versuchte unterdessen über einen Notar, ein Visum für Karl zu erwirken. Der Notar arbeitete im Auftrag der sogenannten »Aktion Gildemeester« (Enteignung vermögender jüdischer Bürger im Tausch für eine Ausreisemöglichkeit) und traf sich mit Karl in Buchenwald. Claire hatte es (wie nur?) geschafft, ihrem Mann seine Gitarre und seine Mandoline ins Lager nachzuschicken, wo sein Spiel, wie er selbst später erzählte, die Aufseher sehr beeindruckt und amüsiert habe. Bei den abendlichen Unterhaltungen (Musik, Theater, Witze), die die Häftlinge aufführten, trug Karl Hemd und Krawatte, beides aus Karton gebastelt. Ein Blockführer, der sich besonders für Karls Unterhaltungskünste begeisterte, brüllte ihn oft an: »Blitz, spiel was auf der Mandoline, aber zweistimmig!«
Als nun der Notar ins Lager kam, hatte zufällig genau dieser Blockführer Dienst. Karl setzte alles auf eine Karte und bat den Blockführer, bitte kurz den Raum zu verlassen, man wolle vertrauliche Dinge besprechen. Ich wüsste gerne, ob er diesen über sein Leben entscheidenden Satz vielleicht in scherzhaftem Ton äußerte, um auf den Blockführer nicht frech zu wirken, oder doch in ernstem und bestimmtem, wie es dem Anlass entsprach.
Jedenfalls wirkte der Satz. Der Blockführer ging aus dem Raum. Nun konnte man die Überschreibung von Karls Vermögen im Tausch für ein Visum arrangieren.
Dann Warten.
Die Zeit geht dahin.
Dann wird es plötzlich konkret, ja offiziell: Karls Entlassung aus Buchenwald wird für den 2. Februar 1939 festgelegt. Aber am selben Tag wird ihm seine Straßenkleidung verweigert, da es im Lager eine Typhusepidemie gibt. Der neue Termin ist der 13. April.
Die Tage vergehen.
Am 13. April wird ihm mitgeteilt, dass er doch nicht entlassen wird. Karl ist verzweifelt.
Am nächsten Tag wird er entlassen. Und er steht auf dem Bahnhof, wahrhaftig, und besteigt den Zug. Und in diesem Zug, in einem gewöhnlichen Abteil, mit einem gewöhnlichen Ticket, das er kaufen durfte, fährt er zurück nach Wien und trifft dort, wenn auch nur für kurze Zeit, Claire. Sie darf ihn nicht ins englische Exil begleiten.
Claire floh von Wien nach Czernowitz, dann weiter nach Griechenland. In England fand Blitz unterdessen Arbeit in einer Fabrik. Aber 1940 begann der Bombenkrieg auf London, und nun wurde sein Nachname mehr und mehr zu einem Problem. Die Menschen zuckten vor ihm zurück, weil »Blitz« auf Englisch so viel wie »Bombardierung« bedeutet, ganz ähnlich vielleicht wie die Nationalsozialisten in Österreich Jahre davor zurückgezuckt waren, weil der Name Blitz jüdisch klang. Irgendwas stimmte nicht mit der Sprache. Nicht mit einer bestimmten Sprache, Deutsch oder Englisch, sondern mit allen. Allen, die Wörter verwendeten. Denn Wörter konnten, egal wie sie lauteten, missbraucht und pervertiert werden. Man konnte ihre Bedeutung in ihr Gegenteil verkehren. Man konnte lügen. Man konnte sogar, wie den Häftlingen in Buchenwald jeden Morgen neu aus den blechern schallenden Lautsprechern vorgeführt worden war, mit Wörtern riesige Mengen an Menschen töten. Solange die Sprache eine klangliche Oberfläche besaß, dachte Blitz, der sich fortan Charles Bliss nannte, so lange war sie anfällig und korrumpierbar, so lange stand sie, letztendlich, im Dienste des Kriegs und der Vernichtung. War der Mensch dazu verurteilt, allein weil er einen Mund besaß, eine Sprache mit klanglicher Oberfläche zu verwenden? Oder konnte man so etwas wie Sinn auch »direkt« übertragen, ohne Umweg über die Stimmlaute?
Nach der Invasion Griechenlands durch die italienischen Faschisten sah sich Claire erneut gezwungen zu fliehen. Charles versuchte 1940, in Kanada Asyl zu erhalten. Seine Bemühungen scheiterten an der undurchdringlichen Bürokratie. Die beiden emigrierten, weiterhin voneinander getrennt, umständliche, aber sichere Reiserouten über den gesamten Globus wählend, an einen der letzten Orte der Erde, der zu diesem Zeitpunkt noch Juden aufnahm: Shanghai. Dort lebte eine Cousine von Bliss, Paula, zusammen mit ihrem Ehemann. Am Weihnachtstag 1940 waren Charles und Claire endlich wieder vereint. Sie heirateten am 25. Januar 1941. Doch das Glück des Neuanfangs im politisch vorerst recht sicheren Exil hielt nur kurz. Claire steckte sich mit Typhus an und lag wochenlang in Lebensgefahr im Krankenhaus. Nachdem sie entlassen und wieder ein wenig genesen war, brach sie sich bei einem Sturz aus einer Rickshaw den Arm. Bliss pflegte seine Frau, währenddessen erlernte er eifrig das Chinesische. Eines Tages erklärte ihm sein Chinesischlehrer etwas Verblüffendes: Zwei Chinesen aus unterschiedlichen Teilen des Landes könnten, so der Lehrer, eine Tageszeitung lesen und verstehen, aber wenn man sie miteinander reden ließe, würden sie einander nicht notwendigerweise verstehen, weil sie völlig unterschiedliche Dialekte sprächen. Auch Bliss kam es später gelegentlich so vor, als könnte er die Schlagzeilen chinesischer Tageszeitungen ohne Kenntnis der Aussprache lesen, sie verwandelten sich in seinem Kopf, so wie einst die Schaltkreiszeichnungen seines Vaters, in deutschsprachige Mitteilungen. Bliss war von dieser Tatsache tief beeindruckt. Konnte das vielleicht die Lösung sein? Dieses Prinzip müsste doch, so schien ihm, auf die ganze Welt ausweitbar sein. Er begann mit ersten Entwürfen einer allein aus Symbolen bestehenden Sprache.
Bereits im Dezember 1941 wurde Shanghai von den Japanern besetzt. Die mit den Nazis verbündeten Besatzer veranlassten, dass alle Juden ins Ghetto Hongkou überführt werden sollten. Für die Umsetzung dieser Maßnahme war der deutsche SS-Mann Josef Meisinger verantwortlich. Da die Japaner vom Begriff »Juden« keinerlei Feindbild abzulesen vermochten, wurden diese im diplomatischen Austausch von Meisinger kurzerhand in »Anti-Nazis« umgetauft und zu Spionen erklärt. Diese Maßnahme erst führte zu einer großangelegten antisemitischen Raserei unter den japanischen Generälen. Nichts fürchtete die japanische Führung mehr als Spionage. Wieder einmal zeigte die Sprache ihr dämonisches Antlitz. Wörter als Munition.
Claire allerdings war Deutsche mit römisch-katholischem Bekenntnis, das bedeutete, sie hätte, um dem elenden und lebensgefährlichen Schicksal der Internierung in der designated area zu entgehen, einfach um Scheidung ansuchen können, so wie es in der Tat viele Frauen damals machten, aber obwohl das Ghetto mit Sicherheit Krankheit und Hunger bedeutete, begleitete sie ihren Mann 1943 dorthin. So ein Satz schreibt sich leicht.
So grauenhaft die äußere Situation für die beiden geworden war, so intensiv und hoffnungstiftend war Bliss’ innere Welt. Er war, nach Julius Payers Vorbild, ausgezogen, um einen neuen Kontinent zu entdecken, aber hatte nun, nach langem Nachgrübeln und dem Studium des Chinesischen, viel mehr entdeckt als bloß einen neuen Erdteil. Er war auf die Heilung der Menschheit gestoßen. Heilung wovon? Vom Bösen. Das heißt von der Sprache. Der Stimmsprache. Dem hinterlistigen Spiel der Wörter. Ganz ohne Sprache ging es natürlich nicht, aber man brauchte etwas Neues, in dem sich Sinn sozusagen direkt übermitteln ließ. In mönchischem Schweigen ausgetauschte Zeichen, die »reine Bedeutung« enthielten. Bliss nannte sein Konzept zuerst New World Writing, dann Semantography.
»Es könnte ein Ohr geben, für welches alle Völker nur eine Sprache redeten«, schrieb Georg Christoph Lichtenberg, und Charles Bliss subtrahierte sogar noch das Ohr aus diesem Gedanken. Was war nicht alles angerichtet und zerstört worden durch gebellte oder geflüsterte Worte! Schluss damit, ein für alle Mal! Gebt den Ohren die Freiheit, Musik und Naturlaute zu hören.
Noch vor der Verbannung ins Ghetto begann Bliss, Vorträge über sein neues System im Shanghai Jewish Club zu halten. Aber auch im Ghetto trat er als öffentlicher Redner auf, etwa vor der Hongkew Medical Society, und stieß damit auf Zustimmung und Interesse, gelegentlich sogar auf Begeisterung. Er engagierte einen Wiener Journalisten namens Kars, dessen Aufgabe es war, sein New World Writing zu kritisieren. Er verkaufte Kameras, bot Filmherstellungsdienste an, er erfand Wege, die Beschränkungen des Ghettos zu umgehen, und entwickelte eine an Maggisauce erinnernde Tafelwürze für Exilanten. Und er begann, ein Buch zu schreiben.
Es liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Antiquarisch erworben, sauteuer, uralt und abgewetzt, mehrere hundert Seiten dick. Jede neue Auflage wurde von Charles um viele neue Kapitel und Abschweifungen ergänzt. Am Ende würde das Buch alles enthalten. Sein ganzes Leben, sein neues Sprachsystem, seine Liebe zu Claire.
Im August 1945 fallen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Der Krieg ist zu Ende, Japan kapituliert bedingungslos. Allen japanischen und deutschsprachigen Bewohnern Shanghais droht die gewaltsame Enteignung ihres letzten bisschen Besitzes. Bevor die chinesische Regierung mit dieser Regelung durchgreift, verlässt das Ehepaar Bliss die Stadt in Richtung Australien.
Auch für seine Mutter erwirkt Charles ein Visum für Australien, aber diese stirbt am 8. März 1947. Unter ihrem Kopfpolster werden die gültigen Einreisepapiere gefunden.
Die wichtigste Unterscheidung in der Bliss’schen Sprachphilosophie ist die zwischen »logischem« und »illogischem« Gebrauch eines Wortes. Hier ein Beispiel, das den Unterschied illustriert, am Wort »gehen«:
Ich gehe in mein Zimmer – logisch.
Ich gehe drauf – unlogisch.
Heute würde man eher sagen: »wörtlich« und »idiomatisch«. Kurz gesagt: Bliss hasste alle idiomatischen Ausdrücke. Für ihn waren sie die Todeskrankheit jeder Sprache. Seine Semantography sollte, zumindest seiner Intention nach, keine idiomatischen Ausdrücke mehr enthalten.
Historisch und linguistisch gesehen ist das freilich Unsinn bzw. unmöglich. Was heute wörtlich gemeint ist, ist morgen ein Idiom. Außerdem wirken Bliss’ Ausdrücke auf mich teilweise sehr metaphorisch, ja geradezu barock in ihrer sich türmenden Pracht, vor allem bei abstrakten Begriffen.
Manche von ihm getroffenen Unterscheidungen besitzen allerdings einen unleugbaren Charme, z. B. das Symbol für »existieren«. Man schreibt es so:
Je nachdem, wie groß man das Symbol schreibt, bezeichnet es die Existenz eines Lebewesens oder eines unbeseelten Objekts. Je größer, desto belebter. »Der Mensch existiert« – hier wird das Symbol genauso groß wie »Mensch« geschrieben. Beim Satz »Der Staat existiert« dagegen schreibt man es klein. Aber man kann auch das kleine Symbol für den Menschen verwenden – dies geschieht in Situationen, wo sein Dasein nicht die Hauptsache, das heißt nur vorübergehend ist. »Der Mensch ist gerade in diesem Haus, aber er lebt normalerweise nicht dort« – in diesem Fall verwenden wir das kleine Symbol. Was aber, wenn man das riesige Symbol für den Staat verwendet? Bliss’ Lehrbuch erteilt uns für diesen Fall keinen Rat.
In der 1974 vom National Film Board of Canada gedrehten Dokumentation Mr. Symbol Man führt Charles Bliss außerdem sein Symbol für das Bedeutungsfeld »haben« vor. Es sieht aus wie ein Pluszeichen. Schreibt man eine horizontale Linie unterhalb des Pluszeichens, erhält man das Symbol für »besitzen«:
»Schauen Sie«, ruft Charles Bliss und tippt ein paarmal wild auf das Symbol, »es sieht wie ein Grabstein aus! Und das ist auch zutreffend, denn es sind ja all Ihre irdischen Besitztümer, die Sie nicht ins Jenseits mitnehmen können!« Er ist tief bewegt von seiner eigenen Deutung.
Bliss’ romantische Sicht auf die chinesischen Schriftzeichen und, damit verbunden, auf seine eigenen Pikto- und Ideogramme steht in der Ideengeschichte freilich nicht allein da. Denken wir etwa an Ernest Fenollosa, der Chinesisch gar nicht und Japanisch nur in Ansätzen beherrschte, aber dennoch aus seiner »Deutung« der angeblichen Poesie der Zeichen eine so attraktive Suppe kochte, dass er alle möglichen Dichter zu Beginn des 20. Jahrhunderts inspirierte, allen voran den manischen Allesversteher Ezra Pound, der keine einzige asiatische Sprache auch nur in Ansätzen beherrschte, aber dennoch jahrelang fleißig und einflussreich Konfuzius übersetzte. – Ich hab so die Vermutung, wir werden dem Herrn Pound in diesem Buch noch öfter begegnen. Vielleicht lässt es sich ja verhindern, aber wir werden sehen.
Fenollosa jedenfalls hielt die chinesische Schrift für ein »Notationssystem, das auf einer bildhaften Kurzschrift naturhafter Abläufe basiert«.[4] Die Zeichen führten demnach beim Sprecher zu einer »ursprünglicheren« und »unverstellten« Wahrnehmung der Welt: »Ein Mosaik durch die Zusammenfügung mehrerer bildhafter Elemente zu einem einzigen Zeichen.« Pound sah darin prompt das Grundwesen der neuen Poesie: ein zu einer knappen Einheit zusammengefasster Wirbel (vortex) aus Bedeutungen, aus »Universum-in-Bewegung«, aus ewig-dynamischen Beziehungen untereinander.
Hm.
Freilich haben bereits lange vor Bliss oder Pound immer wieder Menschen davon geträumt, solche direkten Sinn-Gebilde zu erzeugen, die sich, sozusagen ohne jede Reibungsenergie und Trägheit innerhalb eines Mediums, zwischen den Köpfen der Menschen transferieren lassen. Außerdem muss man zugeben, dass sich in bestimmten Bereichen des menschlichen Lebens ungeheure, das normale Arbeiten fast unmöglich machende Reibungsenergien innerhalb der verwendeten Wörter ergeben, zum Beispiel im Deutschen bei der Benennung von Pilzen. Ich meine, schau dir diese Namen an: Filziger Milchling, Gedrungener Wulstling, Igel-Stachelbart, Krause Glucke, Rötelnder Wüstling, Säufernase, Schleimchen, Wolliger Milchling, Ziegenlippe. Wie soll man sich als Wissenschaftler mit solchen Benennungen befassen, ohne dass einem dabei ständig das Monokel in den Tee fällt?
Im 17. Jahrhundert lebte ein Mann, der Bischof John Wilkins, der genau dieses Problem zu lösen versuchte. Ihm war der Mensch in seiner Rolle als Benenner der Ding- und Tierwelt nicht recht geheuer. Er misstraute ihm. Benennung, darum sollte sich doch eher Gott kümmern. Wilkins war mit dieser Ansicht durchaus so etwas wie ein Vorfahre von Charles Bliss. In An Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language entwarf er eine Sprache, in der man nichts benennt, indem man sich von seiner Form oder Funktion an dies oder jenes erinnern lässt, sondern ausschließlich, indem man seinen Ort innerhalb des großen Baumdiagramms der Taxonomie bestimmt und diesen dann lautlich nachbildet. Jeder Zweig eine eigene Silbe. Das klingt fürchterlich abstrakt. Hier ein Beispiel: Die Silbe »de« bezeichnet die Kategorie Element. Seine fünfte Spielart, Helligkeit in der Luft, wird durch ein »t« gekennzeichnet und die erste Spezies innerhalb dieser Kategorie durch ein »α« (entsprechend der englischen Silbe »aw«). Was aber ist die erste Spezies innerhalb Helligkeit in der Luft? Die aufmerksame Leserin hat es schnell erraten. Natürlich ein Regenbogen. »Detα«.[5] Die dritte Spezies innerhalb Helligkeit in der Luft, »dete«, ist ebenfalls schnell erraten: Nebensonnen, parhelia, sun dogs.
Alles so weit recht simpel. Was aber, wenn wir statt Regenbogen oder Parhelion eines Tages das etwas ausgefallenere Konzept »Hase« benennen wollen? Dann müssen wir Wilkins’ Tabelle konsultieren (oder, seiner Vorstellung nach, bereits von frühester Kindheit an auswendig können), und wir entdecken den Hasen in der dritten Spielart der Kategorie Tier, an dritter Stelle. Die Silbe für Tier ist »Zi«, die dritte Spielart darin wird mit einem »g« bezeichnet und deren dritte Spezies mit einem ans Ende gehängten »e«.
Also: »Zige«.
Mein Gott. Im Ernst? Hase spricht man als »Zige«?
Geh bitte. Okay, wie sagt man dann Ziege auf Wilkins? Ich weiß, das Prinzip ist längst erklärt, aber ich muss das noch kurz nachschauen.
Die Ziege wohnt also hier, im zweiten Kästchen:
Also: »Zi-d-a«. Allerdings auf derselben Ebene mit Schafen. Für diesen Fall der, wie Wilkins es nannte, »durch Affinität verwandten Objekte« muss man nach seiner Regel den lokalisierenden Vokal an den Wortanfang hängen. Schaf: »Zida«. Ziege: »Izida«.
Und wenn wir schon dabei sind, wie steht es mit unserem Katzenlamm? Schauen wir nach. Sein Name in Bischof Wilkins’ philosophischer Sprache lautet: »Zipizida«. Alright. Fehlt nun noch das Wort »tänzelnd«. Das Konzept Tanzen finden wir im eigens angehängten Wörterbuch unter »Motion, V, 5«, also »ce-t-o«. Dann müssen wir noch »ceto«, »der Tanz«, in sein Adjektiv verwandeln, und wir haben das fertige Gefüge: »C’eto Zipizida«.
Unser selig tänzelndes Katzenlamm, das emblematische Begleitertier durch die Geschichte.[6]
Kehren wir nun zu Charles Bliss zurück. In dem Kapitel »How the Semantics of Semantography works« in Semantography analysiert er für uns den Satz »Deutschland über alles«. In Blissymbolics schreibt dieser sich so:
Bliss schreibt dazu:
Wenn man Hitlers Aussagen in Semantographie übersetzt, wird man begreifen, weshalb nicht nur ein Großteil der deutschen Bevölkerung, sondern auch Hitler selbst an sie glaubte. Die relevanten Wörter gehören zu einer Klasse, die in der Semantographie MENSCHLICHEWERTUNG genannt wird.
Der Leser muss entschuldigen, dass ich ihn direkt mit den Symbolen konfrontiere, dessen genauer Sinn sich erst nach einer genauen Lektüre des gesamten Buches ergeben wird. Dies ist nur ein Einführungskapitel.
Die Symbole sind aber leicht erklärt: Das Symbol für Flagge über dem Symbol für Erde gibt uns das Symbol für Staat. Dann fügen wir das landesspezifische Flaggenbild hinzu.
Die Symbole für über und unter sind selbsterklärend. Allerdings müssen wir erkennen, dass ihre Bedeutung vage und relativ ist. Alles hängt davon ab, wo man selbst die Grenze, d. h. die Linie, zieht. Wenn man diese Linie zeichnet, muss man auch angeben, in Bezug wozu sie existiert: über dem Meeresspiegel oder über dem Haus. Das Meer und das Haus sind beides chemische DINGE. Aber wenn wir Wörter aus der Klasse der MENSCHLICHEN WERTUNG verwenden, wie über jeder Kritik, über-haupt, über-dies, kann das Ergebnis absolut alles bedeuten.
Das Symbol für alles besteht aus dem Multiplikationszeichen (×), das in eine abgeschlossene Fläche, ein Quadrat, geschrieben wird. Es kann »viele Dinge« bedeuten, »eine Mannigfaltigkeit«, aber eine begrenzte. Dieses Symbol sollte eine semantische Wirkung haben, die an den Ausspruch von E. T. Bell denken lässt: »The wretched monosyllable all has caused mathematicians more trouble than all the rest of the dictionary.« Aber wir brauchen diese Interpretation gar nicht. Wir fragen uns einfach: »Weisen die Wörter über und alles auf irgendein spezielles chemisches DING oder auf einen speziellen physikalischen VORGANG hin?« Die Antwort ist Nein. Aus diesem Grund erhält das Symbol den Indikator für WERTUNG.
Hätte Hitler gesagt:
Deutschland über allem, gemessen vom Meeresspiegel!
– der Unsinn seiner Aussage wäre für alle sofort klar ersichtlich gewesen. Aber eine Aussage, die Wörter aus der Klasse WERTUNG enthält, ohne dass das genaue Verhältnis (über was? was alles?) angegeben wird, kann von jedermann anders interpretiert werden. Eine Million Mal wiederholt, wird es zu einer »Wahrheit« in den Köpfen der Menschen.
Der Sinn der Semantographie ist also, laut ihrem Erfinder, in erster Linie die Sichtbarmachung der semantischen Klassen, aus der die Wörter stammen. Sie vermeidet dadurch, so zumindest die Theorie, ähnlich wie die Wilkins’schen Wörter die Vieldeutigkeit und die Unschärfe, aus der so manche Propaganda ihre Energie bezieht. Eingängige Slogans, die man gedankenlos grölen – oder nein, grölen sowieso von vornherein nicht –, besser: die man gedankenlos im eigenen Kopf wiederholen kann, lassen sich in Blissymbolics nicht so ohne weiteres bauen.
Was aber bedeutet das für die Poesie? Müssen wir auch auf sie verzichten? Metaphern waren Charles Bliss bekanntlich äußerst verhasst. Er sah sie als eine der größten Verirrungen der Sprache überhaupt – und entwickelte deshalb sogar ein eigenes Zeichen, mit dem man eine Metapher deutlich kennzeichnen kann, damit niemand auf ihre dunkle Zauberkraft hereinfällt.
Und doch enthält Semantography gegen Ende ein eigenes Kapitel über Poesie. Darin zitiert Bliss, wenig überraschend, den Professor Fenollosa. Außerdem erteilt er den Dichtern, und, soweit ich sehe, nur ihnen, ein gewisses Sonderrecht auf Erden:
Ein Leben lang habe ich als Forscher im Bereich der industriellen Chemie gearbeitet und habe viele nützliche Dinge entwickelt, aber das allernützlichste Ding, so bin ich überzeugt, ist ein Gedicht. (…) Ebenso bin ich überzeugt, dass Dichter die empfindlichsten Wesen sind. In einem flesh of understanding (sic!) haben sie Tausende Jahre vor heutigen Physikern und Mathematikern die Naturgesetze erfühlt. Die Sprache der Dichter ist anders als die Sprache des Marktplatzes, aber das sei ihnen verziehen, denn sie versuchen, das Unerklärliche zu erklären, indem sie Metapher, Vergleich und Analogie verwenden.
Bliss hält die chinesische Dichtung für die schönste der Welt. In ihr sei wahre Zeitlosigkeit enthalten. Man müsse nicht einmal die Sprache beherrschen, bloß die Zeichen, und schon könne man den Sinn verstehen, auch 2500 Jahre nach der Entstehung des Gedichts. Hier eine Zeile, die diesen Gedanken illustrieren soll:
Ich habe mir die Mühe gemacht, ins Nebenzimmer zu gehen und meine Freundin, die Sinologin ist, zu bitten, ob sie mir die Schriftzeichen für diese zwei poetischen Zeilen aufschreiben könnte. Ich wollte sehen, ob ich sie tatsächlich irgendwie, ohne Kenntnis des Chinesischen, verstehen kann.
»Aber das ist doch so oder so kompletter Blödsinn«, sagte Sarah. »Für girl kann man mehrere Zeichen auswählen. Und was soll das am Ende überhaupt ergeben?«
»Schreib mir die Zeichen auf!«
»Schreib mir die Zeichen auf. Genau das geht nicht einfach so. Auf Chinesisch listet man nicht bloß irgendwelche Zeichen nebeneinander auf. Man muss die Grammatik kennen. Das klassische Chinesisch hat ja auch eine Grammatik. Das ist alles dieses dumme Fenollosa-Zeug, girl cheek soft peach, mein Gott.«
»Was?«
»Männer, die Frauen als Obst betrachten.«
Sie holte eine französischsprachige Ausgabe mit Gedichten aus der Tang-Zeit aus dem Regal.
»Da, wähl irgendeines aus. Dann schreib ich dir die Zeichen auf.«
»Aber ich wollte doch dieses Beispiel von Bliss hier widerlegen.«
»Das Beispiel ist Unsinn. Diese Kästchen haben überhaupt nichts mit irgendwas im Chinesischen zu tun.«
»Aber zum Beispiel da, moon«, sagte ich.
»Was moon?«
»Der Mond«, sagte ich und hüpfte ungeduldig auf meinem Stuhl. »Dafür gibt’s doch ein Zeichen.«
»Ja. Und?«
»Mond silbern See windstill.«
Aber ich wusste selber nicht mehr, worauf ich hinauswollte. Also schlug ich die Anthologie auf und las ein paar Zeilen. Aber ich verstand nicht mal alle französischen Ausdrücke. Humecter, was heißt das?
Bliss gibt uns im selben Kapitel auch ein Beispiel für eine Gedichtzeile in Blissymbolics:
Die Leserin kann, wenn ihr der Sinn danach ist, einen Augenblick selbst überlegen und raten, was das bedeuten könnte. Die auf Englisch dazugekritzelten Begriffe »mouth« und »musical note« sind ja bereits kleine Hinweise. Das linke Symbol hätte ich selbst tatsächlich, korrekterweise, als SONNE gelesen. Die Sonne geht auf. Ja, nicht schwer. Aber dann das zweite. Ein verknautschtes X, wie das stilisierte Gesicht einer Katze, die niesen will, aber nicht kann. Und hm, das Symbol für »mehrere« darüber, wir kennen es ja bereits aus der Belehrung über den Satz Deutschland über alles. Also mehrere nieserte Katzen. Die Sonne geht über nieserten Katzen auf, und sie singen.
Aber das Symbol heißt »Vogel«. Hätte ich nie erraten. Schaut doch anders aus, ein Vogel. Wobei es natürlich schon Sinn ergibt, so ein flatterndes Dings. Also: Die Sonne geht auf, Vögel singen.
Bliss gibt uns dann drei verschiedene Lesarten des Satzes in verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch lauten seine drei Varianten:
Die Sonne steigt, die Vöglein zwitschern.
Auf geht die Sonne, Vöglein singen.
Im Sang der Vögel steigt die Sonne.
Die letzte Lesart verblüfft mich ein wenig. Woraus sollen wir das »im Sang« ablesen? Nun ja. Bliss selbst sieht die Gefahr, dass man sein System im Bereich der Dichtung eher für »landscape painting« verwenden könnte anstatt für den Ausdruck höherer Ideen.
Dem stellt Bliss die folgende Bildung eines neuen Begriffs gegenüber:
Poesie: geflügelte Sprache, männchenhaft aufgestellt zwischen einem Blatt Papier und einem Herz. Als Definition durchaus akzeptabel.
Apropos landscape painting. Im Internet entdeckte ich vor Jahren den sehr vergnüglichen Blog eines kreativen Blissymbolics-Enthusiasten mit dem sehr amerikanisch-militärisch anmutenden Namen George F. Sutton. Dieser Mann ist der Gründer und Besitzer der Webseite symbols.net und einiger verwandter Seiten. Seit Jahren fehlt von ihm im Internet allerdings jede Spur. Sein Blog wurde gelöscht, und auch sonst findet man seine Arbeiten nur noch in den automatisch angefertigten Screenshots der Wayback Machine, dem Internetarchiv. Aus seiner Selbstbeschreibung dort entnehmen wir, dass Mr Sutton Pilot war, der im Alter von vierundzwanzig Jahren eine religiöse Erleuchtung erlebte, aufgrund der er – die genauen Details werden nicht genannt – ein Jahr später als bipolar diagnostiziert wurde. Er wurde in Frühpension geschickt und studiert oder studierte seither alle möglichen heiligen Schriften und wissenschaftlichen Bücher. Zwischen 1993 und 1996 begegneten ihm die Bliss-Symbole und veränderten sein Leben. Er begann, die Kabbalah in Blissymbolics zu übersetzen, und verwendete da zum ersten Mal ein bildnerisches Verfahren, das er Visual Bliss nennt.[7] Im modernen Blissymbolics-System, also dem, das durch spätere Pädagogen entwickelt wurde, zeigt man Wortarten (Adjektiv, Hauptwort usw.) nicht mehr durch diakritische Zeichen an, sondern durch Farben. Sutton übernimmt das und stellt überdies örtliche und zeitliche Verhältnisse durch visuelle Entsprechungen dar. Hier eines seiner Beispiele für diese neuartige Form von sprachlichem landscape painting:
Oder hier, ein Satz über eine Frau auf einem Liegestuhl: