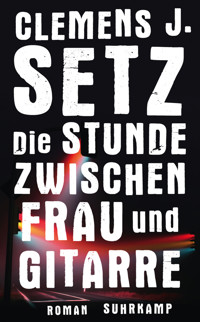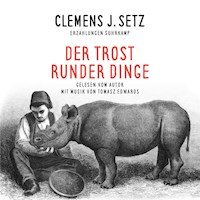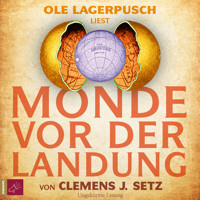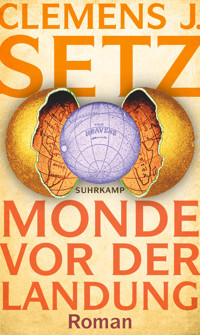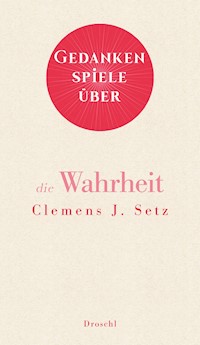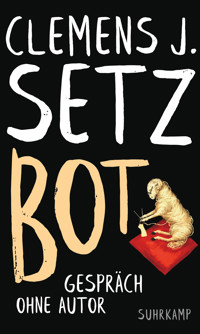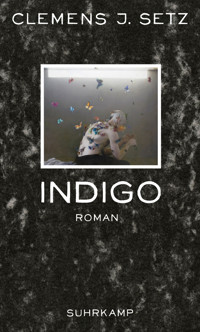
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Norden der Steiermark liegt die Helianau, eine Internatsschule für Kinder, die an einer rätselhaften Störung leiden, dem Indigo-Syndrom. Jeden, der ihnen zu nahe kommt, befallen Übelkeit, Schwindel und heftige Kopfschmerzen. Der junge Mathematiklehrer Clemens Setz unterrichtet an dieser Schule und wird auf seltsame Vorgänge aufmerksam: Immer wieder werden Kinder in eigenartigen Maskierungen in einem Auto mit unbekanntem Ziel davongefahren. Setz beginnt, Nachforschungen anzustellen, doch er kommt nicht weit; er wird aus dem Schuldienst entlassen. Fünfzehn Jahre später berichten die Zeitungen von einem aufsehenerregenden Strafprozess: Ein ehemaliger Mathematiklehrer wird vom Vorwurf freigesprochen, einen Tierquäler brutal ermordet zu haben. Und jetzt noch einmal von vorne. Vergessen Sie die Zusammenfassung einer Romanhandlung, die sich jeder Zusammenfassung entzieht, und lesen Sie das Buch »Indigo« von Clemens J. Setz. Sein viertes insgesamt. Sie werden feststellen: Das »radikale Gegenprogramm zur hübsch verkasteten Literaturwerkstättenliteratur« (»Die Welt«) geht weiter. Rasend spannend und so erholsam wie eine gute Massage. Hinterher spüren Sie jeden Muskel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Im Norden der Steiermark liegt die Helianau, eine Internatsschule für Kinder, die an dem rätselhaften Indigo-Syndrom leiden. Jeden, der ihnen zu nahe kommt, befallen Übelkeit, Schwindel und heftige Kopfschmerzen. Der junge Mathematiklehrer Clemens Setz wird auf seltsame Vorgänge in der Schule aufmerksam: Immer wieder werden Kinder in eigenartigen Maskierungen in einem Auto mit unbekanntem Ziel davongefahren. Setz beginnt Nachforschungen anzustellen, doch er kommt nicht weit; er wird aus dem Schuldienst entlassen. Fünfzehn Jahre später berichten die Zeitungen von einem aufsehenerregenden Strafprozess: Ein ehemaliger Mathematiklehrer wird vom Vorwurf freigesprochen, einen Tierquäler brutal ermordet zu haben.
Clemens J. Setz, 1982 in Graz geboren, studierte Mathematik und Germanistik in Graz. Er arbeitete als Mathematik-Tutor u.a. im Proximity Awareness & Learning Center Helianau und als Journalist. Seit 2008 treten bei ihm die Spätfolgen der Indigo-Belastung auf. Heute lebt er als freier Schriftsteller zurückgezogen mit seiner Frau in der Nähe von Graz. Indigo war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2012 und erhielt den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft.
Zuletzt ist von ihm erschienen: Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes. Erzählungen (st 4335).
Clemens J. Setz
INDIGO
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4477
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Abbildung S. 63, 167: Wikimedia (Foto: Michel Mazeau);
Abbildung S. 339: James Soe Nyun;
alle anderen Abbildungen aus dem Archiv des Autors
bzw. des Suhrkamp Verlags
Umschlagfoto: Robert und Shana ParkeHarrison
Umschlaggestaltung: Judith Schalansky, Berlin
eISBN 978-3-518-78850-9
www.suhrkamp.de
Das Land war so flach, dass man ringsum bis zum Horizont sehen konnte. Und der Horizont war gerade mal kniehoch, manchmal ging er mir auch bis an die Hüfte.
Magda T.
Irgendwann gewöhnt man sich gegen alles.
Dr. Otto Rudolph
It looks like we’re getting closer to the heart of this criminal artichoke.
Adam West als Batman
Raaba b. Graz, am 1. November 2006
Lieber Clemens Setz,
ich nehme an, Sie würden gerne erfahren, was alles passiert ist, nachdem Sie das Bewusstsein verloren haben. Zuerst haben wir versucht, Sie auf das Sofa zu legen. Aber das Sofa war zu schmal, und unsere körperlichen Kräfte sind, wie Sie ja gesehen haben, sehr begrenzt, und so sind Sie uns zurück auf den Boden gerollt. Dabei haben Sie sich die Wunde über dem rechten Auge zugezogen. Natürlich haben wir sofort etwas auf die verletzte Stelle gelegt (Eis, eingewickelt in ein Geschirrtuch), aber trotzdem ist Ihre Stirn rasch angeschwollen. Wir hatten, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass Sie derart leicht vom Sofa rutschen würden. Äußerlich sieht man Ihnen gar nicht an, dass selbst in horizontaler Lage der Schwerpunkt Ihres Körpers irgendwo in der Nähe des Bauches liegt. Dabei sind Sie doch so ein zierlicher, ja fast zerbrechlich wirkender Mensch! Wie dem auch sei, wir haben, als wir die Schwellung über Ihrem Auge gesehen haben, sofort beschlossen, Sie aus der Zone und in ein anderes Zimmer zu bringen.
Sie haben mich und meinen Mann nach den Schwierigkeiten gefragt, mit denen wir seit unserer Entscheidung, Robert wieder nach Hause zu holen, zu kämpfen haben – und nun haben Sie diese Schwierigkeiten am eigenen Leib erfahren. Bitte seien Sie versichert, dass uns das sehr, sehr leidtut, aber ich glaube, die Situation hat Ihnen vielleicht auch einen Einblick verschafft, den Ihnen ein Gespräch allein bestimmt nicht vermittelt hätte. Als Lehrer im Institut waren Sie möglicherweise von solchen Erfahrungen abgeschnitten.
Wir haben Sie schnell aus dem Zimmer getragen, da die Schwellung wirklich besorgniserregend ausgesehen hat und Sie außerdem nicht auf unsere Wiederbelebungsversuche reagiert haben. In der Küche ging es damit eindeutig besser. Sie haben die Augen aufgemacht und sich von uns auf einen Stuhl setzen lassen, aber dann sind Sie plötzlich wieder umgekippt und haben zu schwitzen begonnen, und Ihr linker Arm hat gekrampft, aber Gott sei Dank kannten wir das schon, es ist uns ja allen schon so ergangen. Eisberg – so nennen wir es. Dieses Gefühl, als wäre man unter Tonnen von Eis begraben. Da mussten wir alle mal durch. Klar, das sagt sich jetzt relativ leicht, weil wir schon lange damit leben und eine gewisse Resistenz oder zumindest Erwartungshaltung entwickelt haben. Aber auf nüchternen Magen – so wie bei Ihnen – kann einen das natürlich schon umhauen.
Robert lässt Sie übrigens herzlich grüßen. Zumindest lege ich sein Verhalten in diese Richtung aus. Bei ihm weiß man ja nie. Er wird im nächsten Jahr wohl nicht mehr ins Institut zurückgehen.
Wir haben Sie mit unserem Wagen ins Krankenhaus gebracht. Sie waren ein wenig verwirrt, aber auch damit haben wir schon gerechnet, denn mein Vater, zum Beispiel, der uns kurz nach Roberts Geburt besuchte, konnte einen ganzen Tag lang nicht mehr richtig sprechen, er hatte einen schweren Zungenschlag und hat gelallt, und ihm war abwechselnd heiß und kalt, und er hatte Schwindelattacken. Zuerst haben wir befürchtet, er habe vielleicht vor Schreck einen Schlaganfall oder so etwas erlitten, immerhin hatte er darauf bestanden, Robert auf den Arm zu nehmen. Davon gibt es ein Foto, aufgenommen vom Garten aus durchs Fenster.
Alles nur eingebildet, Indigo-Blödsinn, hat mein Vater gesagt. Sie wissen ja, die Leute seiner Generation und die damalige Zeit, der geringe Aufklärungsgrad in der Bevölkerung generell, also ... Okay, wir wollten ja auch glauben, dass das alles nichts ist. Nichts Bleibendes, nichts, was wirklich mit unserem Kind zu tun hat. Nichts Reales.
Kinder nimmt man an der Hand, man berührt sie, hat mein Vater damals gesagt, und ich hab ihm nur meinen Rücken gezeigt, die Schrammen, die ich mir geholt habe vom vielen Hinfallen in dieser Zeit, den Hautausschlag im Nacken, auch die geplatzte Ader in meinem linken Auge hab ich ihm gezeigt. Damals konnte ich mit dem Auge sogar noch etwas sehen und bin dann natürlich erst zum Arzt gegangen, als es schon zu spät war, als die Sehkraft schon futsch war.
Lieber Herr Setz, wir hoffen, dass es Ihnen inzwischen bessergeht. Und wir möchten Ihnen versichern, dass wir keinerlei Vorurteile gegen Sie hegen – was immer auch der Grund für die frühzeitige Beendigung Ihrer Arbeit am Institut gewesen sein mag, wir maßen uns da überhaupt kein Urteil an. Wenn Sie wollen, können wir unser Gespräch anderswo fortsetzen. Selbstverständlich steht unser Haus Ihnen auch weiterhin offen, und wir freuen uns über Ihren Besuch, aber mein Mann und ich hätten auch Verständnis, falls Sie sich dem, womit wir seit nun fast fünfzehn Jahren immer wieder zu tun haben, nicht mehr aussetzen möchten.
Mit den besten Grüßen,
Ihre
Marianne Tätzel
TEIL I
In a fieldI am the absenceof field.
Mark Strand
1 Das Wesen der Ferne
Am 21. Juni 1919 fand im britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow, nahe der schottischen Küste, die Selbstversenkung der Kaiserlichen Deutschen Hochseeflotte statt. Der kurz zuvor von Deutschland unterzeichnete Vertrag von Versailles sah, neben der Rückgabe des Totenschädels des Häuptlings Mkwawa an die britische Regierung, auch vor, dass alle Schiffe unverzüglich übergeben werden sollten, aber der deutsche Admiral Ludwig von Reuter wollte seine Schiffe lieber versenken, als sie den Briten zu überlassen, die er für ein unkultiviertes Volk hielt. Seither liegen die Kriegsschiffe dort auf dem Meeresgrund, in etwa fünfzig Metern Tiefe. Und das ist ein Glück für die moderne Raumfahrt, denn aus den Wracks dieser seit nun fast hundert Jahren unter Wasser liegenden Kriegsschiffe wird auf Tauchgängen hochwertiger Stahl gewonnen, der beim Bau von Satelliten, Geigerzählern oder Ganzkörperscannern in Flughafen-Sicherheitsschleusen verwendet wird. Jeder andere Stahl auf der Welt ist – nach Hiroshima, Tschernobyl und den zahlreichen in der Erdatmosphäre durchgeführten Atombombentests – zu stark verstrahlt, um beim Bau solcher hochsensiblen Geräte verwendet zu werden. Hinreichend sauberen Stahl gibt es nur in Scapa Flow, in fünfzig Metern Tiefe.
Mit dieser Geschichte beginnt das bemerkenswerte, 2004 erschienene Buch Das Wesen der Ferne der Kinderpsychologin und Pädagogin Monika Häusler-Zinnbret. An einem Samstag im Sommer des Jahres 2006 besuchte ich sie in ihrer Wohnung im villenreichen Grazer Bezirk Geidorf. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein halbjähriges Praktikum als Mathematik-Tutor am Helianau-Institut bereits abgebrochen. Der Leiter des Instituts, Dr. Rudolph, hatte mich davor gewarnt, jemals wieder einen Fuß auf das Grundstück zu setzen.
Ich suchte Frau Häusler-Zinnbret auf, um sie zu fragen, unter welchen Bedingungen Indigo-Kinder ihrer Meinung nach heute, zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres einflussreichen Buches, das in seinen Anfangszeilen hoffnungsvolle Töne anschlägt, in Österreich leben. Und ob sie wisse, was es mit den so genannten Relokationen auf sich habe, deren verständnisloser Zeuge ich während meiner Praktikumszeit des Öfteren geworden war.
An der alten Haustür mit den drei Klingelknöpfen war auch ein ornamentaler Türklopfer angebracht, der aussah, als wäre er vielleicht einmal echt gewesen – aber dann, an einem heißen Tag, verschmolz er einfach mit dem dunkelgestrichenen Holz der Tür und wurde zu einer ohrmuschelartigen Zierde oberhalb der schweren, gusseisernen Klinke. In dem kleinen, von einem Messingzaun und einer von vielen Spinnennetzchen vernebelten Hecke umgebenen Gärtchen, das neben dem ungewöhnlich prächtigen Wohnhaus lag, standen ein paar stille Birken, wassergewächshaft und beinahe silbern, und vor einem ebenerdigen Fenster entdeckte ich eine einzelne Sonnenblume, die den Kopf aufmerksam, als hörte sie leise Musik, gereckt hielt, weil sie die Vormittagssonne schon um die nächste Ecke kommen fühlte. Es war ein warmer Tag, kurz vor zehn Uhr morgens. Die Tür stand offen. Im Treppenhaus war es kühl, und ein schwacher Geruch nach feuchtem Stein und alten Kartoffeln lag in der Luft.
Noch vor einem oder zwei Monaten wäre mir das alles nicht aufgefallen.
Bevor ich durchs Treppenhaus hinauf zur Praxis ging, kontrollierte ich meinen Puls. Er war unauffällig.
Frau Häusler-Zinnbret ließ mich lange vor ihrer Tür warten. Ich hatte den Klingelknopf, unter dem ihre beiden Nachnamen standen, verbunden durch ein gewelltes ≈ anstatt durch einen Bindestrich, mehrere Male betätigt und mich, wie schon so oft in meinem Leben, darüber gewundert, dass Psychologinnen und Pädagoginnen immer Doppelnamen haben. Ich hörte sie in ihrer Wohnung herumgehen und Möbel oder andere größere Gegenstände bewegen. Als ich ihre Schritte einmal ganz nahe an der Tür wahrzunehmen meinte, klingelte ich wieder, in der Hoffnung, sie nun endlich auf mich aufmerksam zu machen. Aber wieder entfernten sich die Schritte, und ich stand im Treppenhaus und wusste nicht, ob ich wieder nach Hause gehen sollte.
Ich machte noch einen Versuch und klopfte an.
Eine Tür hinter mir ging auf.
– Herr Setz?
Ich drehte mich um und sah den Kopf einer Frau, der aus einem Türspalt schaute.
– Ja, sagte ich. Frau Häusler?
– Bitte kommen Sie herein. Ich bin gerade in einer … na ja, in einer Umbruchphase, gewissermaßen, entschuldigen Sie die Unordnung … ja …
Beeindruckt und eingeschüchtert von der Tatsache, dass sich ihre Wohnung offenbar über das ganze Stockwerk erstreckte, blieb ich gleich hinter der Eingangstür stehen und wurde erst durch einen Kleiderbügel, den mir Frau Häusler-Zinnbret vor die Brust hielt, daran erinnert, meinen Mantel abzulegen und meine Schuhe auszuziehen.
Frau Häusler-Zinnbrets körperliche Erscheinung war beeindruckend. Sie war sechsundfünfzig, aber ihr Gesicht wirkte jugendlich, sie war schlank und groß, ihr Haar trug sie in einem langen geflochtenen Zopf auf dem Rücken. Bis auf die schwarzen Stiefel war sie an jenem Tag eher leger gekleidet, eine Strickweste hing ihr über die Schultern. Beim Sprechen blickte sie die meiste Zeit über ihre Brille, nur wenn sie etwas las, schob sie sie ein wenig hoch.
Sie führte mich in ihr Arbeitszimmer, eines von dreien, wie sie mir erklärte. Hier empfing sie meist ihre Besucher – aus aller Welt, fügte sie hinzu und betätigte dann einen Schalter an der Wand, der die Jalousien zuerst ein wenig nach unten und dann in die Höhe fahren ließ; ein merkwürdig hypnotischer Vorgang, als würde der Raum in Zeitlupe blinzeln. Die Vormittagssonne kam ins Zimmer. Ein wie Zellophan glänzender Sonnenstrahl kroch über den Boden, knickte an der Wand ein und lief bis zu einem großformatigen abstrakten Gemälde, auf dem runde Formen gegen eckige kämpften.
– Du liebe Zeit, sagte die Kinderpsychologin. Haben Sie sich verletzt?
– Ja, sagte ich. Ein kleiner Unfall. Aber nichts Schlimmes.
– Nichts Schlimmes, wiederholte Frau Häusler-Zinnbret und nickte, als hätte sie diese Ausrede schon oft gehört. Tee? Oder vielleicht einen Kaffee?
– Nur Leitungswasser bitte.
– Leitungswasser?, fragte sie schmunzelnd. Hm …
Sie brachte mir ein Glas, das stark nach Geschirrspülmittel schmeckte, aber trotzdem war ich froh, etwas zu trinken zu bekommen, denn ich war auf dem Fußmarsch von meiner Wohnung in der Nähe des Lendplatzes bis zu Frau Häusler-Zinnbret müde und durstig geworden. Mein Fahrrad war in der Nacht zuvor von einem Unbekannten in alle Einzelteile zerlegt worden. Fein säuberlich waren sie heute Morgen im Garten gelegen, die Räder, der Rahmen, der Lenker, in annähernd dem Quincunx-Muster entsprechender Anordnung.
– Sie recherchieren also für ein Buch, ja?, fragte sie, als wir uns an einen kleinen Glastisch setzten.
Frau Häusler-Zinnbret nahm einen Fächer aus einer Schachtel, die wie eine vergrößerte Zigarettenpackung aussah, und faltete ihn auf. Sie bot auch mir einen an, aber ich lehnte ab.
– Ich weiß noch nicht, was es wird, sagte ich. Mehr ein Artikel.
– Das finstere Leben der I-Kinder, sagte Frau Häusler-Zinnbret und tippte mit einem Zeigefinger ein kleines Soso auf den Tisch.
Ich nickte.
– Und wie kommt das?
– Na ja, sagte ich, das Thema ist, also, es liegt ja sozusagen in der Luft, gewissermaßen …
Die Psychologin machte eine sonderbare Geste, als verscheuche sie eine Fliege vor ihrem Gesicht.
– Sie waren bis vor Kurzem noch am Institut?, fragte sie.
– Ja.
– Wissen Sie, ich kenne Dr. Rudolph, sagte sie und fächelte sich Luft zu.
– Ich verstehe.
Ich wollte schon aufstehen.
– Nein, sagte Frau Häusler-Zinnbret. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin keine von seinen … Bitte, bleiben Sie sitzen. Dr. Rudolph … Ich würde gerne wissen, was für einen Eindruck er auf Sie gemacht hat, Herr Seitz.
Geräusche von Menschen im Treppenhaus, ein Juckreiz an den sich selbst auflösenden Nähten in meiner Kopfhaut, ein locker sitzendes Schuhband …
– Ein schwieriger Mensch, sagte ich schließlich.
– Ein Fanatiker.
– Ja, mag sein.
– Haben Sie dort gewohnt, ich meine, auf dem Gelände? In der Nähe von den …?
– Nein. Ich bin gependelt.
– Gependelt.
– Ja.
– Mhm, machte Frau Häusler-Zinnbret. Ist auch besser, nicht wahr? Wegen …
Eine Pause entstand. Dann sagte sie:
– Wissen Sie, die Nähe zu den I-Kindern, oder wie sagt Dr. Rudolph inzwischen dazu? Hat er überhaupt noch einen Namen dafür?
– Nein, er zieht es vor –
– Ach, dieser verdammte Idiot, sagte Frau Häusler-Zinnbret mit einem Lachen, und dann fügte sie hinzu: Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Ah ja, die Nähe zu den Dingos kann Menschen verändern. Ich meine, nicht nur körperlich … sondern auch ihr Weltbild. Macht er eigentlich immer noch diese … diese Bäder?
Ich war so erstaunt, sie das Wort Dingo verwenden zu hören, dass es dauerte, bis ich antwortete:
– Wer?
– Dr. Rudolph.
– Bäder? Ich weiß nicht.
Frau Häusler-Zinnbret spitzte kurz die Lippen, dann lächelte sie. Der Fächer übernahm für sie die Aufgabe, ungläubig den Kopf zu schütteln.
– Welche Bäder meinen Sie?, fragte ich nach.
– Das Bad in der Menge, sagte sie.
– Ich habe davon nichts mitbekommen.
– Dr. Rudolphs persönliche Kneipp-Kur. Er lässt sich von den kleinen Dingos umringen und erträgt die Symptome. Stundenlang. Er schwört darauf. Das müssen Sie doch gesehen haben …
Ich schüttelte den Kopf.
– Aber dass er ein Fanatiker ist, ist Ihnen aufgefallen?
– Ja, sagte ich. Ich meine, er hat sein Institut nach dem Spiegelprinzip aufgebaut, das heißt, die Lehrer interagieren ebenso wenig direkt miteinander wie die Schüler. Damit sie wissen, wie sich die Schüler fühlen.
– Ich kann mir vorstellen, dass man da ganz schön einsam wird, sagte Frau Häusler-Zinnbret. Aber es fallen einem auch bestimmt ein paar Sachen auf.
War das eine Aufforderung?
– Ja, sagte ich und versuchte, mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen. Man kriegt schon einiges mit, also zum B–
– Ich hab ihn früher wirklich bewundert, unterbrach mich Frau Häusler-Zinnbret. Seine Arbeitsmethoden. Und diese absolute Beherrschung aller Techniken. Er war blitzschnell, wissen Sie. Wirklich blitzschnell. Ein Virtuose. Aber dann war ich einmal mit ihm in einer seiner Wiener Fördergruppen, also hauptsächlich Kinder mit Down-Syndrom und auch ein paar andere Beeinträchtigungen waren dabei … Jedenfalls hat er dieses Spiel mit ihnen gespielt, Reise nach Jerusalem, aber mit gleich vielen Stühlen wie Teilnehmern. Also vollkommen sinnlos. Und er hat irgendeinen Abzählreim aufgesagt, und die äh … die Kinder sind im Kreis gelaufen und dann, bumm!, haben sie sich hingesetzt. Und dann haben sie sich gegenseitig angeschaut, als wollten sie sagen: Und was hat das jetzt für einen Sinn? Aber Dr. Rudolphs Theorie war, dass niemand ausgeschlossen werden darf, erst recht nicht das langsamste Kind. Keine Gewinner, keine Verlierer. Na ja, wie gesagt, ein Fanatiker. Er hat immer gesagt, es gibt keine Happy Ends, nur hin und wieder Fair Ends.
– Fair Ends, sagte ich. Ja, genau. Das hat er oft gesagt.
– Ein Irrer, sagte Frau Häusler-Zinnbret.
Der Fächer in ihrer Hand bewegte sich zustimmend.
– Er hat mir unmissverständlich klargemacht, sagte ich, dass ich im Institut nicht mehr erwünscht bin.
– Aha, sagte sie und ließ eine Pause entstehen.
Ich spürte, wie die Hitze in mein Gesicht stieg. Ich nahm einen Schluck Wasser und wollte den obersten Knopf meines Hemdes lockern. Aber er war bereits offen.
– Um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, sagte Frau Häusler-Zinnbret. Es ist schon eine Weile her, dass ich direkt mit einem Di… mit einem dieser armen Geschöpfe zu tun hatte. Sie sind ja, Gott sei Dank, selten … immer noch relativ selten, ja … Aber das soll nicht heißen, dass ich mich nicht gut erinnern könnte. Allerdings müssen Sie mir schon konkrete Fragen stellen, Herr Seitz, sonst kann ich nichts erzählen.
– Natürlich.
Ich nahm meinen Notizblock aus der Tasche.
Drei Fragen hatte ich notiert. Mehr war mir nicht eingefallen. Gerne würde ich behaupten, dass ich aus Erfahrung wusste, dass man in einem ungezwungenen Gespräch immer viel mehr erfährt als in einem klassischen Interview mit vorbereiteten Fragen – aber ich verfügte über keinerlei Erfahrung.
– Ja, also meine erste Frage wäre … Wann haben Sie das erste Mal mit Indigo-Kindern gearbeitet?
Man sah Frau Häusler-Zinnbret an, dass sie auf diese Frage vorbereitet war. Sie war ihr bestimmt Hunderte Male gestellt worden, und in ihrem Blick lag ein Vorwurf: Das hätten Sie auch in anderen Interviews mit mir nachlesen können, junger Mann. Ich nahm einen Schluck Geschirrspülwasser und setzte meinen Stift auf den Notizblock, bereit, alles mitzuschreiben, was da kommen mochte.
– Na ja, sagte sie, natürlich ab dem Zeitpunkt, als das Problem zum ersten Mal richtig akut geworden ist. Das war so 95 oder Anfang 96, da gab es die ersten Berichte. Da waren Sie ja auch schon auf der Welt, oder? Und wie das bei solchen Dingen immer ist, gab es jede Menge uninformiertes Geschwätz und journalistisches Chaos, das relativ schnell unerträglich wurde, zumindest für mich und einige andere … und da hab ich dann beschlossen, etwas zu unternehmen. Etwas Licht in die Sache zu bringen.
Ich hatte mitgeschrieben. Auf dem Block stand: PROB.AKUT 95/96, DANACH ∃ GESCHWÄTZ.→DAGEGEN WAS UNTERNEHMEN.
– Können Sie das hinterher wirklich lesen? Entschuldigen Sie, dass ich spicke …
An diesem Wort und auch an der einen oder anderen etwas fremd klingenden Silbe hörte man Frau Häusler-Zinnbrets deutsche Herkunft. Sie stammte aus Goslar, wohnte aber schon seit mehr als dreißig Jahren in Österreich.
– Ist meine Geheimschrift, sagte ich. Ich schreibe immer in Blockbuchstaben.
– Tatsächlich? Und warum? Ist die Schreibschrift denn nicht einfacher für schnelles Notieren?
– Nein, für mich nicht. Ich hab mich nie an sie gewöhnen können.
– Interessant.
Ihr Nicken war eindeutig das einer Pädagogin, als hätte sie sich ihr ursprüngliches Nicken wie einen schwerverständlichen Dialekt erst spät im Leben, etwa während des Studiums, abgewöhnt und arbeite seitdem an diesem neuen Nicken. Und ihr Zeigefinger machte wieder: Soso. Bestimmt hatte sie auch schon einen Namen für diese Störung parat, eine besondere Form der Dysgraphie, eine Abneigung gegen die durchgehende Linie, das Kind, das lieber mit Buchstabensuppe spielt als mit Spaghetti …
– Und Sie können das Gespräch anhand dieser Notizen rekonstruieren?
– Ja, das ist wie Instant-Kaffee, man nimmt das Pulver, und dann braucht man nur etwas heißes Wasser hinzuzugeben und …
Ich brach ab, weil der Vergleich misslungen war.
– Äh, Frau Häusler, sagte ich, Sie haben erwähnt, dass das Problem zum ersten Mal damals aufgetreten ist. Wurde es denn so wahrgenommen? Als Problem?
– Na, also … Selbstverständlich, was glauben Sie denn? Die Leute sind reihenweise krank geworden und haben nicht gewusst, woran das liegt. Mütter, die sich über der Wiege ihres Kindes erbrechen. Eine einzige Schweinerei. Schwindel, Durchfall, Hautausschläge, bis hin zur permanenten Schädigung aller inneren Organe, das sind ja ernste Symptome, die auch nicht immer psychosomatisch zu erklären sind. Verständlich, dass da Panik aufkommt, oder?
Ich nickte.
SCHWINDEL, DURCHF., HAUT, SCHÄDIG. ∀ ORGANE.
– Und dann sind erste Stimmen laut geworden: Ja, die Symptome treten immer nur dann auf, wenn ich zu Hause bin, nur in der Nähe der Kinder und so weiter.
Als Frau Häusler-Zinnbret diese Stimmen nachahmte, verwendete sie einen stark übertriebenen österreichischen Tonfall. Ich musste darüber lachen.
– War aber so, genau so, sagte sie. Sie hätten bestimmt nicht gelacht, wenn Sie dabei gewesen wären. Es war gruselig.
– Ja, das kann ich mir vorstellen.
– Und diese Hysterie der Menschen. Wie sie mit ihren Geigerzählern in den Kinderzimmern herumgelaufen sind und die Fußböden herausgerissen haben, und alles, wirklich alles haben sie untersucht, aber da war nichts. Nichts.
– Außer …
– Na ja, diesen letzten Schritt wollte damals natürlich niemand gehen. Man vergisst immer: Als sie der Krankheit einen Namen geben mussten, haben sie sie anfangs nach dem ersten Kind benannt, das nachweislich von ihr befallen war. Beringer-Krankheit … Aber der Name ist ganz schnell wieder aus der medizinischen Literatur verschwunden, er hat nicht einmal das kollektive Bewusstsein erreicht. Dann haben sie es Rochester-Syndrom oder Rochester-Krankheit genannt, diese einfallslosen Feiglinge … aber auch das hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Der Einwand war, dass eine solche Benennung diskriminierend ist, so wie der erste Name von Aids. Wissen Sie, wie Aids in den frühen Achtzigerjahren hieß?
– Nein.
– GRID. Gay Related Immune Deficiency. Kann sich heute natürlich keiner mehr dran erinnern. Werden ganz schnell vergessen, solche Namen. Indigo, der Name hat sich dann komischerweise am Ende etabliert, obwohl er sicher der lächerlichste von allen ist. Total absurd. Aus irgendwelchen Esoterikratgebern entlehnt. Dabei sind die Kinder ja nicht blau, und die Leute, die krank werden, ebenfalls nicht.
Es entstand eine kurze Pause, da ich nicht schnell genug mitschreiben konnte.
– Und wann haben Sie zum ersten Mal mit einem dieser Kinder gearbeitet? Wie hat sich das ergeben?
– Hm. Ich war damals nicht wirklich an solchen familienübergreifenden Problemen interessiert, obwohl das heute vielleicht engstirnig klingt. Aber damals, ich meine, die späten Neunziger, das waren sozusagen die zweiten Siebziger für die Entwicklungspsychologie. Es war eine irre Zeit.
– Aber natürlich, redete Frau Häusler-Zinnbret weiter, natürlich kann man das oft nicht einfach so ausblenden, ich meine dieses ganze Problemfeld, Schule, Elternhaus, Veranlagung, Lernumgebung, Begabung, wie wird ein Kind, das bestimmte Schwierigkeiten in der Schule hat, beispielsweise durch seine persönliche Umgebung eingeengt und so weiter. Jedenfalls habe ich immer deutlicher gemerkt, dass ich diese … Okay, ich gebe Ihnen am besten ein Beispiel, ja? Ich betrete einen Raum, und da brüllt irgendeine Oper in voller Lautstärke aus einer Stereoanlage, schon mal das sehr komisch, und die Familie auch vollkommen hysterisch, in Tränen aufgelöst, und ich sehe das Kind im Gitterbett und, mein Gott, das war vielleicht ein Anblick, dieses vollkommen ratlose kleine Gesicht. Ehrlich und aufrichtig ratlos, dabei erst zwei Jahre alt. Aber bereits mit seinem Latein am Ende, sozusagen.
Ich nickte nur.
– Dabei war diese Zeit noch nicht so hysterisch wie die heutige. Damals durfte man immerhin jemanden, der sich mit der Hand an die Schläfen griff, fragen, ob er Kopfschmerzen hat. Aber heute, päh! Unmöglich. Denn es könnte ja direkt hinter ihm … ach, was für ein Elend …
Sie lachte. Und fügte hinzu:
– Sie wissen genau, was ich meine, oder?
Ich nickte unbestimmt.
– Wie oft haben Sie sich einen solchen Fauxpas geleistet?
– Ein paar Mal.
– Dr. Rudolph, sagte Frau Häusler-Zinnbret kopfschüttelnd. Ich wette, er bringt sogar seinen Hunden bei … ach, egal. Auf Tiere hat es ja auch gar keine Auswirkung, von einigen Ausnahmen abgesehen. Diese Fälle sind Gott sei Dank sehr selten. Und es könnte sich bei ihnen auch um ganz normale statistische Schwankungen handeln. Bei einem Affen aus einer Versuchsanstalt zum Beispiel, der war, warten Sie, ich schaue kurz nach …
Sie stand auf und ging zu ihrem Bücherschrank.
– Ich zeig Ihnen das Bild, murmelte sie.
Als sie es gefunden hatte, hielt sie das aufgeschlagene Buch in meine Richtung. Das Bild zeigte einen Affen in einem Karton. Das Gesicht schmerzverzerrt. Ich wandte mich ab, streckte eine Hand abwehrend aus und sagte:
– Nein danke, lieber nicht.
Sie schaute mich überrascht an. Ihr rechter Schuh machte eine kleine Drehung. Dann hörte ich, wie sie das Buch zuklappte.
– Wie? Sie möchten lieber nicht, dass ich Ihnen das Bild zeige, oder –
– Ja, sagte ich. Ich halte so etwas nicht aus.
– Aber Sie müssen doch wissen, wie das aussieht, wenn Sie sich für diesen Themenkomplex interessieren. Es ist auch gar nicht so schlimm, warten Sie …
Ich hielt mich an der Sitzfläche meines Stuhls fest. Julia hatte mir geraten, bei plötzlicher Angst meine ganze Aufmerksamkeit auf etwas Vergangenes zu richten. Wie immer fiel mir die weiße Freitreppe ein. Wolkenloser Himmel. Die Venus am hellen Tag sichtbar.
– Machen Sie die Augen auf, sagte Frau Häusler-Zinnbret sanft. Es ist alles okay.
– Entschuldigen Sie, sagte ich. Ich reagiere ganz schlecht auf solche Dinge. Tiere und so. Wenn sie … Sie wissen schon. Es ist sozusagen eine Phobie von mir.
Eine kurze Pause. Dann sagte sie:
– Phobie. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, Herr Setz. Sind Sie sicher, dass Sie das Bild von dem Affen nicht sehen wollen? Soll ich es Ihnen vielleicht beschreiben? Die Vorrichtung? Würde das helfen?
– Nein, bitte …
Ich musste mich nach vorne lehnen, um besser Luft zu bekommen.
– Du meine Güte, sagte Frau Häusler-Zinnbret. Nein, dann lasse ich Sie damit natürlich in Ruhe.
– Danke, sagte ich.
Mein Gesicht war heiß, und ich hatte das Gefühl, durch ein Aquarium zu blicken.
– Waren Sie deswegen schon mal in Behandlung?, fragte sie in dem bisher freundlichsten Tonfall, den ich an ihr wahrgenommen hatte. Ich könnte Ihnen jemanden empfehlen, wenn Sie …
– Nein, danke.
– Wirklich? Ich glaube schon, dass Sie sich damit auseinandersetzen sollten. Zum Beispiel Schreibübungen. Versuchen, das zu visualisieren, was einem Angst macht.
– I-in Ihrem Buch, sagte ich. Da vergleichen Sie … also … ganz am Anfang, also … da schreiben Sie, dass die Kinder wie dieser versunkene Stahl in …
Eine etwas längere Pause. Ich machte eine entschuldigende Gebärde.
– Ja, also, sagte Frau Häusler-Zinnbret, da haben Sie vermutlich die alte Ausgabe gelesen. Hab ich mir eigentlich schon gedacht. Macht aber nichts, der Fehler lässt sich leicht beheben.
Sie stand auf und ging zu einem Regal, nahm ein Buch heraus und brachte es mir. Es sah genauso aus wie das, das ich gelesen hatte. Als ich es aufschlug, sah ich, dass das Vorwort durch ein neues, viel kürzeres ersetzt worden war. Dafür gab es jetzt eine Schwarzweißabbildung, die ein Kind in einem Gitterbett zeigte. Das Kind, etwa zwei oder drei Jahre alt, stand aufrecht und hielt sich mit einer Hand an den Holzstäben fest. Es weinte, aber das Gesicht wirkte nicht verzweifelt, eher neugierig und erleichtert, als wäre derjenige, den das Kind lange herbeigesehnt hat, endlich ins Zimmer gekommen.
– Das Bild habe ich aufgenommen, sagte Frau Häusler-Zinnbret. Mit einem Teleobjektiv.
Während sie das Bild näher an mein Gesicht führte, legte sie mir eine Hand auf den Rücken.
Tommy
Tommy Beringer wurde am 28. Februar 1993 in Rochester, Minnesota, geboren. Er war das dritte Kind von Julian Stork, einem Elektrotechniker und Informatiker, und Roberta Beringer, die bei der Geburt von Tommy gerade mal vierundzwanzig Jahre alt war. Ihr erstes Kind hatte sie bereits mit sechzehn bekommen. Das Paar war Ende der Achtzigerjahre von Sharon Springs, Kansas, nach Rochester gezogen, beide stammten aus kinderreichen Familien. Julian hatte sein Studium an der University of Kansas School of Engineering mit Auszeichnung abgeschlossen und fand bald einen relativ gut bezahlten Job, der es Roberta ermöglichte, zu Hause zu bleiben und auf die Kinder aufzupassen.
Kurz nach der Geburt von Tommy wurde Roberta krank. Es begann mit Gleichgewichtsstörungen und tagelang andauernder Übelkeit. Später kamen starker Durchfall und kurzzeitiger Verlust der Orientierung dazu. Da Roberta auch schon nach ihren ersten zwei Geburten gesundheitliche Probleme gehabt hatte, dachte sie sich nicht viel dabei und ging nicht zum Arzt. Aber kurz darauf wurden auch ihre beiden Söhne Paul und Marcus krank. Und sie zeigten ähnliche Symptome.
Ein Arzt vermutete ein Problem mit der Ernährung. Ein anderer meinte, dass es sich bei den Symptomen vielleicht um allergische Reaktionen auf bestimmte beim Bau der Wohnung verwendete Kunststoffe handeln könnte. Als auch Julian an starken Kopfschmerzen und Übelkeit zu leiden begann, beschloss die Familie, umzuziehen. Sie gaben ihre Wohnung auf und bezogen ein kleines Haus, für dessen Kauf sie eine Hypothek aufnehmen mussten.
Die Symptome klangen nicht ab, verstärkten sich sogar. Bald bemerkte Julian, dass es ihm besserging, wenn er in der Arbeit war, und dass seine rasenden Kopfschmerzen immer dann einsetzten, wenn er einige Stunden zu Hause verbracht hatte. Am Wochenende plagten sie ihn den ganzen Tag.
Eine Woche Urlaub auf der Farm von Robertas Eltern in Sharon Springs brachte auch keine nennenswerte Verbesserung. Es musste also doch etwas mit der Ernährung zu tun haben. Eine makrobiotische Diät wurde versucht, auch ein Rohkost-Monat. Am Ende des Monats musste Roberta eines Nachts mit akuter Atemnot ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erholte sie sich relativ schnell von ihren Symptomen. Die Ärzte sagten ihr, dass sie vollkommen gesund sei, wiesen aber darauf hin, dass eine frühe Mutterschaft und die seither konstant hohe Nervenbelastung, die die Versorgung von drei kleinen Kindern für eine junge Frau selbstverständlich mit sich brachte, oft derartige Ermüdungserscheinungen hervorrufen könne. Sie rieten ihr zu einem Kuraufenthalt und zur Einstellung eines Halbtags-Kindermädchens.
– Heißt das, ich bin verrückt?, fragte Roberta die Ärzte.
Sie versicherten ihr, dass alles in Ordnung mit ihr sei. Sie sei sehr müde und übertrage das möglicherweise auch auf ihre Kinder. Es würde ihr und den drei Söhnen bestimmt guttun, eine neue Person im Haushalt zu haben.
Julian gefiel die Idee mit dem Kindermädchen nicht. Er machte sich, berechtigterweise, Sorgen um die finanzielle Situation der Familie. Immerhin hatten sie gerade dieses Haus hier gekauft und waren weit davon entfernt, es als ihr Eigentum betrachten zu können. Die Verpflichtung eines Kindermädchens sei schlicht und einfach undurchführbar, meinte er. Aber natürlich verstand er, dass es so wie bisher auf keinen Fall weitergehen konnte. Jedes Mal, wenn er seine gut ausgeruhte, von allen gesundheitlichen Beeinträchtigungen befreite Frau im Krankenhaus besuchte, wurde ihm der Unterschied bewusst. Sie war voller Energie, spielte mit Paul, der damals bereits acht oder neun Jahre alt war, im Aufenthaltsraum des Krankenhauses Schach und sprach mit lauterer Stimme als gewöhnlich, ja, sie war sogar zu Witzen aufgelegt und schäkerte mit den jungen Ärzten.
Julian litt weiter an starken Kopfschmerzen, aber durch Schmerzmittel ließen sich diese einigermaßen in den Griff bekommen. Und den Kindern ging es inzwischen auch ein wenig besser. Es war Sommer, Paul und Marcus spielten tagsüber viel im Garten des kleinen Hauses, und der ältere Bruder brachte dem jüngeren das Radfahren bei. Doch kurz nachdem Roberta nach Hause zurückgekehrt war, traten die Symptome bei ihr wieder auf. Im Herbst litt die ganze Familie, außer dem kleinen Tommy, an blutigem Durchfall und Hautausschlägen. Um ihn nicht anzustecken, brachten sie ihn für einige Wochen zu seinen Großeltern nach Sharon Springs. Der Durchfall, an dem die ganze Familie litt, besserte sich sofort, auch die anderen Symptome verschwanden, praktisch über Nacht.
Als sie nach einigen Tagen einen Anruf von Robertas Mutter Linda erhielten, die ihnen mitteilte, dass sie den kleinen Tommy wohl doch wieder abholen müssten, erschraken die Eltern. Linda klagte über Brechdurchfall und starke Schwindelattacken, die sie plötzlich überfielen, heute Morgen, sagte sie, sei sie sogar mit einer Tasse heißem Kakao in der Küche ohnmächtig geworden. Was da alles hätte passieren können!
Sie holten Tommy ab. Im Auto wurde Julian schlecht, und er musste rechts ranfahren, um sich zu übergeben. Danach setzten motorische Störungen ein. Er konnte den Zündschlüssel nicht mehr im Schloss drehen.
– Es ist das schlimmste Gefühl auf der Welt, sagte er später. Wenn man für jede kleinste Handlung zu schwach ist, wirklich körperlich zu schwach. Es ist, als ob der eigene Organismus beschlossen hätte, einfach Schluss zu machen, abzusterben.
Und Roberta fasste die kommenden Monate und Jahre folgendermaßen zusammen:
– Man kann sich die Odyssee nicht vorstellen, die wir hinter uns haben. Wenn es nicht um das Wohlergehen unserer Kinder ginge, hätte ich längst aufgegeben, schon vor Jahren.
Das Bild, das alle mit dem Namen Tommy Beringer assoziieren, zeigt ihn als Baby. Sein angewiderter und dabei ungewöhnlich erwachsen wirkender Gesichtsausdruck und der misstrauisch zur Seite geneigte Kopf dürften wohl der Grund für die außerordentliche Popularität der Aufnahme sein, sie scheint sozusagen einen Nerv getroffen zu haben und ziert T-Shirts, Poster, Albumcover und als Schablonenbild Graffitiwände auf der ganzen Welt.
Ebenfalls berühmt geworden ist das Bild der zweigeteilten Kammer. In der Mitte befindet sich eine dicke Bleiwand. Links von ihr sitzt der kleine Tommy Beringer in einer Spielkiste voller bunter Schaumstoffbälle, rechts sitzt die weibliche Versuchsperson, angeschlossen an verschiedene medizinische Geräte, die Hautwiderstand, Herzfrequenz, Gehirnaktivitäten und andere Körperfunktionen messen. Das Bild stammt vom australischen Fotografen David J. Kerr, der es bei einem der zahlreichen Tests aufgenommen hat. Mit einem Teleobjektiv. Denn alle aus nächster Nähe von Tommy geschossenen Bilder waren entweder unscharf oder wirkten, als hätten dem Fotografen heftig die Hände gezittert.
Die Versuchsperson hat keine Ahnung, welches Kind sich auf der anderen Seite der Wand befindet. Es könne ein I-Kind, aber auch ein völlig unauffälliges sein, hat man ihr erklärt. Skepsis gegenüber dem behaupteten Effekt spiegelt sich im Gesicht der jungen Frau wider. Schon nach einer halben Stunde musste das Projekt abgebrochen werden, da sowohl der jungen Frau als auch einem Arzt schlecht geworden war.
Tommy wurde auf eine Isolierstation gebracht, auf der sonst nur Strahlenopfer behandelt wurden. Die ganze Station war leer, Tommy weinte oft und wurde von einer Krankenschwester betreut, die zu jeder vollen Stunde für nicht mehr als fünf Minuten zu ihm ging, ihn fütterte und reinigte und die Spielsachen, die er auf den Boden geworfen hatte, zurück zu ihm ins Gitterbett legte.
Im Jahr 1999, als Tommy sechs Jahre alt war, wanderte die Familie, überfordert von der Aussicht weiterer Tests und Interviewanfragen, nach Kanada aus. Julian trennte sich 2002 von seiner Frau und wohnt inzwischen wieder in Rochester. Er spricht nicht gerne über die Vergangenheit. Roberta Beringer und ihre drei Söhne wurden 2004 kanadische Staatsbürger. Sie leben sehr zurückgezogen, nehmen an der weltweiten Debatte um das Indigo-Phänomen nicht teil. Jeder Versuch, Tommy Beringer ausfindig zu machen, wird von der Mutter konsequent abgeblockt. Er ist in keinem Schulregister des Landes gemeldet, und eine Webseite mit seinem Namen, auf der hin und wieder Fotos eines Teenagers auf einem Fahrrad und kurze, pathetische Texte über das Weltall und die Einsamkeit gepostet wurden, stellte sich als Scherz zweier College-Studenten aus Kalifornien heraus.*
* Die britische Band The Resurrection of Laura Palmer benannte ihr zweites Studioalbum, The Beringer Tree, nach dem Jungen.
2 Robert Tätzel, 29, ausgebr.
Man brachte ihm den Affen in einer Holzkiste. Die Kiste sah überhaupt nicht nach Labor oder Wissenschaft aus, sie war dunkel und wies einige hellere Flecken und Abwetzspuren auf. Es war schwer zu sagen, was normalerweise darin aufbewahrt wurde.
Robert hatte die Staffelei fertig aufgestellt, die Farbtupfer auf der Palette (er bevorzugte eine kleinere, da zu viel Auswahl ihn lähmte) sahen aus wie ein von einem Planungskomitee entworfener Regenbogen. Alle Pinsel waren neu, vor fünf Minuten hatte er sie aus der Hülle genommen. Er liebte den Geruch jungfräulicher Pinsel.
Das Bild, das er malen würde, war von eher kleinem Format. Dünnflüssige Farben auf dick aufgetragenem Untergrund. A thin paint will stick to a thick paint, hatte Bob Ross (die andere tiefe Stimme neben Adam West, die direkt mit Gott in Verbindung stand) auf der Lern-iVD gesagt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!