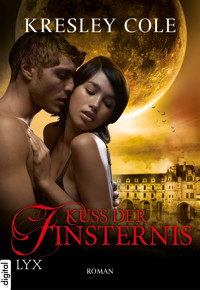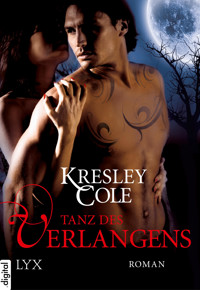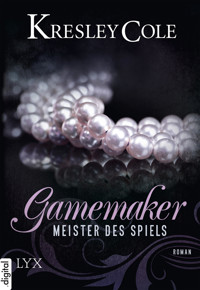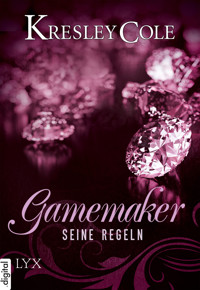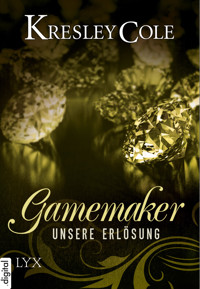9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sutherland Brothers
- Sprache: Deutsch
SINNLICH, LEIDENSCHAFTLICH, TROPISCH HEISS!
Seit einem Schiffbruch inmitten der Südsee gilt Victoria Dearborne als verschollen. Captain Grant Sutherland wurde ausgesandt, die junge Frau zu suchen und zurück nach England zu bringen. Doch die Rettungsaktion läuft ganz anders als gedacht: Auf der kleinen Pazifikinsel ist aus Victoria ein ungezähmter Wildfang geworden - und das bringt Grant in arge Bedrängnis. Denn Toris ungebändigter Geist weckt in dem kühlen und beherrschten Gentleman eine Sehnsucht, der sich Grant kaum zu erwehren weiß ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungZitateProlog123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536DanksagungDie AutorinDie Romane von Kresley Cole bei LYXImpressumKRESLEY COLE
DIE BRAUT DES MEERES
Roman
Ins Deutsche übertragen von Barbara Först
Zu diesem Buch
Ozeanien, 1858. Zusammen mit ihren Eltern, einem Forscher-Ehepaar, bereiste Victoria Dearborne die Welt, bis eines Tages das Schicksal unbarmherzig zuschlägt: Inmitten der Südsee bringt ein tropischer Sturm ihr Schiff zum Sinken. Einzig Victoria und ihr Kindermädchen überleben – und enden in einem Paradies, das zu ihrem Gefängnis wird. Die beiden Frauen müssen sich auf einer einsamen Pazifikinsel behaupten: Gegen die Unbill der Naturgewalten, gegen riesige Schlangen und gegen fremde Matrosen, die Rettung versprachen, aber nur Schlechtigkeiten im Sinn hatten. Da macht neuerlich ein Schiff an den Ufern des Eilands Halt, und Victorias Misstrauen ist schnell geweckt. Als zu allem Überfluss ein Hüne mit wilden Augen hinter ihr herjagt, scheint sich ihr Verdacht zu bestätigen. Was Victoria allerdings nicht weiß: Captain Grant Sutherland ist auf der Suche nach ihr, um sie zurück nach England – zu ihrem Großvater, dem Earl of Belmont – zu bringen. Doch die Rettungsaktion erweist sich als schwieriger als gedacht – denn so leicht lässt sich die attraktive Wildkatze nicht fangen! Grant hat alle Hände voll zu tun, die junge Frau von der Lauterkeit seines Unterfangens zu überzeugen, während sie ihm jedes Mal mit Charme und Eigensinn die Stirn bietet. Victorias ungezähmter Geist und ihre wilde Leichtigkeit rühren etwas in dem kühlen und beherrschten Mann, das er lang vergessen glaubte. Obwohl Grant sich schon vor langer Zeit schwor, nie wieder einer Frau sein Herz zu öffnen, weckt doch Victoria in ihm eine Sehnsucht, der er unter den Sternen des Südens nur schwer widerstehen kann …
Für Mom – Dad –
Dad, der mir Mut zum Schreiben machte,
und Mom, die es mir zeigte
Jeder Mensch hat seinen verborgenen Kummer, den die anderen nicht kennen, und oft nennen wir einen Menschen kühl, dabei ist er nichts anderes als niedergeschlagen.
Henry Wadsworth Longfellow
In der Natur gibt es weder Belohnungen noch Strafen. Es gibt Folgen.
Robert Green Ingersoll
Prolog
Tagebuch von Victoria Anne Dearbourne, 1850
17. Januar
Heute ist der dritte Tag. Mutter, Miss Scott und ich haben den Schiffbruch der Serendipity überlebt und sind in einem lecken Rettungsboot zu einer einsamen Insel irgendwo in Südozeanien getrieben worden.
Da die Windstille seit Wochen andauert, werden wir den Taifunen, die um diese Jahreszeit vorherrschen, schutzlos ausgesetzt sein. Mutter hat gesagt, es sei, als wäre man gefesselt, um auf den Sturm zu warten.
Als die Planken zu bersten anfingen, stürzten die Matrosen von Bord – wie die sprichwörtlichen Ratten verließen sie das sinkende Schiff – und ließen uns im Stich. Einer stieß sogar mit Mutter zusammen und kümmerte sich nicht darum, dass sie vom Deck hinab ins Rettungsboot stürzte. Sie hat sich den Rücken ausgerenkt und einen Arm gebrochen. Aber sie ist stark, und ich bin überzeugt, dass sie wieder gesund werden kann, wenn wir nur Hilfe finden.
Von Vater fehlt noch immer jede Spur. Ich sah nach oben durch Regen und Gischt und entdeckte ihn an Deck mit einem Kind in den Armen. Und beim nächsten grellen Blitzschlag war das Schiffsdeck verschwunden.
Ist es unrecht von mir, zu wünschen, er hätte das schreiende Kind unter Deck gelassen und wäre selbst entkommen? Die niederträchtige Besatzung hat es jedenfalls geschafft. Es spielt auch keine Rolle, was ich mir wünsche – denn ich weiß, dass Vater niemanden im Stich gelassen hätte.
An diesem Morgen haben wir wie durch ein Wunder vom Meer etwas zu essen bekommen. Mutter flüsterte mir zu, dass es die Hand des Schicksals sei, die uns dieses Geschenk machte. Miss Scott aber sagt, es liege nur an einer rückläufigen Strömung – derselben Strömung, die uns auf diese Insel geschwemmt habe (Mutter findet, dass Camellia Scott für ihr Alter von Anfang zwanzig sehr klug ist, und daher weiß ich nicht, welcher von beiden ich nun glauben soll).
Miss Scott und ich haben mehrere Seekisten, ein Fass mit kostbarem Wasser, ein Paddel und viele andere Güter an Land gezogen. Unter den Seekisten fanden wir auch die Truhe des Kapitäns mit einem leeren Logbuch, einem Tintenfässchen und einer Feder. Miss Scott hat mich gebeten, über unsere Zeit auf der Insel ein Tagebuch zu führen.
Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, dass ich nicht das Unglück sehen würde, das uns befallen hat, wenn ich solcherart beschäftigt bin. Doch das habe ich, und wenn ich mich auch unaufhörlich um Mutter kümmere oder schreibe, habe ich die beiden Leichname gesehen, die gleichzeitig mit unserer Beute angetrieben wurden. Das Meer hatte ihnen schreckliche, ganz schreckliche Dinge angetan.
Ich weiß, dass Miss Scott die Toten an den Rand des Dschungels gezerrt und dort begraben hat, weil ich die Spuren im Sand gesehen habe und ihre Hände später mit Blasen vom Graben mit dem Paddel bedeckt waren. Miss Scott ist noch nicht sehr lange bei uns, und ich weiß, dass sie uns vieles ersparen möchte. Aber ich hoffe doch, dass sie mir sagen würde, wenn einer der Verstorbenen Vater gewesen wäre.
18. Januar
Gestern Abend hat Mutter zum ersten Mal geweint. Sie hat sich mit aller Macht gegen die Tränen gewehrt, doch ihre Schmerzen waren zu stark. Es fing an zu regnen, und der Wind wehte in Böen. Wir fingen den Regen in großen Blättern auf. Miss Scott hatte ein paar Feuersteine im Rettungsboot gefunden und versuchte vergeblich, Feuer zu machen. Es war hoffnungslos, aber ich glaube, dadurch konnte sie sich von unserer Lage ablenken. Als sie schließlich aufgab und sofort in den Schlaf sank, waren ihre Hände ganz zerkratzt und aufgesprungen.
Mutter hat gesagt, ich müsse Miss Scott helfen, wo ich nur kann, weil sie »für eine so große Verantwortung zu jung« sei.
19. Januar
Ich sehe nun, wie viel ich bereits geschrieben habe, und mache mir Sorgen, dass ein Buch nicht reichen wird, aber Miss Scott hat prophezeit, dass wir ganz sicher gerettet werden, bevor mir das Papier ausgeht.
Später am Tag fand sie in einer der Seekisten eine Karte und versuchte, unsere Position zu bestimmen. Mich schickte sie Holz sammeln, obwohl wir gar kein Feuer haben. Als ich zurückkam, schienen Mutter und Miss Scott sich damit abgefunden zu haben, dass wir für unbestimmte Zeit auf der Insel bleiben müssen. Wir sind wohl sehr weit von der Zivilisation entfernt. Obwohl Miss Scott und ich sie anflehen, lehnt Mutter es ab, ihren Anteil von unserem kleinen Wasservorrat zu nehmen.
20. Januar
Gestern Nacht habe ich von Vater geträumt. Ich habe geträumt, wie er mit uns gelacht hat und wie geduldig er mir beigebracht hat, zu angeln oder Knoten zu knüpfen. Vater hat ein wunderbares, ein herzhaftes Lachen, weil er so eine breite Brust hat, und er braucht nicht viel Grund, um zu lachen. Er liebt Mutter so sehr, dass man meint, er müsse vor lauter Liebe platzen, wenn er in ihrer Nähe ist. In jedem neuen Land, das wir erforschten, suchten die beiden nach unbekannten Kreaturen, nach kleinen Tieren, die noch kein Mensch zuvor gesehen hatte. Er hat immer darüber gestaunt, wie exakt Mutter sie zeichnen konnte, obwohl sie doch schon so viele Zeichnungen für die Artikel angefertigt hatte, die sie gemeinsam verfassten. Dann legte er ihre Zeichnung hin und schwenkte Mutter im Kreis herum, klemmte mich unter den Arm und verkündete, wir drei seien die beste Mannschaft, zumindest auf dieser Erdhalbkugel. Und später ist dann Miss Scott zu uns gekommen, um mir gutes Benehmen und Rechnen beizubringen und Mutters gute Gefährtin zu werden. Alles schien so vollkommen.
Zum Glück war ich vor Mutter und Miss Scott aufgestanden, denn beim Aufwachen weinte ich bitterlich. Ich habe meine Augen getrocknet, doch den ganzen Tag war mir zum Weinen zumute, jedes Mal, wenn ich an Vater dachte. Meine Lippen zitterten, und mein Gesicht wurde heiß, genau wie bei den kleinen Kindern, mit denen ich auf dem Schiff gespielt habe.
Miss Scott und Mutter mahnen mich jeden Tag, ich solle tapfer sein, doch heute haben sie es mit ganz besonderem Nachdruck gesagt. Trotzdem ist Mutter am Nachmittag aufgewacht und hat mich dabei ertappt, wie ich den Kopf in den Händen barg und heulte wie ein Baby – und dabei bin ich schon dreizehn!
Ich habe ihr gesagt, ich wüsste nicht, ob ich stark genug wäre, um alles zu tun, was auf dieser Insel getan werden muss. Wir müssen eine Schutzhütte bauen. Ich versuche auch, mich an alles zu erinnern, was ich auf unseren Reisen gelernt habe, aber Mama und Papa haben immer die schwere Arbeit gemacht, während ich mit Kindern spielte, die ich zufällig kennengelernt hatte.
Mutter meint, ich sei in der Tat stark genug, um hier zu überleben. Sie hat gesagt: »Denke daran, Tori, Diamanten werden nur unter großem Druck geboren.«
21. Januar
Die tiefen Schnitte an Miss Scotts Händen wollen nicht heilen. Finger und Handflächen sind so angeschwollen, dass sie die Hände nicht schließen kann. Ich weiß, wie gefährlich solche Wunden in diesem heißen Klima sind. Dass ich noch mehr Angst haben könnte, hätte ich nicht gedacht. Es gibt immer noch keinen Hinweis auf Vaters Verbleib, aber ich muss und will glauben, dass er überlebt hat und genau jetzt am Bug eines prächtigen Schiffes steht (größer als die grässliche Serendipity) und nach uns sucht.
22. Januar
Ich träume immer von Essen und Wasser, weil wir nur noch so wenig haben. Deshalb denke ich an Mittel und Wege, wie wir an frische Vorräte kommen könnten. Miss Scott will das Innere der Insel erkunden und nach einer Quelle oder Früchten suchen, doch sie hat Angst, uns am Strand allein zu lassen oder mich in den düsteren Dschungel mitzunehmen. Die nächtlichen Geräusche lassen darauf schließen, dass dort viele Kreaturen hausen, denen wir vielleicht lieber nicht begegnen möchten.
Heute Nachtmittag bat Mutter mich, mich zu ihr zu setzen. Sehr ernst sagte sie mir, dass Vater vielleicht nicht überlebt hat. Das war für mich wie ein Schlag vor die Brust. Denn bevor sie es aussprach, war es nicht Wirklichkeit gewesen. Als ich mich ausgeweint hatte, sah sie mir tief in die Augen und sagte, mein Großvater würde uns finden, er würde auf keinen Fall aufgeben. »Er wird nie aufhören, uns zu suchen, und uns heimbringen, Tori«, erklärte sie. Doch ich weiß, dass er für eine so weite Reise zu alt ist. Mutter aber schwor, er werde jemanden finden, der uns an seiner Stelle suchen würde.
22. Januar, Nachmittag
Wir haben beschlossen, dass ich mit Miss Scott gehen soll. Je hungriger ich werde, desto weniger macht mir der Dschungel Angst. Aber ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, dass irgendetwas passieren wird. Ich weiß es genau, denn mein Nacken fühlt sich an, als wäre er voller Ameisen. Bald wird etwas ganz Schlimmes geschehen.
Fast könnte ich über diese Worte lachen. Bald wird etwas Schlimmes geschehen. Wie viel schlimmer könnte unsere Lage denn noch werden?
Etwas früher an diesem Nachmittag blickte ich hinüber zu Mutter und sah, wie sie eindringlich auf Miss Scott einredete. Meine Mutter, die immer so auf die Gefühle anderer achtet, merkte dabei gar nicht, wie sie Miss Scotts verletzte Hände presste. Und Miss Scott zuckte vor Schmerz zusammen, sagte aber nichts.
Soll ich nicht nur Vater, sondern auch noch Mutter verlieren?
Manchmal habe ich das Gefühl, als würden alle meine Ängste und meine Trauer nur von einem dünnen Seidenfaden im Zaum gehalten. Und manchmal gerate ich in Versuchung, das Gewebe zu zerreißen, mir die Haare zu zerraufen und so lange und laut zu schreien, bis ich zum Fürchten aussehe. Damit die Dinge, vor denen ich Angst habe, stattdessen vor mir Angst bekommen.
Wenn der Tag anbricht, werden wir in den Dschungel gehen.
1
Ozeanien, 1858
Die kurze Überfahrt der Keveral zu der unergründlichen Insel erinnerte Captain Grant Sutherland an die Unbilden der ganzen verdammten Reise. Dooley, sein Erster Maat, legte sich in die Riemen, während sein nimmermüder Blick selbst in dem kleinen Ruderboot nicht zur Ruhe kam, falls da unvermutet eine Krise auftauchen sollte, die es zu bewältigen galt. Da war Grants Mannschaft – auf der Hut vor ihrem Kapitän und stets seinem Befehl gehorsam, weil alle Angst vor ihm hatten. Sein Cousin Ian Traywick, der nach Schnaps stank und der nach all den Meilen und Inseln, die sie abgesucht hatten, immer noch optimistisch war, dass ihre Bemühungen letztlich von Erfolg gekrönt sein würden.
»Ich hab ein gutes Gefühl bei dieser Insel.« Ian schlug Grant auf die Schulter, dann fuhr er sich mit der Hand über den Stoppelbart, in dem Versuch, die Einkerbungen der groben Leinenbetttücher zu glätten, denn er war erst im letzten Augenblick aus den Federn gekrochen. Während der ganzen Reise hatte Ian für »Unbeschwertheit an Bord« gesorgt, wie er das nannte, um die Besatzung, die von »einem ausgesucht kalten Bastard« kommandiert wurde, in bessere Laune zu versetzen. »Hör auf meine gelallten Worte, das muss sie sein. Auch wenn du’s partout nicht glauben willst – sie ist’s.«
Grant warf seinem Cousin lediglich einen finsteren Blick zu. Die Vernunft gebot, dass er endlich sein Scheitern eingestand, denn diese Insel war das Ende ihrer ausgiebigen Suche und die letzte im Solais-Archipel. Nachdem sie vier Monate gebraucht hatten, um überhaupt den Pazifik zu erreichen, hatten sie drei weitere damit verbracht, vergebens jedes Eiland nach den Dearbournes zu durchkämmen, die vor acht Jahren auf See verschollen waren.
»Un’ wenn wir sie heute finden«, setzte Dooley hinzu und klatschte vor Begeisterung in die schwieligen Hände, »dann können wir abhauen und den Taifunen ’n Schnippchen schlagen.« Der alte Seebär war ebenso gutmütig wie befähigt und würde seinen Kapitän niemals offen tadeln. Grant wusste aber ohnehin zu gut, dass er die Mannschaft viel zu lange in diesen Breiten festgehalten hatte – kurz vor der drohenden Sturmsaison.
Sowohl Dooley als auch Ian hofften immer noch darauf, die Dearbournes zu finden. Grant seinerseits hielt Hoffnung zu diesem Zeitpunkt für eine Illusion.
Und ein Grant Sutherland gab sich niemals Illusionen hin.
Während das Boot näher an die Insel heranglitt und ein Geruch nach feuchter Erde und Seetang den brackigen Gestank der See zu überlagern begann, hegte Grant trübe Gedanken, sodass er kaum den dicht belaubten Inselberg oder die smaragdgrüne Bucht zwischen den Riffen sah. Unzählige Male waren sie schon auf diese Weise auf eine Insel zugerudert, und jede hatte wie ein Paradies gewirkt.
»Cap’n, was halten Sie vom Nordende der Bucht?«, fragte Dooley und deutete auf einen Strand, der von Felsvorsprüngen eingeschlossen war.
Grant musterte den salzweißen Strand. Als er eine Durchfahrt zwischen den Riffen erspähte, winkte er zum Zeichen seiner Zustimmung.
Während des langwierigen Herantastens zwischen unterseeischen Felsen und des Abwartens nach jedem Riemenschlag spähte Grant in das kristallklare Wasser hinab. Ein gewaltiger Bullenhai auf Beutesuche schwamm genau unter ihnen. Kaum überraschend – Haie gab es in diesen Gewässern zu Tausenden. Grant hoffte nur, dass die Familie Dearbourne keinem dieser Ungeheuer zum Opfer gefallen war.
Vielleicht hatten sie es geschafft, eines dieser Eilande zu betreten, nur um an Unterkühlung zu sterben. Das war kaum besser. Grant wusste, dass Unterkühlung das Leben nahm wie eine Katze, die mit einem gefangenen Vogel spielt; sie lässt immer noch ein wenig Hoffnung zu, bis es zum Schluss keine mehr gibt. Dennoch setzten beide Szenarien voraus, dass es der jungen Familie überhaupt gelungen war, sich von dem sinkenden Schiff zu retten. Viel wahrscheinlicher war, dass sie, an die Kabinenwände gepresst, hilflos hatten mit ansehen müssen, wie das Wasser unaufhaltsam stieg und ihnen schließlich das Lebenslicht auslöschte.
Als letzte von acht Suchmannschaften hatten Grant und seine Männer die Aufgabe, die Dearbournes entweder zu finden oder aber ihren Tod zu melden. Er fürchtete schon den unausweichlichen Tag, an dem er die Nachricht überbringen musste …
»Cap’n?«, rief Dooley mit erstickter Stimme.
Grant hob ruckartig den Kopf. »Was gibt’s?« Vor seinen Augen lief Dooleys zerfurchtes Gesicht krebsrot an.
»Sie wer’n … Sie wer’ns einfach nich’ glauben. Da drüben! Süd-Südwest.«
Grant richtete den Blick auf den Punkt, auf den das Fernglas des Mannes zeigte. Und sprang so ungestüm auf die Beine, dass mehrere Hände an die Bordwände klatschten, um das schaukelnde Boot im Gleichgewicht zu halten. Er war sprachlos.
Endlich brachte er heraus: »Ich … will … verdammt sein.«
Eine Frau rannte so schnell den Strand entlang, dass sie über dem Sand zu schweben schien.
»Ist das die Tochter?«, wollte Ian wissen und stand gleichfalls auf. Von hinten legte er Grant die Hand auf die Schulter und zerquetschte sie fast. »Sag bloß nicht, das ist sie!«
Grant schüttelte die Hand ab. »Ich … kann es nicht mit Sicherheit sagen.« Er wandte sich an die Ruderer. »Legt euch in die Riemen, Männer! Los doch!«
Er wollte schon den kleineren Matrosen vom Steuerbordriemen wegdrängen und selbst übernehmen, als er etwas Unglaubliches erblickte: Helle Haare quollen unter dem breitkrempigen Hut der Frau hervor und fielen über ihren Rücken. Haar, so blond, dass es fast weiß erschien, genau wie das Haar des kleinen Mädchens auf der Daguerreotypie, die er von Victoria Dearbournes Großvater bekommen hatte.
Je näher sie kamen, desto sicherer war sich Grant. Inzwischen konnte er sie besser erkennen: lange, wirbelnde Beine und ein schlanker Arm, der den Hut auf dem Kopf festhielt. Eine schmale, nackte Taille. Grant sah es mit Missfallen. Ganz eindeutig nackt.
Victoria Dearbourne. Wer sonst? Grant konnte es kaum fassen, dass er sie schließlich doch gefunden hatte. Bei Gott, er würde sie nach England zurückbringen, heil und lebendig!
Sie ritten auf den Wogen näher zum Strand und wurden erst jetzt von der jungen Frau entdeckt. Sie stoppte so abrupt, dass unter ihren Füßen Sand aufwirbelte und vom Wind fortgeweht wurde. Ihr Arm sank herab, und ihr Hut wehte davon. Dabei kreiselte er im Wind.
Sie waren jetzt so nah herangekommen, dass Grant erkennen konnte, wie bestürzt, ja fassungslos sie war. Ihm selbst erging es ähnlich. Der Wind zerzauste ihr Haar, das sich um die Ohren lockte und um den Hals lag wie ein Kragen. Seine Gedanken rasten. Victoria Dearbourne war ein hübsches Kind gewesen, aber jetzt …
Außergewöhnlich. Unglaublich lebendig.
Sie wich vor ihnen zurück.
»Bleib da, Mädchen!«, schrie Ian. »Bleib, wo du bist!«
Sie aber stolperte weiter zurück – floh vor ihnen – und stürzte Grant damit in eine Verzweiflung, die er noch nie empfunden hatte. »Bei dem Wellengang kann sie dich doch nicht hören!«, fauchte er.
Und dann sah er etwas, das sich auf ewig in sein Gedächtnis brennen würde. In einer einzigen fließenden Bewegung drehte Victoria Dearbourne sich um und lief los. Noch nie hatte er eine Frau so laufen sehen.
Sie rannte … wie der Teufel.
Und dann war sie verschwunden, vom Dschungel verschluckt.
»Mein Gott!«, rief Ian. »Sag, dass ich das nicht gesehen hab!«
Grant wollte ihm antworten, fand jedoch keine Worte. Nachdem seine Männer ihrer Enttäuschung mit ein paar gemurmelten Flüchen Luft gemacht hatten, sahen sie erwartungsvoll zu ihm auf.
Ohne den Blick von der Stelle zu lösen, an der die junge Frau verschwunden war, verkündete Grant: »Ich gehe und hole Victoria.« Er sprang aus dem Boot und pflügte durch die Wellen. Als er den Strand erreichte, lief er schneller, ließ sich von der abweisenden Wand aus Bäumen und Lianen nicht beirren. Er brach durch die Stelle, wo Victoria verschwunden war, und folgte einem ausgetretenen Pfad. Immer wieder sah er sie in einiger Entfernung vor sich laufen, konnte sie aber nicht einholen.
Doch plötzlich erblickte er sie genau vor sich. Sie war stehen geblieben und hielt etwas an ihrer Seite, die Augen vor Konzentration zusammengekniffen. Als Grant sich von seinem Schreck erholt hatte, holte er rasselnd Luft. »Ich bin … Captain … Gr…« Die feinen Muskeln ihrer Arme spannten sich, Grant hörte ein Zischen. Ein Ast traf ihn voll vor die Brust und schleuderte ihn zu Boden. Er heulte vor Schmerz auf und mühte sich, blind vor rasender Wut, wieder auf die Beine. Während er dem Pfad folgte, krümmte er sich, bis der Schmerz endlich nachließ. Das Einzige, was er hören konnte, waren sein klopfendes Herz und seine keuchenden Atemzüge.
Als trüge er Scheuklappen, raste Grant durch den Dschungel. Er sah nicht nach links oder rechts, sondern allein auf Victoria, die er als undeutliche Silhouette vor sich ausmachen konnte, während er langsam aufholte. Als er eben nahe genug herangekommen war, um sich auf sie zu stürzen, legte sie die Hände an einen Baumstamm und schwang sich im Halbkreis darum. Nun standen sie zu beiden Seiten des gewaltigen Stammes. Grant rannte nach rechts, Victoria ebenfalls. Er wechselte die Richtung. Sie auch. Dann täuschte sie rechts an, wandte sich aber nach links und flitzte an ihm vorbei. Im letzten Moment streckte er die Hand aus und packte sie.
Hab ich dich! Am liebsten hätte Grant seinen Triumph laut hinausgebrüllt.
Bis er ungläubig den Stofffetzen in seiner Faust anstarrte, der dort blieb, während sie sich nicht aufhalten ließ. Das Geräusch von reißendem Stoff und Victorias Fluchen verschmolzen mit seinen schweren Atemzügen. Grant sah fassungslos zu, wie der mürbe Stoff in einem Streifen von ihrem Schenkel bis zur Taille aufriss. Wieder war sie ihm entkommen. Verdammt noch mal. Verdammt, verdammt, verdammt!
Jetzt kochte er vor Wut. Er rannte unter Aufbietung aller Kräfte hinter der Flüchtenden her. Fang sie ein! Erkläre ihr, wer du bist! Bring sie aufs Schiff! Fang sie doch endlich, verdammt! Als er tiefer in den Dschungel eindrang, wurde die Luft feucht und neblig. Schlüpfrig-schleimige Blätter klatschten gegen seine Brust.
Ein Wasserfall von geradezu mythischen Ausmaßen tat sich vor ihm auf; donnernd ergossen sich die Fluten auf schwarze Felsen. Aus dem Augenwinkel erspähte er Victorias Gestalt in weißer Wäsche inmitten des Grüns.
Inmitten des Grüns auf der anderen Seite des reißenden Flusses.
»Victoria!«, brüllte er. Erstaunlicherweise schien sie ihren Lauf zu verlangsamen. »Ich bin gekommen, um Sie zu retten!«
Sie drehte sich um und marschierte auf eine Lichtung, formte mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und schrie ihm etwas zu. Doch das Wasser erstickte ihre Worte. »Verdammter Mist!« Also konnte sie auch nicht verstanden haben, was er gesagt hatte.
Da Grant keine andere Lösung einfiel, sprang er in den Fluss und pflügte durch die starke Strömung. Er schluckte Wasser, geriet außer Atem, krabbelte am anderen Ufer mühsam hinaus und stolperte weiter. Victoria war nicht weit voraus, doch obwohl er erneut in den Laufschritt verfiel, war ihm klar, dass er sie nicht einholen konnte. Dann jedoch sah Grant seine Chance.
Victoria folgte einem Pfad – er aber konnte durch das Dickicht abkürzen und ihr den Weg abschneiden. Grant schwenkte nach links, prallte gegen eine Palme, doch er hatte schon ein Stück aufgeholt.
Im nächsten Augenblick sah er seine Füße – über seinem Kopf! Und schon folgte die erste unsanfte Berührung mit dem Erdboden, denn er befand sich im freien Fall, stürzte in eine Schlucht.
Noch während des Sturzes wusste Grant, dass sie ihn absichtlich diesen Pfad entlanggeführt hatte. Wenn er sie in die Finger bekam, konnte sie sich auf etwas gefasst machen … Er stürzte die letzten paar Meter und landete so hart auf dem Rücken, dass der Aufprall sämtliche Luft aus seiner Lunge presste.
Bevor Grant wieder klar sehen konnte, stand sie schon über ihm und stupste seine Hüften mit einem Stock an. Die Sonne schien durch das Blätterdach und zauberte eine goldene Aureole um ihr Haar. Sie legte den Kopf schief. »Warum sind Sie hinter mir hergelaufen?«
Grant rang nach Luft, suchte nach Worten, brachte aber nur pfeifende Geräusche zustande. Er sah, wie sie ihre hellen Augenbrauen zusammenzog und ein weiteres Mal »Warum?« fragte, dann aber hörten sie seine Männer, die sich krachend durch den Dschungel schlugen. Victoria schaute ihn noch einmal an, maß ihn langsam und gründlich mit ihren Blicken, dann beugte sie sich zu ihm herab. »Wenn Sie das noch einmal versuchen, Seemann, dann stürze ich Sie von den Klippen.«
Damit wandte sie sich zum Gehen. Grant wälzte sich auf den Bauch und sog begierig die Luft und die Feuchtigkeit der Pflanzen ein, die ihn umgaben. Hustend streckte er eine Hand aus – ein letzter schwacher Versuch, sie aufzuhalten.
Doch sie sah sich nicht nach ihm um. Ein Iguana huschte ihr in den Weg, zischte sie an und wechselte angriffslustig die Farbe. Victoria zischte zurück und verschwand hinter der schwarz-grünen Mauer des Unterholzes.
Obwohl sie es ungern zugab, schmerzte Tori Dearbournes Herz vor Angst, als sie mit hoch erhobenen Armen durch das dichte Laub stürmte. Sie hörte die Matrosen hinter sich, hörte ihr Johlen und Lachen, während sie durchs Unterholz brachen. Tori überlief ein eisiger Schauder. Genau wie der letzte Trupp, der hier gelandet war.
Nein, so ganz stimmte es nicht, denn jene Männer hatten sich immerhin wie Freunde, sogar wie Retter benommen, bevor sie schließlich ihr wahres Gesicht gezeigt hatten. Aber dieser gewaltige Hüne mit den wilden Augen hatte ja nicht einmal gewartet, bis das Boot den Strand erreicht hatte. Er war wie ein Löwe hinter ihr her gejagt und hatte zu allem Überfluss ihre Kleider zerrissen!
Die Angst brachte große Sorge mit sich. Eine Sorge, die sie sich einfach nicht leisten konnte, gegen die sie inzwischen immun sein sollte. Das Schicksal hatte Victoria Dearbourne so grausam gebeutelt, dass zumindest dieser Teil von ihr hätte absterben müssen.
Aber wenigstens hatte sie ihre Angst nicht gezeigt, sondern mit kühlem Kopf dafür gesorgt, dass er in die Falle laufen musste, wenn er ihr den Weg abschneiden wollte. Sie hatte ihn ja gewarnt. Zum zehnten Mal redete sie sich ein, dass er den Weg selbst gewählt hatte.
An diesem Morgen hatte Tori eigentlich nur eine Falle im seichten Wasser am Strand überprüfen wollen – eine ihrer täglichen Pflichten. Sie hatte nur kurz zum Wasser gehen und dann wieder unter das schützende Blätterdach eilen wollen, um die brennende Sonne zu meiden. Nach so vielen Jahren hatte sie nicht unbedingt mit Gesellschaft gerechnet …
Ein zurückfedernder Zweig traf ihren Oberschenkel, und ein sengender Schmerz durchzuckte sie. Tori schaute an sich herab und sah Blut aus der Wunde quellen, das den zerfetzten weißen Batistrock rot färbte. Verflucht! Vielleicht war der Schaden noch zu beheben, aber wie viele Wäschen würde der Stoff noch überstehen, ohne völlig zu zerfasern? Viel brauchbare Kleidung gab es nicht mehr in den alten Seekisten.
Tori zwang sich zu einer langsameren Gangart. Sie warf einen besorgten Blick über ihre Schulter. Eigentlich sollte sie es besser wissen und keine Spuren wie abgerissene Zweige und Blut auf einem großen Blatt hinterlassen. Sie atmete tief durch und setzte ihren Weg durch stachelige Palmwedel fort, bis sie den Pfad zum Lager erreichte. Nach einem zehnminütigen Sprint hügelaufwärts gelangte sie zu einem überwölbten Gang aus Bananenblättern, der als Eingang zu ihrem Heim diente.
»Männer!«, keuchte Tori, als sie auf die Lichtung taumelte. »Männer und ein Schiff!« Sie beugte sich vor, schöpfte keuchend Atem, dann sank sie auf die Knie. »Cammy?« Keine Antwort. In der Hütte, die sich hoch oben in einem alten Banyanbaum befand, rührte sich nichts. Cammy sollte aber dort sein. Wie oft hatte Tori ihr gesagt, dass sie im Lager bleiben sollte?
Und Cammy hätte das auch beherzigt, wenn sie nicht unter zunehmendem Gedächtnisverlust gelitten hätte.
Tori eilte zu der Leiter, nahm zwei der Sprossen aus Bambus auf einmal, dann riss sie die »Tür« auf, die aus einem Streifen alten Segeltuchs bestand. Sie spähte hinein. Leer. Tori wandte den Blick ab und schaute dann wieder in das Baumhaus, als traute sie ihren Augen nicht. Was, wenn Cammy diesmal bis zum Strand hinuntergelaufen war?
Es gab zwei Wege zu ihrem Refugium auf dem Hügel, einen versteckten und einen noch geheimeren. Den ersten hatte Tori bereits in seiner ganzen Länge abgesucht, blieb also nur der zweite. Auf halbem Wege zum Strand fand sie Cammy, die an einen Baum gelehnt dasaß. Sie atmete flach, war wachsbleich, die Lippen aufgesprungen und rissig.
Tori rüttelte sie an der Schulter, und nach ein paar Sekunden schlug Cammy die Augen auf und blinzelte gegen das Licht. »Wo ist dein Hut, Tori? Bist du etwa in der Sonne gewesen?«
Wie eine frische Brise überkam Tori die Erleichterung. Eine scheltende Cammy war sehr viel besser als eine Cammy, die wie eine Tote schlief.
»Bei deiner weißen Haut ist es vernünftiger …« Sie brach ab, als sie Toris blutiges Bein und den nassen, ruinierten Rock sah. »Was ist denn nun schon wieder passiert?«
»Männer und ein Schiff! Nachdem ein Hüne mich gejagt und mir die Kleider zerrissen hatte, konnte ich meinen Hut nicht wiederfinden.«
Cammy lächelte schwach. »Wir können mit unserem Teint nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr?«, sagte sie zerstreut.
Zerstreut – das war der Ausdruck, mit dem man Cammy jetzt am besten beschreiben konnte. Früher hatte sie vor Leben gesprüht, war so quicklebendig gewesen wie ihr feuerrotes Haar, eine Frau von klarer, aufgeweckter Intelligenz. Jetzt erschien sie gleichsam verwelkt, und ihre klaren Momente kamen und gingen ohne erkennbares Muster.
Tori zählte im Geiste bis fünf. Manchmal, wenn Cammy so vage ins Leere starrte, hätte sie ihre Freundin am liebsten geschüttelt. »Hast du gehört, was ich gesagt habe? Wir sind nicht mehr allein.«
Gerade als Tori glaubte, Cammy habe sie überhaupt nicht verstanden, wollte diese wissen: »Wie sehen sie aus?«
»Der eine, der mich verfolgte, hatte die kältesten, stechendsten Augen, die ich je gesehen habe. Ich musste ihn in die Schlucht locken, damit er von mir abließ.«
»Die Schlucht?«, fragte Cammy. »Oh, das hätte ich zu gern gesehen!«
Tori zog bei der Erinnerung die Brauen zusammen. Wie zu sich selbst sagte sie: »Es stimmt wirklich: Je größer ein Mensch ist, desto schlimmer sein Sturz.« Sie schüttelte unmutig den Kopf. »Die Übrigen haben wie wild auf das Laub eingedroschen, um durch den Dschungel zu kommen.«
»Seeleute, die den Dschungel durchkämmen.« Cammy erschauerte. »Die Geschichte wiederholt sich …«
Beide erstarrten, als die Vögel in den Bäumen verstummten. »Wir müssen zum Lager«, wisperte Tori.
»Ich halte dich doch nur auf. Geh voraus, ich komme schon nach!«
»Natürlich, genauso mache ich das«, sagte Tori, während sie eine Schulter unter Cammys Arm zwängte und die Freundin aufhob. Quälend langsam mühten sie sich den Weg hinauf. Als ihr Lager in Sicht kam, suchte Tori die Umgebung ab, wobei sie versuchte, es mit den Augen eines Fremden zu sehen. Wie merkwürdig, sich vorzustellen, dass Männer in ihrem Unterschlupf umhergingen, ihn musterten, die primitive Feuerstelle umrundeten! Wenn Außenstehende erkennen würden, wie kunstfertig dieses Lager gebaut war, wäre es ein Beweis für ihren zähen Überlebenswillen. Tori war sich bewusst, wie schrecklich dieser Charakterzug war, aber sie sehnte sich im Grunde danach, dass jemand ihr Werk bewunderte. Dein Stolz wird eines Tages noch dein Untergang sein, würde Cammy dazu bemerken.
Doch Tori glaubte nicht daran, dass sie untergehen würde. Wenn ihr dies vorherbestimmt wäre, wäre es längst geschehen. Natur und Schicksal hatten sich gegen sie verschworen und ihnen beständig Herausforderungen in den Weg gelegt, die Cammy und sie aber entgegen aller Wahrscheinlichkeit gemeistert hatten. Sie hatten überlebt und würden weiterhin überleben. Nein, ein Untergang kam nicht infrage. Tori runzelte ob der eigenen Gedanken die Stirn. Cammy hatte ihr oft vorgehalten, sie sei stolz; Tori aber fürchtete, dass sie obendrein arrogant war.
Doch schließlich hatte Arroganz ihr stets besser gedient als Angst.
»In welche Richtung sind sie gelaufen?«, fragte Cammy.
»Spielt keine Rolle.« Tori lächelte kalt. »Es ist auf jeden Fall immer die falsche.«
2
Grant humpelte unter dem Schutz der Bäume auf den Strand zu, wo seine Mannschaft wartete. Er knirschte vor Schmerz mit den Zähnen, hielt einen Arm vor der Brust und drückte die Hand auf die gegenüberliegende Schulter. Wasser tropfte aus seinen Haaren und mischte sich mit dem Schweiß seiner Stirn, der ihn in die Augen biss.
Überrumpelt. Genau das war ihm geschehen. Ihm schwirrte vor Gedanken der Kopf. Warum sollte sie überhaupt vor ihm fliehen? Und, wichtiger noch: Warum zum Teufel hatte er sie stur und stumpfsinnig gehetzt wie ein Hund den Hasen? Und weshalb würde er es wieder genauso machen?
»Grant, du siehst aus, als hättest du dich mit einer wilden Eingeborenen gebalgt«, scherzte Ian. »Runde eins gewinnt also Victoria. Oder vielleicht auch nicht«, setzte er mit bedeutungsschwangerem Blick auf den durchnässten Fetzen hinzu, den der Kapitän immer noch in der Hand hielt. Grant spürte, wie er rot wurde, nahm Dooley rasch seinen Seesack ab und stopfte den Fetzen hinein.
»Glückwunsch, Cap’n! Sie haben wirklich ’ne Überlebende gefunden!«, rief Dooley mit einem breiten Grinsen. »Hab doch gewusst, dass Sie’s schaffen!«
Woher das unerschütterliche Vertrauen seines Ersten Maats rührte, war Grant ein Rätsel.
Ian schielte ihn von der Seite an. »Aber hat es nicht geheißen, dass genau das der schwierigste Teil sein würde – sie zu finden?«
Grant warf seinem Cousin einen missbilligenden Blick zu, dann bellte er die Männer an: »Holt mehr Proviant! Genug für eine Nacht. Und sammelt für die Rückreise so viel Nahrung ein, wie der Laderaum fassen kann.«
Obwohl Dooley sich willfährig zeigte, zögerten die anderen Matrosen zum ersten Mal, einem Befehl Grants nachzukommen. Sie schauten ihn mit dem üblichen Ausdruck steter Furcht an, doch jetzt stand außerdem Verwirrung in ihren Gesichtern. Ihr kühler Kapitän, der stets so planvoll handelte, war wie ein Raubtier einem jungen Mädchen hinterhergestürzt.
Grant beschloss, seine Mannschaft von der Unsicherheit zu befreien. »Bewegt euch!«, sagte er in einem Ton, der keinerlei Gefühl enthielt. »Sofort!«
Er hätte beinahe gelacht, als sie auseinanderstoben und in verschiedene Richtungen davonliefen. Die meisten seiner Männer hegten mehr Respekt vor seiner beherrschten Haltung als vor den berüchtigten Schimpftiraden seines Bruders Derek. Da sie selbst gefühlsbetonte Menschen voller Gelüste waren, konnten sie einen Mann wie ihn nicht begreifen. Also folgerten sie, dass er irgendwann überschnappen würde. »Stille Wasser sind tief«, hatte er sie des Öfteren murmeln hören.
Ian schnaubte verächtlich. »Eines Tages werden sie begreifen, dass von dir keinerlei Gefahr ausgeht. Und was soll dann aus uns werden?«
»Dann sind wir längst im Ruhestand.« Grant entledigte sich seiner triefenden Stiefel und des zerfetzten Hemdes und nahm trockene Kleidung aus seinem Seesack. Nachdem er sich umgezogen hatte, sah er, dass Ian eine Machete und ein Kochgeschirr aus dem Boot holte. »Du rüstest dich aus, als wolltest du mitkommen. Lass mich mal eines klarstellen: Dies ist ein Dschungel. Hier gibt es keine Feste, keinen Alkohol und auch keine Frauen für … deinen ausgeprägten Geschmack.«
»Verstanden, Cap’n.« Ian schulterte sein Kochgeschirr. »Ich möchte aber trotzdem mitkommen. Selbstverständlich nur, wenn du gegen meinen Strandanzug nichts einzuwenden hast«, setzte er hinzu – eine Spöttelei, die sich zweifellos darauf bezog, dass Grant einmal einen Matrosen zurückgeschickt hatte, um das Schiff zu teeren, nur weil er sein Hemd nicht ordnungsgemäß in die Hose gesteckt hatte.
»Was dich angeht, so habe ich gegen alles etwas einzuwenden.«
Ian verzog das Gesicht zu einem zufriedenen Grinsen. Dann trabte er auf die am nächsten gelegene Lücke in der grünen Wand des Dschungels zu.
Grant schulterte seine eigenen Gerätschaften, atmete lang und ergeben aus und wappnete sich mit Geduld. Während er seinem Cousin folgte, rief er sich in Erinnerung, dass Ian zwar schon sechsundzwanzig, aber immer noch sehr unerfahren war. Er fragte sich nur, wie lange seine Geduld vorhalten würde.
»Also, wonach suchen wir?«, wollte Ian wissen.
»Nach einem Weg, Fußspuren, einem Lager. Irgendwas«, gab Grant brüsk zurück und hoffte, dass die Unterhaltung damit beendet war. Er wollte nicht reden – er wollte über das Geschehene nachdenken, wollte die letzte, unglaubliche Stunde seines Lebens verstehen. Er schüttelte den Kopf, weil er immer noch nicht fassen konnte, Victoria Dearbourne gefunden zu haben. Und dass sie sich in eine Wildkatze verwandelt hatte.
Überrumpelt. Hereingelegt, irregeleitet – buchstäblich – und angegriffen. Von einem kleinen Mädchen!
Grant hasste Überraschungen, vor allem deswegen, weil er nie wusste, wie er auf sie reagieren sollte. Er stieß den angehaltenen Atem aus. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Grant!, ermahnte er sich. Und die war, auf den Punkt gebracht, simpel genug: Bring das Mädchen auf dein Schiff!
»Glaubst du, dass diese Insel früher unbewohnt war?«
Wieder atmete Grant hörbar aus. »Ich weiß es nicht. Diese Insel ist größer als die anderen. Hier könnte es eine verdammte Großstadt geben, ohne dass wir davon wissen.«
Ian wurde merklich langsamer. Dann drehte er sich um und sah ihn nachdenklich an. »Grant. Du weißt, dass ich dich niemals vor der Mannschaft kritisieren würde …«
»Aber sicher würdest du.«
Ian wischte den Einwand beiseite. »Wie auch immer – was ist denn bloß in dich gefahren? So hab ich dich ja noch nie erlebt. Man konnte den Eindruck gewinnen, du wärest besessen.«
Grant schnaubte böse, obwohl Ian nur allzu recht hatte. Grant tat nichts ohne sorgfältige Überlegung, handelte niemals, ohne die Folgen vorher bis ins Letzte bedacht zu haben. »Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet.« Die Erklärung klang selbst in seinen Ohren lahm. Er hatte sich wie ein Besessener gefühlt. Ein Impuls hatte ihn ergriffen, und zum ersten Mal in seinem Leben war er ihm bedenkenlos gefolgt. »Ich hätte sie nicht gehetzt, wenn sie nicht fortgelaufen wäre.«
Ian warf ihm einen schlauen Blick zu. »Vielleicht bist du deinen Brüdern ähnlicher, als du glaubst.«
Grant spannte den ganzen Körper an. »Ich bin nicht wie meine Brüder. Ich bin seriös, anständig …«
»Ich weiß, ich weiß«, fiel Ian ihm ins Wort. »Du weißt dich stets zu beherrschen. Du bist von beispielhafter Zurückhaltung.« Er legte den Kopf schief. »Oder vielleicht stimmt ja auch, was deine Matrosen sagen: dass du dir jegliche Lebenslust versagst und deshalb wie aus Stein bist.«
Grant verlangsamte den Schritt. »Sie finden, dass ich wie ein Stein bin?«
»Sie sagen noch Schlimmeres, aber das gebe ich nicht preis.«
»Dann halte doch einfach den Mund, Ian!« Er beschleunigte sein Tempo.
»Aber heute warst du gar nicht wie ein Stein, so viel ist sicher.« Ian holte ihn ein und gestand: »Bin froh, dass du sie gehetzt hast.«
Grant warf ihm einen Blick zu, der von langer, leidvoller Erfahrung sprach. »Aus welchem Grund denn bitte?«
»Das hat allen gezeigt, dass du doch noch ein Mensch bist. Ein einziges Mal hast du dich nicht von kühler Logik leiten lassen. Und vielleicht hat diese Frau das in dir zum Vorschein gebracht.«
»Der Lohn, dass ich sie gefunden habe, hat das in mir zum Vorschein gebracht. Dass sie eine Frau ist, hat damit gar nichts zu tun.«
»Und dass sie eine Schönheit ist?« Ian zog die Brauen hoch. »Nun ja, jedenfalls hast du sie zu Tode erschreckt. Bist ja nicht gerade ein Zwerg. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich irgendwo verkrochen hat und weint.« Er schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Das ist ein Charakterzug, den du auf keinen Fall von den Sutherlands geerbt hast: die Kunst, mit Frauen umzugehen.«
Grant verbannte die Gereiztheit aus seiner Miene. Wie üblich neckte sein Cousin ihn, während er mühsam jegliche Reaktion unterdrückte. Ians unsteter Charakter war seinem so unähnlich wie nur möglich, und wäre Grant ein anderer, so hätten sie sieben Monate Zeit gehabt, einander an die Gurgel zu gehen.
Als ungeladener Passagier war Ian wenige Minuten vor dem Ablegen an Bord gekommen. Zum hundertsten Mal bedauerte Grant, seinen nichtsnutzigen Wüstling von Vetter an Bord genommen zu haben. Er fluchte unterdrückt vor sich hin, während er Ian musterte, der fröhlich wandernd zu den Vögeln aufsah und dabei eine Banane aß. Ian war jedoch trotz seiner Fehler, seiner geradezu unheimlichen Spottsucht, seiner Trägheit, seines … Grant gebot seinen rasenden Gedanken Einhalt und gab insgeheim zu, dass Ian trotz all seiner Fehler wie ein Bruder für ihn war. Falls er wieder in die gleiche Lage geriete, würde er Ian ein zweites Mal auf die Reise mitnehmen.
Während seines hastigen Laufs zum Liegeplatz der Keveral hatte Ian mit schreckgeweiteten Augen über die Schulter gesehen – dessen entsann er sich genau.
Wieder einmal unterdrückte Grant das Bedürfnis, seinen Cousin daran zu erinnern, dass er an Bord weder einen Handschlag tat noch für die Reise bezahlte, als Ian plötzlich mit den Fingern schnippte. »Mir ist grade was eingefallen – das bedeutet doch, dass Victorias Großvater nicht übergeschnappt ist.«
»Manche von uns haben das ja auch nie geglaubt.« Das war bestenfalls eine unaufrichtige Antwort. Grant hatte sich sehr wohl Gedanken über den Geisteszustand von Victorias Großvater gemacht. Edward Dearbourne, der alte Earl of Belmont, wurde innerhalb der feinen Gesellschaft und von sämtlichen Reedern Londons für unzurechnungsfähig gehalten. Was sollte man auch sonst von einem einsamen alten Mann halten, der sich so heftig nach seiner Familie sehnte, dass er sich ihren Tod überhaupt nicht vorstellen konnte? Der seit Jahren einen erfolglosen Suchtrupp nach dem anderen in den Südpazifik geschickt hatte und dadurch immer mehr verarmt war?
Grant jedenfalls wusste, was er von der Geisteshaltung des Alten hielt: Er hatte recht gehabt.
Zumindest im Hinblick auf Victoria. Er entsann sich noch gut der ersten Begegnung mit dem Earl. Tränen hatten in Belmonts trüben Augen gestanden, während er die Geschichte seiner verschollenen Familie erzählte. Da Grant angesichts der Zurschaustellung dieser Gefühle unbehaglich zumute gewesen war, hatte er sich in Plattitüden geflüchtet. Sie sind nicht mehr. Man sollte es lieber hinnehmen und weiterleben. Sie sind an einem besseren Ort …
Doch wider alle Vernunft hatte der Mann weiter daran geglaubt. Grant runzelte die Stirn. Wider alle Logik.
Er schüttelte heftig den Kopf. Die Hoffnung des Earls hatte nicht auf Intuition basiert. Er hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, weil alles andere unerträglich gewesen wäre …
»Stell dir vor, was für ein Gesicht er machen wird, wenn wir sie ihm zurückbringen! Ach was, er! Alle werden sie staunen.« Ians sonst so matte Augen leuchteten vor Erregung. »Und ich hatte gedacht, wir sind zwei Dummköpfe auf einem Himmelfahrtskommando.«
»Wir?«
Ian wirkte gekränkt. »Ich denke, hier draußen sind du und ich. Also wir.«
Grant warf seinem Cousin einen zornigen Blick zu und setzte sich an die Spitze. In den nächsten drei Stunden kamen sie gut voran, doch dann platzte wieder eine Blase an der Hand, mit der er die Machete hielt. Er biss die Zähne zusammen und sog scharf den Atem ein. Als Ian noch weiter zurückfiel, hielt Grant an, stemmte die von Schlamm überzogene, blutige Hand gegen einen Baumstamm und ließ sich vornübersinken. Er fühlte sich bis ins Mark erschöpft.
Das Innere der Insel war ein Glutofen – hier wehte keine Seebrise, hier gab es keinen puderfeinen Sand. Hier bildeten Schlamm und faulende Pflanzen einen breiigen Boden, sogen gierig jegliche Feuchtigkeit auf und kämpften erbarmungslos um jeden Sonnenstrahl. Grant trank einen Schluck Wasser, nur einen, und sah dann prüfend an sich herab. Er war voller Schnittwunden, seine Hände voller münzgroßer Blasen, und über seine Brust lief ein breiter, rötlicher Striemen.
»Grant, das ist doch kein Wettrennen!«, schnaufte Ian, während er die letzten Meter aufholte. »Willst du an einem Nachmittag die ganze Insel absuchen?«
Grant hatte kein Mitleid mit seinem Cousin. »Ich hatte dich gewarnt.«
»Ich hab nicht gedacht, dass es so …« Ihm versagte die Stimme, während er die Augen aufriss. »Ich spüre meine Füße nicht mehr. Verdammt! Ich spüre meine Füße nicht mehr!«
Während Ian im Kreis herumtaumelte und sich davon überzeugte, dass er immer noch zwei Füße hatte, ignorierte Grant die Schmerzen in seinem geschundenen Körper und lief weiter.
»Langsamer, Grant!«, flehte Ian.
Er drehte sich zu seinem Cousin um. »Wenn du zurückbleibst, wirst du zurückgelassen. Ich hoffe, du hast dir den Weg gemerkt.«
Ian musterte das Gewirr aus Bäumen und Lianen mit leiser Panik. »Hab ich nicht, weil ich dachte, dass du das machst.«
Auch das war schon immer so gewesen.
»Dann solltest du lieber Schritt halten.« Aus mehr als einem Grund hielt Grant das unbarmherzige Tempo aufrecht. Er hatte Victoria gefunden, und, ja, er war seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, aber er wollte sie auch in Sicherheit bringen. Seiner Meinung nach stand sie jetzt unter seinem Schutz. Bis er sie fand, war sie einsam und allein, eine blutjunge, schwache – wenn auch kämpferische – Frau, irgendwo auf einer wilden Insel, die sogar gestandene Männer das Fürchten lehren konnte.
Im Laufe des Tages hatte sein Zorn über ihre List seinem schlechten Gewissen Platz gemacht. Er hatte sie wie ein Wilder gehetzt, doch schließlich war sie nach sieben Monaten – sieben Monaten – endlich zum Greifen nahe gewesen. Selbst jetzt noch kribbelten Grant bei diesem Gedanken die Finger. Aber dann sah er wieder ihr Gesicht vor sich, den Ausdruck in ihren Augen, die Bestürzung. Er hatte ihr keine Angst einjagen wollen, hatte jedoch genau das erreicht.
Victoria hatte schon genug durchlitten – Jahre ohne jeden Komfort, abgeschnitten von den Segnungen der Zivilisation und Vater und Mutter vermutlich beide tot. Selbstverständlich hatte sie Angst gehabt! Grant konnte beinahe verstehen, warum sie ihn in die Schlucht gestürzt und mit dem Ast fast enthauptet hatte. Dass sie ihn mit einem Stock angestoßen und verhöhnt hatte, konnte er hingegen nicht ertragen, aber vielleicht hatte sie bloß Tapferkeit vortäuschen wollen.
Sie suchten weiter, bis ein Dreiviertelmond am Himmel aufging, dann humpelten sie zum Lager zurück. Als die Männer ihn neugierig anschauten, sagte Grant lediglich: »Morgen finden wir sie.« Sein Ton duldete keinen Widerspruch, Grant selbst war jedoch längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor.
Als Dooley heranwieselte und einen Blechbecher mit Kaffee brachte, ließ sich Grant wie betäubt auf eine liegende Palme sinken und trank. Doch selbst das war zu anstrengend. Er schüttete den Rest Kaffee in den Sand und brachte eben noch genug Energie auf, um seine Pritsche aufzubauen.
Nachdem er sie unter einer Lücke im Kronendach aufgestellt hatte, lag er, während die anderen schliefen, noch lange wach und schaute zu den grell funkelnden Sternen auf. Er dachte über die Wendung nach, die sein Leben mit einem Mal genommen hatte. Jetzt hatte er Belmonts Belohnung wirklich verdient. Es war das Letzte gewesen, was der Mann anzubieten hatte: sein Haus. Wenn der Earl starb, würde Grant der Besitzer des großen, wenn auch verfallenden Belmont Court werden. Endlich würde er ein Heim haben, eine Familie gründen können.
Und doch hatte seine Mission nicht nur daraus bestanden. Victorias Großvater, der alte Mann mit den traurigen Augen, der so sichtlich einsam war, hatte es irgendwie geschafft, Grant davon zu überzeugen, dass seine Familie gegen alle Vorhersagen noch am Leben sein könnte.
Grant hatte nie zuvor Veranlassung gesehen, den Helden zu spielen, aber wenn sie wirklich dort draußen waren, wollte er sie retten. Und jetzt stand er so kurz davor, wenigstens Victoria zurückzubringen. Sie hatte überlebt, ohne dabei Kraft oder Gesundheit einzubüßen. Doch das konnte nicht ewig gut gehen. Sie musste unbedingt gerettet werden, selbst wenn sie nicht genug Verstand besaß, um es einzusehen.
»Ist dir inzwischen etwas eingefallen?«, fragte Cammy. Sie biss ein zweites Mal von ihrer Banane ab und klopfte sich dann zum Zeichen, dass ihr Frühstück beendet war, auf den eingefallenen Bauch. Kein Wunder, dass sie immer mehr Gewicht verliert, dachte Tori. Handwurzelknochen und Schlüsselbein ragten unter Cammys Haut hervor, ebenso wie ihre Wangenknochen.
Sie muss unbedingt mehr essen, dachte Tori, während sie in der kleinen Hütte auf und ab schritt. Der aus Schiffsplanken gezimmerte Boden unter ihren Füßen knarrte vernehmlich, gab aber nicht nach. »Eine Menge. Nur nichts, was machbar wäre. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie wir mit ihrem Schiff davonsegeln, während sie am Strand stehen und sich blöde am Kopf kratzen.«
»Das wäre eine ausgezeichnete Lösung!«
Tori sah Cammy fragend an. Doch zum Glück hatte die Freundin es scherzhaft gemeint. »Wir müssen mehr über sie herausbekommen.«
»Ja, zum Beispiel, ob die anderen gute Menschen sind. Und nur der Mann, der dich gejagt hat, vielleicht zufällig ein … ein Trunkenbold war?«
Tori schüttelte den Kopf. »Nein, er war vollkommen nüchtern.«
»Dann vielleicht ein Verrückter?«
Sie wollte schon wieder mit Nein antworten, da fielen ihr seine Augen ein. Obwohl voller Konzentration, eisblau und kalt, war deren Ausdruck ein wenig … barbarisch gewesen. »Warum sollten sie so einen Mann als Vorhut ausschicken?«
»Weil sie ihn auf dem Schiff nicht mehr ertragen konnten? Oder weil sie ihn aussetzen wollten?«, sinnierte Cammy. »Du hast ihnen möglicherweise einen Gefallen getan!«
Tori ließ sich im Schneidersitz auf ihr Strohlager sinken. »Ich nehme an, dass alles möglich ist.«
»Was sollen wir denn jetzt tun? Das Risiko eingehen, dass sie uns hierlassen – oder das Risiko, dass sie uns aus niederträchtigen Motiven entführen?«
Tori spürte die Anspannung in Nacken und Schultern. Was für eine gefährliche Gratwanderung! Ein falscher Tritt … »Wenn ich eine Frau oder ein Kind an Deck gesehen hätte, dann hätte ich weniger Vorbehalte gegen diese Männer.«
»Oder vielleicht sogar einen Geistlichen.«
Tori nickte. »Ich muss mir einfach ihr Schiff genauer anschauen. Vielleicht sollte ich noch mal zum Strand hinunterschleichen …«
»Warum bleibst du nicht auf dem Hügel und nimmst das da?« Cammy deutete auf das Fernrohr, das in einer Ecke der Hütte stand – stand, weil es nicht mehr ineinandergeschoben werden konnte.
Toris müder Blick streifte das Fernrohr. »Das alte Ding? Die äußere Linse hat einen Sprung.«
»Im Moment können sie uns nicht aufspüren, doch wenn ich das Fernrohr benutze, könnten sie die Reflexionen bemerken«, wandte Tori ein. »Und wenn ich sie sehen kann, können sie mich auch sehen.«
»Warte, bis eine Wolke kommt, und versteck dich im Unterholz!« Für Cammy war das Thema damit erledigt. »Und sei bloß vorsichtig, Tori!«
Sie seufzte. »Und du, Cammy, bleib bloß hier!«
So kam es, dass Tori Minuten später auf dem Bauch durch den Staub robbte, sich mit den Ellenbogen vorwärtszog, ein rostiges, kaputtes Fernrohr mit sich schleppte und Cammy verfluchte, weil diese ausnahmsweise einen klaren Moment gehabt hatte.
Sie richtete das Fernrohr aus, stützte das Kinn auf ihren flachen Handrücken und wartete – Stunden, so kam es ihr vor – auf eine Wolke, die aus der Ferne heranzog. Wie verschüchtert schwebte diese heran. Es war, als würde sie von jemandem, den Tori nicht sehen konnte, mit dem gekrümmten Zeigefinger herbeigewinkt. Als die Sonne endlich verhüllt war, richtete Tori das Fernrohr auf die Bucht und machte sich darauf gefasst, alles doppelt zu sehen.
Während der langen Zeit, in der die Sonne verhüllt war, konnte Tori keine Frau mit windzerzausten Röcken, kein spielendes Kind, auch keinen Geistlichen im schwarzen Rock, sondern nur eine Horde gemeiner Matrosen an Bord ausmachen.
Tori sank der Mut. Über solche Männer wusste sie nur zu gut Bescheid.
In Bauchlage trat sie den Rückzug an, dann sprang sie auf und lief zum Lager zurück, den Kopf voller verworrener Einfälle. Sie fand Cammy dösend in der Hängematte neben der Hütte vor, beinahe schon von der sanften Brise in den Schlaf gewiegt.
»Einen schönen Nachmittag, Tori!«, grüßte Cammy gähnend. »Hast du Fische gefangen?«
Eins, zwei, drei, vier, fünf … »Ich habe das Schiff ausgekundschaftet, das hast du doch nicht vergessen?«
Cammy riss die Augen auf, doch sie überspielte ihr Erstaunen gut. »Aber natürlich!« Mit geübten Bewegungen brachte sie sich in eine sitzende Haltung. »Ich habe doch bloß Spaß gemacht.«
Tori kniff die Augen zusammen. »Wird es mit deinem Gedächtnis schlimmer?«
Cammy seufzte. »Woher soll ich das wissen? Wenn ich es an irgendeinem Punkt gemerkt hätte, hätte ich das sowieso wieder vergessen.«
Sie hatte ihre Phasen der Unklarheit einmal mit einem Erwachen am Morgen verglichen, ohne das Wissen, wo man sich befand. Aber es sei nicht schwer, sie abzuschütteln. Zuweilen schob sie ihre Ausfälle auf verdorbenes Essen, dann wieder auf eine unerkannte Krankheit.
»Tori, jetzt spann mich nicht so auf die Folter …«
»Ich habe nichts von dem gesehen, was wir uns erhofft hatten. Ich verstehe das einfach nicht. Kapitäne und Erste Maaten nehmen oft ihre Familien mit.«
»Sie könnten unter Deck sein.«
Tori schüttelte den Kopf. »An einem Tag wie diesem wäre es dort so heiß wie in einem Backofen. Absolut jeder würde sich an Deck unter dem aufgespannten Segeltuch aufhalten.«
»Welche Flagge haben sie aufgezogen?«
»Den Union Jack.« Dass die Besatzung englisch war, fanden die beiden Frauen nicht sonderlich beruhigend. Das letzte Schiff war unter der gleichen Flagge gesegelt. Und Großbritannien zwang ebenso viele Mannschaften, die ausschließlich aus Verbrechern bestanden, in seinen Dienst wie andere Staaten. Tori setzte sich auf einen Treibholzstamm. »Ich habe über unsere Theorie nachgedacht, dass ›die anderen gute Menschen sind‹.«
»Müssten wir ihr nicht eine ›Die anderen sind genauso schlechte Menschen‹-Theorie entgegenstellen?«
Tori nickte. »Ich fürchte, wir wollen so dringend gerettet werden, dass wir Ausreden für sie erfinden. Ich bin gejagt und angefasst worden. Das ist eine Tatsache. An Bord des Schiffes befinden sich nur Männer – ebenfalls eine Tatsache. Ich habe auch nicht gehört, dass sie den Mann, der mich verfolgte, beschimpft hätten. Nein, im Gegenteil, sie schienen hocherfreut darüber zu sein. Und er ist auch nicht aufs Schiff zurückgeschickt worden.«
Cammys strenge Miene zeigte nur zu deutlich ihre Meinung über diese Männer. »Haben wir es nicht auf die harte Tour gelernt? Ich glaube, sie war hart genug.«
»Sie könnten aber Arznei an Bord haben.«
»Und was, glaubst du wohl, wollen sie dafür haben?« Cammy rieb sich die schweißnasse Stirn. »Verzeih, Tori. Die Krankheit macht mich schwermütig. Doch diese Männer könnten ebenso schrecklich sein wie die letzte Besatzung, die hier vor Anker ging.« Ihr Gesicht wurde zu einer Maske des Ekels. »Oder wie die Matrosen der Serendipity, die nach dem Urin gestunken haben, mit dem sie ihre Kleider wuschen. Wenigstens bist du jetzt in Sicherheit, und dir ist noch nichts geschehen.« Mit leiserer Stimme fuhr sie fort: »Und welche Hilfe könnte ich dir schon sein? Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um … um das zu tun, was vielleicht nötig wäre.« Sie schlang die dünnen Arme um die Knie.
Tori senkte den Blick. Nie mehr durfte sie von Cammy so ein Opfer erwarten. Und sie hatte es weiß Gott auch beim ersten Mal nicht erwartet. Als sie wieder aufschaute, versuchte sie, gleichmütig zu erscheinen, was ihr jedoch nicht gelang.
»Oh, Tori, deine Augen verraten dich, ich kann dir fast beim Denken zusehen. Du ersinnst doch einen Schlachtplan.
Tori beugte sich vor. »Ich finde, wir müssen herausbekommen, was für Männer das sind. Was, wenn es gute Menschen sind? Vielleicht sehen sie sich als britische Gentlemen an? Und ein Mann von Ehre würde niemals eine Lady hilflos zurücklassen. Egal, was ihm widerführe.«
Cammy machte ein interessiertes Gesicht. »Während eine Mannschaft von Halsabschneidern durch deine Maßnahmen in die Flucht getrieben werden kann. Das gefällt mir. Wenn sie zu rasch aufgeben, sind sie nicht die Art Männer, die wir hier haben wollen.« Als Tori nickte, fügte Cammy hinzu: »Bist du dir auch sicher, dass sie dich nicht fangen?«
»Niemand kann mich fangen«, spöttelte Tori.
»Das haben wir damals leider auch gedacht.«
Tori straffte sich. »Ich bin jetzt älter. Und schneller.«
»Was schwebt dir vor?«
»Erinnerst du dich an die Pflanze, nach der wir tagelang erbrochen haben?« Sie tippte sich auf die Wange. »Ich denke, ich werde ihnen etwas davon ins Essen geben.«
Cammy hielt sich unbewusst den Bauch. »Also, das werde ich nie vergessen. Fast eine Woche lang wollte ich nur noch sterben.«
Tori fuhr keuchend in die Höhe, während der Lärm der zerbrechenden Serendipity noch in ihren Ohren widerhallte.
Ihre Hände zuckten hoch, doch sie hielt in der Bewegung inne, bevor sie die Ohren bedecken konnten. Tori glaubte nicht, jemals das Kreischen und Beben der splitternden Planken vergessen zu können. Die Kräfte, derer es bedurft hatte, um schwere Holzbohlen zu zertrümmern. Sie legte die Hände auf die Augen und wischte die Tränen fort. Zum Glück schlief Cammy weiter, es war ja noch nicht einmal Morgen.
Obwohl Tori diesen Albtraum seit Jahren nicht mehr gehabt hatte, quälte er sie nun schon den zweiten Morgen in Folge. Sie hatte ihre erbärmliche Angst vor Schiffen stets vor Cammy zu verbergen versucht – ohne Erfolg, wie sie sehr wohl wusste. Als ihnen klar wurde, dass sie niemals gerettet werden würden, hatte Cammy gesagt: »Sieh es mal von der angenehmen Seite. Zumindest werden wir nie mehr Schiffbruch erleiden.« Tori hatte dies damals für einen Scherz gehalten, doch Cammy hatte ein todernstes Gesicht gemacht.
Aber jetzt ankerte ein anderes Schiff in der Bucht und wurde von den Wellen hin und her geworfen. Tori erschauerte und wühlte sich tiefer unter ihren Patchwork-Quilt, doch dann riss sie plötzlich die Augen auf. Sie hatte eine Aufgabe zu erledigen.
Selbst nachdem sie sich angekleidet und zum Lager der Matrosen hinabgestiegen war, stand der Morgennebel immer noch dicht zwischen den Bäumen und erleichterte ihr die Aufgabe des Anschleichens sehr. Leise untersuchte Tori alle Gefäße, bis sie das Hafermehl fand. Sie schüttete eine Kalebasse missfarbenes, winzig klein gehäckseltes Kraut hinein und mengte es gründlich unter. Dann setzte sie den Deckel wieder auf das Gefäß, wischte sich die Hände ab, warf die Kalebasse fort und schlüpfte ins Dickicht zurück. Sie schaute zu, wie die Männer erwachten und sich für ihr Tagewerk bereit machten, Feuer schürten, kochten. Feixend sah Tori zu, wie einige Männer das von ihr »gewürzte« Hafermehl in ihre Näpfe löffelten.
Der Hüne erhob sich zur gleichen Zeit wie die anderen, obwohl er in einiger Entfernung von ihnen geschlafen hatte. Aus der Nähe betrachtet bestätigte sich Toris früherer Eindruck, dass er der größte Mann war, den sie je zu Gesicht bekommen hatte. Und mit seinen breiten Schultern und der muskulösen Brust war er sicher auch der kräftigste.
Am Vortag noch hatte sie sich gefragt, ob er ein Trunkenbold, ein Verrückter oder sogar – möge Gott es verhüten – der Kapitän des Schiffes war. Jetzt wusste sie es. Jeder Zoll an ihm verkündete den Anführer: die zurückgenommenen Schultern, das eckige Kinn, das er um eine Winzigkeit höher trug als die anderen Männer. Er machte den Eindruck, als wären alle um ihn herum in einem schrecklichen Irrtum befangen, und er sei darüber sehr zornig. Seine Männer verhielten sich äußerst wachsam ihm gegenüber und duckten sich, als erwarteten sie Schläge.
Statt mit den anderen zu trinken oder zu essen, sagte der Kapitän etwas zu einem gedrungenen, nervös wirkenden Mann, schnappte sich ein zusammenrollbares Lederfutteral und eine Machete und machte sich auf den Weg zu den kleineren Wasserfällen. Tori benutzte diesen Weg täglich, um im Teich zu baden. Sie konnte ganz einfach unter den Bananenblättern hindurchschlüpfen, er aber musste sie mit seiner Machete abhacken, um durchzukommen.
Warum isst er nichts?, überlegte Tori missmutig, während sie ihm leise wie ein Mäuschen zu einem ihrer Lieblingsorte auf der Insel folgte. Es war eine Szenerie wie im Garten Eden: ein klarer Teich, in dem sich die rauchfarbenen Felsen spiegelten. Zwei tröpfelnde Wasserfälle sorgten dafür, dass das Wasser stets frisch blieb.
Tori riss die Augen auf. Er war bereits dabei, sein Hemd aufzuknöpfen. Um zu … baden? Meine Güte, er wollte … baden! Sie biss sich auf die Lippen, wollte aber auf keinen Fall ihren Platz räumen. Und warum auch? Dies war ihre Insel. Ich kann seine Brust sehen! Der Eindringling war er. Jetzt hat er einen Stiefel ausgezogen. Außerdem brauchte sie dringend neue Anregungen. Ihr Leben war allzu eintönig geworden: arbeiten, arbeiten, nicht sterben, arbeiten. Hmmm. Trotz seiner Größe ist er schlank.
Toris Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln, als sie zu dem Ergebnis kam, dass sie es verdiente, einen nackten Mann zu sehen. Doch als er bei der Hose anlangte, drehte er sich um, und Tori konnte nur noch seinen Rücken sehen. Nur? Schon bei diesem Anblick schlug ihr Herz schneller. Seine Schultern und der obere Teil seines Rückens waren sehr breit und wirkten wie gemeißelt. Fast hätte sie vor Enttäuschung geschmollt, als er sich ins Wasser stürzte.
Während sie ihn angaffte, zog der Mann stetig seine Bahnen. Vielleicht versuchte er, die schmerzenden Glieder zu lockern. Endlich kam er wieder ins Seichte, erhob sich und schüttelte das Wasser aus den Haaren. Jetzt ist er gleich ganz aus dem Teich heraus, dieser große, nackte Mann. Als er ans Ufer kam, schnellte Toris Blick zu seinem Gesicht, um nur ja nicht woandershin zu schauen.
Er war so unglaublich groß. Und so, so … nackt.
Gerade als ihr aufging, wie lächerlich sie sich verhielt – denn das Schauen war ja nicht verboten –, nahm der Mann ein großes Trockentuch zur Hand und schlang es um seinen Unterkörper.
Tori fiel der Unterkiefer herunter, während er sich mit einem kleineren Tuch die Brust abrubbelte, zunächst vorsichtig die grellen Striemen, die er ihr zu verdanken hatte, dann den Rest seines Torsos. Sein Bauch war flach und fest. Sie schluckte, als sie zusah, wie sich die Bauchmuskeln zusammenzogen. Faszinierend. Schwarze Haare wuchsen unter seinem Nabel und dehnten sich nach unten aus – sie wollte sehen, wohin, verflixt –, wurden aber von dem Tuch verdeckt. Nie war Tori so neugierig und gleichzeitig so enttäuscht gewesen. Ihre Hände krallten sich in das Schilf. Weg mit dem Tuch! Lass es fallen! Jetzt!
Er tat es.