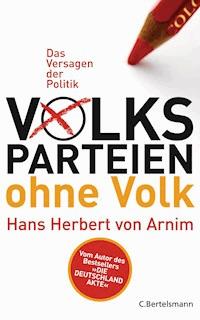Hans Herbert von Arnim
Die Deutschlandakte
Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2008 by C. Bertelsmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-01988-4V002
www.cbertelsmann.de
Zur Einführung
Politiker und Honoratioren, die bei öffentlichen Anlässen die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands in den Blick nehmen, kommen nur allzu gern in Festtagslaune und streichen die Sternstunden der deutschen Demokratie heraus. In diesem Buch wird die andere Geschichte der Republik hinter den vollmundigen Erfolgsmeldungen erzählt. Hier trifft der Leser auf eine erschreckende Fülle von Versäumnissen, gezielten Täuschungen, Rechtsbrüchen und politischer Verantwortungslosigkeit. Aus purem Egoismus haben vor allem die politische und die wirtschaftliche Klasse in erstaunlicher Kontinuität seit den Gründungsjahren die Weichen falsch gestellt und dringend notwendige Anpassungen unterlassen. Angesichts der Unterdrückung dieser Schattenseite unserer Demokratie in der öffentlichen Diskussion erscheint es legitim, sie hier besonders hervorzuheben. Ist die Rute verbogen, so sagt schon das Sprichwort, kann man sie nur richten, indem man sie nach der anderen Seite biegt. Das Buch handelt deshalb von Tatsachen und Zusammenhängen, die aus Gründen der Ideologie und der sogenannten politischen Korrektheit meist ungenannt bleiben. Von Sachverhalten, die aus dem Sprachgebrauch verbannt, und von Begriffen, denen ein Inhalt untergeschoben wird, der mit ihrer eigentlichen Bedeutung nichts mehr zu tun hat. Die Dinge beim Namen nennen und mit den Problemen offen umgehen ist erste Voraussetzung für eine Wende zum Besseren und die Entwicklung konkreter Reformvorschläge.
Für den unvorbereiteten Leser mag die Ansammlung von Aufregern, die das Buch enthält, wie ein Schock wirken. Immerhin wird der Stoff dadurch leichter verdaulich, dass er in wohlbemessene Portionen aufgeteilt ist. In 82 in sich geschlossenen Texten, die in 16 Kapitel gegliedert sind, werden Defizite und Auswüchse in Politik, Gerichtsbarkeit und Wirtschaft beleuchtet. Das neue Format entspricht einem vielfachen Wunsch von Lesern nach handlicher und eingängiger Darstellung. Anders als sonst bei Sachbüchern muss man sich nicht erst lange einlesen, um wirklich etwas »mitzunehmen«. Die kompakten Texte fördern Erschütterndes zu Tage, regen zu unkonventionellem Nachdenken an, und vielleicht stimulieren sie sogar zu politischem Handeln. Man kann sich je nach Geschmack in kürzester Zeit informieren oder – dank der Querverweise, des zusammenfassenden Schlusskapitels und der 16 Thesen am Ende des Buches – auch intensiver mit der Sache beschäftigen.
Das Buch ist die Quintessenz intensiver Recherchen des Autors auf der Basis jahrzehntelanger Beschäftigung mit den politisch-gesellschaftlichen Zuständen in Deutschland. Wer sich nicht vom vordergründigen Schein blenden lassen will, findet hier die richtige Anleitung und die nötige Aufklärung, die »neuen Kleider« der heute Mächtigen zu durchschauen und die politische und wirtschaftliche Klasse nackt dastehen zu sehen.
Die einzelnen Texte sind nicht isoliert aneinandergereiht, sondern werden durch ein inneres Band zusammengehalten. Indem die Ziele und Motive der Akteure – die von den öffentlich behaupteten völlig abweichen – hinterfragt werden, wird der übergreifende Zusammenhang deutlich. Das – ansonsten sorgfältig verborgene – Netzwerk hinter dem auf der Schaubühne präsentierten Politstück wird erkennbar. Zugleich zeigt sich, dass und auf welche Weise die Institutionen, die dieser Doppelzüngigkeit Vorschub leisten, allmählich von den Akteuren selbst deformiert worden sind, um ihre egoistischen Ziele besser durchsetzen zu können. Das Ergebnis ist eine krasse Diskrepanz zwischen dem öffentlich immer wieder beschworenen Ideal und den real existierenden Zuständen, die sich – angesichts der Herausforderungen, vor denen unser Gemeinwesen steht – als fatal zu erweisen droht. Denn die verdorbenen Institutionen passen nicht mehr und verlieren ihre Steuerungskraft. Die gesetzten Anreize und Schranken vermögen die Akteure in Politik, Verwaltung und Wirtschaft nicht mehr so zu dirigieren, dass ihre Entscheidungen möglichst zum Vorteil für die Gemeinschaft ausschlagen. Es herrscht ein Zustand organisierter Unverantwortlichkeit.
Die Zusammenhänge, die zur Verdeutlichung der großen Linie am Schluss dieses Buches ausführlicher dargestellt sind, werden nirgendwo sonst thematisiert, weder von der etablierten Wissenschaft noch von der Publizistik. Einzelne Problemfälle treten zwar immer wieder in Erscheinung. Oft werden sie auch skandalisiert und sind deshalb unübersehbar. Doch was diese Welt »im Innersten zusammenhält«, das eigensüchtige Streben der sogenannten Eliten, ihre weit gesponnenen Beziehungsgeflechte und die spezifische Wirkungsweise der pervertierten Institutionen, bleibt im Verborgenen. Fast alle staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wortführer halten an einem normativ aufgeladenen, aber wirklichkeitsfernen Bild von sich selbst und von der Funktionsweise unserer Institutionen fest. Die Zusammenhänge herzustellen und die Realverfassung unseres Landes hinter den auf Glanzpapier vorgeschobenen Normativverfassungen zu enthüllen gilt als tabu. Solche Entzauberung müsste, so scheint man instinktiv zu befürchten, ja auch die Grundvorstellungen, auf denen Staat und Gesellschaft beruhen, ins Wanken bringen und die Legitimität der Herrschaft im Staat, in der Wirtschaft, in Verbänden und Medien erschüttern. In Wahrheit kann nur ungeschminkte Offenheit die Basis schaffen, um die tief gehenden Defizite unseres Gemeinwesens zum Wohle aller zu beseitigen. Der Idee nach hat die Demokratie ja auch den großen Vorzug, dass sie die öffentliche Diskussion ihrer Mängel erlaubt und so einer Versteinerung vorbeugt und ihre Leistungsfähigkeit auch gegenüber neuen Herausforderungen bewahrt.
Hält man sich also nicht an die Tabuisierung – und das sollte die ureigenste Aufgabe des Wissenschaftlers sein – und schiebt den interessen- und machtbedingten Schleier beiseite, entsteht ein Gesamtbild, das zu schlüssigen Erklärungen führt und weitgehende Folgerungen für Staat und Gesellschaft erzwingt. Das dafür erforderliche theoretische Rüstzeug ist im Ansatz da und dort und in unterschiedlichen Disziplinen durchaus vorhanden. Aber auch die Wissenschaft ist schwerfällig wie ein Tanker und vermag nur ganz langsam eine neue Richtung einzuschlagen. Zudem stehen diejenigen Wissenschaftler, die sich mit Parteien, Verbänden etc. befassen, diesen meist so nahe, dass sie ihnen nicht wehtun wollen. Deshalb scheut man davor zurück, die isolierten Ansätze zu einem problemorientierten Ganzen zusammenzufügen, eine umfassende Gesamtsicht zu entwickeln und diese konsequent auf die verschiedenen Bereiche unseres Gemeinwesens anzuwenden. Genau dies aber wird im vorliegenden Buch versucht.
I
Volkssouveränität und Verfassung
1 Volkssouveränität: Usurpation durch die politische Klasse
Die demokratische Bewegung hat das Gottesgnadentum, das die Herrschaft der Monarchen und des Adels über Jahrhunderte legitimiert hatte, als fromme Lüge entlarvt und an ihre Stelle die – unter gewaltigen Blutopfern erkämpfte – Volkssouveränität gesetzt. Doch die erweist sich heute ebenfalls als bloßes herrschaftsstützendes Trugbild, mit dem nunmehr eine neue politische Klasse ihrer Stellung ideologischen Glanz zu verleihen und das Volk ruhig zu stellen sucht.
Die viel beschworene Volkssouveränität, die die Basis unseres ganzen demokratischen Staatsaufbaus darstellt, ist bei genauem Hinsehen nichts weiter als eine Fiktion. Weder beruht das Grundgesetz von 1949 auf Entscheidungen des Volkes, noch hat das deutsche Volk heute über die europäische Verfassung (die nun nicht mehr so heißen darf) mit zu entscheiden – und über Erweiterungen der EU schon gar nicht.
Volkssouveränität bedeutet: Die Schaffung der Verfassung als politisch-rechtlicher Grundlage eines Gemeinwesens ist Sache des Volkes. Eine solche »Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit des Volkes. Darin liegt ihr Pathos, und dafür sind die Völker auf die Barrikaden gegangen.« So hatte es der SPD-Abgeordnete Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz in den Jahren 1948 und 1949 konzipierte, formuliert. Doch darum ist es in unserer Republik schlecht bestellt. Selten war ein Volk so sehr von der Gestaltung »seiner« Verfassung ausgeschlossen wie das deutsche. Zwar behauptet die Präambel des Grundgesetzes das Gegenteil: »Das deutsche Volk« habe sich »kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz« gegeben, und Art. 20 postuliert, »alle Staatsgewalt« gehe »vom Volke aus«. Die herrschende deutsche Verfassungslehre nimmt – staatstragend, wie sie ist – die vollmundigen Sätze für die Wirklichkeit und schließt daraus, die Organe der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit seien schon dadurch demokratisch legitimiert, dass das Grundgesetz sie nennt. Doch die ganze Konstruktion steht auf tönernen Füßen, weil die genannten Sätze schlichtes Wunschdenken sind. In Wahrheit fehlt dem Grundgesetz selbst die erforderliche demokratische Legitimation. Die sogenannte bundesdeutsche Volkssouveränität ist ein ideologisch verbrämtes Traumgebilde.
Dass die Väter des Grundgesetzes so taten, als ob, hatte seine Gründe: Seit der Aufklärung und den darauf fußenden Menschenrechtserklärungen gelten nur solche Verfassungen als anerkennenswert, die das Volk sich selbst gegeben hat. Dieses Prinzip gehört zu den »unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten«, zu denen sich das »Deutsche Volk« gemäß Art. 1 Abs. 2 Grundgesetz ausdrücklich »bekennt«. Dementsprechend sind die 1946 und 1947 erlassenen Verfassungen der Länder der späteren Bundesrepublik regelmäßig von Versammlungen beschlossen worden, die zu diesem Zweck direkt vom Volk gewählt worden waren, und vor ihrem Inkrafttreten wurden sie vom Volk in Abstimmungen angenommen.
Alles das fehlt beim Grundgesetz. Tatsächlich waren es die westlichen Besatzungsmächte, die die Entstehung des Grundgesetzes beherrschten. Sie dekretierten den Erlass des Grundgesetzes, nahmen massiv Einfluss auf seinen Inhalt und stellten sein Inkrafttreten unter den Vorbehalt ihrer Genehmigung. Und selbst der Parlamentarische Rat war keineswegs vom Volk eingesetzt, sondern von den Landesparlamenten, die das Grundgesetz auch mehrheitlich beschlossen. Nach den Landesverfassungen waren die Landesparlamente dazu aber gar nicht befugt. Sie waren von den Bürgern für ganz andere Aufgaben gewählt worden. In ihrer Wahl konnte deshalb keine Ermächtigung zur Bundes-Verfassungsgebung seitens des Volkes gesehen werden. Und auch abschließend durften die Westdeutschen nicht über das Grundgesetz abstimmen, obwohl selbst die Alliierten dies ausdrücklich verlangt hatten (dies aber später nicht energisch durchsetzten).
Im Parlamentarischen Rat war man sich des konstitutiven Mangels auch völlig bewusst. Sein Präsident, der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, bekannte freimütig: »Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes, wir haben den Auftrag von den Alliierten«, und Carlo Schmid sprach unumwunden von einer Form der »Fremdherrschaft«. Deshalb hatte der CDU-Abgeordnete Bernhard von Brentano, der spätere Außenminister, bei der zweiten Lesung des Grundgesetzes den Antrag gestellt, das Volk wenigstens über das Grundgesetz abstimmen zu lassen, und dies so begründet:
»Indem wir anerkannt haben, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, haben wir ein unverzichtbares, aber auch unabdingbares Recht des Volkes anerkannt, über sein politisches Schicksal selbst zu entscheiden... Nicht wir, sondern nur die Gesamtheit des Volkes kann die Verfassung mit dem Vertrauen ausstatten und sie damit zu lebendiger Wirksamkeit bringen, die für eine gesunde Entwicklung unserer Demokratie Voraussetzung ist.«
Der Antrag fand zwar die Zustimmung der FDP und der KPD, wurde aber von der Mehrheit niedergestimmt. Damals ließ sich die Ablehnung immerhin einigermaßen plausibel begründen: Das Grundgesetz unterliege der Kontrolle der Besatzungsmächte und erfasse auch nur die Deutschen der drei westlichen Besatzungszonen. Es sei deshalb keine echte demokratische Verfassung und könne ohnehin nur vorläufigen Charakter haben, daher auch bloß die Bezeichnung »Grundgesetz«. Zudem stand der Parlamentarische Rat unter dem Eindruck einer akuten Ost-West-Krise. Das von den Sowjets blockierte Berlin musste mit »Rosinenbombern« entsetzt werden, die in Frankfurt im Minutentakt starteten und landeten – unmittelbar über den Köpfen der Ratsmitglieder. Man fürchtete, die Kommunisten würden eine Abstimmung der Demokratie-entwöhnten Deutschen als Agitationsplattform missbrauchen.
Die damaligen Argumente gegen die Verfassungsgebung durch das Volk waren allerdings durchweg zeitgebunden und sind spätestens mit der Wiedervereinigung entfallen. Die Väter der Verfassung hatten dafür in weiser Voraussicht auch Vorsorge getroffen. Denn das Grundgesetz sieht in seinem Schlussartikel 146 für den Fall der deutschen Wiedervereinigung seine eigene Ablösung vor, sobald »eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Selbstbestimmung beschlossen worden ist«. Das erforderliche Ausführungsgesetz zu dieser Vorschrift, das auch eine Initiative aus der Mitte des Volkes ermöglichen würde, hat das Parlament aber bisher zu erlassen versäumt. Dafür, dass der Weg des Art. 146 GG nach der Vereinigung nicht beschritten und die demokratische Legitimation nicht nachgeholt wurde, gibt es keine stichhaltige Begründung – außer die Machtinteressen der politischen Klasse. Auch die nach der Hitlerdiktatur zunächst von vielen unterstellte Unmündigkeit des deutschen Volkes sollte nach fünfzig Jahren demokratischer Praxis im Westen und nach erfolgreicher basisdemokratischer Revolution im Osten (»Wir sind das Volk«) inzwischen eigentlich als überwunden gelten.
Zusammenfassend muss man feststellen: Die angebliche Volkssouveränität ist eine mit den vollmundigen Behauptungen des Grundgesetzes unvereinbare Lüge, für die es heute keine Rechtfertigung mehr gibt. Teile der deutschen Staatsrechtslehre, für die z. B. Gerd Roellecke steht, geben das Fiktive der bundesdeutschen Volkssouveränität denn auch offen zu.
Das hat die gewichtige Konsequenz, dass die demokratische Legitimation, die alle Staatsorgane vom souveränen Volk herleiten, entfällt. Geht man davon aus, die Verfassung beruhe auf dem Willen des Volkes, wird nämlich auch den Institutionen, die die Verfassung geschaffen und denen sie Funktionen zugewiesen hat, eine Art demokratische Salbung zuteil. Dann erhalten Bundestag, Regierung, Präsident, Verfassungsgericht etc. verfassungsunmittelbare sogenannte institutionelle und funktionelle demokratische Legitimation (so das Bundesverfassungsgericht und die herrschende Staatsrechtslehre). Da dem Grundgesetz selbst aber die demokratische Legitimation fehlt, fällt die ganze Konstruktion in sich zusammen wie ein Kartenhaus (zur sogenannten personellen demokratischen Legitimation, die angeblich durch die Wahl des Bundestags vermittelt wird, siehe S. 42 ff.).
Der größte Teil der Staatsrechtslehrer will das Fehlen der Volkssouveränität denn auch auf gar keinen Fall wahrhaben. Zu ihnen zählt Reinhard Mußgnug. Er flüchtet in die Behelfsthese, das demokratische Defizit des Grundgesetzes sei durch die hohe Wahlbeteiligung bei der ersten Bundestagswahl im Herbst 1949 geheilt worden. Doch das widerspricht jeder Logik: Bei Bundestagswahlen stand damals wie heute nur die Entscheidung zwischen bestimmten Parteien, die um die Regierungsbildung wetteifern, nicht aber eine Entscheidung für oder gegen das Grundgesetz zur Debatte. Die genannte These ist letztlich nur Ausdruck einer ideologischen Überhöhung des Status quo und der Maxime, dass nicht sein kann, was nicht sein darf: Eine sich als demokratisch ausgebende Verfassung muss demokratisch legitimiert sein. Ist sie es nicht, muss man es irgendwie hinbiegen.
Eine andere Lehrmeinung, für die z. B. der Staatsrechtslehrer und frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof steht, versucht, die Frage, ob das Volk das Grundgesetz angenommen habe oder nicht, überhaupt als irrelevant abzutun: Da die Zustimmung der Bürger einer bestimmten Generation alle späteren Generationen ohnehin nicht binden könne, spiele es heute keine Rolle mehr, ob das Volk früher einmal zugestimmt habe oder nicht. Doch dieser Argumentation ließe sich dadurch leicht der Boden entziehen, dass man nicht nur das überfällige Ausführungsgesetz zu Art. 146 GG erließe, sondern auch jeder Generation das Recht gäbe, auf das Grundgesetz einzuwirken – ein Gedanke, den die Politikwissenschaftlerin Heidrun Abromeit in die Diskussion gebracht hat. Zu diesem Zweck müsste man auch auf Bundesebene Volksbegehren und Volksentscheide einführen, mittels derer das Volk das Grundgesetz jederzeit ändern könnte (was fast alle Bundesländer hinsichtlich ihrer Landesverfassungen bereits vorsehen). Dann wiederum könnte das Nicht-Gebrauch-Machen von der Möglichkeit, das Grundgesetz zu ändern, vernünftigerweise als Einverständnis mit dessen aktuellem Inhalt verstanden werden. Es gibt also durchaus einen Weg, die Souveränität des deutschen Volkes zu verwirklichen, und zwar die Souveränität der gegenwärtigen und aller zukünftigen Generationen. Man muss dem Bundesvolk lediglich ein Recht geben, das auf Landesebene ganz selbstverständlich ist.
Übrigens: Der Gedanke, jede Verfassung müsse von Zeit zu Zeit überprüft werden und jede Generation eines Volkes müsse das Recht haben, über ihre Verfassung neu zu befinden, ist zeitlos. Der Gedanke stammt von Thomas Jefferson, dem »Vater« der amerikanischen Verfassung, und er ist zum Beispiel in US-Bundesstaaten auch realisiert. In Michigan, Illinois, Missouri und anderen Staaten bestimmt die Verfassung, dass die Bürger alle zwanzig Jahre per Volksabstimmung darüber entscheiden dürfen, ob eine neue verfassunggebende Versammlung einberufen werden soll oder nicht.
In Deutschland ist die Herstellung der Volkssouveränität allerdings schwierig und stößt auf große Widerstände. Denn in die Position, die dem Volk vorenthalten wird, ist inzwischen die politische Klasse eingerückt. Sie hat die Souveränität an sich gerissen und macht gegen jeden Versuch, das zu ändern, massiv Front – nicht zuletzt dadurch, dass sie diesen Sachverhalt ideologisch verschleiert und ein gezieltes Sperrfeuer gegen jeden, der um Aufklärung bemüht ist, entfacht. In fraktions- und länderübergreifender Einigkeit gestaltet die politische Klasse die Verfassung nach ihren Belangen, vor allem die für den Erwerb und Erhalt der Macht zentralen Regeln: das Wahlrecht, die Übergröße der Parlamente, die Finanzierung von Parteien, Fraktionen und Parteistiftungen, die Überversorgung von Politikern, die parteipolitische Vergabe von Posten, die Deformation des Föderalismus und die prägende Struktur der politischen Willensbildung insgesamt. Sie wird auch direktdemokratische Elemente kaum freiwillig auf Bundesebene einführen.
Auch auf Europaebene bleibt das deutsche Volk bisher außen vor. Wichtige Abstimmungen, etwa über die Einführung des Euro, die sogenannte europäische Verfassung (auch wenn man sie seit der Regierungskonferenz von Heiligendamm vom Juni 2007 nicht mehr so bezeichnet) und die Erweiterung der EU, erfolgen nur im Bundestag – und dort auch noch im Wege bloßen Abnickens und ohne wirkliche Debatte. Das Volk bleibt ausgeschlossen, ganz zu schweigen von einer Volksabstimmung, wie sie etwa in Frankreich, Dänemark, Irland, den Niederlanden und anderen Ländern stattgefunden hat.
Dabei hatten große Teile des politischen Establishments zu Beginn des europäischen Verfassungsgebungsprozesses auch in Deutschland die Notwendigkeit einer Volksabstimmung über die europäische Verfassung selbst eingeräumt. Ministerpräsidenten wie Peter Müller (Saarland), Wolfgang Böhmer (Sachsen-Anhalt), Dieter Althaus (Thüringen) und Edmund Stoiber (Bayern) plädierten für ein Referendum. Stoiber: »Bei Fragen von fundamentaler Bedeutung darf nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werden.« Und am 26. November 2001 sprachen sich CDU und CSU insgesamt für ein Referendum über eine europäische Verfassung aus. Doch am Ende des Prozesses hatte man alle guten Vorsätze vergessen, fiel wieder auf die Abwehrhaltung gegen direkte Demokratie zurück, und auch die Spitzen der Union fügten sich in eine rein parlamentarische Ratifikation, die dann auch noch in eine regelrechte Farce ausartete: Auf der Bundestagssitzung im Mai 2005 wurde jede Kritik von der Fraktionsregie unterdrückt. Kein Gegner des Vertragswerkes durfte ans Rednerpult. Neunzig Abgeordnete konnten ihre Erklärungen nur schriftlich zu Protokoll geben. Dahinter stand nicht zuletzt die Absicht, der kurz darauf folgenden Volksabstimmung in Frankreich durch ein geschlossenes Ja zur europäischen Verfassung ein Signal zu geben. So wurde die gesamte deutsche Volksvertretung, wie der Politikwissenschaftler Otmar Jung mit Recht kritisiert, in unwürdiger Weise »für eine außenpolitische ›Geste‹ der Demonstration instrumentalisiert«.
Dass die Entscheidungen in aller Eile über die Köpfe der Bevölkerung hinweg getroffen wurden, erstickte jede breite und tief gehende öffentliche Diskussion. Wie immer, wenn das Volk nichts zu sagen hat, fehlte jede fundierte Erörterung des Für und Wider, obwohl es um wahrhaft fundamentale Fragen ging, nämlich um die Übertragung von Teilen der Souveränität von Bonn bzw. Berlin auf Brüssel. Das Bewusstsein der politischen Klasse, die Bürger nicht überzeugen zu müssen, und das Gefühl der Bürger und Medien, doch nichts bewirken zu können, weil alles schon entschieden sei, nahm jeder großen Debatte schon im Ansatz die Motivation.
Warum eigentlich dürfen nur die Bürger anderer EU-Staaten über europäische Verfassungsfragen abstimmen und nicht auch die Deutschen? In Sachen Europa ist die direkte Mitbestimmung der Bürger genau so unerlässlich wie in grundlegenden nationalen Fragen (siehe S. 73 ff.). Über den neuen EU-Reformvertrag findet nun allerdings auch in Frankreich und den Niederlanden keine Volksabstimmung mehr statt. Begründung: Das Risiko einer Ablehnung sei zu hoch, und der Vertrag sei ja auch keine Verfassung mehr. In Wahrheit ist er fast inhaltsgleich mit dem früheren Text. Hier zeigt sich, wie die europäische Demokratie immer weiter erodiert. Immerhin: Mindestens die Iren stimmen über die europäische Verfassung ab, im Mai oder Juni 2008.
2 Verfassung: Sicherung oder Gefährdung des Gemeinwohls?
Ferdinand Lassalle sah in Verfassungen schon vor eineinhalb Jahrhunderten nichts weiter als den Ausdruck der jeweiligen Machtverhältnisse. Bloß werde das durch idealistische Konstrukte verschleiert. Lassalle wandte sich gegen die Ausbeutung der Arbeiterschaft. Wird heute aber nicht das ganze Volk ausgebeutet – durch die politische Klasse, die den Staat in Besitz genommen und die Verfassung ihren Zwecken nutzbar gemacht hat?
Seit den Ursprüngen der modernen Demokratie in den USA und in Frankreich unterscheidet die Verfassungstheorie zwischen der verfassunggebenden Gewalt (pouvoir constituant), die durch Erlass der Verfassung ausgeübt wird, und der durch die Verfassung geschaffenen Gewalt (pouvoir constitué), die jeweils durch Wahlen eingesetzt wird. Beides, der Erlass der Verfassung und die Wahl der Regierung, steht in der Demokratie dem Volke zu. Die Verfassung soll die Voraussetzungen für bürgernahe und gute Politik schaffen und die Akteure daran hindern, statt dem Wohl des Volkes ihr eigenes Wohl zu verfolgen. Sie hat vor allem drei Funktionen: die Staatsmacht demokratisch zu legitimieren, Machtmissbrauch zu verhindern und günstige Bedingungen für die Gemeinwohlgestaltung durch die Politik zu sichern. In Bundesstaaten mit kommunaler Selbstverwaltung grenzt die Verfassung zusätzlich die Kompetenzen von Bund, Ländern und Gemeinden voneinander ab.
Demokratische Legitimation verlangt, dass zunächst einmal die Verfassung selbst und damit auch alle von ihr geschaffenen Institutionen und die ihnen zugewiesenen Funktionen auf dem Willen des Volkes beruhen. Daran fehlt es beim Grundgesetz, wie wir gesehen haben (siehe S. 15 ff.). Demokratische Legitimation verlangt weiter, dass die Mitglieder des Parlaments vom Volk gewählt werden und damit auch der Kanzler, der Bundespräsident, die Verfassungsrichter und alle anderen vom Parlament gewählten Amtsträger zumindest mittelbar demokratisch legitimiert sind. Auch daran fehlt es in unserer Republik (siehe S. 42 ff. und 175 ff.).
Machtmissbrauch soll verhindert werden durch Gewaltenteilung und Grundrechte sowie deren Sicherung durch das Bundesverfassungsgericht. Günstige Bedingungen für gute Politik zu schaffen ist vor allem die Aufgabe des Wahlsystems, das den Kern des verfassungsrechtlichen Demokratieprinzips bildet.
Wie aber soll eine solche Verfassung, die auch eigennützige Akteure dazu bringt, die Interessen der Bürger, und zwar möglichst vieler Bürger, zu verfolgen, zustande kommen? Wenn sie schon nicht aus dem Willen des Volkes hervorgegangen ist, muss sie jedenfalls so gestaltet werden, dass sie zumindest als aus dem Willen der Bürger hervorgegangen vorgestellt werden kann. Das verlangt Unabhängigkeit und Neutralität derer, die die Verfassung konzipieren. Können Politiker, die später selbst an die Regierung kommen wollen, aber wirklich dazu gebracht werden, bei Festlegung der Spielregeln ihre Eigeninteressen zu unterdrücken? Der Sozialphilosoph John Rawls will allen einen »Schleier des Nichtwissens« überstreifen, der ihnen ihre eigenen Interessen verbirgt und so wirkliche Unbefangenheit schafft – ähnlich dem Bild der Justitia, deren Augen verbunden sind, damit sie »ohne Ansehen der Person«, also unbeeinflusst und gerecht, entscheiden kann.
Doch diese zentrale Voraussetzung für eine gute Verfassung, die Unabhängigkeit des Verfassungsgesetzgebers, liegt in unserer Republik nicht vor. Diejenigen, die die Verfassung beschließen, sind alles andere als neutral. Die Regeln des politischen Kampfes werden bei uns von den Kämpfern selbst, das heißt der politischen Klasse, gemacht. In vielen Fällen fehlt überhaupt eine grundgesetzliche Regelung. Grundlegende Bestimmungen, die eigentlich in die Verfassung gehören, werden stattdessen dem einfachen Gesetzgeber überlassen. Beispiele sind Wahlgesetze, Abgeordneten- und Ministergesetze sowie das Parteiengesetz. Sie sind materielles Verfassungsrecht, stehen aber dennoch nicht im Grundgesetz. Das erleichtert es den Kämpfern um die Macht, sie an ihren Interessen auszurichten. Die politische Klasse hat das Wahlrecht so verfälscht, dass es dem Wähler keine Wahl mehr lässt und den Wettbewerb der Personen und Parteien krass zugunsten der Etablierten verzerrt. Auch das Parteien- und das Abgeordnetenrecht hat die politische Klasse nach ihren Interessen gestaltet.
Selbst das Grundgesetz unterliegt dem Einfluss der Akteure, die es eigentlich zügeln soll. Schon auf den Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz konzipierte, haben spätere Nutznießer eingewirkt. Die Bevorzugung des Bundesratsmodells anstelle des Senatsmodells wurde von den davon profitierenden Ministerpräsidenten selbst durchgesetzt (siehe S. 215). Wirksame Regeln gegen die Verbeamtung der Parlamente fanden im Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder selbst zu sechzig Prozent aus dem öffentlichen Dienst kamen, keine Mehrheit (siehe S. 178 ff.). Zudem kann die Verfassung jederzeit geändert werden. Dazu sind Zwei-Drittel-Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat erforderlich, über die die Fraktionen- und Föderalismus-übergreifende politische Klasse aber verfügt. So wurde die Pflicht zur Neugliederung der Bundesländer, statt ihr zu folgen, 1976 kurzerhand aus dem Grundgesetz gestrichen (siehe S. 212). Auch die Umgestaltung unseres Föderalismus zu einem System organisierter Unverantwortlichkeit geht auf die Praxis derer zurück, denen das Grundgesetz eigentlich Vorgaben machen sollte (siehe S. 217 ff.).
Da die Verfassung in der Hand der politischen Klasse ist, sind Anpassungen an neue Entwicklungen praktisch unmöglich. Gerade das aber wäre dringend erforderlich. Wesentliche Teile des Grundgesetzes wurden aus früheren Verfassungen übernommen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse aber völlig gewandelt, und ganz neue Mächte sind auf den Plan getreten. Die Wirklichkeit wird heute von politischen Parteien, Interessenverbänden, Medien und Großunternehmen dominiert, ohne dass es wirksame Schranken gegen Machtmissbrauch dieser Kräfte gäbe. Das bewirkt eine für unser politisches Gemeinwesen charakteristische Verschleierung der wahren Machtverhältnisse: Der vom Grundgesetz konstruierte Staat ist mit allen seinen Organisationen nur die formale Hülle, hinter der die eigentlichen machtvollen Akteure ihr Spiel treiben. Das Grundgesetz kann deshalb viele unserer aktuellen Probleme gar nicht mehr erfassen, und die erforderlichen Anpassungen nimmt die politische Klasse, die von den Defiziten profitiert, eben nicht vor. Auch für die grassierende parteipolitische Ämterpatronage und dafür, dass dagegen nichts Wirksames unternommen wird (siehe S. 92 ff.), ist die politische Klasse verantwortlich, genauso für die Verbeamtung der Parlamente und andere Verstöße gegen die Gewaltenteilung. Die bestehende Verfassung, die die Macht in Schranken halten und zum Besten der Gemeinschaft lenken soll, ist selbst eine Ausprägung der Macht.
Was die Verfassung beinhaltet, sagt letztverbindlich allerdings nicht der auslegungsbedürftige Verfassungstext, sondern das unabhängige Verfassungsgericht, das die Auslegung vornimmt. Darin könnte man einen gewissen Ersatz dafür sehen, dass der Verfassungsgeber selbst nicht unabhängig war und ist. Auch dieser Gedanke trägt allerdings nur begrenzt. Denn erstens werden die Richter von den zu Kontrollierenden ausgewählt (siehe S. 94 f.). Das beeinträchtigt ihre Unabhängigkeit, besonders, wenn gezielt Personen ins Gericht gewählt werden, die spezielle politische Formeln, Theorien und Mythen propagieren, die aus dem Geist der politischen Klasse resultieren und ihre Stellung stützen. Nur so sind Urteile etwa zur Fünf-Prozent-Klausel im Wahlrecht (siehe S. 57 ff.), zur Unmittelbarkeit der Wahl von Abgeordneten (siehe S. 42 ff.), zur Parteienfinanzierung (siehe S. 200 ff.), zu den Abgeordnetendiäten und zu Fragen direkter Demokratie (siehe S. 78) zu verstehen. Zweitens kann das Gericht nur auf Antrag der unmittelbar Betroffenen tätig werden, nicht aber auf Antrag von Bürgern, die gegen die Selbstbedienung der politischen Klasse vorgehen wollen. Die Beschränkung des Antragsrechts mindert die Kontrollkraft des Gerichts. Deshalb bestehen weiterhin Parteisteuern (siehe S. 111 ff.) und eine überzogene Steuerbegünstigung von Spenden und Beiträgen (siehe S. 102), um nur diese Fälle offensichtlicher Verfassungswidrigkeit zu nennen. Drittens kann die politische Klasse Urteile des Gerichts unterlaufen, indem sie mit Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat die Verfassung ändert. Die schon erwähnte Beseitigung der Pflicht zur Neugliederung der Bundesländer und die Absicherung der sogenannten Boden reform von 1945 in der Sowjetzone (siehe S. 254 ff.) waren Beispiele. Derartiges kann allerdings auch einmal an der Öffentlichkeit scheitern, wenn das Entscheiden in eigener Sache zu offensichtlich ist. So ist im Jahre 1995 der Versuch, die Diäten von Bundestagsabgeordneten an das Gehalt von Bundesrichtern zu koppeln, gescheitert. Der Bundesrat verweigerte nach massiver öffentlicher Kritik und einem Appell von 86 Staatsrechtslehrern seine Zustimmung. Das hielt den Bundestag aber nicht davon ab, die Gehälter von Bundesrichtern zur Richtlinie zu nehmen und darauf z.B. die jüngste Diätenerhöhung vom November 2007 zu gründen (siehe S. 140 ff.).
3 Politische Klasse: Der heimliche Souverän
Zahlreiche Missstände in Staat und Politik werden den Parteien zugerechnet. Sie wirken, so sagt man, nicht nur an der politischen Willensbildung des Volkes mit, wie es in Art. 21 Grundgesetz heißt, sie beherrschen sie. Dies ist zwar richtig, aber nur ein Teil der Wahrheit, der wichtigere Teil bleibt verborgen. In den Parteien gibt es nämlich ganz unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Perspektiven und Interessen. Dies zeigte die Auseinandersetzung um die Weizsäcker’sche Parteienschelte im Jahre 1992 exemplarisch. Da die Kritik des damaligen Bundespräsidenten sich pauschal gegen die politischen Parteien richtete, ließ sie Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich als Vorsitzender der CDU getroffen fühlte, die Möglichkeit, zu seiner Entlastung die zwei Millionen Menschen anzuführen, die in den Parteien ehrenamtlich tätig sind, oft ohne für sich persönlich etwas zu erstreben. Und diese Feststellung Kohls war im Kern ja auch durchaus zutreffend. Die Kontroverse verdeckte aber das Wesentliche: In Wahrheit sind es nicht so sehr »die Parteien« als Ganzes, sondern eine zahlenmäßig kleine, aber sehr machtvolle Gruppe innerhalb der Parteien, die Berufspolitiker, die die Hauptverantwortung für Fehlentwicklungen tragen. Und die große Mehrheit der Parteimitglieder übt daran oft am heftigsten Kritik, ist aber meist in einer ganz ähnlichen Ohnmachtssituation wie die Bürger insgesamt, die sich außerstande sehen, etwas zu ändern. Mit dem Fortschreiten der Professionalisierung der Politik haben Berufspolitiker innerhalb der Parteien weitgehend das Sagen. Ihre Interessen und Motive prägen die parteiinterne Wirklichkeit und die Struktur der politischen Willensbildung. Die überkommene Kritik, die auf »die Parteien« insgesamt abhebt, ist auf einem überholten Diskussionsstand stehen geblieben.
In der von Berufspolitikern beherrschten Verfassungswirklichkeit geht es um Macht, Status, Posten und Geld. Die Existenz solcher Eigeninteressen kann jeder in der Politik erfahrene Beobachter bestätigen. Zwei Motive sind elementar: Das eine ist das Interesse an der Mehrheit und damit an Macht und Gestaltung, um welche Regierung und Opposition konkurrieren. Das andere vitale Interesse ist, von der Politik leben zu können, und zwar möglichst gut und möglichst auf Dauer. Da die Politik selbst über ihren Status entscheidet, kommt es zur Überversorgung von Politikern, zur Aufblähung der Posten und zur Abschottung gegen Konkurrenz. Hierher gehören Doppelbezüge und überzogene Altersrenten von Politikern, viel zu große Parlamente und die vielfältigen selbst gezimmerten Regeln, mit denen Politiker ihre Abwahl erschweren und möglichen Konkurrenten wenig Chancen lassen.
Das Versorgungsinteresse unterscheidet sich dadurch vom Machtinteresse, dass nicht nur eine Seite, also die Spitzenpolitiker der jeweiligen Regierungsparteien, es befriedigen kann, sondern gleichzeitig alle Berufspolitiker, auch die der parlamentarischen Opposition. Das Versorgungsinteresse ist also – fraktionsübergreifend – allen hauptberuflichen Politikern gemeinsam, so dass sie es am wirkungsvollsten nicht durch Konkurrenz, sondern durch Kooperation und Kollusion befriedigen können, und genau das geschieht in der Praxis. Gerade bei der Menge der Hinterbänkler ist das Streben nach finanzieller Absicherung besonders ausgeprägt, weil sie – anders als die politische Elite in den vorderen Rängen – dieses Interesse nicht gegen das Interesse an Macht und Mehrheit abwägen müssen. Sie kommen ohnehin nicht als Minister oder Inhaber anderer hoher Ämter infrage. Für sie persönlich ändert sich auch dann, wenn ihre Partei die Wahlen gewinnt und die Regierung übernimmt, nicht viel, jedenfalls nicht so viel, dass der Wunsch, Regierungsfraktion zu werden oder zu bleiben, die Dominanz des eigenen Versorgungsinteresses erschüttern könnte.
Das Zusammenwirken der Berufspolitiker bei der Sicherung ihrer übereinstimmenden Interessen und die daraus resultierende politische Kartellierung sind das zentrale Phänomen, das die Politikwissenschaft heute unter dem Begriff »politische Klasse« thematisiert. Ehemalige Volksparteien entwickeln sich zu »Kartellparteien«, in denen Berufspolitiker das Sagen haben und deren zentrales Kennzeichen darin liegt, dass sie ihre Position durch Nutzung staatlicher Macht-, Personal- und Geldmittel stetig verbessern und zugleich (fast) unangreifbar machen gegen die Konkurrenz aller möglichen Herausforderer, so dass neue, noch nicht etablierte politische Kräfte praktisch keine Chance haben (siehe S. 51 ff.).
Da die Interessenten selbst an den Schalthebeln der staatlichen Macht sitzen, können sie ihre Wünsche direkt in Gesetze oder Haushaltstitel umsetzen. Das betrifft nicht nur das Wahlrecht, die staatliche Finanzierung von Parteien, Fraktionen und Parteistiftungen, die Versorgung von Politikern und die parteiliche Vergabe von Posten, Behörden und Ämtern aller Art. Es betrifft vielmehr auch – und das wird in der publizistischen Diskussion noch völlig übersehen – die Prägung der Struktur und der Institutionen der politischen Willensbildung insgesamt (siehe S. 37 f.). Da Regierungsmehrheit und Opposition gemeinsam auch über die für Verfassungsänderungen nötigen Mehrheiten verfügen, werden alle rechtlichen Barrieren gegen einvernehmlich durchgesetzten Machtmissbrauch stumpf. Sie können machen, was sie wollen, ohne dass ihnen noch eine Opposition oder ein Verfassungsgericht in den Arm fällt. Da sie in der Gemeinsamkeit ihrer Interessenlage über die Spielregeln von Macht und Einfluss verfügen, sind sie quasi souverän. Damit ist die eigentlich dem Volk zukommende Souveränität auf die politische Klasse übergegangen.
Tatsächlich erschöpfen sich Macht und Einfluss der politischen Klasse darin noch keineswegs und gehen weit über die Festlegung der formalen Regelungen hinaus: Wer den Staat beherrscht, hat Einfluss auf die gültigen ideologischen Grundvorstellungen und bestimmt, wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu dargelegt hat, letztlich die Denkkategorien mit, nach denen Politik überhaupt wahrgenommen und beurteilt wird. Die politische Klasse hat die Einrichtungen, die das Denken prägen, insbesondere die gesamte politische Bildung, fest im Griff. Die Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung, die Parteistiftungen und die meisten Volkshochschulen sind in ihrer Hand. Kaum ein Leiter einer größeren Schule, der nicht auch unter parteipolitischen Gesichtspunkten berufen wird, Führungskräfte der öffentlich-rechtlichen Medien werden nach Parteibuch bestellt (siehe S. 92 ff.). Die politische Klasse vergibt Ämter mit dem höchsten Ansehen bis hin zum Bundespräsidenten, zu Regierungsmitgliedern und Verfassungsrichtern. Sie verleiht Orden, Ehrenzeichen und Preise (siehe S. 181 ff.) und verpflichtet sich so fast alle zur Dankbarkeit, die öffentlich etwas zu sagen haben. Das erleichtert es ihr, Nonkonformisten, die gegen den Stachel löcken und an die Wurzel gehende Kritik an den Verhältnissen äußern, als politisch inkorrekt zu brandmarken, sie notfalls auch persönlich zu diffamieren und ins politische Abseits zu stellen. Und wenn dann doch einer vom inneren Kreis der Berufspolitiker sich aufrafft, etwas Kritisches zu sagen, wie Richard von Weizsäcker mit seiner Parteienkritik, wird das von der politischen Klasse und (fast) allen ihren unzähligen Zuarbeitern als Ausdruck von Undankbarkeit, ja von Verrat hingestellt.
Berufspolitiker verfügen damit – als einzige Berufsgruppe überhaupt – nicht nur über die gesetzlichen und wirtschaftlichen, sondern weitgehend auch über die ideologischen Bedingungen ihrer eigenen Existenz. Von daher wird die von Richard von Weizsäcker beschworene Gefahr, die Parteien – oder besser: die politische Klasse – drohten sich den Staat zur Beute zu machen – mit tiefgreifenden Rückwirkungen auf das politische System und die politische Kultur insgesamt – immer realer. Es ist auf diese Weise eine Verfassung hinter der Verfassung entstanden (siehe S. 30 ff.). Die realen Machtverhältnisse sprechen der geschriebenen Verfassung vielfach Hohn und verändern allmählich auch den Charakter der Parteien selbst.
Abhilfe kann nur das Volk selbst schaffen: Nur der wirkliche Souverän besitzt das Recht und die Kraft, dem angemaßten Souverän seine illegitim usurpierte Macht wieder zu entreißen. Ohne Revolution kann das nur im Wege von Volksbegehren und Volksentscheid geschehen (siehe S. 73 ff.).
4 Norm und Wirklichkeit: Die Verfassung steht nur auf dem Papier
Gute und bürgernahe Politik hängt nicht nur von der Tüchtigkeit und Integrität der Politiker ab, sondern auch davon, dass der rechtliche Rahmen adäquat ausgestaltet ist. Darin liegt der Grundgedanke des Konstitutionalismus. Ist das aber bei uns noch der Fall? Klaffen nicht geschriebene Verfassung und Realität so weit auseinander, dass das Grundgesetz seine Funktion nur noch eingeschränkt erfüllen und die Anreize für die Politiker nicht mehr so setzen kann, dass deren Entscheidungen möglichst zum Vorteil für die Gemeinschaft ausschlagen? Stehen nicht Kernvorschriften des Grundgesetzes nur noch auf dem Papier? Wird nicht der Sinn wichtiger Verfassungsvorschriften geradezu ins Gegenteil verkehrt? Das sind nicht nur juristische Fragen, sondern sie führen mitten ins Zentrum der Fehlentwicklungen, die allgemein beklagt werden: das Partizipationsdefizit und die mangelnde Handlungsfähigkeit der Politik.
Das Grundgesetz postuliert Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG). Deshalb müssen Beamte aufgrund von Unvereinbarkeitsvorschriften ihre Rechte und Pflichten ruhen lassen, wenn sie ins Parlament eintreten. Das verlangt die Trennung von Legislative und Exekutive. Doch ausgerechnet die Spitzen der Exekutive, die Kanzler, Minister und Parlamentarischen Staatssekretäre, gehören ganz ungerührt gleichzeitig dem Parlament an (siehe S. 194 ff.).
Doch damit nicht genug: Die ins Parlament gewählten Beamten können ihre Herkunft nicht verleugnen. Sie bleiben dem öffentlichen Dienst auch deshalb verbunden, weil sie bei Beendigung des Mandats einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung haben. Das erhöht die Attraktivität des Mandats und begünstigt die Verbeamtung der Parlamente (siehe S. 178 ff.). In vielen Landesparlamenten kommt mehr als die Hälfte der Abgeordneten aus dem öffentlichen Dienst. Wie sollen Beamtenparlamente noch die Verwaltung und den öffentlichen Dienst, also quasi sich selbst reformieren?
Geht es um die eigenen Diäten, um die Versorgung von Politikern und um die Parteienfinanzierung, ziehen Regierung und Opposition an einem Strang und sind sich ausnahmsweise fraktionsübergreifend einig, so dass die Kontrolle ausfällt. Ganz ähnlich ist es etwa bei der Abwehr von Wahlrechtsreformen (siehe S. 39 ff.). Statt Gewaltenteilung herrschen dann erst recht Gewaltenvermengung und Kungelei (siehe S. 37 f.).
Das Grundgesetz betont, dass Beamten- und Richterstellen nur nach persönlicher Qualifikation und fachlicher Leistung vergeben werden dürfen (Art. 33 Abs. 2 GG). Tatsächlich grassiert »Parteibuchwirtschaft« in immer weiteren Bereichen (siehe S. 92 ff.). Dann geraten auch die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Gebot, dass alle Bürger vom Staat gleich zu behandeln sind (Art. 3 GG), in Gefahr. Kann von Beamten, die ihre Stellung der parteilichen Begünstigung verdanken, wirklich erwartet werden, dass sie dem Patronageprinzip bei ihrer Amtsführung abschwören und nicht etwa ihre Parteigenossen bei der Vergabe von Aufträgen und Subventionen begünstigen?
Die Demokratie lebt von der Erwartung, dass Politik und Gesetzgebung tendenziell ausgewogene und richtige Entscheidungen hervorbringen. Tatsächlich vernachlässigt die Politik unter dem Druck von schlagkräftig organisierten Partikularverbänden leicht die wichtigen allgemeinen Interessen (siehe S. 285 ff.). Volksvertreter sind vor der Macht der Lobby völlig unzureichend geschützt. Der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung ist rein symbolische Gesetzgebung. Die Abgeordneten haben ihn so eng gefasst, dass er praktisch nie zur Anwendung kommen wird (siehe S. 289 ff.). Auch Zukunftsinteressen kommen typischerweise zu kurz. Der Kurzfristhorizont der Parteien- und Verbändedemokratie buttert sie unter. Die Folgen finden in der Staatsverschuldung (siehe S. 305 ff.), in der mangelnden Vorsorge für die künftige Alterssicherung, in der Überbesteuerung von Investitionen in Betriebe und in der mangelnden staatlichen Förderung von Kindern (verstanden ebenfalls als Investition in zukünftige Generationen, siehe S. 301 ff.) ihren Ausdruck.
Das Grundgesetz garantiert das Eigentum und lässt Enteignungen nur gegen Entschädigung zu (Art. 14 GG). Es schützt aber nicht vor dem gefährlichsten Zugriff des Staates auf das Vermögen seiner Bürger: Gegen Überbelastung mit Steuern und gegen Geldentwertung besteht kein grundrechtlicher Schutz, obwohl sie das Eigentum besonders nachhaltig aushöhlen können.
Das Grundgesetz, die Haushalts- und Gemeindeordnungen binden Staat und Kommunen und alle ihre Amtsträger an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Doch kaum eine rechtliche Bindung wird in der Praxis so häufig ignoriert.
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip verlangen Öffentlichkeit von Staat und Verwaltung. Tatsächlich herrscht meist das Gegenprinzip des Amtsgeheimnisses (siehe S. 297). Daran haben auch die Informationsfreiheitsgesetze nicht viel geändert.
Die Verfassungen verpflichten alle Amtsträger auf das Gemeinwohl. Das impliziert uneigennütziges Handeln. Tatsächlich orientieren sich Berufspolitiker jedoch im Zweifel meist an ihren eigenen Interessen.
Das Grundgesetz verspricht allen Bürgern die unmittelbare und freie Wahl ihrer Abgeordneten (Art. 28 Abs. 1 Satz 2 und Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG). So steht es jedenfalls auf dem Papier. In Wirklichkeit sind alle Kandidaten, die die Parteigremien auf sichere Listenplätze gesetzt oder in sicheren Wahlkreisen nominiert haben, damit praktisch schon gewählt, nur eben nicht von den Bürgern (siehe S. 42 ff.). Nach der Verfassung genießen alle Bürger das Recht gleicher Wählbarkeit. Tatsächlich geben die Parteien Anwärtern nur nach unendlicher »Ochsentour« die Chance, an aussichtsreicher Stelle nominiert zu werden (siehe S. 126 ff.). Dabei erfolgt die Auswahl nicht primär nach der Qualität als künftiger Volksvertreter, sondern nach Proporz, parteiinternen Machtstrukturen und nach den Vorleistungen, die der Kandidat für die Partei erbracht hat. Diese Ochsentour können sich aber nur »Zeitreiche« und »Immobile« leisten. Deshalb hat – neben Verbandsfunktionären – vor allem eine bestimmte Kategorie von Beamten, besonders Lehrer, die beste Voraussetzung, ein Parlamentsmandat zu erlangen und in Partei, Politik und Parlament eine Rolle zu spielen (siehe S. 178 ff.).
Die Abhängigkeit setzt sich auch nach der Wahl fort. Als Dank für die Verschaffung des Mandats muss der Abgeordnete hohe Abgaben aus seinem staatlichen Gehalt zahlen (siehe S. 111 ff.). Zudem ist er in die sogenannte Fraktionsdisziplin eingebunden. Das Grundgesetz garantiert den Abgeordneten zwar das freie Mandat (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG). Treffen sie aber Entscheidungen »nach ihrem Gewissen«, ohne dass die Fraktionsführung das Stimmverhalten ausnahmsweise einmal »freigegeben« hat, oder zahlen sie ihre – rechtswidrigen! – Parteisteuern nicht, geraten sie leicht ins innerparteiliche Abseits und müssen befürchten, bei der nächsten Wahl nicht wieder aufgestellt zu werden (siehe S. 157 ff.).
Regierungen, Fraktionen und Parteien werden durch Koalitionsvereinbarungen faktisch gebunden, die von wenigen politischen »Elefanten« ausgehandelt worden sind, und können die Vereinbarungen dann oft nur noch nachträglich abnicken und während der Legislaturperiode abarbeiten, wollen sie die Koalition nicht gefährden.
Die Verfassungen geben den Abgeordneten ausdrücklich einen Anspruch auf »eine ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung« (Art. 48 Abs. 3 Satz 1 GG), also auf Kostenerstattung und Ausgleich des Einkommensverlustes. Tatsächlich erhalten alle Abgeordneten eine gleich hohe Alimentation, so dass die materiellen Anreize, ein Mandat anzustreben, typischerweise gerade die Falschen ansprechen: diejenigen, deren Einkommen sich durch die Diäten erhöht und die von der Politik leben wollen, statt für sie (siehe S. 171 ff.).
Das alles hat eine geradezu abschreckende Wirkung auf hoch qualifizierte Persönlichkeiten: Die vorherige Ochsentour können sich viel gefragte Leute schon aus Zeitgründen gar nicht leisten, die Fraktionsdisziplin nimmt dem Mandat die Attraktivität für die besten und eigenständigsten Köpfe, und die beamtenähnliche Einheitsalimentation macht das Mandat gerade für die Erfolgreichsten zu einem finanziellen Zuschussgeschäft. Hinzu kommt, dass die amtierenden Abgeordneten den Staatsapparat nutzen, um das Risiko einer Abwahl zu minimieren und Seiteneinsteigern den Weg vollends zu verlegen. So pflegen Abgeordnete ihre aus Steuermitteln bezahlten Mitarbeiter auch vor Ort einzusetzen. Das verschafft ihnen im alles entscheidenden Kampf um die parteiinterne Nominierung einen schier uneinholbaren Vorteil gegenüber allen Herausforderern (siehe S. 162 f.). Hinzu kommt, dass Landtagsmandate als Fulltimejob bezahlt werden, obwohl sie auch in Teilzeit erledigt werden können (siehe S. 152 ff.). Das setzt Mandatsinhaber in den Stand, auf Staatskosten tagein, tagaus vor Ort Nominierungswahlkampf zu führen und möglichen Herausforderern vollends keine Chancen zu lassen.
Der Bundesrat soll die Länderinteressen in die Bundespolitik einbringen. In Wahrheit wird der Bundesrat zunehmend parteipolitisch instrumentalisiert. Im Bundesstaat sollen die Länder untereinander um die beste Politik wetteifern. Tatsächlich tendieren die Länder zur Vereinheitlichung, also einer Art Ersatzzentralismus. So haben sie ihre Kompetenzen etwa in der Schul- und Hochschulpolitik praktisch an die Kultusministerkonferenz abgetreten. Da diese aber grundsätzlich nur einstimmig entscheidet, bestimmt der Schwerfälligste das Tempo des ganzen Verbandes. Die Absprachen der Länderexekutiven im Bundesrat und in vielen Hunderten von interföderalen Gremien (zum Beispiel eben in der Konferenz der Kultusminister) haben fatale Rückwirkungen: Die Landesparlamente, also die Hauptorgane der Länder, werden zunehmend ausgeschaltet – und damit auch die sie wählenden Bürger.
Laut Präambel hat das deutsche Volk sich das Grundgesetz gegeben. Tatsächlich war aber selten ein Volk so sehr von der Gestaltung »seiner« Verfassung ausgeschlossen wie das deutsche (siehe S. 15 ff.). Das Gleiche gilt für die Europaebene. Der Maastricht-Vertrag, der sogenannte Verfassungsvertrag oder die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vollziehen sich in Deutschland praktisch unter Ausschluss des Volkes.
Das Grundgesetz verbrieft die Offenheit des politischen Wettbewerbs und die Chancengleichheit im Kampf um die Macht. Doch was bedeuten diese majestätischen Grundsätze in der Praxis, wenn eine professionalisierte politische Klasse – über die Fraktions- und die föderalen Grenzen hinweg – Kartelle bildet, um die Regeln des Machterwerbs und der Machtausübung in ihrem Interesse zu gestalten, die eigene Existenz zu sichern und sich gegen Einwirkungen der Bürger und Wähler zu immunisieren (siehe S. 26 ff.)? Läuft das dann in letzter Konsequenz nicht auf die Umkehrung der Richtung der politischen Willensbildung hinaus, die in der Demokratie ja eigentlich von unten nach oben verlaufen sollte?
Gegen das Wuchern der Eigeninteressen der politischen Klasse gibt es letztlich nur ein wirksames Gegenmittel, die Aktivierung des Volks selbst als des eigentlichen Souveräns in der Demokratie: Das ganze System ist für den Willen der Bürgerschaft durchlässiger zu machen, das heißt, der Common Sense der Bürger muss den ihm in der Demokratie zukommenden Einfluss erhalten. Nur dann kann der Bürger wirklich mitbestimmen. Nur dann können die verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden, nur dann können die Handlungsfähigkeit der Politik und ihr Vermögen, auf neue Herausforderungen zu reagieren, wiederhergestellt werden. Die Erkenntnis, dass letztlich allein das Volk als wirksames Gegengewicht gegen Fehlentwicklungen der repräsentativen Demokratie in Betracht kommt, folgt aus der inneren Logik der Demokratie und war in früheren Zeiten intellektuelles Gemeingut. Die Verschüttung dieser Erkenntnis beruht auf den ideologischen Selbstschutz- und Immunisierungsstrategien der politischen Klasse. Sie fürchtet mit Recht, die hier angesprochenen urdemokratischen Mechanismen könnten ihre Monopolherrschaft gefährden (siehe S. 73 ff.).
5 Repräsentation und Partizipation: Dichtung statt Wahrheit
Repräsentation im staatsrechtlichen Sinn meint Herrschaft für das Volk, wobei die Herrscher ihre Legitimation früher von oben ableiteten (»von Gottes Gnaden«), heute von unten (»im Namen des Volkes«). Zugrunde liegt die Vorstellung vom »repräsentativen«, d.h. uneigennützigen und am Wohl der Gemeinschaft orientierten, Amtsträger und Staatsmann, wie sie das Grundgesetz und die Landesverfassungen in der Tat postulieren. Partizipation meint dagegen die Mitentscheidung der Beherrschten, d.h. Herrschaft durch das Volk, also Volkssouveränität und Demokratie.
Das Verhältnis beider Grundsätze zueinander ist umstritten. Deshalb werden sie – im Streit der Politik, aber auch der Wissenschaft – vielfach gegeneinander ausgespielt, ohne dass man überprüft, ob ihre Voraussetzungen in der Realität wirklich gegeben sind. Und das ist in Wahrheit nicht der Fall. Der fiktive Charakter von Volkssouveränität und Demokratie ist teilweise geradezu offensichtlich: Dass das Volk sich eine Verfassung gegeben habe (wie es in der Präambel des Grundgesetzes heißt), trifft überhaupt nicht, und dass das Volk die Abgeordneten und politischen Programme der Parteien wähle, trifft nur sehr eingeschränkt und nur bei formal-vordergründiger Betrachtung zu.
Das wäre vielleicht hinzunehmen, wenn auf der anderen Seite wirkliche Repräsentation bestände. Und in diese Richtung geht ja auch die übliche Argumentation: Gegen einen Abbau des Demokratiedefizits und gegen ein näheres Heranrücken der Politik an den Common Sense der Bürger (etwa durch Neuerungen im Bereich des Wahlrechts und direktdemokratischer Elemente) pflegt immer wieder der Gedanke ins Feld geführt zu werden, den Repräsentanten müsse ein Freiraum gewährt werden, um ihnen auch unpopuläre politische Entscheidungen zu ermöglichen. Doch darf man das verfassungsrechtliche Gebot repräsentativen Entscheidens nicht mit der Wirklichkeit verwechseln, in der selbstverständlich auch Politiker Eigeninteressen haben, denen sie im Falle der Kollision mit Gemeinwohlerfordernissen meist Vorrang geben. Unter Berufspolitikern dominiert (wie regelmäßig unter »Professionals«) Eigennutz statt Gemeinnutz. Damit verändert der den Repräsentanten gewährte Freiraum unter der Hand seine Qualität: Statt zur Sicherung des Gemeinwohls droht er zum Instrument unkontrollierter Durchsetzung von Eigeninteressen der politischen Klasse zu werden, zur Sicherung ihrer Macht und ihres Einflusses und zur Aufrechterhaltung der »oligarchischen Strukturen«, auf denen diese beruhen. Die von den Verfassungen vorausgesetzte Grundannahme, die Repräsentanten handelten quasi automatisch für das Volk, erweist sich damit ebenfalls als Fiktion.
Lässt man die unwirklichen Idealisierungen und Fiktionen beiseite und greift auf die Verhältnisse durch, so wie sie nun einmal sind, lässt sich der Repräsentationsgedanke nicht mehr ungeprüft gegen die Bemühungen um einen stärkeren Einfluss des Volkes ausspielen. Anders ausgedrückt: Dann lässt sich das so entzauberte und auf seinen realen Gehalt reduzierte Repräsentationsprinzip nicht mehr unbesehen zur Rechtfertigung von Partizipationsdefiziten anführen.
Summa summarum: Wir haben nur in sehr eingeschränktem Maße eine Regierung durch das Volk und eine Regierung für das Volk, beide Defizite werden aber durch kunstvolle Fiktionen verdeckt. Was liegt dann aber näher, als auf jene Fiktionen ganz zu verzichten, die staatliche Willensbildung wieder stärker an das Volk heranzuführen und dadurch im Ergebnis nicht nur mehr Regierung durch, sondern auch für das Volk zu erlangen?
6 Selbstbedienung: Entscheidung der Politik in eigener Sache
Es ist ein eherner Grundsatz des Rechts, dass keine Amtsperson in eigener Sache entscheiden darf. Richter, Beamte und Mitglieder eines Stadtrats, die ein eigenes Interesse an einer Entscheidung haben, sind von der Mitwirkung ausgeschlossen – und das aus gutem Grund: Selbstbetroffenheit macht befangen, und man weiß aus praktischer und geschichtlicher Erfahrung, dass eigene Interessen der Entscheidenden leicht zu einseitigen, unangemessenen und missbräuchlichen Resultaten führen. Doch gegen den Grundsatz, dass niemand in eigener Sache entscheiden darf, verstößt die Politik geradezu chronisch, wenn es um Entscheidungen geht, die die Mitglieder eines Landesparlaments, des Bundestags oder des Europaparlaments betreffen, die aber gleichwohl durch Gesetz, also in der repräsentativen Demokratie von den Parlamentariern selbst, zu treffen sind. Die Parlamente bestimmen durch ihre Gesetzgebung, was als »Recht« verbindlich gilt, und durch die von ihnen beschlossenen Haushaltspläne, wer wie viel Geld aus der Staatskasse erhält. Die Parlamente bestehen aber ihrerseits aus Abgeordneten und Fraktionen. Haben diese am Ergebnis der parlamentarischen Entscheidungen ein unmittelbares Eigeninteresse, so kommt es zu Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache, also zu einer Konstellation, die ansonsten in unserer Rechtsordnung verpönt ist.
Am auffälligsten wird die Problematik bei Entscheidungen des Parlaments über Abgeordnetendiäten und Parteienfinanzierung. Hier sieht das Grundgesetz zwar eine Entscheidung durch Gesetz und damit durch die Abgeordneten selbst vor. Doch die Väter des Grundgesetzes waren noch davon ausgegangen, dass Abgeordnete nur eine Aufwandsentschädigung erhielten, und eine staatliche Parteienfinanzierung hätte schon gar nicht in ihr Vorstellungsbild gepasst. Statt den Abgeordneten die Entscheidung in eigener Sache aufzubürden, sollte in solchen Fällen ein anderer die Letztentscheidung treffen, nämlich der demokratische Souverän. Das Volk sollte im Wege von Volksentscheiden eine Kontrolle über die Bezahlung von Abgeordneten und Parteien ausüben können, wie es z. B. in der Schweiz üblich ist. Dort beziehen Parlamentsabgeordnete sehr viel niedrigere Diäten und erhalten keine staatliche Altersversorgung. Auch eine staatliche Parteienfinanzierung ist dort unbekannt. Es geht aber keineswegs nur um Fragen der Politikfinanzierung. Die Lage ist nicht weniger fatal bei Entscheidungen des Parlaments über andere Regeln des Machterwerbs und der Machtausübung, etwa das Wahlrecht, die Größe des Parlaments, die Ernennung von Amtsträgern, die Struktur des Föderalismus und andere grundlegende Verfassungsvorschriften. Auch hier sind die Politiker selbst betroffen. Sollen alle diese Regeln nicht einseitig die Interessen der politischen Klasse widerspiegeln und dieser damit praktisch die Souveränität übertragen (siehe entsprechende Texte, S. 26 ff. und 15 ff.), muss ihr die Entscheidung aus der Hand genommen werden. Dies dürfte nur im Wege direkter Demokratie (siehe S. 73 ff.) zu realisieren sein.
II
Wahlen
1 Wahlen: Das entwertete Fundamentalrecht der Bürger
Wahlen sind der Schlüssel für die Legitimation von Demokratien. Das gilt besonders für rein repräsentative Systeme wie die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union, in denen – mangels direktdemokratischer Elemente – Wahlen das einzige Instrument sind, mit dem die Gesamtheit der Bürger Einfluss auf die Politik, auf die politischen Organe und ihre Entscheidungen nehmen kann. Die befriedigende Ausgestaltung der Parlamentswahlen ist somit ein zentraler Prüfstein der Demokratie – mit den Worten des spanischen Kulturphilosophen und Essayisten Ortega y Gasset: »Das Heil der Demokratie hängt von einer geringfügigen technischen Einzelheit ab: vom Wahlrecht. Alles andere ist sekundär.«
Die Wahl der staatlichen Funktionäre ist im Laufe der Zeit immer noch wichtiger geworden, weil die Bedeutung und das Gewicht des Staates sich vervielfacht haben: Vor 100 Jahren nahm der Staat etwa zehn Prozent des Sozialprodukts durch Steuern und Abgaben in Anspruch. Heute sind es rund fünfzig Prozent. Früher setzte der Staat im Wesentlichen nur den Rahmen für Wirtschaft und Gesellschaft. Heute interveniert er andauernd und überall. Entsprechend zugenommen haben das Interesse und der Wunsch der Bürger mitzubestimmen, was der Staat wie und wofür tut.
Doch wie sieht es mit dem demokratischen Fundamentalrecht der Bürger in der Praxis aus? Die Vielzahl der Wahlen zum Bundestag und zum Europäischen Parlament, zu sechzehn Landesparlamenten und zu Tausenden von Kreistagen, Stadt- und Gemeindevertretungen erweckt zwar den Eindruck, die Bürger hätten unheimlich viel zu sagen, aber der Schein trügt. Das Wahlrecht wurde im Laufe der Jahrzehnte faktisch immer mehr entwertet. Früher konnte der Bürger immerhin zwischen zwei höchst unterschiedlichen Parteilagern wählen: den Sozialdemokraten, die für mehr Staat eintraten, und liberal-konservativen Kräften, die mehr den Selbststeuerungsmechanismen von Wirtschaft und Gesellschaft vertrauten. Inzwischen sind die Unterschiede zwischen Union und SPD fast völlig abgeschliffen. Beide verfolgen, genau genommen, eine sozialdemokratische Politik. Als Volksparteien vertreten sie nicht mehr die Interessen einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft, sondern wollen es möglichst mit niemandem verderben. Auch die drei kleineren Bundestagsparteien bieten kein wirkliches Kontrastprogramm oder müssen sich in Koalitionen den Großen fügen. Die Linke macht hier nur zum Schein eine Ausnahme, ist in Wahrheit aber sehr »flexibel«, wenn davon ihre Regierungsbeteiligung abhängt. Das sieht man am Beispiel des Landes Berlin, wo sie selbst den einschränkendsten Maßnahmen zustimmt. Die Angleichung der Politik beflügelt allenfalls eine vordergründige »Waschmittelwerbung« in der Politik, die Unterschiede wort- und bildreich vorspiegelt, nimmt aber der Frage, ob der Bürger die eine oder andere große Partei wählt, ihre Bedeutung.
Hinzu kommt, dass bei unserem Verhältniswahlrecht nach dem Einzug der Linken auch in die westlichen Landesparlamente oft nur noch Große Koalitionen oder Dreierkoalitionen eine Regierung bilden können. Die Wähler wissen dann erst recht nicht, wozu ihre Stimme führt. Zudem redet auch der Bundesrat noch mit, der oft eine andere Mehrheit aufweist. Dann tragen alle Parteien und damit keine die Verantwortung, und der Bürger und Wähler verliert vollends die Orientierung.
Umso wichtiger wäre es, dass die Bürger wenigstens die Personen, die sie repräsentieren sollen, auswählen können. Doch auch hier ist Fehlanzeige zu vermelden. Das Versprechen des Grundgesetzes, alle Bürger könnten ihre Abgeordneten frei und unmittelbar wählen (Art. 28 Abs.1 Satz 2 und Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG), wird nicht eingelöst. Nach dem in Deutschland bei Wahlen des Bundestags und der Landesparlamente vorherrschenden Wahlsystem haben die Parteien nicht nur praktisch das Monopol für die Aufstellung der Kandidaten. Sie haben die Regeln auch noch so gestaltet, dass sie den Bürgern sogar die Wahl der Abgeordneten selbst abnehmen. Die Parteien entscheiden, welchen Kandidaten der Erfolg von vornherein garantiert ist, indem sie sie in sicheren Wahlkreisen aufstellen oder auf vordere Listenplätze setzen, also solche, die selbst dann Mandate garantieren, wenn die Partei schlecht abschneidet (siehe S. 42 ff.). Aus diesen Gründen ist das innerparteiliche Gerangel bei der Platzierung der Kandidaten besonders groß. Hier fallen die eigentlichen Entscheidungen über politische Karrieren. Das erklärt die Härte und Intensität, mit der in den Parteigremien um die aussichtsreichen Plätze gerungen wird.
Wir haben also die paradoxe und zutiefst undemokratische Situation, dass die Mitwirkung des Bürgers an der staatlichen Willensbildung durch Wahlen immer wichtiger geworden ist, gleichzeitig aber die Wahlen immer weniger wert sind, weil der Bürger mit dem Stimmzettel nichts mehr entscheiden kann. Über die fatalen Eigenheiten unseres Wahlrechts wird offiziell wenig gesprochen. Die politische Bildung, der sich die politische Klasse seit Langem bemächtigt hat (siehe S. 93 f.), hat es bisher wohlweislich versäumt, den Bürgern das tatsächliche Funktionieren unseres Wahlsystems nahezubringen. Darüber zu sprechen verbietet die Political Correctness. Kaum ein Wähler, der sein demokratisches Grundrecht der Wahl ausübt, kennt die Konsequenzen.
Wird die Mitwirkung der Bürger immer wichtiger, ist aber das Wahlrecht völlig entwertet, muss man einerseits das Wahlrecht reformieren, andererseits nach Alternativen suchen, die dem Bürger echte Mitwirkung erlauben, etwa Elemente der direkten Demokratie (siehe S. 73 ff.). Diese sind zugleich Voraussetzung für eine Wahlrechtsreform. Denn da die etablierten Parteien und Abgeordneten mit der Reform des Wahlrechts überfordert sind, so nötig eine solche Reform auch ist, kommt ihre Durchsetzung wohl nur durch Volksbegehren und Volksentscheid in Betracht, die in den Bundesländern ja bereits eröffnet sind.
2 Wahl von Abgeordneten: Inszenierter Schein
Jahrhundertelang haben mutige Männer und Frauen für das Recht des Volkes, seine Vertreter selbst zu wählen, gekämpft und dabei häufig ihre Freiheit geopfert und ihr Leben gelassen. Heute gehört dieses Recht zu den demokratischen Selbstverständlichkeiten. In der Praxis unserer Republik werden die Wähler aber darum betrogen, und zwar auf derart raffinierte Weise, dass sie selbst es kaum merken. Da die politische Bildung fest in der Hand der politischen Klasse ist, unterlässt selbst sie die nötige Aufklärung, und auch die Medien lassen sich einlullen.
Tacheles gesprochen wird nur, wenn es um andere Länder geht. Dazu passt eine Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25. Oktober 2007: »Über eine Änderung des Wahlsystems wird seit Jahren diskutiert. Es herrscht weitgehend Konsens darüber, dass die Listenwahl eine negative Auslese begünstigt, weil sich die Abgeordneten nicht persönlich vor ihren Wählern verantworten müssen.« Die Meldung bezog sich auf Rumänien. Gilt für unser starres Listenwahlrecht in Deutschland aber nicht genau dasselbe? Unter Experten bestreiten das nur ideologisch Indoktrinierte.
Die politische Klasse hat unser Wahlsystem in eigener Sache derart pervertiert, dass die Abgeordneten gar nicht mehr vom Volk gewählt werden, wie es das Grundgesetz verlangt. Wen die Parteien auf sichere Plätze setzen – und das ist oft die große Mehrheit der Abgeordneten -, der ist lange vor der Wahl praktisch schon »gewählt«, bloß eben nicht von den Bürgern. In den sogenannten »Hochburgen« der Union oder der SPD kann die dominierende Partei den Bürgern »ihren« Wahlkreisabgeordneten diktieren. Und wer im Wahlkreis verliert, kommt oft dennoch ins Parlament. Die Parteien »überlisten« die Wähler, indem sie ihre Wahlkreiskandidaten über die Liste absichern. Denn wer auf den starren, vom Wähler nicht zu verändernden Listen auf vorderen Plätzen der etablierten Parteien steht, dem kann der Wähler rein gar nichts mehr anhaben. Könnten die Bürger dagegen wirklich auswählen, würden manche »Repräsentanten« sogleich hinweggefegt. Doch genau das können die Bürger nicht: die Abgeordneten durch Abwahl für ihr Tun verantwortlich machen. Das schürt Verdrossenheit mit Politikern und Parteien und trägt zum Rückgang der Wahlbeteiligung bei (siehe S. 48 ff.).
Die Wähler wissen nicht einmal, wem ihre Zweitstimme zum Einzug ins Parlament verhilft, obwohl dies (einschließlich der sogenannten Überhangmandate) die Mehrheit der Abgeordneten ist. Auf den Wahlzetteln sind nur wenige aufgelistet, und welcher Wähler nimmt schon Einblick in die Landeslisten? Das wäre auch nutzlos, weil nicht zu erkennen ist, wer nach Abzug der erfolgreichen Direktkandidaten noch übrig bleibt. Es hätte aber auch deshalb gar keinen Sinn, weil der Wähler die Auswahl der Listenabgeordneten ohnehin nicht beeinflussen kann.
Wie unser Wahlsystem funktioniert, zeigt sich beispielhaft an zwei Abgeordneten, die am 11. April 2006 in einer n-tv-Talkrunde, an der auch der Verfasser teilnahm, auftraten: Peter Altmaier (CDU) war bei der Bundestagswahl 2005 im Wahlkreis Saarlouis zwar dem SPD-Kandidaten Ottmar Schreiner unterlegen, kam aber dennoch ins Parlament, weil seine Partei ihn auf der saarländischen Landesliste abgesichert hatte. Dieter Wiefelspütz (SPD) trat im Wahlkreis Hamm-Unna II an, einem sicheren Wahlkreis seiner Partei, den er erwartungsgemäß mit rund 55 Prozent der Erststimmen gewann. Im selben Wahlkreis kandidierten auch Laurenz Meyer (CDU) und Jörg van Essen (FDP). Ihre Niederlage tat ihnen aber überhaupt nicht weh, weil beide sichere Listenplätze innehatten und deshalb von vornherein feststand, dass auch sie in den Bundestag einziehen würden. Der heftige Wahlkampf in Saarlouis, Hamm-Unna II und in vielen anderen Wahlkreisen war nur ein inszeniertes Scheingefecht, das die Wähler darüber hinwegtäuschte, dass sie in Wahrheit nichts zu sagen haben. Wissenschaftliche Analysen beweisen, dass bei Parlamentswahlen in Deutschland häufig drei Viertel aller Abgeordneten längst vor der eigentlichen Wahl durch die Bürger feststehen.
Würde die zeitliche Reihenfolge vertauscht und würden die Bürger zuerst die Parteien wählen und diese erst danach festlegen, welche Personen die auf sie entfallenden Mandate erhielten, wäre der Verfassungsverstoß offensichtlich. Dann wäre unübersehbar, dass die Wahl der Abgeordneten durch die Parteien erfolgt und nicht durch das Volk. Soll es aber wirklich einen Unterschied machen, wann die Partei festlegt, wer die sicheren Mandate bekommt? Ob dies vor oder nach der Wahl geschieht, das Ergebnis bleibt doch dasselbe: Die Partei und nicht das Volk verteilt die Mandate.
Wie absurd dies ist, zeigt auch ein Vergleich mit der Wirtschaft: Kein privates oder öffentliches Unternehmen stellt Personen ein, die es nicht vorher gründlich auf ihre Eignung geprüft hat. Nur das »Großunternehmen« Bundesrepublik Deutschland mit mehr als achtzig Millionen Einwohnern liefert sein politisches Schicksal Personen aus, die es nicht ausgewählt hat und deren Namen es meist nicht einmal kennt.
Damit ist die ganze Konzeption von der repräsentativen Demokratie, wie sie unserer Verfassung zugrunde liegt, in Wahrheit ohne Fundament. Die Bürger können die Abgeordneten nur dann als ihre Repräsentanten ansehen und die von ihnen beschlossenen Gesetze nur dann als bindend anerkennen, wenn sie ihre Vertreter wirklich gewählt haben, frei und unmittelbar, wie es das Grundgesetz ja auch ausdrücklich vorschreibt. Genau das ist aber nicht der Fall. Wer ins Parlament kommt, das wird von den Parteien bestimmt.
Diese treffen die Auswahl nach ganz anderen Kriterien als das Volk. Sie verlangen von ihren Kandidaten nicht so sehr Leistung als vielmehr Bewährung innerhalb der Partei. Parteikonformes Verhalten ist Trumpf. Das gilt auch für Abgeordnete bei Abstimmungen im Parlament (siehe S. 157 ff.). Umgekehrt werden sie als »Abweichler« diskreditiert und müssen um ihre Wiedernominierung bangen, wenn sie versuchen, von ihrem (grundgesetzlich garantierten) freien Mandat Gebrauch zu machen. Aus Repräsentanten des Volkes werden vollends gebundene Parteibeauftragte, Parteisoldaten (siehe S. 138 ff.).
Die gewandelte Rolle der Abgeordneten ändert auch die Geschäftsgrundlage für ihre Bezahlung. Wer nicht von den Bürgern, sondern von der Partei gewählt und von ihrer fortbestehenden Gunst existenziell abhängig ist, muss seiner Partei für die Verschaffung des Mandats dankbar sein und als Gegenleistung »Parteisteuern« entrichten (siehe S. 111 ff.). Ein solcher – in die Partei- und Fraktionsdisziplin eingebundener – Funktionär ist hinsichtlich seiner »Bedeutung« und »Verantwortung« (die das Bundesverfassungsgericht zu den Kriterien für die Bezahlung von Abgeordneten rechnet) ganz anders einzuschätzen als der von Artikel 38 Grundgesetz geforderte unabhängige, wirklich demokratisch legitimierte Volksrepräsentant. Er ist auch in gar keiner Weise zu vergleichen mit einem vom Volk gewählten und ihm verantwortlichen Bürgermeister einer Stadt, obwohl der Bundestag, wenn es um die Höhe der Diäten geht, diesen Typus immer wieder beschwört (siehe S. 140 ff.).