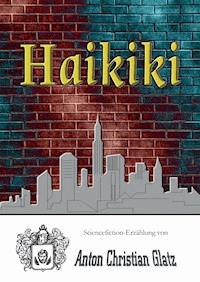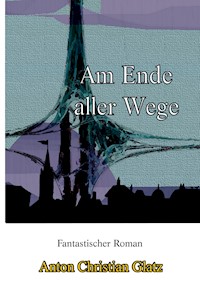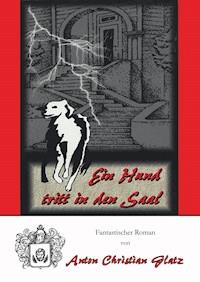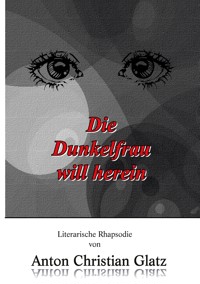
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band versammelt kurze, atmosphärisch und inhaltlich durchaus eigenständige Texte zu einem bunten, literarischen Blumenstrauß. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: 1. Kurzgeschichten, 2. Essays Sie suchen das Besondere, weit entfernt jeden Mainstreams? Von Fantastik bis zur Satire? Hier werden Sie fündig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kein Vorwort
Teil 1 – Kurzgeschichten
Was der Schwarze Reiter gesagt hat
Ich will zu dir
Ein betrüblicher Anblick
Ein alter Bock
Zwischendurch
Heimweg
ER – Ein Triptychon
Wer ER war
Wer ER ist
Wer ER sein wird
Einführung in die moderne Klassik
Brief an eine angehende Literatin
Die Geschichte, die ich beinahe geschrieben hätte
Teufelskarten
Sieben Meter Freiheit
Waldfeen betrügen nicht
Gö, der Urwald
Eine Verheißung
Gespräch mit Laura
A – Vorher
B – Nachher
Die Dunkelfrau will herein
Teil 2 – Essays
Einige wenige sind gleicher
Wenn der liebe Gott regiert
Das Medea-Syndrom
Der Bach
LIO
Kein Nachwort
Kein Vorwort
(Ein Interview)
F: Warum nicht?
A: Ich schreibe keine Vorworte, weil der Autor darin die Aufmerksamkeit der Lesenden vom Text zu sich abzieht.
F: Ja und?
Die Texte müssen für sich alleine sprechen. Ein Vorwort ist immer so, als stünde der Herold des Mittelalters mit seinen trommelwirbelnden Musikanten auf dem Marktplatz und sonne sich in der Aufmerksamkeit der Untertanen. „Kommet von nah und fern, ich habe etwas Wichtiges zu sagen.“ Das ist lächerlich. Vorworte sind Niederschlag von Eitelkeit.
F: Und wenn die Botschaft den Tamtam rechtfertigt?
A: Dann sollen die Leserschaft diese Entdeckung machen dürfen und sich daran erfreuen. Genügt doch, oder?
F: Anton, du lässt hier äußerst unterschiedliche Texte auf dein Publikum los, zwar geordnet, dennoch mühsam unter ein gemeinsames Dach gestellt. Meinst du nicht, ein paar erklärende Worte voran würden für mehr Verständnis sorgen?
A: Nein, das sieht wohl jeder Blinde … äh, 'tschuldigung, jeder Trottel, dass es sich um eine Kurzgeschichte handelt, wenn diese auf der vierten Seite zu Ende ist. Wenn's um ein sachliches Thema geht, sagen wir Essay dazu.
F: Andererseits geht es oft um Gespensterfrauen, unerwiderte Liebe, konfliktbehaftete Verhältnisse, tabuisierte Themen usw. Das könnte Anlass zu Spekulationen geben.
A: Unsinn, alles purer Zufall, sage ich. Die Texte sind im Laufe der Zeit aus unabhängigen Anlässen entstanden und entbehren in Wirklichkeit eines gemeinsamen Mottos. Warum wohl schreibe ich auf der Titelseite von Rhapsodie? Man nimmt am besten jeden Text eigenständig für sich.
F: Genau das sollte drin stehen.
A: Der geneigte Leser kommt ohnehin drauf, dem anderen hilft kein Vorwort und sei es noch so toll.
F: Komm schon, Anton, sei nicht bockig und schreib ein Vorwort.
A: Nein, nein und nochmals nein. Ich schreibe keine Vorworte.
Teil 1
Kurzgeschichten
„Als man sich die Vergangenheit noch in Form von Geschichten erzählte, die Gegenwart in Form von Geschichten zu deuten versuchte und die Zukunft in Geschichten vorhersagte, da hielt man stets den besten Platz am Feuer dem Geschichtenerzähler frei.“
Jim Henson („The Storyteller“)
Was der Schwarze Reiter gesagt hat
Es war einmal eine junge Gräfin. Ihre Schönheit war weithin bekannt und die Heiratsanträge blieben nicht aus. Der erste unter ihren Freiern hatte in der Schlacht ein Auge verloren. Die Gräfin wies ihn ab, da es unbedingt zweier Augen bedürfe, ihre volle Schönheit wahrzunehmen. Dem zweiten verhalf Übergewicht zu Speck um die Hüften. Die Gräfin ließ ihm bestellen, wenn ihr nach etwas Schwabbeligem zumute wäre, lege sie sich lieber einen Bären zu. Der dritte hatte vom vielen Reiten O-Beine bekommen, weshalb ihn ein unbeholfener Gang beeinträchtigte. Die Gräfin verspürte jedoch keine Lust, beim Spaziergang durch den Garten dauernd auf ihren Gatten warten zu müssen. Auch er wurde abgewiesen.
Jeder junge Prinz, jeder Fürst, der um ihre Hand anhielt, wurde zurückgewiesen. Entweder war er zu alt, zu hässlich, zu ungebildet oder hatte eine unsympathische Mutter. Am schlimmsten war es, wenn einer zu arm war. Zu guter Letzt wurde in dieser Sache niemand mehr vorstellig.
In Wirklichkeit war die Gräfin nur an funkelnden Edelsteinen, Schmuck und Reichtum interessiert. Sie selbst vermied alles, was Geld kostete. Keine rauschenden Feste auf Kosten des Volkes, wie unter Ihresgleichen schicklich, nicht das kleinste bisschen Luxus, das ihr die Bauern erwirtschaften durften. Da sie sich dergestalt nicht das Mindeste gönnte, wurde sie sehr verhärmt und verbrachte mehr Zeit in ihren Schatzkammern als unter Menschen. Denen unterstellte sie, nur an ihrem Geld interessiert zu sein. Auf diese Weise verlebte sie ihre Tage ungeliebt. Ihre Schönheit erhielt herbe, unnahbare Züge.
Als die Gräfin eines Tages verschwand, verbreitete sich im Nu das Gerücht, sie sei verstorben. Bald gewöhnten sich die Leute an diese Vorstellung und landauf, landab hieß es: „Wird wohl der Geiz gewesen sein.“ Nur die Damen des Kirchenchors wussten Genaueres. Von denen erzählte aber jede etwas anderes. Die Leiche indes fand man nie.
Jahre später ging die Kunde von einem Gespenst, das bei Vollmond des Nachts im Schlosswald umginge. Es sollte sich um die Gräfin handeln, deren Geiz über den Tod hinaus so stark war, dass er sie daran hinderte, in den Himmel aufzusteigen oder endgültig in die Hölle zu fahren. Die Meinungen waren unterschiedlich. Zu jeder Vollmondnacht spukte sie im Wald und bat jeden, den sie traf: „Erlöse mich.“ Allerdings war sie so schön, wie selbst zu Lebzeiten nicht. Es befand sich außerdem stets ein Topf, gut gefüllt mit Gold, in ihrer Nähe. Wer sie erlöste, erhalte diesen Schatz als Belohnung.
Das interessierte den Bäckergesellen des Dorfes. Obwohl er es vom jahrelangen Tragen der Mehlsäcke mit den Füßen hatte, bemühte er sich beim nächsten Vollmond in den Wald. Dort traf er tatsächlich pünktlich zur Geisterstunde auf das Gespenst der Gräfin. Wie atemberaubend schön und geisterhaft bleich sie war! Wäre sie lebendig gewesen, der Geselle hätte sich augenblicklich in sie verliebt. So war es zuerst Mitleid, das ihn erfasste. Tatsächlich befand sich zu Füßen der Gestalt ein ansehnliches, kniehohes Gefäß. Randvoll mit goldenen Münzen gefüllt funkelte es selbst im schwachen Licht des Mondes, dass es nur so eine Freude war. Auch das sah der Geselle mit Wohlgefallen.
Die Erscheinung flüsterte mit Grabesstimme: „Erlöse mich!“
„Was muss ich tun?“
„Geh zur Dorfbrücke und warte auf den Schwarzen Reiter. Den musst du fragen. Und sag mir, was er dir aufgetragen hat.“
Der Bäckergeselle tat wie ihm geheißen und wartete Stunde um Stunde an der Brücke auf den geheimnisvollen Reiter. Der ließ sich aber nicht blicken. Enttäuscht begab er sich wieder in den Wald, um dies der Gräfin zu berichten. Leider war die Geisterstunde längst vorbei und das Gespenst verschwunden.
Beim nächsten Vollmond suchte der Bäcker die Gräfin wieder auf. Sie sagte: „Es kann sein, dass es viele Monate dauern wird, bis der Schwarze Reiter auftaucht. Wenn du mir hilfst, soll es dein Schaden nicht sein.“
„Wie viele Monate auch nötig sein werden, ich werde dich erlösen“, versicherte ihr der Bäcker.
Da war die Gräfin beeindruckt von seiner Beharrlichkeit und hauchte: „Du bist ein lieber Mensch.“
Ich ließ das Buch sinken. Warum eigentlich? Es war doch spannend. Aha, die Schrift verschwamm vor meinen Augen, denn fortgeschritten war der Abend! Gerade in diesen Minuten senkte sich die Sonne hinter dem Horizont und warf den Schatten meines Kopfes auf die Buchseiten.
In der Nähe graste Hades, mein grauer Noriker-Hengst. Er hatte die Zeiten seiner stolzen Turniersiege schon lange hinter sich, aber für einen gemütlichen Ausritt konnte ich mir keinen liebenswürdigeren Gesellen auf vier Beinen vorstellen. In stoischer Ruhe kaute er an einem Büschel Gras. Meinem Pferd war es freilich egal, ob wir rechtzeitig im Reitstall anlangen würden, aber mir nicht, wurde der Stall doch abends pünktlich geschlossen. Meine Vorliebe für ausgedehnte Ausflüge mit Hades hatte mich heute die Zeit übersehen lassen. Wenn ich mich beeilte, war vielleicht noch jemand im Stall anwesend.
Zügig schlüpfte ich in die Lederjacke, zog mir die Stiefel an und sattelte Hades. Wir galoppierten los. Trotz Vollmond war es bald so finster, dass ich das Tempo drosseln musste. Als wir in die Nähe des Dorfes kamen, auf dessen anderer Seite sich der Reitstall befand, gelangte ich auf eine schlecht beleuchtete Landstraße. Als Hades und ich uns im Galopp der Murbrücke am Dorfeingang näherten, stand ein Mann mitten auf der Straße.
Ich rief ihm zu: „Aus dem Weg, ich habe es eilig!“
Er schien nicht verstanden zu haben, denn er hielt die Hand hinter das rechte Ohr, den Kopf geneigt.
„Weg da! Gehen Sie weg!“, rief ich noch einmal in voller Lautstärke, worauf der Mann endlich beiseite trat. Hades und ich donnerten vorbei.
Wie ich befürchtet hatte – der Reitstall war bereits geschlossen. Kein Mensch befand sich mehr im Gebäude, alles war dunkel. Kein Wunder, mitten in der Nacht. Was tun? Dann reite ich eben nach Hause, überlegte ich mir.
Gesagt, getan. Weil Hades, der alte Herr, bedenklich schnaufte, ritt ich in gemächlichem Tempo Richtung Heimat. Zuhause sattelte ich im Garten den Hengst ab, der sich bald erschöpft zum Ausruhen niederlegte. Aus Solidaritätsgründen beschloss ich, die Nacht über bei meinem Pferd zu bleiben, schließlich hatte ich es in diese missliche Lage gebracht. Ich holte mir eine Decke aus dem Haus, legte mir den Sattel unter den Kopf und machte es mir auf diese Weise neben Hades' Rücken bequem. Überdies mag ich den Geruch von Pferden und die erdige Wärme, die von ihnen ausgeht. Im Schein der Lampe meines Handys las ich zu Ende.
Mehrere Monate hindurch besuchte der Bäckergeselle die Geistergräfin, wartete jedoch stets vergeblich auf den Schwarzen Reiter. Mit der Zeit hatte ihn auch die Liebe zu dem schönen Gespenst erfasst.
Eines Nachts kam er aufgeregt von der Brücke zurückgewatschelt. Schwer atmend rief er: „Ich habe den Schwarzen Reiter getroffen, Liebste! Mit donnernden Hufen kam er auf mich zu, auf einem riesigen Ross, als hätte die Hölle selbst ...“
„Jaja, schon gut“, unterbrach die Gräfin. „Was hat er gesprochen?“
„Ich traue es dir kaum zu sagen, Liebste ...“
„Na los, raus damit!“
„Weg da! Gehen Sie weg!“
Die Gräfin stutzte. Was sollte das heißen, sie sollte weggehen?
„Bist du sicher?“
„Ja. Ich bin selbst verblüfft. Aber die Frage ist, ob es der richtige Reiter war. In der Nacht sehen alle Pferde dunkel aus. Was, wenn es sich in Wirklichkeit um eine graue, klapprige Schindmähre gehandelt hat, vom Unbekannten halb zu Tode geschunden? Du musst wissen, ich bin auf dem rechten Auge so gut wie blind. Ich denke, ich werde es nächsten Vollmond erneut versuchen.“
Der Gräfin war nicht wohl bei dem Gedanken, ihren einäugigen, watschelnden Freund noch länger hin- und herzuschicken, obwohl das sicher gegen sein Fett um die Hüfte geholfen hätte. War doch der Arme nach seinen Ausflügen jedes Mal ganz außer Atem. Und verschwitzt obendrein; nur so nebenbei.
„Nein“, hauchte sie mit ihrer Geisterstimme, „heute ist die Nacht der Nächte. Lass mich überlegen.“
Minutenlang ging sie tief in sich ... Mit einem Mal schien sie zu begreifen. Sie wandte sich an den Topf zu ihren Füßen und sagte: „Ja, es ist wahr, nicht ich habe dich besessen, sondern du mich. In Wahrheit ist das mein Fluch. Aber ich werde dir nicht weiter dienen. Die unheiligen Bande, die uns bislang verbunden haben, werde ich heute für immer lösen. Ich gehe jetzt weg und du bleibst hier.“
Merkwürdig, wie sehr ihre Stimme an Kraft und Fülle gewonnen hatte. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen ... Das Wunder geschah! Im gleichen Maße, wie sich die Gräfin vom Topf entfernte, wurde sie menschlicher, bis sie vor dem Bäcker stand, jung und begehrenswert, aus Fleisch und Blut, mehr denn je. Freudestrahlend deutete sie auf den Schatz hinter sich und sagte: „Hier, deine Belohnung.“
Ihr Gefährte schüttelte bedächtig den Kopf: „Was ich getan habe, tat ich dir zuliebe.“
Das hörte die Gräfin gern; es war immerhin das erste Mal, dass jemand so zu ihr gesprochen hatte.
„Nein“, fuhr der Bäcker fort, „ich werde mich nicht mit dem belasten, was dir zum Fluch geworden ist. Ich nehme einen anderen Schatz.“
Er breitete seine Arme aus, die Gräfin liebevoll zu umfangen. Diese stürzte sich mit einem „Komm zu mir, du mein Schwabbelbärli!“ auf ihn und küsste ihn, dass ihm Hören und Sehen verging. Dann zerrte sie ihren Retter hinter das nächstbeste Gebüsch. In der Tat, es wurde die Nacht der Nächte …
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie heute noch quietschfidel.
Ich will zu dir
Ich kann dich förmlich sehen, mein Liebling, wie du auf dem schmalen Schotterweg stehst, der mich von meinen Nachbarn trennt. Vermutlich fasst deine Linke den Schal, da du im spätherbstlichen Wind nicht frieren möchtest, die Rechte weilt tief im Mantelsack vergraben. Die Finger spielen wahrscheinlich mit der Zigarettenschachtel. Dein Blick ist gesenkt, Schmerz beschwert dir das Gemüt. Aus deinen Augen laufen Tränen die Wangen hinunter, zwei gute Bekannte aus zärtlichen Momenten, aus Küssen und Berührungen voll ungezügelter Leidenschaft.
Mein Liebling, du warst über viele Jahre meine treue Gattin, später meine fürsorgliche Krankenschwester. Du hast mich über zwei Jahre lang gepflegt. Unerschütterlich bliebst du an meiner Seite und ich …? Ich fand nicht einmal Gelegenheit, dir zu danken. Du weißt ja, wie sich gegen Ende hin die Ereignisse überstürzten. Wenn nicht du, wer dann? Du entsinnst dich gewiss meiner verzweifelten Handbewegung, als ich nicht mehr reden konnte. Da wollte ich dir noch etwas sagen. Leider war ich dazu bereits außerstande.
Mag sein, du wünschst dir einen kurzen Besuch bei mir, sozusagen in einem Zwischenreich, in dem wir uns für einen Atemzug der Ewigkeit zärtlich wie ehedem die Hände reichen. Und dann für immer im Guten auseinandergehen. Oder gar einen Kuss, da die Sehnsucht dich drängt. Glaube mir, es wäre keine gute Idee. Reicht es nicht, wenn einer von uns beiden tot ist? Da habe ich eine bessere Idee. Ich komme zu dir. Ja, ich will zu dir ... Bald bin ich bei dir, du wirst es sehen. Vielleicht ist es richtig, was man sagt: Manche Liebe und sonstige mächtige Gefühle überdauern selbst den Tod. Jedenfalls drängt es mich mit aller Kraft zu dir.
Allerdings, bevor ich es vergesse: Ich sehe ihn auch; ihn, der wahrscheinlich eine Armlänge hinter dir steht, sofern er noch einen Funken Anstand hat. Er, du weißt, von wem ich rede. Er hat meine Medizin verschrieben, die du mir so überreichlich eingeflößt hast, ohne Rücksicht auf die Nebenwirkungen. Und den Totenschein hat er auch ausgestellt.
Es ist schlimm, die ganze Zeit im Bett verbringen zu müssen. Da bist du dankbar um jede Abwechslung, um jede gurrende Taube, die vor dem Fenster Platz nimmt. Du freust dich über das Rumpeln der Müllabfuhr jeden Mittwoch, saugst tief den Duft der blühenden Büsche ein, der im Frühling durch das geöffnete Fenster weht ... Eines Tages war ein Flüstern vor der Tür, die ihr unachtsamerweise einen Spalt offen gelassen hattet. Es war das Murmeln eurer Stimmen, das ich nur bruchstückhaft zu verstehen vermochte. Indes, von Wort zu Wort machte sich Entsetzen in mir breit und fraß fortan an meiner Seele.
Künftig lauschte ich euren Worten und allem, was ihr sonst noch getrieben habt, während ihr mich schlafend wähntet. Du kennst dich bestimmt aus, was ich meine. Anfangs wollte ich es nicht glauben, später war ich nicht mehr in der Lage, mich zu wehren. Ihr wart der Meinung, eure Konspiration sei mir entgangen, aber ich war krank, nicht verblödet. Es war durchaus aufschlussreich, als ihr von Woche zu Woche die Lage einschätztet, wie lange ich noch durchhalten würde ...
Als es dann soweit war, beugtest du dich über mich, um dich zu überzeugen, dass es sich endlich um mein letztes Röcheln handelte. Da wollte ich dich packen. Ich wollte dir an die Gurgel, auf dass du mit mir in die Ewigkeit fährst, in die Finsternis, zu den Würmern, dorthin, wo wir beide hingehören. Es reicht keineswegs, wenn nur ich steif, stinkend nach Verwesung im Sarg liege und der Ewigkeit entgegendämmere.
Ihr Lebenden sperrt uns Toten in Särge, beschwert uns mit meterdicker Erde, aus der zu guter Letzt ein Grabstein ragt, vorzugsweise Granit oder Marmor, je schwerer, desto besser. Und all das aus Angst, wir könnten zurückkehren in eure Welt, die ihr euch so piekfein eingerichtet habt. Und weißt du was, mein Liebling? Ihr habt Recht. Zu gewissen Zeiten werden um Mitternacht Kräfte frei, von denen du keine Ahnung hast; noch ... Wie der Volksmund sagt, kann der Glaube Berge versetzen. Was sind da Sargdeckel, Grabsteine, oder gar deine lächerlichen Kerzchen?
Ich will zu dir ... Bald bin ich bei dir, du wirst es sehen. Aber wenn ich komme, wird es nicht aus Rache geschehen. Da ich nun seit Zeiten, die ich nicht einzuschätzen vermag, hier unten liege, kann ich dir nicht mehr böse sein. Der Kuss der Ewigkeit enthob mich jeder Rachegelüste. Im Angesicht des Jenseits fühle ich mich frei aller niederen Absichten. Ich tue hier Blicke in das Universum, ein berauschender Reigen von Visionen, die jeder Beschreibung spotten. Ich will dich zu mir holen, damit du ebenfalls an dieser Herrlichkeit teilhaben kannst. Glaub mir, ich werde als Freund kommen, als guter sogar.
Ich werde mir alle Mühe geben, dich nicht zu erschrecken. Ich möchte nicht, dass dir die Würmer aus meinem Gesicht in den Ausschnitt fallen, oder sich die fauligen Fleischbatzen von meinen Fingern lösen, wenn sich meine Hände zärtlich deinen lieben Wangen nähern. Es reicht, wenn dir der süße Atem der Verwesung in die Nase steigt. Er wird deine Lunge füllen und dort dein Blut mit meinen Molekülen verderben, die sich in deinem ganzen Körper verteilen, vom Herz ins Gehirn steigen; wie Säure aus dem Jenseits ...
Es kann durchaus sein, dass mir dein Tod folgen wird wie ein Schatten, aber es steht nicht in meiner Macht, das zu ändern. Was ist das schon im Vergleich zu dem, was ich dir bieten kann? Auch du musst einmal sterben. Was macht es für einen Unterschied, wenn es ein paar Jahre früher geschieht? Ach, du und er, ihr habt meine Erbschaft noch nicht verprasst ..? Schließlich ist es ja darum gegangen, mich unter die Erde zu kriegen, solange du von meinem Geld profitierst. Ich fürchte, darauf werde ich keine Rücksicht nehmen können. Lass mich dir zeigen, was wirklicher Reichtum ist. Wenn du alle Zeit der jenseitigen Welt zur Verfügung hast, wirst du mir zustimmen. Ach, was rede ich? Zutiefst dankbar wirst du sein, in deinem Herzen, in dem sich gierige Maden fett fressen.
Ich will zu dir, mein Liebling … Bald werde ich kommen. Du wirst es sehen, du wirst mich sehen ... Und es wird dein Ende sein.
Ein betrüblicher Anblick
Es war ein betrüblicher Anblick: Keine Bäume mehr, alle verschwunden ... Ich stand auf dem Berghang und sah in das Tal hinunter. Nicht in irgendein Tal, in das Tal meiner Kindheit, als Weihnachten noch heilig war und der Osterhase die bunten Eier brachte. Hier hatte ich meinen ersten Frosch gefangen. Das Tal meiner Jugendzeit. Hier hatte ich mich später immer an derselben Buche mit Sigrid getroffen. Sigrid – meine Jugendliebe ... Was aus ihr wohl geworden sein mochte? Keine der Studentinnen an der Wiener Uni konnte ihr das Wasser reichen. Als Zeichen meiner Wertschätzung hatte ich ihr damals eine Rune in den Stamm geritzt.
Nun aber waren sämtliche Bäume beiderseits des Flusses gefällt. Selbst die Büsche am Flussufer schienen arg in Mitleidenschaft geraten. Zerrupft, geknickt und ausgedünnt boten sie ein jämmerliches Bild. Dazwischen hatten Schubraupen, Traktoren und andere Nutzfahrzeuge den Boden aufgewühlt. Wo ich einst barfuß über weiches, feuchtes Moos gewandert war, hatten sie den Wald respektlos mit hässlichen Narben gezeichnet. Was für ein Gegensatz zu dem traulichen Bild, wie ich es in Erinnerung hatte! Eine freudlose Gegend, in die erst im Laufe der Jahre wieder das gewohnte Leben kommen musste.
„Ja, der Sturm letztes Frühjahr ...“; sagte der Förster neben mir, den ich auf dem Weg zufällig getroffen hatte. „Wir sind immer noch nicht fertig mit den Aufräumarbeiten; wird wohl noch eine Weile dauern. Aber Ihr Vater darf sich nicht beschweren. Er hat sein Holz so billig gekriegt wie noch nie.“
Niedergeschlagen begab ich mich in das Sägewerk meines Vaters zurück. Er hatte letzthin gemeint, er beabsichtige mir das Unternehmen in einigen Jahren zu übergeben und ich solle mich in der Zwischenzeit einarbeiten. Wozu sonst hätte er mich in der Fremde Betriebswirtschaftslehre studieren lassen?
Die Sekretärin meines Vaters informierte mich, dass unser Chef noch mit einem dringenden Telefonat beschäftigt sei. Ihr dienstbeflissenes Lächeln kaschierte kaum ihre Neugierde auf den Sohn ihres Arbeitgebers. Sie forderte mich auf, mich im Schauraum umzusehen, bis mein Vater frei sei.
Der Schauraum unweit des Betriebseinganges beherbergte ein paar besonders ausgefallene Bäume, Wurzeln und sonstige Exponate. Auch die üblichen vergilbten Fotos zur Firmengeschichte hingen in Augenhöhe an der Wand. Großvater mütterlicherseits, der Unternehmensgründer, ein Holzknecht der Nachkriegszeit, die Axt in der Faust! Und den Obstler im Rucksack, aber den sah man nicht. Das waren noch Zeiten, als der Chef selbst mit Hand anlegte ... Fleiß und ein untadeliger Lebenswandel hatten einmal genügt, um erfolgreich zu sein. Lange, lange war es her ...
Plötzlich sah ich sie – die Buche meiner Jugendzeit! Zumindest ihre untersten eineinhalb Meter, als Beispiel für typischen Baumbewuchs in unserer Gegend und qualitativ hochwertiges Brennholz. Mitten unter anderen vergleichbaren Exponaten hatte man sie auf einen hölzernen Sockel gestellt. Unverkennbar war Laf, die Liebesrune aus der Futhark-Reihe. Sie bestand aus einem langen, senkrechten Strich, von dessen oberen Ende ein kurzer Strich nach rechts unten führte, eine spiegelverkehrte Eins. Bei diesem Anblick wurde mir gleich warm ums Herz. Ich meinte wieder ihre Küsse in meinem Gesicht zu fühlen, ihre Arme um meinen Körper ...
Als ich nähertreten wollte, bemerkte ich eine Frau meines Alters, die von der Seite nahte. Sie kam mir seltsam bekannt vor; diffuse, gefühlsbeladene Erinnerungsfetzen stiegen undeutlich in mir hoch. An ihrer linken Hand zog sie ein kleines Mädchen, die rechte hatte sie bei einem vierschrötigen Mann eingehakt. Sein protziger Ring am rechten Ringfinger stach mir unangenehm ins Auge.
„Ha, das ist aber witzig“, sagte die Frau lachend und deutete auf das Stück Buche. „An diesem Baum habe ich mich vor über zehn Jahren regelmäßig mit meinem Jugendfreund getroffen.“
Ich drehte mich unauffällig im rechten Winkel weg, hielt mich aber weiterhin in der Nähe auf, um alles verstehen zu können. Den Kragen meines Sakkos stellte ich vorsichtshalber auf.
Der Vierschrötige hakte unverblümt nach: „Du hast mir noch nie davon erzählt. Wie war es mit ihm?“
„Was gibt es schon über einen total verliebten jungen Gockel zu erzählen? Ich war nicht annähernd so begeistert von ihm wie er von mir, aber was soll's? Als halbwüchsiges Mädchen hat mir das natürlich sehr geschmeichelt. Die Kathi habe ich immer damit geärgert, die hatte nämlich keinen Freund. Irgendwie wollte ich ihm seine Illusionen nicht nehmen. Zuletzt war ich froh, als er nach Wien studieren ging.“
In diesem Augenblick trat der Werkleiter an mich heran. Mein Vater lasse mir ausrichten, ich möge mich von ihm ein wenig durch das Werk führen lassen, als kleine Einführung, da ja nun alles umgebaut sei. Liebend gerne folgte ich ihm.
In der Tat war das Werksgelände deutlich vergrößert worden. Besonders stolz war mein Begleiter auf die Anschaffung modernster Geräte. An einer der wenigen Schneidemaschinen, die noch von Hand zu betätigen waren, ließ ich mir die Bedienung erklären. Dann sagte ich: „Ich will ausprobieren, ob ich damit umgehen kann. Bleiben Sie bitte hier, ich komme gleich.“
Bald war ich zusammen mit einem anderen Arbeiter wieder zurück, denn alleine wäre mir das Holz zu schwer gewesen. Ich schnappte mir den Schutzhelm des Arbeiters, legte den Buchenstamm in die Zuführung, schaltete die Maschine ein und stellte den Abstand auf 25 Zentimeter ein. Das durchdringende, grimmige Geräusch, mit dem sich das Gerät an die Arbeit machte, passte bestens. In einem Tempo, das mich erstaunen ließ, wurde meine Buche in sechs gleich lange Teile zersägt, die Liebesrune in zwei Hälften geschnitten ...
… Ich stand barfuß am Fluss meiner Jugendzeit. Unter den Fußsohlen spürte ich die Wärme der Sommersonne, die während des Tages den Waldboden aufgeheizt hatte. Die abgefallenen, vertrockneten Fichtennadeln kitzelten ein wenig. Einige Meter flussaufwärts hüpfte eine faustgroße Kröte durchs Gebüsch. Ich sah den Buchenstamm, die Rune nach oben, gemächlich flussabwärts treiben, in abendliches Dunkel hinein, bis es die Finsternis der Vergangenheit verschluckt hatte. Und das war's ...
Plötzlich stellte ich Hunger fest. Ich ließ mir vom Werkleiter die Kantine zeigen, einen modernen, bestens ausgestatteten Saal, in dem er sich besonders wohl zu fühlen schien. Dort saß ich bald vor Wiener Schnitzel mit meinen geliebten Petersilkartoffeln, frischem Vogerlsalat und reichlich Kürbiskernöl. Und das war weiß Gott kein betrüblicher Anblick.
Ein alter Bock
Auf einem Bauernhof am Fuße der Alpen lebte Konrad, ein alter Ziegenbock. Tagein, tagaus stand er auf der Weide herum, kaute an einem Grasbüschel und ließ den lieben Gott einen guten alten Mann sein. Dies fiel eines Tages dem Eber auf, der den Hof leitete. Es störte ihn gewaltig. Der Eber, von allen schlicht und ergreifend Boss genannt, war so beschäftigt mit der Verwaltung des Hofes, dass er kaum Zeit für eine Pause fand. Deswegen ging es Konrad eigentlich besser als ihm und das, fand der Boss, stand ihm gar nicht zu.
Am nächsten Tag schickte er seine Botenhenne Berta aus, Konrad solle an seinem Futtertrog vorstellig werden. Pünktlich zum vorgeschriebenen Termin erschien Konrad und sah dem Boss mäßig interessiert entgegen.
Der Eber grunzte: „Du bist zwar ein langjähriges, verdienstvolles Mitglied unseres Hofes; allerdings lässt in letzter Zeit dein Leistungsprofil altersbedingt sehr zu wünschen übrig. Da die Abteilung zur Bewirtschaftung der Weiden ohnehin überbesetzt ist, musst du den Hof verlassen.“
Fast wäre Konrad das Gras aus dem Mund gekippt. Wo gab's denn sowas? Das Schwein hatte anscheinend noch nie etwas von wohlerworbenen Rechten gehört. Da war guter Rat teuer. An wen hätte sich Konrad wenden sollen? Leider war der Gockel als Betriebsrat zu nichts zu gebrauchen. Der war den ganzen Tag damit beschäftigt, seine Hennen zu inspizieren, und die Gewerkschaft? Die war weit weg.
„Wir machen das natürlich einvernehmlich, wenn du möchtest“, ergänzte der Boss. Er gefiel sich sehr, wenn er gelegentlich seine gönnerhafte Seite zur Schau stellte.
„Und wo soll ich dann leben?“
„Du kannst meinetwegen auf der äußeren Wiese bleiben. Aber der Platz im Stall ist nur für die von uns, die eine ausreichende Wertschöpfung erwirtschaften. Du verstehst sicher.“
Das tat Konrad zwar nicht, aber was hätte er machen sollen? Also lebte der Bock fortan auf besagter Wiese. Dort versuchte er sich vor den Herbstwinden im Gebüsch zu schützen und im Winter fror er. Außerdem war die Gesellschaft nah am Waldrand nicht annähernd so gesittet wie innerhalb des Zaunes. Zu Ostern lauerte Konrad aus Langeweile dem Osterhasen auf. Er wollte ihn um einige der bunten Eier erleichtern, aber der kam nicht. Da war das Christkind zuverlässiger gewesen. Dessen goldene Locken wärmten Konrads Knie, wenn ihn das Zipperlein plagte. Über dieses neue Leben rümpften die Ziegen des Hofes die Nase. Wenn sie zufällig Konrad sahen, sprachen sie nur kopfschüttelnd: „Naja ...“
Eines Tages im späten Frühling kam der Boss mitten in der Nacht reichlich beschwipst nach Hause. Er war beim Kartenspielen in der Schenke gewesen und hatte eine Menge Geld gewonnen. Im Dusel grölte er sein Lieblingslied: „Es ist so schön, ein Schwein zu sein ...“ Mit einem Stapel Euroscheinen fächelte er sich lässig frische Luft zu. Kurz vor dem Haus lauerten ihm seine Mitspieler, zwei Wölfe, auf und schickten sich an, den Boss totzubeißen. Urplötzlich war Konrad zur Stelle und – zack!!! – rammte den beiden Angreifern die Hörner in den Bauch. Erschrocken über derartige Tollkühnheit flohen die Wölfe Hals über Kopf und wurden nie mehr gesehen.
Am nächsten Tag suchte die Henne Berta den Bock in seinem Ausgedinge auf und überreichte ihm ein Schreiben des Bosses. Darin wurde ihm in aller Form der Dank ausgesprochen für seine spontane, ehrenamtliche Unterstützung während der Nacht zum Wohle aller. In Anlage fand er einen Gutschein für ein extra saftiges Büschel Gras aus dem Garten vor dem Stall. In das Haus durfte Konrad auch wieder. Er erhielt sogar einen Ehrenplatz im Haupttrakt. Aus Freude über die frohe Botschaft, die sie hatte überbringen dürfen, legte Berta gleich ein Ei.
Tief in der Nacht jedoch, als alle schliefen, öffnete Konrad klammheimlich die hintere Eingangstür und ließ die beiden Wölfe in die Speisekammer. Diese mussten künftig keinen Hunger mehr leiden und die beschwerliche Jagd blieb ihnen ebenfalls erspart. Immerhin sahen sie selbst schon den Jahren entgegen, in der jede Hatz auf ein müdes Kaninchen zum Extremsport ausartet.
Konrad lächelte hintergründig. „Ich habe es euch versprochen, meine Freunde. Nie und nimmer kommt der Eber auf die Idee, wir könnten unter einer Decke stecken.“
Und die Moral von der Geschichte? Das für Sie Zutreffende bitte ankreuzen:
A – Dies ist die Lehr' aus der Geschicht': Unterschätz die alten Böcke nicht.
B – Fürchte keinen Feind, bist du nur im Kampf vereint.
C – Du würdest staunen, würdest lachen, was manche Böcke so für Sachen machen.
D – Ihre eigene Moral:
Zwischendurch
(Frau Mag.a Gerit Haas gewidmet)
Maylin saß neben mir in der Steuerzentrale. Natürlich, was sollte meine Kopilotin sonst tun? Allerdings tat sie das seit uns das Kommando mit einer Ladung Ersatzteile für die Kolonie auf Rasalgethi, im Sternbild des Herkules, auf Reise geschickt hatte. Von den etwas mehr als 382 Lichtjahren waren noch 23 übrig. Dank Überlichtgeschwindigkeitsantriebes neuester Bauart sollten wir diese Distanz in dreieinhalb Sternwochen planmäßig zurückgelegt haben. Aber bis dahin war Langeweile angesagt. Ich spielte kein Go und sie verabscheute Karten. Und immer der Bordcomputer als Partner war auf Dauer auch nicht das Gelbe vom Ei. Alle Witze waren seit mindestens dreihundert Lichtjahren ausgetauscht, zumindest die gesellschaftsfähigen. So tief, Maylin mit den übrigen Pointen zu unterhalten, wollte ich nicht sinken.
Die auf den ersten Blick vielfältige Welt aus Computern, Monitoren, Anzeigen und Schalttafeln aller Art, von der wir umgeben waren, war auf Dauer genauso eintönig. Wir thronten zwar inmitten dieser technologischen Sinfonie komfortabel in unseren Schalensitzen auf sündhaft teurem Leder, aber von Abwechslung war keine Rede. Die routinemäßigen Kontrollkontakte mit dem Kommando alle zwei Sternwochen waren zwar am Anfang eine willkommene Zerstreuung gewesen, aber inzwischen brachten sie es auch nicht mehr. In regelmäßigen Abständen das faltige, strenge Gesicht der Kommandantin, Majorin Nadja Tscherkessowa, genannt „der alte Besen“ ...?! Eine englische Gouvernante Ende des 19. Jahrhunderts konnte nicht schlimmer gewesen sein.
Maylin war im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen geradezu wortkarg. Dabei redeten Frauen asiatischer Herkunft meines Wissens ebenso viel und gerne wie die europäischen. Jedenfalls freute ich mich darüber zu Beginn des Fluges entschieden mehr als die letzten zweihundertfünfzig Lichtjahre. Apropos Maylin; ihr erging es ähnlich. Sie erwähnte es zwar nie, aber ich merkte das trotzdem. War ich vielleicht die Stimmungskano...
„Mark!!! Da kommt was auf uns zu!“
Tatsächlich, die Scanner meldeten ein Objekt von beachtlicher Größe auf Kollisionskurs. Wie ich derlei schwammige Formulierungen nicht leiden konnte! Als Krieger, als der ich mich verstand, pflegte ich zu sagen: „Mit jedem Feind kann ich leben, kenne ich nur sein Gesicht.“ Glücklicherweise folgten in der Regel bald genauere Informationen. Nach dem Bordprotokoll war es Aufgabe der Kopilotin, das Objekt zu identifizieren. Himmelskörper oder Raumschiff?, das war die Frage ... Hellwach starrte Maylin auf die Anzeigen der Scanner sowie auf die ersten Computerberechnungen auf einem der Nebenmonitore.
„Ein Himmelskörper!“
„Wie beruhigend“, spottete ich. „Ich fürchtete schon, meine Exgattin beehrt uns.“
„Der da ist in unseren Sternkarten nicht verzeichnet.“
Das klang schon erheblich aufregender. Maylin zoomte das Objekt auf den Hauptschirm: eine anthrazitfarbene Kugel, die sich dank eines hohen Albedowertes glänzend vom dunklen Hintergrund abhob.
„Ein herrenloser Planet“, flüsterte Maylin andächtig. Bingo! Der reinste Volltreffer. Seit herrenlose Planeten Anfang des 21. Jahrhunderts entdeckt worden waren, umgab sie ein ähnlicher magisch-mystischer Nimbus wie ehedem die Kometen. Woher kamen sie? Was war mit ihren Sonnen passiert? Die meisten wa