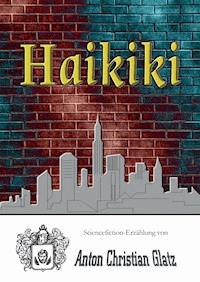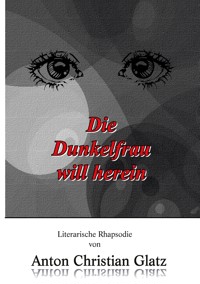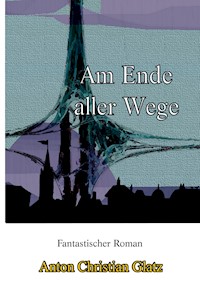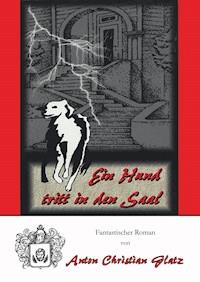Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dieser Band versammelt diverse Erzählungen und Kurzgeschichten. Den Hauptteil bildet eine Erzählung von einem Stein, der in grauer Vorzeit vom Himmel fällt. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Laufe der Jahrtausende gerät er in die Hände von Menschen, deren Leben er entscheidend inspiriert. Die Texte sind zumeist genreübergreifend, haben jedoch starke unterhaltende und erzählerische Qualitäten. Ein dezenter, experimenteller Hauch sorgt zusätzlich für ein Leseerlebnis der unverwechselbaren Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein Stein reist durch die Zeit
Prolog
Zarathustras Ritual
Zarathustras Vision
Zarathustras Inspiration
Winterstadt
Frühlingsstadt
Sommerstadt
Akkon
Eines kühnen Abenteuers wagemutiger Beginn
Eines kühnen Abenteuers ruhmreicher Höhepunkt
Eines kühnen Abenteuers trauriges Ende
Luthers erste Reise zur Macht
Luthers zweite Reise zur Macht
Der Maschinengott frisst seine Kinder
Wie ein Phönix aus der Asche
Hinter allen Horizonten
Epilog
Enthüllung einer mysteriösen Botschaft
Wie Genio sprechen lernte
Der Versuch
Marc Duchute
Wenn der Himmelvater schimpft
Ein Buch für Bruno
Die Geschichte, die nie geschrieben wurde
Engel auf Brücken weinen nicht
Ein Stein reist durch die Zeit
(in verschiedenerlei Episoden, versteht sich)
Prolog
Am Anfang aller Zeiten, als sich das Universum entfaltete, entströmten alle Dinge einem gemeinsamen Ursprung. Was vorher leer und zeitlos gewesen war, füllte sich mit rasender Materie. Getrieben von einer ungeheuren Kraft ergossen sich die Atome in die Weiten des Weltalls und verbanden sich in Jahrmillionen zu kugelförmigen Materieklumpen. Sie zogen sich gegenseitig an, wuchsen dadurch und nahmen so im Laufe der Zeit die ungeheuren Ausmaße an, die sie heute noch haben. So formte sich die Materie. Die Klumpen waren größer geworden und hatten sich strukturiert. Wo zuerst Chaos herrschte, war nun Ordnung. Auf diese Weise gebar das Große Geheimnis sämtliche Galaxien, Sonnen- und Planetensysteme, alles, was das Firmament bevölkert.
In den schier unendlichen Tiefen zwischen den Gestirnen gibt es heute noch ganz vereinzelt kleinere Materieklumpen, die sich seit den Geburtsstunden des Alls nicht verändert haben. Sie gleichen Freibeutern, die sich keinem Materieverband anschließen wollten oder konnten und so ihre ursprüngliche Zusammensetzung bewahrt haben. Kometen werden sie genannt, diese geheimnisvollen Wanderer, von denen manchmal einer über den Himmel irrt. Stürzt ein solcher auf die Erde, verglüht er meist in der Atmosphäre. Von den wenigen Überlebenden heißt es, sie würden magische Kräfte bergen.
Ein solcher fiel eines Tages zur Erde. Als schwarzer, runder Gesteinsbrocken in der Größe einer Faust raste er durch die Atmosphäre und zeichnete diese mit seinem Schweif. Mit dumpfem Aufprall bohrte er sich in den Boden der heutigen persischen Steppe.
Da lag er nun, nur wenig unter dem spärlichen Gras, das ihn bald überwucherte. Viele Tiere schon lange ausgestorbener Gattungen zogen an ihm vorbei, längst verschwundene Pflanzen deckten ihn zu. Kein Wind, kein Regen konnte ihm etwas anhaben. Es schien, als sei er für eine größere Mission geschaffen. So zogen viele Jahre ins Land, hunderte, tausende ...
Zarathustras Ritual
In grauer Vorzeit breiteten sich unaufhaltsam die Menschen auf der Erde aus. Völker entstanden, vermehrten sich und gingen in blutigen Schlachten wieder unter.
In den Tiefen dieser Zeiten lebte ein Volk in der Gegend des Steines, das eine bemerkenswerte Ansicht von der Welt hatte. Das ganze Universum war für dieses Volk belebt, durchzogen von einem einzigen Geist, den es Ahura Mazdah nannte. Doch Ahura Mazdah war diesen Menschen nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde, Tag und Nacht, oben und unten und den vier Himmelsrichtungen, sondern auch der Zwillingsgeister Spenta Mainyu (der Gute Geist) und Angra Mainyu (der Böse Geist). Seit sich beide Geister für den Weg des Guten bzw. den des Bösen entschieden hatten, gab es ein Reich des Lichtes und eines der Finsternis, welche im ewigen Streit miteinander lagen.
Um sich in den Wirrnissen einer solchen Welt zurechtzufinden, gab es in diesem Volk Priester, die Magier genannt wurden. Durch ihre Riten sollten diese mit Ahura Mazdah und Spenta Mainyu in Verbindung treten und sie für die Menschen günstig stimmen. Allerdings wirkten unter den Magiern auch solche, die dem Reich Angra Mainyus, des Bösen, dienten. In Unmengen brachten sie ihren finsteren Dämonen Schlachtopfer dar und tranken Haoma im Übermaß. Ursprünglich ein Geschenk der Götter, wurde Haoma, der Trank der Visionen und der Unsterblichkeit, den abtrünnigen Magiern durch fortwährenden Missbrauch zum Gift für ihre Seele.
In dieser bewegten Zeit blieben manche Völker ihren alten Kulten treu. Nomadisierend zogen sie gemäß ihren Traditionen durch die Gegend, während der Glaube an Ahura Mazdah bereits die große Wende zur sesshaften Lebensweise einleitete. Inmitten dieser allgemeinen Unruhe wirkte der Anführer der Magier Ahura Mazdahs und Ahnherr der Weißen Magie, Zarathustra. Er lebte manche Jahre in der Gegend des Steines, ohne von diesem Kenntnis zu erlangen. Sanft war sein Haus an die Westseite eines Hügels gelehnt und überblickte von dort die Weite der Steppe bis zum Horizont. Hier grasten tagsüber die wenigen Rinder und Kamele Zarathustras, denn Ahura Mazdah hatte ihn mehr mit Weisheit als mit irdischen Gütern gesegnet.
Überall auf dem Hügel verstreut wuchsen Zarathustras Pflanzen, die er züchtete, damit sie ihm bei seinem Großen Werk, der Bekämpfung des Bösen, dienlich seien. Blau, gelb und weiß wogte des Frühlings ein Blütenmeer, das großzügig die unterschiedlichsten Düfte verströmte. Auf der Südseite des Hügels befand sich ein bescheidener, liebevoll eingerichteter Tempel. Bequeme Sitzkissen vor Wandteppichen luden die Gläubigen ein, im Gebet zu verweilen. Der Tempel diente den Brüdern der Weißen Magie als Zentrum ihrer Macht. Zwischen seinen Marmorsäulen hielt die Bruderschaft unter der Leitung Zarathustras in regelmäßigen Abständen ihre Rituale ab.
Zarathustra hatte viel unter den Anfeindungen seiner Gegner, der finsteren Bruderschaft der Schwarzen Magie, zu leiden. Sein ganzes Leben hatte er dem Kampf des Guten gegen das Böse gewidmet, ohne dass bislang ein durchschlagender Erfolg seine Bemühungen gekrönt hätte.
Eines Nachmittags saß er ziemlich entmutigt am Lieblingsfenster und sah seufzend in die Steppe auf seine dürren Rinder hinaus. Geistesabwesend kraulte er der schnurrenden Perserkatze auf seinem Schoß den Kopf ... In bewegten Bildern zeigte ihm die Erinnerung die wichtigsten Stationen seines Lebens: die Einweihung in die Bruderschaft, die Ausbildung, die Prüfungen, seine Heirat, das Lachen seiner beiden Töchter, später deren Hochzeit. Es schien Zarathustra eine halbe Ewigkeit her zu sein ... Seit er seine Ehefrau begraben hatte müssen, bewohnte er zusammen mit einer betagten Haushälterin und zwei Knechten sein einsames, doch wohl bekanntes Anwesen.
Was sollte Zarathustra noch alles tun? Die gleichen Techniken, derer er sich bediente, halfen auch den Schwarzmagiern, seiner Bruderschaft einen Streich nach dem anderen zu spielen. Einmal waren sie eine Nasenlänge voraus, dann waren es wieder die anderen. Ein Ende des Kriegs war nicht in Sicht, und manchmal war der Magier gar nicht recht davon überzeugt, dass er und seine Brüderschaft gewinnen würden. Natürlich hatte ihm Ahura Mazdah geoffenbart, dass am Ende der Zeiten das Reich des Lichtes über das der Finsternis siegen würde, aber warum fiel es in Zeiten harter Prüfungen so schwer, dem Glauben zu schenken? Sollten sich aber die Schwarzmagier unter diesem abscheulichen Bandva durchsetzen, taten ihm jetzt schon die Menschen leid. Bandva würde für lange Zeit eine Herrschaft des Schreckens errichten, wie sie in der Geschichte der Menschheit noch nie da gewesen war.
Koste es was es wolle, Zarathustra musste das verhindern. Die Frage war nur, wie. Hätten seine Brüder und er nur einen Zauber, der wirklich neu wäre, einen, der nicht sofort zu bekämpfen wäre, könnte er vielleicht die magische Kraft seiner Gegner bannen. Gänzlich brechen war ohnehin unmöglich, weil das Böse nach Ahura Mazdahs eigenem Willen bis zum Ende aller Zeiten Bestand haben sollte, seufz, aber für eine Zeitlang unschädlich machen – ja, wenigstens das sollte zu schaffen sein. Der Magier entschloss sich, Ahura Mazdah zu befragen. Entschlossen stand Zarathustra auf und machte sich daran, astrologisch den günstigsten Zeitpunkt für ein Ritual zu berechnen. Und siehe da, noch heute Nacht, kurz vor Morgengrauen, würde sich der Jupiter in Konjunktion mit dem Saturn befinden, dazu ein Trigon mit dem Mond. Das verhieß gutes Gelingen.
Nachdem er Moimona, seiner Haushälterin, noch die Anweisung gegeben hatte, ihn kurz nach Mitternacht zu wecken, vertiefte er sich in das Studium seiner alten Schriften, der Weisheit seiner Vorfahren. Darüber wurde es langsam Abend, ein Umstand, der Zarathustra auffiel, als ihm das Lesen immer schwerer fiel. Er zündete eine Kerze an, fütterte die Katze, aß ein Stück Ziegenkäse mit Brot, trank einen Schluck Milch und stürzte sich wieder auf den Mythenschatz seines Volkes ... Plötzlich wurde er an der Schulter aus dem Schlaf gerüttelt. Moimona hatte ihn geweckt.
Tau lag in der Zwischenzeit, stellte Zarathustra fest, als er durch seinen Kräutergarten in Richtung Tempel ging. Noch war es stockfinstere Nacht, als sich ächzend die schwere Türe zum Tempel öffnete. Im Opferraum zündete er die magisch geweihten Kerzen an, warf seine Robe über und traf seine sonstigen Vorbereitungen. Nach einigen Minuten qualmten die Räucherungen, deren betäubenden Duft der Magier tief einsog. Dann setzte er sich und versenkte sich in die Ruhe des Geistes, um für sein Ritual bereit zu sein. Ab und zu warf er einen Blick aus dem Ostfenster des Tempels, damit er die Zeit nicht übersehe.
Als ihm ein heller werdender Streifen am Horizont anzeigte, dass die berechnete Stunde angebrochen war, erhob sich Zarathustra und begann mit seinen Gebeten. Währenddessen schritt er zur Statue Ahura Mazdahs an der Stirnseite des Tempels. Dort beugte er sich andächtig zu einem Becher mit Haoma hinunter, erhob diesen mit einer würdevollen Geste und trank in kleinen Schlucken. Dann begann er mit allmählich lauter werdender Stimme seine Beschwörungsformeln gemäß den überlieferten Anweisungen zu rezitieren. Wenig später erfüllten noch mehr Räucherungen die Luft und hüllten alles in wabernden Nebel. Langsam verschwammen die Konturen Ahura Mazdahs … Der Magier vernahm seine eigenen Beschwörungen wie aus weiter Ferne, gedämpft und ohne Hall. Mitten in diese Stimmung hinein fühlte er, wie sich seine Seele öffnete. Sein ganzer Körper vibrierte, erschüttert durch die unsichtbare Gegenwart einer überwältigenden, transzendenten Macht.
Plötzlich schien es ihm, als vernehme er eine Stimme, die in tiefer, männlicher Stimmlage von allen Seiten auf ihn eindrang: „Zarathustra, ich weiß, du bist in Sorge. Zu recht. Folge mir, ich will dir etwas zeigen.“
Zarathustras Geist folgte Ahura Mazdah in Visionen vieler Sphären, eine fremdartiger als die andere, von Anfang und Ende der Welt, quer durch alle Zeiten. So sah er sich einmal durch eine Gegend gehen, die keine Sonne beschien, weil der Himmel von tiefhängenden Wolken verdunkelt war. Am Boden reihten sich verschieden große Krater zwischen Feuerherden. Auch Pfützen mit stinkendem, brackigem Wasser musste Zarathustra ausweichen. Alles war zerstört, kein Vogel war zu hören, kein Baum zu sehen, der nicht verkohlte Äste anklagend in die bleierne Dämmerung gestreckt hätte. Die Luft ließ sich nur schwer atmen und war gelegentlich mit beißenden, unangenehmen Gerüchen geschwängert. Hin und wieder bemerkte er eine halb verbrannte oder verstümmelte Leiche, die inmitten von Ruinen und ihm fremder Geräte aus schwerem Metall herumlag. Offensichtlich war niemand da, um die Toten zu beklagen. Hier herrschten nur Zerstörung, Tod und Verwesung. Mit klammen Fingern griff die Trostlosigkeit des Ortes nach seiner Seele, so dass Zarathustra froh war, als sich sein mystisches Auge schloss ...
Als es sich wieder öffnete, gewahrte er eine Herde großer, stark gebauter Pferde über eine Ebene galoppieren. Der Vollmond beleuchtete die Gegend fast taghell. Der Tritt der Pferde ließ die Erde beben und die wenigen Sträucher und Bäume erzittern. Die Vibrationen pflanzten sich bis in das Weltall hinaus fort und es schien Zarathustra, als würde das Universum bis an sein Ende vom Galopp der Pferde erschüttert ...
Dann wieder schaute er einen Pfau. Der Vogel saß in seiner vollen Schönheit auf einer orchideengeschmückten Veranda. Diese gehörte zu einem Gebäude aus Marmor, das am ehesten mit einem Tempel zu vergleichen war. Davor erblickte Zarathustra eine in Blüte stehende Wiese. Über diese bunte Pracht glitten feenhafte Wesen hin, ätherisch schwebend zwischen Schmetterlingen in der Sonne. Ein Stück weiter weg schaute er einen Waldrand. Mächtig hoben sich urwüchsige Stämme und das satte Grün der Zweige und Äste vom wolkenlosen Himmel ab. Davor glänzte verträumt die Oberfläche eines kleinen Teiches. Aus der Ferne hörte er das Rauschen eines Wasserfalles, vermischt mit dem Gesang fremder Vögel. Alles war lichtdurchtränkt, durchpulst mit Freundlichkeit ...
Leider wurde ihm auch diese Schau früher oder später entzogen. Am Ende aller Visionen fand sich Zarathustra im heimatlichen Tempel wieder, zu Füßen der Statue Ahurah Mazdahs. Erneut vernahm er dessen Stimme: „Es ist vermessen von dir, das Böse vernichten zu wollen, das liegt nicht in deiner Macht. Aber ich achte es, wenn du das Gute stärken möchtest, soweit du das vermagst. Daher möchte ich dir heute meinen letzten Auftrag mitteilen. Du bist der treueste meiner Diener und nur du bist würdig, ihn zu erfüllen.
Finde einen schwarzen Stein von der Größe einer Faust. Er muss vom Anfang des Universums stammen. Den trage bei dir, denn er wird dich inspirieren. Was du durch ihn vernimmst, das schreibe auf. Schreibe es nieder in Versen, und diese sollst du Gatha nennen. Das sei dein Vermächtnis für die Welt, ein Leuchtfeuer für die Wesen, die guten Willens sind.“
Damit verklang die Stimme, ein verebbendes Echo zwischen den Säulen des Tempels. Erschöpft schlief Zarathustra ein. Es war bereits heller Tag, als er wieder zu sich kam.
Zarathustras Vision
Zwei Tage nach Zarathustras Ritual hielt die Bruderschaft der Schwarzen Magie eine Zusammenkunft ab. In der Tiefe der Nacht prasselte Regen auf die Dächer der Hauptstadt. Da und dort kämpfte eine blakende Fackel einsam gegen die Dunkelheit. Kein Mensch, nicht einmal ein Hund, hielt sich auf den Straßen auf, die zwischen den Häusern zum Tempel der Bruderschaft inmitten der Stadt führten.
In einem der Nebenräume des Gebäudes flackerte der Schein von Kerzen aus schwarzem Wachs und warf unruhiges Licht auf die Pfützen vor dem Fenster. Beißender Rauch erfüllte die ohnehin schlechte Luft des Raumes. Wegen der aufgesetzten Kapuzen und der mangelhaften Beleuchtung erkannte man kaum die Gesichter der Männer, die sich hier eingefunden hatten, ihre Ränke zu schmieden.
Bandva, der verworfenste aller Schwarzen Magier, gegen den mancher in der Runde ein harmloser Waisenknabe war, leitete das Treffen. Wie leblos saß er am Kopfende eines massiven Holztisches und hörte die längste Zeit dem Gemurmel seiner Brüder zu, ohne sich am Gespräch zu beteiligen. Plötzlich legte er die rechte Hand auf die Tischplatte, zum Zeichen, dass er nun zu sprechen wünsche. Es wurde still.
Mit einer Stimme die klang, als käme sie direkt aus der Gruft, begann er zu reden: „Ich habe euch nicht umsonst gerufen, Brüder. Unser Spion im Hause Zarathustras hat mir berichtet, dass sein Herr vorgestern ein Ritual abgehalten hat. Er weiß nicht, worum es gegangen ist, aber dem Verhalten seines Herrn zufolge dürfte es ein Erfolg gewesen sein. Lasst uns Zarathustras magische Kraft durch das Kleine Bannritual lähmen, damit er gehindert ist, seine Pläne zu verwirklichen. In der Zwischenzeit müssen wir herausfinden, was er erreicht hat, damit wir mit aller Macht zurückschlagen können."
Da meinte hinten der einäugige Lumma, den alle „den Heimtückischen“ nannten: „Die Kraft des Rituals schwindet, wenn der Mond fünfmal voll geworden ist. Und unsere Fähigkeiten sind in dieser Zeit ebenso gelähmt."
„Ja, Bruder“, erwiderte Bandva, „deswegen verwenden wir das Kleine Bannritual nur, wenn es sich als unerlässlich erweist. Zudem sind unsere Spitzel keineswegs beeinträchtigt. Wir müssen diese anweisen, eifrig alles an Beobachtungen zusammenzutragen. Nach dem, was wir zur Stunde wissen, sind wir ohnehin außerstande, einen Plan zu schmieden, der der Weißen Bruderschaft das verdiente Verderben bringt. Brüder, wir müssen immer vorsichtiger werden. Zarathustra und seine Anhänger werden von Jahr zu Jahr gefährlicher. Eines Tages müssen wir ihn vernichten, je eher desto besser.
Weil sein Ritual schon zwei Tage zurückliegt, tut Eile not, bevor er irgendwelche Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Und daher, Brüder, lasst uns in dieser Nacht unseren Bund mit Angra Mainyu durch Blut erneuern. Die Sterne stehen günstig und die Stunde des Saturn zieht herauf. Ehe sie vergeht muss das Ritual vollzogen sein, zu Ehren Angra Mainyus!“
Kaum hatte er geendet, gab er einer Person, die die ganze Zeit an der rückwärtigen Wand gestanden hatte, einen Wink mit der linken Hand. Einer der Knechte Zarathustras trat aus dem Halbdunkel hervor und nahm eine Goldmünze in Empfang, welche ihm Bandva verächtlich entgegenwarf. Der Knecht bedankte sich untertänig und beeilte sich, rückwärts hinkend und sich dabei verbeugend, den Raum zu verlassen.
Die Brüder warteten bis die astrologischen Berechnungen eine Konjunktion zwischen Saturn und Mond ergaben. Kaum war es soweit, zerrten einige von ihnen die für die Opferung bestimmten Rinder und Ziegen an rostigen Ketten in den Ritualraum. Hier qualmten bereits Räucherungen großteils giftiger Pflanzen, während Bandvas Stimme in Anbetungen zu Angra Mainyu mächtig anschwoll.
Lumma wetzte fachmännisch die Opfermesser. Schneidend scharf drang das Geräusch durch die Gänge und Hallen und vermischte sich mit dem Scharren der Hufe und dem angstvollen Schreien der Opfertiere. Kundig ließ er den Blick seines einen Auges über die Klingen schweifen, um zu prüfen, ob sie scharf genug waren. Ein anderer Bruder rührte inzwischen das Haoma an, welches ihnen bald zu Macht über die Kräfte der Finsternis verhelfen sollte. Drei andere Brüder nahmen trommelähnliche Schlaginstrumente, die mit Menschenhaut bespannt waren, zur Hand. Ihr ohrenbetäubendes Trommeln leitete das Ritual ein. Mit einem scharrenden Geräusch in den Angeln stießen zwei Brüder das Tor zum Opferraum zu und verriegelten es von innen ...
Von Stunde an beschäftigte Ahura Mazdahs Auftrag Zarathustra fast Tag und Nacht. Er wäre ja gerne gewillt gewesen, ihn zu erfüllen, doch eröffnete sich ihm vorläufig kein Weg, an den bewussten Stein zu gelangen. Die ersten Tage hatte er mit astrologischen Berechnungen, die ihn keinen Schritt weiterbrachten, verschwendet. Sämtliche altbewährten Methoden, eines Gegenstandes habhaft zu werden, schlugen fehl. Befragte er seinen magischen Spiegel nach dem Aufenthaltsort des Steines, zeigte ihm der nur sein eigenes Gesicht, keine Landschaft, geschweige denn einen Stein, nicht die Spur einer Vision. Wollte er seinen Geist während des Schlafes auf Erkundung schicken, träumte er unkontrolliert vor sich hin; einmal sogar von den lockeren Frauenzimmern der Hauptstadt. Wie ärgerlich, hatte er doch das Alter schon lange hinter sich, in dem derlei das Herz erfreut! Überhaupt schien es, als hätten ihn seine magischen Kräfte verlassen. Alles, was er übersinnlich unternehmen wollte, führte zu nichts – es war wie verhext. Zu guter Letzt hoffte Zarathustra nur noch auf den Zufall.
Auf diese betrübliche Weise war bald ein halbes Jahr vergangen. Inzwischen war es Frühherbst geworden und Zarathustra weilte bei seinem Schwager, einem angesehenen Pferdezüchter, vier Tagesreisen entfernt im Norden. Dieser gab anlässlich der Heirat seines Sohnes ein Fest. Zarathustra wollte zugegen sein, auch um wieder einmal die Gegenwart lieber Freunde und Verwandter zu genießen. Einige von ihnen hatte er Jahre nicht mehr getroffen. Es war erstaunlich und belehrend zugleich zu sehen, wie die Zeit die Leute formte. Den einen machten die Jahre dürr, den anderen feist und gar manchen hätte Zarathustra nicht mehr wieder erkannt, wäre ihm nicht sein Schwager hilfreich zur Seite gestanden.
Das Fest zog sich über drei Tage hin. Gegen Ende hatte Zarathustra immer öfter das Bedürfnis, sich von der Gesellschaft zurückzuziehen. Der viele Lärm und die pausenlose Anwesenheit all der Leute hatten ihn erschöpft. Erfreulicherweise lag ein Teich hinter dem Hause seines Schwagers. Eingesäumt von duftendem Gebüsch lud das Gewässer Zarathustra ein, an seinem Ufer aus der Ruhe Kraft zu schöpfen.
Der Magier setzte sich an den Rand des Teiches und genoss es, die Geräusche des Festes nur mehr im Hintergrund zu hören. Tief sog er die frische Abendluft in die Lunge, nachdenklich ließ er seinen Blick auf der Wasseroberfläche ruhen. Wie schnell die Zeit doch verstreicht, achtete man ihrer nicht. Gelegentlich kräuselte ein Lufthauch die Oberfläche ... Sein Geist wurde still. Zarathustras Atem ging ruhiger und tiefer, ohne dass er dies bemerkt hätte ...
Da formte sich die Oberfläche des Wassers, als hätte sie jemand mit unsichtbarer Hand berührt. Als sich der Wasserspiegel wieder glättete, schaute Zarathustra eine Steppengegend, ganz in der Nähe seines Hauses. Ein Pferd – war es nicht eines der seinen? – scharrte ein Stück Grasnarbe zur Seite. Darunter kam ein schwarzer, faustgroßer Stein zum Vorschein. Eine behaarte Männerhand griff danach. Im nächsten Augenblick zeigte ihm die Vision den ganzen Mann. Es war Gotlin, einer seiner Knechte, der nun den Stein in einem Sack verstaute und auf das Pferd stieg. Dann trübte sich das Wasser. Als es wieder aufklarte, waren die Bilder verschwunden.
Jetzt war Zarathustra munter geworden. Freudestrahlend sprang er auf und eilte zu seinem Gastgeber in den Festsaal: „Lieber Schwager, hab' Dank für deine Gastfreundschaft. Aber ich muss dich jetzt verlassen, weil mich eine Angelegenheit nach Hause ruft, die keinen Aufschub duldet. Ich gehe dem größten Ereignis meines Lebens entgegen. Ich hoffe, es fällt dir der Abschied leichter, wenn du weißt, dass ich mich jetzt schon glücklich schätze.“
Zwar wollte ihn sein Schwager zurückhalten, da es zu gefährlich sei, in seinem Alter nächtens durch die Wildnis zu reiten, aber Zarathustra zeigte sich uneinsichtig. Schnell verabschiedete dieser sich von den Leuten, umarmte geschwind den einen, bat noch, dem anderen Grüße auszurichten. Ungeduldig ließ er die Liebkosungen seiner Base über sich ergehen, die ihn unbedingt noch an ihren wogenden Busen drücken wollte. Würde man sich doch lange nicht mehr sehen! Sei die Reise ja so gefährlich! Überdies höre man neuerdings viel von Räubern und ähnlichem Gesindel! Und überhaupt, man wisse nie ...!
Schließlich gelang es Zarathustra, sich auf sein Pferd zu schwingen und ihm die Sporen zu geben. Voller Unrast ritt er in Richtung heimatlicher Gefilde. Es beeindruckte ihn wenig, dass der Weg bei Tage schon beschwerlich war – und dann erst noch bei Nacht! Jeder Hufschlag seines Pferdes brachte ihn dem Stein näher, das war alles, was zählte.
Es war schon Mitternacht vorbei, als Zarathustra seine erste Pause einlegte. Am Ufer eines kleinen Flusses, an dem er entlang geritten war, band er sein Pferd an einen jungen Baum. Dann suchte er trockenes Holz für ein Feuer. Als die Flammen prasselten, dachte er über seine Lage nach. Deutlich fühlte er sich der größten Schlacht seines Lebens nähern. Dementsprechend wollte er sich innerlich vorbereiten. Vielleicht vermochte er endlich einen vernichtenden Streich gegen die Bruderschaft des Bösen zu führen. Wie sehr hätte es ihn gefreut!
Das knisternde Feuer im Rücken sah er den Fluss hinauf. Langsam floss das Wasser, auf dessen Oberfläche sich der Mond und die Sterne glitzernd spiegelten. Ein kühlender Lufthauch wehte ihm ins Gesicht. Da er sich in die nächtliche Stimmung vertiefte, wurden seine Gedanken ruhig. Er konzentrierte sich auf sein mystisches Auge und stellte sich seinen Geist als scharfes Schwert vor, das vor ihm in der Luft hing. Als er nach Minuten intensivster Bemühungen das Schwert in aller Deutlichkeit vor sich sah, griff er mit beiden Händen danach und betete: „Oh Ahura Mazdah, verleihe mir die Kraft, dieses Schwert mit Weisheit zu führen.“
Das angstvolle Wiehern seines Pferdes riss Zarathustra aus seiner geistigen Versenkung. Was näherte sich aus dem Dunkel? Ein Wolf! Augenblicklich ergriff Zarathustra einen brennenden Ast und verscheuchte diesen damit. Weil das Feuer schon recht nieder war, würde es wohl besser sein, weiterzureiten und erst bei Tageslicht erneut zu rasten.
So ritt Zarathustra unter mancherlei Gefahren Richtung Heimat.
Zarathustras Inspiration
Es ging schon auf den Mittag des vierten Tages zu, als Zarathustra in die Nähe seines Hauses kam. Der Morgennebel, der um diese Jahreszeit bis weit in den Vormittag hielt, lichtete sich gerade und gab den Blick auf die vertraute Weite der herbstlichen Steppe frei. Vor dem Eingang stieg er müde ab, führte sein Pferd in den Stall und übergab es Gotlin, auf dass dieser es betreue. Im Haupthaus begrüßte er Moimona, die ihrem Herrn einen Lammeintopf anbot. Nachdem sich Zarathustra ausgiebig gestärkt hatte, legte er sich nieder. Erschöpft schlief er ein.
Wieder munter überlegte der Magier, wie er am besten in den Besitz des Steines gelangen könnte. List, Gewalt, Kauf? Eine List mochte fehlschlagen. Gewalt war ihm erstens zuwider, zweitens würde sie sicher kein Glück bringen. Ein Kauf wieder musste nicht unbedingt zustande kommen und hätte in diesem Falle Gotlin Zarathustras Interesse daran verraten. Was wäre, wenn Gotlin, sein hinkender Knecht, sich von dem Stein nicht trennen wollte? Aber der Magier musste sich den Stein aneignen, koste es, was es wolle. Der Zufall sollte ihm helfen.
Die nächsten Tage fiel ihm auf, dass Gotlin schlechter Laune war. Offenbar unausgeschlafen schlich er mürrisch den ganzen Tag umher, gab nur knappe Antworten und verhielt sich auch sonst wie ein alter, misslauniger Dachs. Weil sich dieser Zustand nicht ändern wollte, stellte Zarathustra seinen Knecht zur Rede.
„Ich weiß nicht, wie mir geschieht“, gab ihm Gotlin entschuldigend zur Antwort, „aber ich habe seit neuestem schwere Albträume. Etwas Schwarzes, Drückendes legt sich auf meine Brust und schnürt mir die Luft ab. Dazwischen wache ich wieder schweißgebadet auf, sodass ich morgens wie erschlagen aufstehe. Du bist doch so weise, Zarathustra, vielleicht weißt du, woran das liegen könnte?“
Zarathustra entgegnete: „Mir scheint, es ist ein ungünstiger Einfluss in dein Leben getreten. Hast du vielleicht in jüngster Zeit Bekanntschaft mit einem Ding gemacht, das sich mit schwarz, drückend und schwer verbinden ließe?“
„Oh ja, ich habe vor wenigen Tagen einen merkwürdigen Stein in der Steppe gefunden. Denkst du, dass er es ist, der mir diese Träume bringt? Warte, ich hole ihn.“
Mit diesen Worten eilte er in seine Kammer. Wenig später war er zurück und hielt den verdächtigen Stein in seiner Hand. Zarathustra musste alle Beherrschung aufbringen, als er den Stein aus seiner Vision in Gotlins Hand erblickte. Scheinbar unberührt betrachtete er ihn prüfend, wog ihn abschätzend in seiner Hand. Was für ein Gefühl! Dann nahm er ein Pendel und hielt es über den Stein. Nach kurzer Zeit war ein Ausschlag wahrzunehmen, den Zarathustra als Bestätigung ihrer Vermutung, der Stein sei an den schweren Träumen schuld, deutete.
„Gotlin, du hast Recht. Du musst diesen Stein unbedingt so schnell als möglich loswerden. Wenn du ihn mir gibst, mache ich ihn unschädlich und du wirst erneut ruhig schlafen.“
Gotlin bedankte sich für die Hilfe, überließ Zarathustra erleichtert den Stein und begab sich wieder zu seiner Arbeit.
Für Zarathustra gab es kein Halten mehr. Zuerst musste er den Stein vom Fluidum Gotlins reinigen. Dazu wurde er einige Stunden lang in fließendes Wasser gelegt, anschließend kräftig abgetrocknet. Dann verwendete Zarathustra eine spezielle, streng geheime Räucherung, der er den Stein eine Nacht über aussetzte. Daraufhin legte er den Stein an eine geschützte Stelle auf dem Dach in den Wind. Nach drei Tagen nahm er ihn in den Tempel und vollzog ein abschließendes Reinigungsritual. Nun galt es, seine übernatürlichen Kräfte zu wecken. Zu diesem Zweck setzte der Magier den Stein wieder eine Nacht bestimmten Räucherungen aus, sodann ließ er ihn im Lichte des Vollmondes ausgiebig baden. Des Weiteren trug ihn Zarathustra stets mit sich. Schlief er, lag der Stein unter dem Kopfpolster. Tagsüber befand er sich meist in einer seiner Taschen, wo er von Zarathustras Körper erwärmt wurde.
Eines Nachts geschah das Unglaubliche. Zarathustra erwachte, weil er sich von einer Stimme gerufen fühlte. Gespannt, ob sich diese erneut melden würde, setzte er sich im Bett auf und versuchte, seinen Geist so weit wie möglich zu öffnen. Vollmond schien durch das Fenster und tauchte das Zimmer in mildes Licht. Einem inneren Impuls folgend, holte Zarathustra Kerze und Schreibzeug. In der Tat, nach wenigen Minuten vernahm er wieder die Stimme. Er beeilte sich niederzuschreiben, was ihm eingeflüstert wurde. Auf diese Weise begann er an jenen 17 Hymnen zu schreiben, die als „Gathas“ die Jahrtausende überlebten. Sie beschäftigen sich mit dem Weg des Menschen durch das Universum. In kunstvollen Versen schilderte Zarathustra die Möglichkeiten, im Einklang mit der Wahrhaftigkeit und der rechten Ordnung zu leben und damit auf einem vom rechten Geist erfüllten Lebensweg zu wandeln ... Danach folgten andere Schriften, welche im Dunkel der Geschichte verborgen blieben.
Fortan dachte er Tag und Nacht an nichts anderes mehr. Wo immer er sich aufhielt, wo immer er ging, beflügelte ihn die Inspiration. Gelegentlich drängten sich ihm die Gedanken so schnell auf, dass er alle Mühe hatte, sie niederzuschreiben, bevor er sie vergessen hatte, da sich ihm schon wieder neue Erkenntnisse eröffneten. Zudem ließ Zarathustras Sehkraft infolge fortgeschrittenen Alters nach. Außerdem seufzte er oft, wenn er in den langen Winternächten das wärmende Bett verließ, um sich der Inspiration hinzugeben. So hatte er zwar manche Mühe – und dennoch, es war ein Lächeln in seinem Gesicht wie noch nie zuvor in seinem Leben. Natürlich sprach sich dies rasch herum.
Im Winter dieses Jahres hielt die Schwarze Bruderschaft wieder eine Zusammenkunft ab. Eiszapfen und gefrorene Pfützen zeichneten die Stadt. Ein steifer Wind peitschte nächtens schwere Schneeflocken durch menschenleere Gassen. Gegen Ende der Versammlung öffnete sich die Hintertüre des Tempels. Eine finstere Gestalt trat in den Frost hinaus. Ein Messer aus der Sammlung Lummas, des Heimtückischen, verbarg sie unter dem winterlichen Umhang, der bald mit Schnee bedeckt war. Unheilvoll waren die Gedanken, das Verlangen nach Rache verdüsterte das Herz. Und eine Belohnung winkte ebenfalls, sollte ein blutiger Plan erfüllt werden ...
Knapp drei Monate später starb Zarathustra, im Alter von 77 Jahren mitten in einer seiner durchwachten Nächte. Die letzte Zeile war geschrieben, seine letzte Schlacht gegen das Böse geschlagen. Und außerdem fand sich im Hause ohnehin kein Federkiel mehr, den der Magier hätte zuschanden schreiben können.
Ehe der Morgen graute öffnete sich leise knirschend die Tür zu Zarathustras Zimmer. Der Mond warf sein Licht bis kurz vor den Eingang. Beginnend mit den Stiefeln trat eine menschliche Gestalt vorsichtig aus dem Dunkel. Kühler Frühlingswind sorgte für den Duft blühender Ginstersträuche in der Kammer. Ein wehender Umhang schälte sich aus der Finsternis. Draußen zirpten die Grillen. Eine Messerklinge blitzte in der Hand. Zuletzt erhellte der Mond das Gesicht – Gotlin!
Zarathustra hatte ihn damals schändlich betrogen. Um einen Schatz hatte er ihn in Wirklichkeit gebracht, war ihm gesagt worden. Seither hatte Gotlin auf eine günstige Stunde gewartet, dafür Rache zu nehmen. Und nun fand er seinen Herrn tot über seinen Aufzeichnungen, in einer Haltung, als sei er gerade friedlich eingeschlafen! Irgendwie war Gotlin erleichtert, dass ihm der Tod zuvorgekommen war. War er wenigstens nicht zum Mörder geworden. Und als ehemaliger Angehöriger eines Nomadenstammes fühlte er sich im Grunde seines Herzens sowieso nicht als Anhänger Ahura Mazdahs. Insofern sah er den Tod seines Herrn ohne wahres Bedauern.