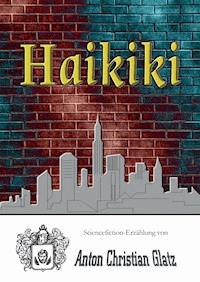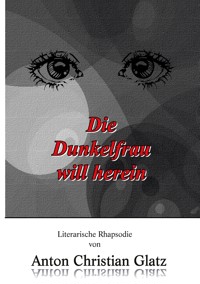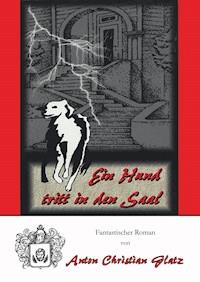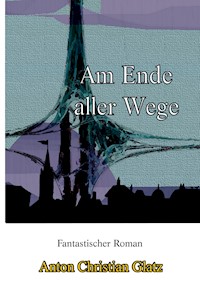
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Lektorin Laura zieht in Keffrin, im berüchtigten Wohnblock Wilhelm-Reich-Straße 15, ein. Jede Menge skurrile Menschen wohnen in der Nachbarschaft. In einen, den Apotheker Pepito, verliebt sie sich. Doch Pepito hat ein Geheimnis, das sich den beiden nur langsam enthüllt. Während seiner pharmazeutischen Experimente mit der Weltformel stellen sich höchst beunruhigende Erinnerungen ein. Sie lieben das Ungewöhnliche, das Groteske? Sinnliches? Sie schätzen Schwarzen Humor im wüsten Handgemenge mit philosophischen Verrenkungen? Greifen Sie zu und genießen Sie ein in gemäßigt transrealistischer Technik geschriebenes Vergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dosojin gewidmet, dem japanischen Gott all derer, die unterwegs sind.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
1
Die Immobilienmaklerin sperrte die Wohnungstüre auf. Neugierig folgte ihr Laura Mannheim. Sie betraten eine 2-Zimmer-Wohnung, teilmöbliert, im vierten Stock, schöne Aussicht, nach Süden gelegen; soweit die Beschreibung im Inserat. Genau das, was Laura brauchte. Nächste Woche sollte sie beim Verlag Freche Feder als Lektorin beginnen, und bis dahin musste die Übersiedlung erledigt sein.
Die junge Frau hörte sich interessiert die Informationen der Maklerin an. Auf ihrem Rundgang durch die Räume gab sich diese jede Mühe, die Vorzüge der Wohnung zu betonen. Im Wohnzimmer schwärmte sie von der Aussicht auf die Berge in der Ferne, im Schlafzimmer lobte sie die Fernwärme als zuverlässig und günstig, die Hausverwaltung als zuvorkommend usw. Bei aller Eloquenz umging sie das Thema Nachbarn geschickt.
In der Kochnische gingen ihr die Argumente aus, wodurch eine kurze Pause entstand. Das nützte Laura indem sie fragte:
„Und der Preis?"
„Nur 2.000,-- Drachmen im Monat“, antwortete die Maklerin. Mit gedämpfter Stimme: „Plus Betriebskosten" Und meiner Provision, fuhr sie in Gedanken fort. Aber das verstand sich wohl von selbst.
„Für Keffriner Verhältnisse kommt mir das verdächtig billig vor. Gibt es da vielleicht einen Pferdefuß?"
„Nun ja, Sie haben die Leute im Treppenhaus gesehen ... Im Hause wohnt nicht unbedingt das beste Publikum. Die Lage ist gut und die Wohnung bietet alles, worüber ein moderner Haushalt verfügen muss. Die Nachbarn könnten möglicherweise ein wenig problematisch sein."
„Aha, deswegen die zusätzlichen Schlösser, die mir an den Türen der anderen Wohnungen aufgefallen sind.“
Laura ging zur Eingangstür und vergewisserte sich, dass auchan dieser zwei Sicherheitsschlösser mit massiven Stahlketten mehr angebracht waren als üblich.
Auf dem Parkplatz unten heulte eine Polizeisirene auf. Die Polizisten rasten um die Ecke und hielten mit quietschenden Reifen vor dem Haus. Die Maklerin hoffte, Laura würde es nicht bemerken, es könnte die Kundin abschrecken, und es würde ihr nie gelingen, diese Wohnung zu vermieten. Führte sie das Objekt doch schon mehr als zwei Jahre im Angebot! Wenn sie es schaffte, die Wohnung zu vermitteln, dann an jemanden, dem die Wilhelm-Reich-Straße 15 kein Begriff war. Und der musste von weit her kommen.
„Aha, die Polizei“, sagte Laura nachdenklich und sah vom Balkon auf sieben oder acht Beamte hinunter, die mit gezückten Pistolen den Eingang stürmten.
„Äh ..., wahrscheinlich nur eine kleine Meinungsverschiedenheit unter den Jugendlichen im Treppenhaus“, meinte die Maklerin beschwichtigend. „Tja, die Jugend von heute ...“
Neugierig verfolgte Laura das Geschehen. Was würde wohl passieren, ginge es um mehr als eine kleine Meinungsverschiedenheit?
Wenig später schleppten die Polizisten zwei Jugendliche, wahrscheinlich männlichen Geschlechtes, mit Handschellen aus dem Haus. In diesem Moment fuhr die Rettung vor. Vier Sanitäter hasteten mit Tragbahren in das Gebäude. Kaum zwei Minuten später eilten sie wieder heraus, zwei Männer auf den Tragbahren, einer davon an eine Infusion angehängt. Ein Mädchen mit vielleicht 17 Jahren taumelte, gestützt von einem Sanitäter, hinterher. Mit Blaulicht und aufheulendem Motor entfernte sich der Rettungswagen.
Laura sagte spöttisch: „Natürlich nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und was die Wohnung betrifft, ich nehme sie.“
Der Maklerin fiel ein Stein vom Herzen. Am liebsten hätte sie Laura umarmt. Fast hätten ihre Hände gezittert, als sie ihrer Kundin das Besichtigungsprotokoll zur Unterschrift vorlegte. Weilten ihre Gedanken doch beim Kassieren ihrer Provision!
Laura war klar, hier würde sie wahrscheinlich bloß vorübergehend wohnen. In diesem Haus auf Dauer glücklich werden? Aber erstens war die Wohnung in bequemer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz, zweitens war sie billig, und drittens war keine Zeit mehr, eine andere Bleibe zu suchen. Und wegen der möglicherweise ein wenig problematischen Nachbarn hatte sie weniger Sorgen. Schließlich lebte Onkel Eduard, ein hochrangiger Polizist, in dieser Stadt. Er würde ihr sicher helfen, sollte sie auf Schwierigkeiten stoßen.
Schon am übernächsten Tag zog Laura ein. Sie hatte eine Speditionsfirma beauftragt, weil diese den Umzug mit einem einzigen LKW rasch und ohne Aufwand zu erledigen versprochen hatte. Außerdem wurden die Arbeiter der Firma von den üblen Typen im Treppenhaus in Ruhe gelassen.
Dann hieß es Hand anlegen: das Bett dahin, den Schreibtisch dorthin, die Bücher vorläufig in die Ecke stapeln, Geschirr auspacken, einräumen, Vorhänge aufhängen, Lampen montieren, stundenlang ging es so dahin. Am Abend eines anstrengenden Tages stellte Laura erleichtert fest, dass sie es schon recht wohnlich hatte. Es war zwar noch lange nicht alles perfekt, aber die Möbel standen wenigstens an ihrem Platz; auch Kleider und Geschirr waren bereits eingeräumt.
Laura beschloss, eine Verschnaufpause einzulegen, setzte sich auf den Balkon und erfreute sich der abendlichen Stimmung sowie der Aussicht auf die Berge. Mit Genuss zündete sie sich eine ihrer überlangen, dünnen Zigaretten an. Die Arbeiter hatten eine Flasche Bier vergessen, die sie sich öffnete. Mit einem pfffff... entwich die Kohlensäure. In kleinen Schlucken trank Laura aus der Flasche.
Die Idylle wäre perfekt gewesen. Ehe die junge Frau ins Schwelgen geriet, sorgte der Nachbar in der oberen Wohnung für den ironischen Kontrapunkt. Dem fiel es ein, seine Balkonblumen zu gießen. Er tat es dermaßen ausgiebig, dass das Wasser auf Lauras Balkon nicht nur tropfte, sondern rann.
Als Laura ihre durchnässten Hosenbeine sah, maulte sie aufgebracht nach oben: „He, Sie da!“
„Äh, ja ...“, antwortete ihr ein blonder, gut aussehender Mann Anfang dreißig. Da bemerkte er selbst, was er angerichtet hatte, und stellte die Gießkanne sofort auf die Seite.
Ein wenig verlegen sagte er: „Tut mir leid. Sie müssen sich jetzt von mir denken, der Trottel ist zum Blumengießen zu dämlich. Ich war einfach in Gedanken versunken. Sehen Sie doch das herrliche Abendrot.“
In der Tat, es war beeindruckend. Wie auf einem romantischen Gemälde des 19. Jahrhunderts warf die untergehende Sonne ihre letzten Strahlen zwischen Wolken, die sich in den Himmel türmten. Das stimmte Laura versöhnlich. In diesen Anblick hätte sie versinken können.
Jäh unterbrach der Nachbar ihre kleine Meditation: „Ich heiße Pepito Röhsler. Sie sind neu hier, oder?“
„Ja. Ich bin Laura Mannheim.“
„Wenn Sie Zeit, Lust und Laune haben, dann kommen Sie hoch zu mir. Ich lade Sie zum Essen ein.“
Laura warf einen kurzen Blick zuerst in ihre Seele, dann in den Kühlschrank – ja, sie hatte Zeit, Lust und Laune. Würde ihr doch heute erspart bleiben, sich etwas kochen zu müssen. In einer halben Stunde wollte sie zu ihrem Nachbarn. In dieser Zeit ging sie unter die Dusche und wechselte ihre Klamotten.
Einen Stock über ihr überlegte Pepito inzwischen, was er Laura vorsetzen sollte. Die gähnende Leere in seinem Kühlschrank belehrte ihn, dass er mit seiner Einladung etwas voreilig gewesen war. Halt! Da war noch ein Glas mit Kräutersugo. Als sich zu Pepitos Erleichterung im Vorratsschrank ein paar italienische Nudeln fanden, stand das Menü fest: Spaghetti mit Kräutersugo. Eindruck schinden ging sich damit beim besten Willen nicht aus. Zum Glück verzeiht man der Daseinsform Junggeselle vieles ...
Außerdem hieß es aufräumen. Ungeordnet standen seine geliebten chemischen Substanzen in diversen Reagenzgläsern und sonstigen Behältern im Wohnzimmer herum. In Windeseile verstaute er diese Utensilien in einer kleinen Besenkammer. Sicherheitshalber versperrte Pepito die Türe. Anschließend machte er sich an das Kochen.
Dolly, seine Waldmaus, saß in ihrem Käfig im Wohnzimmer und putzte sich. Anschließend beobachtete sie ihren Herrn, der eine ungewöhnliche Betriebsamkeit an den Tag legte ...
Unterdessen hatte Laura ihre Wohnung abgesperrt und sich in den oberen Stock aufgemacht. Wäre sie in der Nähe des Kellers vorbeigekommen, hätte sie eine Serie merkwürdiger, dumpfer Klopfgeräusche gehört: klackklack ... klockklock klick-klick ..., so pflanzte es sich in den unterirdischen Räumlichkeiten fort ...
Wegen eines Stocks wollte Laura nicht den Lift benützen, daher wandte sie sich dem Treppenhaus zu. Eine der Wohnungstüren war demonstrativ geöffnet und gab den Blick auf eine Prostituierte frei. Lauras neue Nachbarin wartete im Vorraum, auf einem Campingstuhl sitzend, bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Aus Langeweile blies sie eines ihrer Kondome auf. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Korridors, füllte ein Kind soeben seinen Topf mit viel Getöse. Daneben lungerten drei verwahrloste Jugendliche. Zwei spritzten sich gerade irgendetwas in die Vene ihres linken Unterarmes. Der dritte bohrte mit glasigen Augen andächtig in der Nase.
Laura ging vorbei. Sie öffnete die Glastüre, die das Treppenhaus vom Gang trennte. In diesem Moment begegnete sie einem unauffälligen Mann unbestimmten Alters mit einem schlecht sitzenden falschen Bart.
Im oberen Stock war Inspektor Ginzner gerade dabei, eine Verdächtige zu vernehmen. Den bulligen Mann mit deutlichem Bauchansatz und fettig glänzendem Haar störte es nicht, dass er sich auf dem Korridor befand. Ganz im Gegenteil, es sollte jeder wissen, wie es denen erging, die sich mit ihm anlegten.
Den Gerüchten zufolge war einer der Hausbewohner letzte Nacht erstochen worden. Diese Frau hier hatte unter allen Bewohnern des Stocks kein Alibi; mithin war sie schuldig. Zumindest für den Greifer Ginzner, der in seiner bekannt kurzen Entschlossenheit einen schnellen Erfolg zu verbuchen gedachte.
„Gesteh endlich, du Nutte!“, brüllte er sie an. Ohne auf eine Antwort zu warten, knallte er ihr eine Ohrfeige in das Gesicht. Es war ohnehin schon verschwollen von Ginzners Ermittlungsmethoden. Dann prügelte er die Frau windelweich. Daraufhin hatte sie genug und gestand einen Mord, den sie nicht verübt hatte.
2
Laura läutete bei Röhsler. Nach wenigen Sekunden öffnete der Nachbar. Pepito Röhsler – der ideale Jeans-Typ, gute Figur, lässig, trotzdem nicht nachlässig angezogen, offenes Wesen, ein Kumpel-Typ. Das versprach eine unkomplizierte Nachbarschaft. Dezent umgab ihn der Hauch eines ausgefallenen Aftershaves, an das sie sich erst würde gewöhnen müssen. Und Laura Mannheim – schwarzer Lederrock, passend zu ihren schulterlangen, blonden Haaren, freundliche Augen, hellblaue Raulederschuhe. Unverkennbar, wenngleich großteils verhüllt, waren die wichtigsten körperlichen Charakteristika einer erblühten Fraulichkeit. Welche Freude! Die Nachbarin verkörperte das, was Pepito unter einer adretten, jungen Frau verstand. Was ihr an körperlichen Attributen fehlte, um wirklich schön zu sein, machte sie durch ihre sympathische Ausstrahlung wett.
Während Laura die Wohnküche betrat, sagte Pepito: „Laura, das ist Dolly“, und zeigte mit dem rechten Daumen auf seine Maus im Hintergrund. „Dolly, das ist Laura.“
Smalltalk leitete zum gemütlichen Teil des Abends über. Nach der Menge Arbeit heute füllten die Spaghetti Lauras knurrenden Bauch mit Wohlbehagen. Mit Genugtuung stellte es Pepito fest. Zwischendurch ertappte er sich selbst dabei, wie sein Blick versonnen auf dem sich auf- und abbewegenden Brustansatz über der Nachbarin dunkelblauer Bluse ruhte. Darüber hätte er fast seinen Rotwein verschüttet.
Während die beiden aßen, fuhr unten eine teure Limousine vor. Dr. Ederle, ein Rechtsanwalt, stieg aus. Am Haupteingang läutete er bei Top 8, Erdgeschoß.
Diese Wohnung hatte er seinerzeit gekauft und an Studenten vermietet. Sie hatten für ihn Rauschgift an der Universität verteilt. Anfangs war es hauptsächlich Kokain, der Klassiker für Intellektuelle, gewesen, dann kamen Designerdrogen in Mode. Alles, was einer natürlichen Quelle entstammte, wie Haschisch und Kokain, war damit dem Bio-Freak vorbehalten. Später zogen leider die Studenten aus, leider deswegen, weil sie dank derlei Einkünfte stets pünktlich ihre Miete gezahlt hatten. Die Nachfolger waren gelegenheitsarbeitende, im Grunde beschäftigungslose Jugendliche, die in dieser Hinsicht viel unzuverlässiger waren. Freilich verteilten auch sie für ihn, aber im Stadtpark, wo das Klientel weniger zahlungskräftig war. Indes war das noch lange kein Grund, die Miete schuldig zu bleiben. Wie oft hatte Ederle seine Mieter ermahnt! Dieses Mal würde er ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden müssen.
Als der Türsummer ertönte, trat der Rechtsanwalt in den Hausgang. Er ging am Hausmeister vorbei, der gerade mit einem Reisigbesen eine schwer zu definierende Arbeit verrichtete. Ederle hörte ihn mit sich selbst reden: „Was für ein Scheißjob, immer das Blut von den Wänden wischen, Heroinspritzen und gebrauchte Verhüterli aufklauben, die Leute räumen heutzutage schon gar nichts mehr selber weg ... Ist ja der Hausmeister da! ... Beschweren sollte ich mich bei der Hausverwaltung. Ich bin einfach zu gutmütig für die Kerle in diesem Haus. Wenn sie es wenigstens zu schätzen wüssten ..."
Plötzlich flog eine Türe auf, und ein jaulender Hund schoss in den Korridor. Dann stand Ederle vor Top 8 im Parterre, er wusste selbst nicht, wie. Ein halb verwilderter Jugendlicher, vermutlich männlichen Geschlechtes, öffnete dem Vermieter. Ungepflegte Zähne mit einem deutlichen, zum Zahnfleisch hin dunkleren Belag bleckten Ederle entgegen, als der ihm unbekannte Jugendliche grüßte. Dauernd sind andere Typen da, stellte Ederle mürrisch fest.
3
Im vierten Stock, Top 43, wohnte Professor Heimo Häckemann, ein pensionierter Mathematiklehrer. Tag für Tag und bei jedem Wetter begab er sich in seine ehemalige Schule, dem Adam-Riese-Gymnasium, dem bedeutendsten Schulzentrum in Keffrin. Dort hatte er im Konferenzzimmer seinen Stuhl im Biedermeier-Stil in einer geschützten Ecke, in der er niemanden störte. In stoischer Ruhe wartete er hier auf das Schulende. Häckemann gehörte beinahe schon zum Mobiliar, ähnlich wie sein Stuhl, auf dem er sich pünktlich kurz nach acht Uhr morgens, allseits vernehmbar seufzend, niederließ.
Großväterlich wohlwollend schweifte sein Blick über das geschäftige Treiben von Lehrern und Schülern gleichermaßen. Gelegentlich wurde er von einem Lehrer oder einem Schüler zu einer Frage konsultiert. Dann zeichnete die Freude leuchtende Augen in die Falten seines Gesichtes. Klar hatte Häckemann streng genommen in der Schule nichts mehr zu suchen, doch ließ man den alten Herrn gewähren, schließlich störte er niemanden.
Diese Gewohnheit verlieh dem Tagesablauf des Pensionisten Struktur und seinem Leben ein Mindestmaß an Kontinuität; wie bei anderen Zeitgenossen das tägliche Gassigehen mit dem Hund. Auf diese Art und Weise war Häckemanns Gang zur Schule so etwas wie seine Nabelschnur zu dieser Welt. Trotz allem war dieser Gang keineswegs ungetrübte Freude, denn Prof. Häckemann war gehbehindert; er benötigte einen Stock. Manchmal stürzte er im Winter, dann war er heilfroh, wenn ihm jemand auf die Beine half.
Des Professors Gefährten waren die typische Einsamkeit des alternden Menschen und die Bitterkeit, als er merkte, wie manch einer der Schüler vor den Falten, den grauen Haaren und seiner trockenen Haut zurückwich.
Die Pensionierung war für Häckemann eine Katastrophe gewesen. Obwohl geistig noch völlig rüstig, fand er sich über Nacht in einem sozialen Ghetto, in das er seiner Auffassung nach noch lange nicht gehörte. Weil Häckemann keine Verwandten hatte und kaum noch Freunde, hatte ihn der Pensionsschock mit aller Härte erwischt. Mit seiner Gesundheit ging es infolge seines angegriffenen Kreislaufes rapide bergab. In seinem Stuhl hatte er jede Menge Zeit, diesen Fragen nachzuhängen.
Eines Tages fiel ihm eine neue Kollegin auf. Als auffallend attraktive Frau bewegte sie sich selbstbewusst durch die Schule. Wohlgefällig nahm sie die Bewunderung der Kollegen und die neidischen Blicke der Kolleginnen entgegen. Da wurde Häckemann schmerzlich bewusst, dass er sich mit Riesenschritten seinem Tod näherte. Enttäuschung machte sich breit. Enttäuschung, worüber? Weil das Leben im Grunde an ihm vorbeigezogen war. Was hatte es ihm schon geboten? Eltern, die viel zu früh gestorben waren, eine strenge, puritanische Erziehung im Haidenreichinternat, mit 24 Jahren seine Verwundung durch ein Auto, dessen betrunkener Fahrer mit 80 km/h bei Rot über die Kreuzung raste und Häckemann damit für den Rest des Lebens zum Hinken verurteilte. Später dann eine Menge pubertierender Jugendlicher, denen er gegen ihren Willen Integral- und Infinitesimalrechnen beibringen sollte und was der Unerfreulichkeiten mehr sind. Wenn er jetzt sterben würde, hätte er nicht einmal gesehen, wie sich eine schöne Frau nach allen Regeln der Kunst auszieht ... Im Grunde eine Schande ...
Prof. Häckemann fühlte sich in einem gänzlich anderen Boot als Hohfels, einer seiner ehemaligen Kollegen. Sabbernd vor Geilheit stand dieser hinter einer Straßenecke und sah mit glänzenden Augen den Schulmädchen nach. Nein, Häckemann trieb nicht die Gier des alten Lustmolches. Ihm drängte sich vielmehr die Einsicht auf, dass wichtige Erfahrungslücken in seiner Biografie klafften. Zudem zeigte ihm dies, wie stark das Leben nach wie vor in ihm pulsierte. Das wollte er genießen, bevor es zu spät gewesen wäre. Also zog er sich eines Abends seinen einzigen Anzug an, den er sich vor fünfzehn Jahren, der damaligen Mode folgend in mausgrauem Nadelstreif, gekauft hatte. Mit pffff – pffff versprühte er üppig sein Eau de Toilette der Marke „Skunk“ auf alle Körperstellen, die einer olfaktorischen Tarnung besonders bedurften.
Für seine Begriffe beschwingt machte er sich auf. Im Flur begegnete ihm eine hübsche, junge Frau. Vielleicht war es die neue Hausbewohnerin, die heute eingezogen war? Mit der U-Bahn fuhr er 5 Stationen bis zum Keffriner Zentrum. Dort lag der Trippoli-See, das zentrale Gewässer in Keffrin. Inmitten des Sees ragte ein felsiger Hügel aus der kalten, finsteren Tiefe. Darauf war der „Tempel“ erbaut. Seine Architektur war der Antike nachempfunden, daher die Bezeichnung. Säulen und Torbögen erhoben sich zwischen schroffen Felsen, dazwischen Kammern und Räumlichkeiten aller Art. Teilweise waren seine Gänge, Säle und Kammern in den Fels geschlagen, sodass seine wahren Ausmaße nach außen hin nicht annähernd erkennbar waren.
Häckemann zahlte und bestieg den Kahn. Der Fährmann war ein wortkarger und wahrlich finsterer Geselle, ein kongenialer Kollege Charons, der schon im alten Griechenland die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt beförderte. Er nahm ohne nachzuzählen schweigend Häckemanns Geld entgegen. Anschließend begann er zu rudern. Der Professor hatte die ganze Zeit über die Rückseite seines schwarzen, knöchellangen Umhanges vor sich, der sich gleichmäßig im Abendwind wiegte. Rachmaninovs „Toteninsel“ ertönte als entstiegen die Klänge dem Wasser und verwob sich einem Gemälde gleich in die Landschaft.
Hohe Pinien säumten die schroffen Felswände des kleinen Eilandes. Von weitem schon sah man auf halber Höhe die Eingänge zu den einzelnen Höhlen. Die größeren waren von antiken Säulen eingefasst. Von den Eingängen führte eine schmale Treppe zum Ankerplatz an das Ufer hinunter. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die „Toteninsel“ verebbte.
Ohne ein Wort verließ Häckemann den Kahn und stieg über die Marmortreppe nach oben. Am Eingang der ersten Höhle sprach ihn der Portier des Lokales an: „Guten Abend, mein Herr. Ich nehme an, Sie sind das erste Mal in einem Striptease-Lokal. Sie waren sicher bisher zu anständig, um eine so verruchte Örtlichkeit zu besuchen. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass Sie völlig richtig handeln, unser Gast zu sein. Am Ende sind das Heilige und die Sinnlichkeit eines. Fassen Sie sich ein Herz und gehen Sie unbeirrt den Weg zu Ende.“
Häckemann sah sich kurz um. Dann wollte er dem Portier seinen Mantel aushändigen – niemand mehr zu sehen! Als ihm eine Kellnerin entgegenkam, fragte Häckemann sie, wo der Portier blieb. Sie antwortete verdutzt, es gäbe hier keinen solchen. Da sie begriff, dass der alte Herr dankbar wäre für ein bisschen Unterstützung, half sie ihm, sich im Lokal zurechtzufinden. Nach dem Vorraum mit der Garderobe gelangte man in den eigentlichen Gastraum. Im hinteren Teil befand sich eine Tanzfläche von schätzungsweise sex mal vier Metern, die durch einen Vorhang wie eine Theaterbühne abgeschirmt werden konnte. Momentan war die Bühne frei. Den Rest des Raumes füllten die Tische mit den Gästen. Hier ließ ihn die Kellnerin alleine.
Mit klopfendem Herzen nahm Häckemann möglichst unauffällig in einer der hinteren Ecken Platz. Bald würde es losgehen.
4
Während des Essens waren Laura und Pepito übereingekommen, sich zu duzen. Kaum hatte Pepito das Geschirr abgeräumt, wollte Laura wissen: „Und was hat es jetzt mit diesem Haus auf sich? Irgendetwas stimmt doch nicht mit der Wilhelm-Reich-Straße 15!?“
Oh je, das war eine heikle Frage! Dabei hatte der Abend so gut angefangen. Als hätte er das Gefühl, er müsse sich schützen, schloss Pepito die Türe des Wohnzimmers bevor er antwortete: „Es wird von einem Haufen verkorkster, gestrandeter Typen bewohnt, du wirst schon sehen; Himmel und Hölle. Für die Hölle sorgen die anderen, um den Himmel musst du dich selbst kümmern.“
Schnell von etwas anderem reden, also fuhr er fort: „Was hast du für ein Gefühl wegen morgen? Immerhin wird es dein erster Arbeitstag im Verlag sein.“
Warum nur beschlich Laura das Gefühl, Pepito wollte vom Thema Nachbarschaft ablenken? Na gut, sie würde über kurz oder lang dahinterkommen. Sie antwortete: „Ich bin zuversichtlich. Ärgerlicherweise hat mir meine Vorgängerin jede Menge Arbeit hinterlassen. Man hat mich darauf vorbereitet, zuerst einmal den Rückstand abzuarbeiten. Wird schon werden."
„Prost!" – „Prost!"
Zwei bauchige Weingläser stießen aufeinander. Dann rann der französische Blauburgunder vom letzten Jahr (2 Drachmen 90 Cent bei Alpi Diskont) ölig Lauras und Pepitos Kehle hinunter. Er hinterließ einen angenehm fruchtigen Nachgeschmack. Wow, damit lässt es sich leben, dachte sich Laura anerkennend.
„Lektoratsarbeit besteht zwar zum Großteil aus Lesen, aber es ist weiß Gott kein Vergnügen. Was einem die Schreiberlinge alles zumuten! Einmal hat mir jemand eine Schuhschachtel geschickt, mit Tagebüchern und notdürftig geordneten Notizblättern darin. Im Begleitschreiben stand: Ich habe ein interessantes Leben geführt. Hier sind die Unterlagen, bitte machen Sie ein Buch daraus. Wie naiv, ich kann nur den Kopf schütteln!“
„Und“, hakte Pepito nach, „hat dieser Jemand ein interessantes Leben geführt?“
„Weißt du, die eigentliche Frage lautet ganz anders. Die allermeisten Menschen empfinden ihre Biografie als halbe Offenbarung, vor allem dann, wenn sie im Alter in romantisierender Verklärung auf ihre eigene Geschichte zurückblicken. Zweifellos hat jeder Lebenslauf etwas, in erster Linie natürlich für den Betreffenden. Ein Verlag will und muss Geschäft machen. Also ist die entscheidende Frage, ob diese Biografie für die Allgemeinheit so bedeutsam ist, dass sie in Form eines Buches zugänglich gemacht werden sollte. Das war diese genauso wenig wie garantiert 98 Prozent aller anderen auch.
Genug von meiner Arbeit. Was ist mit deiner? Was machst du, außer deine Blumen gießen und dabei der Nachbarin Balkon überschwemmen?“
„Ich bin Apotheker, und zwar mit Leib und Seele. Die Apotheke zu den bläulichen Schwaden ist seit sechs Jahren mein Arbeitsplatz. Jeden Tag verkaufe ich dort die Bandagen, die Omas Füße stützen sollen und die Pillen für Opas Prostata.
Was mich frustriert ist der Umstand, dass wir Apotheker bei bester Ausbildung im Tagesgeschäft bloß einen Bruchteil unseres Wissens umsetzen dürfen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen, fürchte ich, selbst wenn es langweilig klingt.“
Eine innere Stimme flüsterte in Laura: Lüge! Ohne auf das Thema näher einzugehen sagte sie: „Entschuldige mich bitte, ich werde bald zu Bett gehen, ich bin total geschafft."
5
Kurt wartete immer noch. Er befand sich rund 900 Meter Luftlinie südsüdöstlich von Lauras Wohnblock an einem schmucklosen, peinlich sauberen Restauranttisch. Er hatte sich mit einer jungen Dame, die seine Testosteronausschüttung in eine schwindelerregende Höhe getrieben hatte, verabredet. Sie hatte ihn vor dem Rathaus gebeten, ein Foto von ihr zu schießen.
„Erwarten Sie mich um halb sechs im Bahnhofsrestaurant“, hatte sie ihm danach verheißungsvoll zugehaucht, also tat er das. Kurt war Buchhalter, und auf ihn war Verlass. Das würde die junge Dame sicher würdigen.
Gewiss, Kurt war weder ein Star noch ein Adonis, mit seinem dezenten Bauchansatz und den Plattfüßen, deretwegen er im exakt halbjährlichen Rhythmus seine Schuheinlagen wechselte. Aber er hatte einen Job, der krisensicher war mit einem angemessenen Einkommen und eine glänzende, schwarze Aktentasche aus echtem Leder. Allerdings, welcher Art das Leder war, entsann sich Kurt nicht mehr. Rinds-, Ziegen- oder Rehleder? Oder doch etwas anderes? So sehr er bisweilen dank ausreichend Zeit an seinem Tisch hin- und her überlegte, es war ihm entfallen. Folglich hatte sich Kurt selbst die Anweisung gegeben, solange von „Dingsbumsleder“ zu sprechen, bis er sich entsinnen würde.
Peinlich! Er würde auf die Frage der jungen Dame, aus welchem Leder diese tolle Tasche gemacht war, mit „Tut mir leid, keine Ahnung“ antworten müssen. Hoffentlich würde dies seine Chancen, seinen Testosteronspiegel in der jungen Dame einzupendeln, nicht beeinträchtigen. Immerhin war es echtes Leder.
Der langen Rede kurzer Sinn: Kurt hatte einer Frau sicherlich das Eine oder Andere zu bieten ... Und wenn eine klug genug war, vor allem innere Werte zu schätzen ... Wer weiß, wer weiß, was sich dann ergeben würde? Insofern saß er voll Optimismus am Tisch und schlürfte in gemäßigtem Tempo sein Glas Bier.
Außerdem war es Kurt eine willkommene Abwechslung, auf die junge Dame zu warten, lebten doch in seinem Wohnblock derart viele schlicht und einfach skurrile Leute. Die einen Nachbarn noch absonderlicher als die anderen! Mit solchen Personen wollte er als anständiger Mensch ohnedies nicht mehr als unbedingt nötig zu tun haben. Andererseits passten diese Leute irgendwie in das Gebäude. Dieses selbst war im Grunde um keinen Deut besser: verschroben, als sei es lebendig, und viel schlimmer noch – unberechenbar! Und als Buchhalter wusste er um die Bedrohlichkeit des Unberechenbaren.
Abgesehen davon wachte er zwischendurch in der Nacht auf, da er meinte, Klopfgeräusche vernommen zu haben. Also saß er eigentlich gern im Bahnhofsrestaurant, jeden Tag am selben Tisch und wartete genau eine halbe Stunde. Mehr Wartezeit wollte er nicht investieren, man hat schließlich seinen Stolz.
Gut, seine Verabredung war jetzt über 24 Jahre her, und er war seitdem jeden Tag um spätestens 17.25 Uhr im Bahnhofsrestaurant. Von der jungen Dame indes war immer noch keine Spur zu sehen. Irgendwie war das schon verdächtig, aber sie hatte ja keine Erwähnung gemacht an welchem Tag, nicht einmal, in welchem Jahr, sondern lediglich die Uhrzeit verraten. Hoffentlich stimmte wenigstens das Jahrhundert, scherzte Kurt ab und zu. Doch dass sie kommen würde, dessen war er sicher. Wann, war die Frage. Er würde jedenfalls da sein, ihm als gewissenhaften Menschen würde man keinen Vorwurf machen können ...
6
Nach getaner Arbeit ist gut ruhen, übte sich Laura in altbackenen Weisheiten, duschte und begab sich zu Bett. Ihre Gedanken weilten bei ihrem Nachbarn im oberen Stock. Kein Zweifel, der junge Mann gefiel ihr. Einerlei was es mit diesem Haus auf sich hatte, gab es Laura ein gutes Gefühl, Pepito in der Nähe zu wissen. Es mochte schon sein, dass bizarre Leute im Haus lebten, aber im Grunde war jeder auf irgendeine Art absonderlich oder außergewöhnlich, wenn nicht gar ein Spinner. Wo bliebe sonst die Vielfalt des Lebens?
Die Jugendlichen fielen ihr ein. Sozial am Rande der Gesellschaft und mit einem Fuß im Gefängnis, schätzte sie diese ein. Andererseits, leicht war es in Zeiten wie diesen für niemanden. Manch einer kultivierte seine Absonderlichkeiten aus snobistischen Gründen, manch einem ließ die Not keine andere Wahl. In Wahrheit zählte Laura in ihrer Position mit ihrem Gehalt bereits zu den Privilegierten, wenn auch bloß ein ganz kleines bisschen. Wie viele Mitmenschen entbehrten sogar das? Vor allem, wenn man es weltweit bedachte. Alleine der Umstand, dass trinkbares Wasser aus den Armaturen in Küche und Bad floss, machte Keffrins Einwohner global gesehen privilegiert. Also kam es im Endeffekt darauf an, von welcher Seite man was betrachtete.
Ja, genau das war Leben. Und wenn ihr die Umstände im Wohnblock zu prekär wurden, würde sie eben eine neue Bleibe suchen. Vorläufig war sie mit ihrer Situation jedenfalls einverstanden.
Im Schein ihrer Nachttischlampe griff sie zu einem Manuskript, das ihr heute zur Beurteilung vorgelegt worden war. Kopfschüttelnd las sie den Titel: „Des Teufels Gute-Nacht-Geschichte“. Auf welche Ideen diese Schreiberlinge kamen!
Überraschend unspektakulär war ihr erster Arbeitstag bei der Frechen Feder gewesen. Freundlich war sie vom Chef, Herrn Liborius Meixner, begrüßt und von ihrer Kollegin Susi in die betriebsinternen Gepflogenheiten eingeführt worden. Eigentlich verspürte Laura keinen Wunsch mehr, sich selbst in ihrer Freizeit mit Büchern zu beschäftigen, dennoch war sie neugierig geworden. Wie zufällig las sie: „Onkel Fredi“, sagte die kleine Sabine, die mit Grippe im Bett lag, „warum bist du eigentlich Teufel geworden?“
„Weißt du“, antwortete Onkel Fredi und kratzte sich zwischen den Hörnern, „das ist eine lange Geschichte. Zuerst sollten wir zusehen, dass du wieder gesund und munter wirst, dann reden wir eines Tages darüber. In Ordnung?“
„Nein, jetzt“, erwiderte Klein-Sabine, trommelte mit den kleinen Fäustchen auf die Bettdecke aus der vorletzten Weihnachtsaktion von Alpi-Diskont. Sie setzte ihren Schmollmund auf. Dem widerstand fast keiner, Onkel Fredi schon gar nicht. Diese Erfahrung hatte das Mädchen bereits gemacht.
In diesem Augenblick sprang wie von Geisterhand die Türe auf. Großmutter erschien, wie üblich inmitten grünlich-schillernder, wabernder Giftschwaden, mit einem dampfenden Kochtopf in der Hand. Oh weh, dachte Onkel Fredi, jetzt kommt die Kraftbrühe. Herr, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen!
Schon hörten sie Großmutter: „Meine lieben Kinder, ich habe euch eine stärkende Suppe gemacht. Krötensuppe mit Hexenkraut und Knochenmehl abgeschmeckt, die reinste Kraftbrühe.“
In stoischer Ruhe breitete sie die Löffel aus Menschenknochen und zwei polierte Hirnschalen als Teller auf dem Nachtkästchen aus. Sabine zog sich die Decke bis zum Kinn. Mit argwöhnischen Augen verfolgte sie die Handlungen der Großmutter. Onkel Fredi schien sich desgleichen am liebsten verkrümeln zu wollen.
Unbarmherzig ging es ans Füttern. Ein Krankheitsfall in der Familie stimulierte unweigerlich Großmutters Fütterungsinstinkt. Traditionsgemäß bedeutete das Kraftbrühe. Der erste Löffel war für Sabine bestimmt, der zweite für Onkel Fredi. Und wer immer noch im Raum gewesen wäre, er wäre dem dritten Löffel nicht entkommen. So traf es erneut Sabine.
Fredi missbilligte es zutiefst, wenn Großmutter ihn mit den Kindern gleichsetzte. Halbherzig versuchte er so etwas Ähnliches wie Protest: „Erstens bin ich seit siebentausend Jahren kein Kind mehr, zweitens bin ich gesund und munter wie ein Vampir im Blutrausch, drittens schmeckt Krötensuppe scheußlich. Und wenn sie zehnmal nahrhaft ist.“
Großmutter blieb unbeeindruckt: „Papperlapapp, solange ich dich auf die Welt gebracht habe, bist du mein Kind und damit basta!“
Der Onkel ergab sich in sein Schicksal. Kein Unglück dieser Welt hätte Großmutter aufhalten können. Gnadenlos wurde zu Ende gefüttert. Mit einem liebevollen „Bleibt mir nicht zu lange auf" und einem dicken Schmatz in Sabines Gesicht, dass das Bett wackelte, verabschiedete sich Großmutter. Als sie draußen war, seufzten Sabine und ihr Onkel erleichtert auf.
„Und jetzt, Onkel Fredi, erzähl mir, warum du Teufel geworden bist ... bitte, bitte ...“
Oh je, das war weiß Gott keine Geschichte für kleine Mädchen! Treuherzig rollte Sabine mit den Augen ... Einmal mehr ergab sich Fredi seufzend in sein Schicksal und begann: „Niemand ist Teufel von vornherein. Man wird es im Laufe der Zeit. Ich habe viele Ereignisse in allen Ländern der Welt beobachtet und oft genug war ich selbst beteiligt. Und es hat eben leider oft das Gute gesiegt. Das ist ärgerlich! Da muss man nachhelfen! Ich mache dir einen Vorschlag. Jeden Abend vor dem Einschlafen erzähle ich dir eine dieser Geschichten, einverstanden?“
„Ja, aber bitte keine, die damit aufhört, dass es sich nicht lohnt, gut zu sein und diese ganze pädagogische Scheiße. Dass man die Guten verfolgen und die Bösen nach Kräften unterstützen soll, weiß ich auch so.“
Damit begann der Teufel Fredi zu erzählen. Doch was er erzählte, entging Laura bereits; sie war eingeschlafen. Als Fredi das erleichtert bemerkte, gab er seiner Nichte ein inniges, liebevolles Küsschen auf die Stirn und begab sich anschließend zur strategischen Lagebesprechung zu Großmutter.
Diese saß in ihrem Wohnzimmer, von dem aus sie einen ernüchternden Ausblick auf die Autoabstellplätze vor dem Eingang des Hauses hatte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde in einer Filiale von Alpi Diskont täglich das Volk mit billigem Einheitsbrei versorgt.
Großmutters Füße steckten in wärmenden Hüttenpantoffeln, die sie im Urlaub in den Alpen zu einem sündhaften Preis erstanden hatte. Neben ihr stand eine altersschwere Truhe, auf der sich ein Aquarium mit Piranhas befand. Auf dem Tisch vor ihr lag ein Schachspiel. Gerade war eine Partie im Gange, denn die Figuren befanden sich unregelmäßig verteilt auf dem Brett.
Fredi setzte sich seiner Mutter gegenüber. Nachdem er ihr eine Weile zugesehen hatte, sagte er vorwurfsvoll: „Wir haben jede Menge zu tun. Die Guten sind auf dem Vormarsch, wir geraten überall in Bedrängnis und du sitzt hier und spielst Schach! Noch dazu mit einem abwesenden, unbekannten Gegner! Manchmal habe ich alle Mühe, dich zu verstehen.“
„Oh, Fredi“, meinte die Großmutter milde lächelnd, „das Gefühl, die Guten seien im Vormarsch, hatte ich schon, als du noch in die Windeln gepupst hast. Deswegen habe ich ja damals deinen Vater geheiratet. Wenn ich gewusst hätte, dass er mich nach nicht einmal viertausendsiebenhundert Jahren verlassen würde, hätten mich keine zehn Pferde zum Traufeuer gebracht. Ja ja, dieses dämonische Flittchen mit ihren Modelmaßen aus dem Necronomicon hat ihm besser gefallen. Nichts als Hurerei und Bigamie heutzutage! Dabei stammen wir aus einem ehrenwerten Haus, mein Sohn.“
„Ach tatsächlich? Warum hat uns dann Gott am Anbeginn der Zeiten verstoßen?“
„Das ist doch Propaganda der Gegenseite! Tatsächlich weiß keiner mehr, wie es wirklich war. Ist halt schon eine Weile her. Du solltest selbst bei dem, was unsere Leute darüber berichten, vorsichtig sein. Vielleicht ist am Ende das Gute gar nicht so schlecht und das Böse gar nicht so edel, wie man gemeinhin denkt?“
Ihr Sohn sah sie staunend an. Großmutter beeilte sich, hinzuzufügen: „Ich bin nur eine alte Frau. Mir verzeiht man es, wenn ich Unsinn rede. Und was die Schachpartie betrifft ... Glaube mir, ich kenne meinen Gegner gut, und auf eine gewisse Weise ist er mitten unter uns.“
Plötzlich war ein merkwürdiges Geräusch zu hören: Klickklack- klock-klackerdi-klack-klock, drang es dumpf durch den Wohnzimmerboden.
„Aha, Dame nach B2“, frohlockte die Großmutter und rückte die weiße Dame auf das Feld. „Ich hatte gehofft, er würde mir in diese Falle gehen.“
Nach einer Weile sagte Onkel Fredi: „Mir ist deine Wohnung hier im Erdgeschoß reichlich ungemütlich. Das suspekte Klopfen vom Keller herauf würde mir schon längst auf den Geist gegangen sein. Wie hältst du das aus, Oma?“
Großmutter erwiderte nichts; sie war in das Spiel vertieft. Als Fredi die Spielfiguren näher betrachtete, fiel ihm auf, dass ihn manche verblüffend an die Menschen erinnerten, die sich im Hause tummelten. Da war der schwarze König, der Rechtsanwalt Ederles Gesichtszüge aufwies, und Inspektor Ginzners als schwarzer Turm. Einmal näher, das andere Mal weiter tanzten die Figuren vor seinen Augen. Dann die Jugendlichen im No-Future-Outfit als Bauern der schwarzen Seite. Sich selbst sah er sich am ehesten als Läufer. Sollte das stimmen, stand ihm ein Läufer der weißen Partei gegenüber, einer, der für die Gegenseite kämpfte ... Wie von ferne meinte Fredi seine Mutter etwas reden zu hören. Es drang nicht zu ihm durch ...
Sein Blick wanderte zur weißen Seite. Hier tummelten sich weitere Gestalten aus dem Haus. Die Dame hatte unverkennbar die Züge einer jungen, blonden Frau, die dieser Tage in das Wohnhaus gesiedelt war. Der König erinnerte Fredi an ihren Nachbarn vom oberen Stock. Heinrich Gahlen, der verrückte Musiker, war einer der beiden Türme. Der andere Läufer, der machte ihm allerdings Sorgen. Der war ihm unbekannt ...
7
Als Laura, versunken in unruhigen Träumen, ihre Lage veränderte, rutschte das Buch mit einem schlurfenden Geräusch zu Boden und blieb aufgeschlagen liegen. Die Seite zeigte den Anfang eines Kapitels mit dem Titel: „Strategie ist alles“.
Für einen Moment aus dem Schlaf gerissen, fühlte sich Laura zu müde, den Band aufzuheben. Neuerlich auf der Schwelle zum Schlaf schaute sie graue Wolkengebilde, die sich permanent umschichteten. Aus diesem Gewaber schälte sich im Laufe der Zeit, was sich in Top 23 im 2. Stock abspielte. Dort war wieder einmal der Musikstudent Heinrich Gahlen dem absoluten Klang auf der Spur. Dass er selbst keine Vorstellung davon hatte, wie dieser beschaffen sein sollte, um absolut zu sein, hinderte ihn keineswegs. Sonst hätte er nicht suchen müssen, oder? Begonnen hatte alles in früher Jugend mit dem Krautrock von Amon Düül II. Von da an ging es zügig durch die hehren Gefilde des Progressive Rocks bis ihn die Avantgarde endgültig in höhere Sphären katapultiert hatte. Bei John Cages berühmter Klaviersonate 4,33, bei der die Pianistin vier Minuten und 33 Sekunden keinen einzigen Ton gespielt hatte, hingegen war er eingenickt. Aber das musste er ja niemandem auf die Nase binden.
Letztes Jahr hatte sich Gahlen einen Synthesizer geleistet. Sozusagen als moderne Inkarnation des Pythagoras auf den Spuren der Sphärenmusik malträtierte er seither unermüdlich dieses Gerät. Er würde weder ruhen noch rasten bevor er das Klanggebilde gefunden hätte, welches die Welt im Innersten zusammenhält. Heißt es nicht: Nada brahma, die Welt ist Klang?
Wie besessen drehte er an den Knöpfen, schob die Regler hin und her, verstellte einmal diese, dann jene Einstellung, mal mit mal ohne Obertöne. Die meiste Zeit gab das Gerät nur ein wenig erfreuliches Rauschen, Pfeifen oder Blubbern, ab und an sogar mit vulgärem Unterton, von sich. Sporadisch mischten sich kurzzeitig Klopfgeräusche in diese Klangkulisse, deren Herkunft dem Studenten unbekannt blieb. Auf dem Bildschirm seines, an den Synthesizer angeschlossenen Computers, verfolgte er fasziniert die Frequenzen, Tondauer und Lautstärke. Dank seines Programms wurden diese grafisch dargestellt, ein wahres Hightech-Feuerwerk irritierender, abstrakter Bilder. Berauscht von der Magie unserer Tage starrte Heinrich Gahlen mit Augen in den Monitor, die bald wie im Fieber glänzten ...
In seiner Reichweite stand ein Pappbecher mit kaltem Instantkaffee. In den wenigen Pausen, die er einlegte, sah er sich unanständige Bilder auf dem Monitor an. Stilvoll, wie er meinte, unterlegte er diese mit den Aufnahmen der NASA, die durch die Voyagersonden 1 und 2 von den Geräuschen der verschiedenen Gestirne des Sonnensystems gemacht worden waren. Heute gab es Striptease zu den Klängen der Saturnringe.
Ein ähnliches Klanggemälde aus elektronisch induziertem Rauschen, Zwitschern, Pfeifen und Blubbern vernahm Hedwig Ginzner, die Gattin des Inspektors, aus dem Radio. Ehe der Sprecher sagte: „Das, meine Damen und Herren, war unsere Sendung: Avantgardemusik heute“, drehte sie das Gerät ab. Da hörte sie lieber ihrem Staubsauger oder der Waschmaschine zu! Bei diesen Geräuschen weiß man wenigstens, dass sie einen nützlichen Effekt begleiten.
Enttäuscht von der Radiosendung nahm Hedwig die Fernbedienung zur Hand und suchte sich ein passendes Fernsehprogramm. Ihre Wahl war noch auf keinen der Sender gefallen, als sie das wohlbekannte Klirren eines Schlüsselbundes vor der Wohnungstüre hörte. Das Geräusch zeigte an, dass ihr Mann nach Hause kam. Hoffentlich war er nicht wie zumeist angetrunken! Aber er war ...
Ohne den Gruß seiner Frau zu erwidern nahm er ihr die Fernbedienung aus der Hand und stellte seinen eigenen Lieblingssender ein. Zu seiner Freude lief „Das Albtraumschiff“ (4712. Folge). Noch immer ohne ein Wort zerrte er Hedwig auf die Couch, entblößte ihr den Unterleib und rückte diesen in Position. Dann nahm er sie von hinten. Von hinten deswegen, weil er in dieser Stellung im wahrsten Sinne des Wortes in der Lage war, ungestört auf den Bildschirm zu glotzen. Außerdem war die Bierdose auf dem Schrank in bequemer Reichweite. Heute hatte seine Frau Glück im Unglück, denn sie kam wenigstens ohne Schläge über Ginzners Runde der Vergnügungen.
8
Pepito hantierte mit allerlei dubios riechenden Chemikalien in seinem kleinen, privaten Labor. Gelegentlich mischte er zwei oder mehrere der Substanzen in den Reagenzgläsern. Konzentriert beobachtete er, wie sich die Substanzen mal bereitwillig, mal widerstrebend miteinander vermengten, dabei kurzfristig aufschäumten, Dämpfe entwickelten, ihre Farben veränderten. Die übrigen chemischen Eigenschaften testete er anhand verschiedener Katalysatoren. Eifrig führte er dazu seine Notizen auf einem Laptop.
Selbst Laura hatte er die Kammer bisher verweigert, obwohl sie sich neuerdings nahezu täglich in seiner Wohnung aufhielt. Ihrem fragenden Blick, als sie einmal auf die versperrte Türe gestoßen war, war er mit einem schulterzuckend gemurmelten „Ist 'ne Besenkammer“ begegnet. Laura hatte vorläufig akzeptiert und bis heute nicht insistiert.
In Laura sah Pepito eine echte Bereicherung für sein Leben. Klar, eine attraktive Blondine dieses Alters mit zunehmenden Anzeichen sexueller Willigkeit würde jeder Mann in Pepitos Umständen als Gewinn betrachten, aber das alleine war es nicht. Was dann? Was war so besonders an Laura? Dass ihre Anwesenheit ein angenehmes Kribbeln in seiner Hose verursachte? Andererseits – das schafften andere Frauen ebenso. Und ehrlich gesagt, eine große Kunst war dies nicht gerade. Nein, eine Begegnung mit Laura fühlte sich an, als schreite er durch ein Barockschloss und trete durch eine geöffnete Türe nach der anderen, mehr noch, als stolpere er geradezu durch diese. In welchem Saal würde er zu stehen kommen? Welche Fresken zierten dort die Wände? Wartete etwa jemand an diesem Ort auf ihn? Auf kühlem Marmor stehend, mitten in den wärmenden Strahlen der Wintersonne, die durch hohe Fenster ohne Vorhang scheinen ...
Andererseits zeigte die Erfahrung mit seiner letzten Freundin, dass Frauen stets Unruhe in das Gemütsleben eines Mannes bringen. Das schien ihm einer kontinuierlichen Forschungsarbeit entschieden abträglich. Laura würde ausgehen und tanzen wollen, ins Kino gehen, mit ihm Partys besuchen und weiß der Teufel was sonst mit ihm unternehmen. Und außerdem, wie lange gelänge es ihm, seine Forschungen zu verbergen? Seine letzte Freundin hatte ihn vor die Wahl gestellt: Entweder sie oder sein Labor. Schweren Herzens hatte er sich für seine Reagenzgläser und Erlenmeyerkolben entschieden.
Die Pharmazie war für Pepito seine ureigenste Form des Yogas. Wie sich viele Hindus im Alter, wenn die Kinder erwachsen und außer Haus gezogen sind, zurückziehen, um sich der Meditation zu widmen, wollte er eines Tages gänzlich für seine Forschungen da sein. Nur nicht bereits mit 31 Jahren, es reichte, wenn ihm die Dämpfe über seinen Gläsern die Langeweile in der Pension vertreiben würden. Solange er sich mitten auf dem Weg durchs Leben sah, galt es, Kompromisse zu finden.
Mit Laura wollte er es besser machen, wähnte er sich doch kurz vor dem Durchbruch mit seiner Arbeit. Pepito plante, die aktuelle Experimentenreihe abzuschließen, bevor der Konflikt neuerlich zur Grundsatzfrage eskalierte. Also hieß es, sich zu beeilen.
Mit mehr Elan denn je tippte er seine Zahlen und Formeln in den Laptop ein. Dieser stellte nach einer angemessenen Zeit des Grübelns seine Ergebnisse wunschgemäß mal in Zahlen, mal in Form einer Grafik dar. Unermüdlich bewegte sich Pepito zwischen den verschiedenen Gerätschaften. Konzentriert arbeitete er bis spät in die Nacht hinein.
9
Bruder Osiris und Schwester Nofretete im fünften Stock, Top 53, bereiteten das Reinigungsritual vor. Osiris, alias Armin Leopold Wurnig, war Beamter des Städtischen Wohnungsamtes, zuständig für Verteilung der eingehenden und Versand der ausgehenden Post. Schwester Nofretete, vulgo Resi Wurnig, betätigte sich tagsüber als Kassiererin bei Alpi Diskont. Sie waren Anhänger einer Gemeinschaft, die sich „Ägyptisch-christliche Urgemeinschaft des Goldenen Lichtes“ nannte.
Gott sei Dank hatten die Großmeister der Gemeinschaft die Anweisungen der Eingeweihten aus Ägypten getreulich aufbewahrt, neuerdings in Form eines binären Codes auf der Festplatte des Zentralrechners der Gemeinschaft. Gemäß diesen Vorschriften hielten Frau und Herr Wurnig regelmäßig einmal pro Monat ein Reinigungsritual ab.
Waren sie doch verurteilt, ein ganzes Menschenleben in dieser gotterbärmlich unspirituellen Bewusstseinssphäre zu verbringen. Auf einem Planeten, der nichts als einen einzigen Sündenpfuhl darstellte! Was stand im Zentrum allen Geschehens hier? Jawohl, die niedrigen Triebe, pure Lust, nackte Geilheit, bestenfalls Zerstreuung! Für höhere Wahrheiten, geschweige denn das Wort Gottes, hatte kaum jemand Sinn.
Tagein, tagaus bewegten sich Bruder Osiris und Schwester Nofretete wie ferngesteuert durch diesen Vorhof zur Hölle, umringt von Wesen, die aus spiritueller Sicht als Zombies zu bezeichnen waren. Eines Tages ließ die furchtbare Schwingung dieser Wesenheiten Schwester Nofretete in der Straßenbahn den Fahrer über die linke Schulter kotzen! Man kann durch keinen Schweinestall waten, ohne sich schmutzig zu machen.
Ein wahrlich übles Schicksal, das Osiris und Nofretete für diese Inkarnation auf die Erde verbannt hatte. Damit derlei für alle Zukunft verhindert war, sollte die regelmäßige Reinigung des Astralkörpers sorgen! In der Tat konnten und wollten es sich Bruder Osiris und Schwester Nofretete nicht vorstellen, in der Wilhelm-Reich-Str. 15 zu leben, ohne die göttliche Feierlichkeit ihres geliebten Rituals.
Zu diesem Zweck verdunkelten sie zuerst das Zimmer mit schweren schwarzen Vorhängen, zum Zeichen, von welch massiver Dunkelheit sie auf diesem Planeten umgeben waren. Dann setzten sie eigens für diese Gelegenheiten zubereitete Räucherungen in Brand. Diese symbolisierten die Vergänglichkeit allen Seins, mithin auch der Finsternis dieses Planeten. Schwester und Bruder stellten zwei hüfthohe, brennende Kerzen im Abstand von eineinhalb Metern in die Mitte des Zimmers. Eine für die Schwester, die andere für den Bruder, beide gleichermaßen willig, sich zu verzehren und dadurch Licht in den schauerlichen Abgrund dieser Welt zu bringen. Sorgfältig nach astrologischen Prinzipien zusammengestellte Blumen an der Rückwand schmückten den Raum zusätzlich.
Zwischen den Kerzen befand sich eine hölzerne Vorrichtung, genannt das Bußgestell. Es bestand aus zwei grob zubehauenen Pfosten, weil bessere Qualität das Kreuz des Herrn auf Golgatha ebenfalls nicht hatte. Das Holz ragte mannshoch aus einer Platte, die den Pfosten Halt verlieh. Eine Holzstange als Verbindung in Kopfhöhe sorgte für Stabilität. Daran spannte der Bruder den entblößten Körper Schwester Nofretetes. Stählerne Klammern fixierten ihre Arme waagrecht gestreckt, wodurch ihr Körper eine Haltung erhielt, als hinge sie am Kreuz.
All das geschah zur Erinnerung an die Leiden des Erlösers am Kreuz zu Golgatha. Schwester Nofretete schickte sich nunmehr an, diese im Dienste ihrer eigenen Erlösung symbolisch nachzuempfinden. Nächsten Monat würde Bruder Osiris diesen Teil des Rituals übernehmen dürfen.
Vor ihr auf dem Boden lag eine billige Papyrus-Imitation der Originalseite mit dem Reinigungsgebet aus dem „Buch der zehn göttlichen Gebote“ im Format DIN-A4. Sofern Schwester Nofretete demutsvoll ihr Haupt gesenkt hielt, wie es sich ohnehin geziemte, war sie imstande, die Zeilen zu lesen.
Bruder Osiris prüfte unter gemurmelten Gebeten den biegsamen Ritualstab. Schwer und trunken vom langen Gebrauch, den Gebeten und Traditionen fühlte sich das abgenutzte, dunkelbraune Leder in seiner Handfläche an. Ein seltsames, beinahe erregendes Gefühl bemächtigte sich seiner. Wie sich der Stab wiegte, gleich dem Schilf am Ufer des Nils, aus dem die ägyptische Prinzessin seinerzeit den kleinen Mose in seinem Körbchen gerettet hatte ... Ein gesegneter Gegenstand, der von der Prophetin der Gemeinschaft extra für diesen Zweck geweiht worden war.
Vor sich sah Osiris den nackten Rücken Nofretetes, ihr Gesäß, ihre Beine, ihr Fleisch in dessen ganzer Verletzlichkeit. Die blasse Haut schimmerte im ruhigen Licht der Kerzen. Er gewahrte, wie dieser Körper förmlich seiner Läuterung entgegenfieberte.
Tschack! – hallte der erste Schlag, über die linke Schulter gezogen. Er hinterließ einen roten Striemen auf zarter Haut. Schwester Nofretete atmete schwer auf. Dann begann sie mit lauter Stimme das Reinigungsgebet zu rezitieren: „Oh Herr, reinige unseren Körper, mache ihn zu deinem Tempel. Vertreibe die Dämonen der Wollust, schütze uns vor den satanischen Kräften der Leidenschaft.“
Tschack! – Der nächste Schlag ließ ihren Körper erbeben.
„Zu dir führt unser Weg, an deiner Seite wollen wir weilen, dereinst im himmlischen Paradies, inmitten der Eingeweihten aus dem Alten Ägypten.“
Wiederum sauste der Stab – tschack!
„Deshalb, oh Herr, stärke unseren Geist, reinige unseren Körper, mache ihn zu deinem Tempel.“
Tschack!
„Lass nicht zu, dass wir von den unreinen Kräften der Hölle bedrängt werden, sondern führe uns den Pfad des Goldenen Lichtes.“
Tschack! Osiris legte sich mächtig ins Zeug. Unbeirrt las Nofretete unterdessen vor: „Zeige uns den Weg, den schon die Weisen der Vorzeit gegangen sind. Oh Herr, reinige unseren Körper, mache ihn zu deinem Tempel.“
Tschack und – tschack! Am Rande gewahrte Osiris, dass Nofretetes Rücken zu bluten begann.
„Verzeih uns, dass wir schwach sind, doch sieh hernieder auf uns, deine Kinder, und sieh, dass unser Geist willig ist.“
Tschack!
„Demütig erflehen wir den Beistand der Adepten auf unserem Weg, dem Weg des Goldenen Lichtes.“
Tschack! Unbarmherzig prasselten die Schläge auf Nofretetes Körper. Blut tropfte zu Boden, machte sich als Blutlache breit und griff mit dunkelroter Farbe nach dem Reinigungsgebet.
„Oh Herr, reinige unseren Körper, mache ihn zu deinem Tempel.“
Tschack! Nofretete hatte bereits alle Mühe, mit dem Gebet fortzufahren. Unter Stöhnen und Wimmern schaffte sie es trotzdem: „Herr, der du Sodom und Gomorrha gestraft hast. Gehe nicht ohne die Gnade der läuternden Züchtigung an deiner Dienerin vorbei.“
Tschack! – Tschack!
„Wir wollen teilhaben an deinem Leiden, der du unter unendlichen Qualen für uns am Kreuze gestorben bist. Erteile deiner unwürdigen, bescheidenen Dienerin den Segen, den Pfad durch den Vorhof zur Hölle zu gehen.“
Tschack! – Tschack!
„Wartest du doch am Ende meines Weges in all deiner Herrlichkeit auf mich, dein demütiges Geschöpf. Oh Herr, reinige unseren Körper, mache ihn zu deinem Tempel."
Da meinte Osiris ein Geflecht aus Formen zu sehen, gebildet aus aufspritzendem Blut, den Lachen am Boden, den Schwaden der Räucherungen und dem flackernden Licht der Kerzen.
Tschack!
Aus diesem hypnotischen Gemälde tauchten kontinuierlich Formen in wechselnder Gestalt auf ... Was zeigte sich da? Gierige Krallen, rotglühende Augen, Mäuler, die rasiermesserscharfen Zähne gebleckt ... Fratzen aus einer dämonischen Welt! Waren sie erschienen, die Heerscharen der Finsternis?
„Oh ja, ihr Höllenfürsten,“ rief er in aufkommender Ekstase, „zeigt euch nur, ich treibe euch alle aus!“
Dann gab er sein Bestes. Tschack, tschack, tschack … Im orgastischen Rausch entfesselt drosch er auf das gepeinigte Fleisch ein ... Tschack, tschack ... Irgendwann sackte Osiris am Boden zusammen, entkräftet, gebadet in Schweiß, mit pfeifender Lunge und einem Samenerguss, der seiner Wahrnehmung entgangen war. Sein Gesicht war blutverschmiert, die spärlichen Haare hingen ihm wirr über die Augen. Nofretetes Körper hing blutüberströmt, reglos in ihrem Holzgestell über einer Lache aus Blut und Urin. Nofretete flüsterte und es klang, als sei es das Letzte, was sie dieser Welt zu sagen hatte: „Erbarme dich unser.“
Dann gab sie keinen Ton mehr von sich. Ihre Augen waren glasig, sie wirkten, als blickten sie bereits in eine andere Welt.
Langsam verhallte das Echo der Schläge im Gang, verebbten sekundenlang im Treppenhaus. Sie vermischten sich dort mit Klopfgeräuschen, die undeutlich von der Kellerstiege heraufdrangen zu einem indifferenten, bedrohlichen Klanggemälde.
10
Einen Stock darunter bügelte Laura ihre Wäsche zu Ende. Nachdem sie fertig war, setzte sie sich auf den Balkon und nahm sich die Literarische Vogelperspektive zur Hand, ein Magazin, das auf zeitgenössische und avantgardistische Literatur spezialisiert war. Die Freche Feder hatte das Magazin abonniert. Wenn eine neue Ausgabe eintraf, kursierte das Exemplar die ersten zwei oder drei Wochen innerhalb der Belegschaft. Liborius Meixner sah es gerne, wenn die Angestellten sich in ihrer Freizeit der weiterbildenden Lektüre widmeten.
Laura begann mit der ersten Geschichte. Sie las von einer Frau, die sich nach dem Bügeln auf den Balkon setzte und anfing, eine Geschichte zu lesen. Die Geschichte handelte von einer Frau, die es sich nach dem Bügeln auf ihrem Balkon bequem machte und eine Geschichte las. Diese schilderte eine Frau, die zuerst ihre Wäsche bügelte, sich dann auf den Balkon setzte und von einer Frau las, die ihre Wäsche fertig bügelte. Danach begab sie sich auf den Balkon, um eine Geschichte zu lesen. In dieser Geschichte wurde eine Frau beschrieben, wie sie bügelte, und dann Durst bekam.
Laura öffnete den Kühlschrank. Verflixt, keine kalte Limonade! Egal, sicher würde Pepito aushelfen können. Laura fand zusehends Gefallen am stressfreien, unkomplizierten Umgang, der sich zwischen ihr und Pepito eingestellt hatte. Obwohl sie sich fast jeden zweiten Tag mit ihrem Nachbarn traf, hatten beide noch das Gefühl, für die Anwesenheit in der Wohnung des anderen eine möglichst sachliche Rechtfertigung vorschützen zu müssen. Dass es sich lediglich um einen Vorwand handelte, war zwischen beiden zwar ein offenes Geheimnis, ein Teil des Spieles, auf das sie sich stillschweigend geeinigt hatten. Laura fragte sich, wohin sie dieses Spiel führen würde ...
Da tauchten vage Bilder in ihrer Phantasie auf, die ihr einen zuckenden männlichen Körper zwischen ihren Schenkeln zeigten. Sie hörte, wie ihr der Mann sein Begehren ins Ohr keuchte, roch den Schweiß auf seiner Haut, fühlte ihren eigenen Leib. Jucken machte sich zwischen ihren Schenkeln bemerkbar. Sie fühlte dort ihr Blut pulsieren. Unwillkürlich positionierte sie sich mit geradem Rücken, damit sie ihren angeschwollenen Kitzler am Untergrund reiben konnte ... Wie angenehm sich das anfühlte!