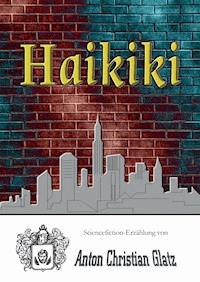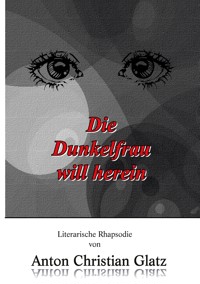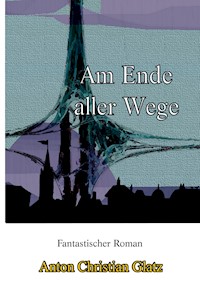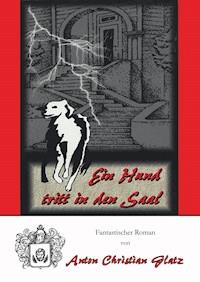Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band versammelt sechzehn Essays zu diversen gesellschaftlich relevanten Themen. Diese entzünden sich besonders an den strategischen Unterschieden zwischen Theorie und Praxis. Die Sicht ist freigeistig, religions- und sozialkritisch. Ein Vademecum für alle Querdenkenden von heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Weikhard-Uhr
Babsi, eine Sünderin vor dem Herrn
Sind wir alle Charlie Hebdo?
Des Glückes Schmied
Das bedingungslose Grundeinkommen – eine pragmatische Vision
Der lange Weg zum Mann
Im Zentrum des Zyklons
Zwischenwort
Stramm gestanden
Es geht um die Wurst
Theodizee
Die Becherwaschanlagen-Sinfonie
Danila
Vegetarisch leben
Sieben Söhne für den Himmel
Gehen
Nachwort
Vorwort
Anfang der 90er-Jahre stellte sich mir die Aufgabe, meine Interessen stärker zu fokussieren, wobei Literatur, Politik oder Philosophie zur Auswahl standen. Die Befürchtung, mich zu verzetteln und folglich meine Energien zu vergeuden, führte mich an diesen Punkt. Strategisch schien eine Spezialisierung geraten. Ich sah mich am Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit, die ich dem Betätigungsgebiet mit den besten Aussichten zukommen lassen wollte. Nach eingehender Introspektion entschied ich mich für die Literatur. Ich meinte damit über ein Mittel zu verfügen, das politische und philosophische Inhalte ebenfalls zu transportieren imstande ist, wenngleich in eingeschränktem Umfang. Wie es sich für einen politisch bewussten Schriftsteller gehört, griff ich fortan gesellschaftskritische Inhalte auf, verpackte subversive Botschaften aller Art auf unterschiedliche, möglichst raffinierte Weise in meine Texte. Ich kultivierte die wohldosierte Provokation, würzte mit Seitenhieben gegenüber den offiziellen Autoritäten, usw. Lange Jahre ging es mir gut damit, dergestalt Gott, der Welt und vor allem den gesellschaftlichen Eliten ans Bein zu pinkeln.
Inzwischen ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Die Gesellschaft scheint mir Formen angenommen zu haben, die nach einer deutlicheren, einer expliziteren Sprache verlangen. Ich möchte nicht die gute, alte Zeit beschwören, denn diese ist meist einer romantisierenden Erinnerung geschuldet. Aber dass wir heutzutage, angesichts einer Weltwirtschaftskrise nach der anderen, Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit, fanatisierten Gotteskriegern etc., in der öffentlichen Diskussion eine wuchtigere Sprache führen müssen, ist offensichtlich. Die in Belletristik, und sei es mit noch so viel Liebe und Sorgfalt, eingebauten Botschaften erscheinen mir nunmehr zu fragil. Zu leicht fallen sie der Vergessenheit anheim, wenn man sie überhaupt wahrnimmt. Außerdem ist Belletristik, von wenigen glücklichen Ausnahmen abgesehen, nicht dazu angetan, die Welt zu verändern, geschweige denn zu verbessern. Ich halte das fest, wenngleich diese Erkenntnis mit einer gewissen Düsternis umflort ist. Prätentiöses gehört zu den marginalen Effekten in der Literatur. Der langen Rede kurzer Sinn: Es drängte mich, schweres Geschütz aufzufahren. In diesem Sinne möge man sich nicht wundern, wenn ich in dieser Essaysammlung bisweilen klardeutsch rede. Flaue Texte ohne Ecken und Kanten kann ich nicht ausstehen. Ich halte es mit Martin Luther, der gesagt hat: „Wenn ich furze, soll man es bis Rom riechen.“
Auf der Suche nach literarischen Ausdrucksmöglichkeiten für dieses Bedürfnis kam mir die Textgattung Essay gelegen. Der Essay wurde von Michel de Montaigne (1533 – 1592) begründet. Ein solcher Text beschäftigt sich mit Sachfragen, ist aber keine wissenschaftliche Arbeit. In der Wissenschaft muss sich ein Autor möglichst zugunsten objektiver Fakten zurücknehmen. Trotzdem hat bereits der Nobelpreisträger und Begründer der Quantenphysik Werner Heisenberg1 die Beobachterrelevanz gerade für eine, gemeinhin als exakt und objektiv geltende, Wissenschaft, die Physik, nachgewiesen. Man ist sich speziell in der Geisteswissenschaft lange schon im Klaren, wie hypothetisch dieses Postulat ist, vor allem, wenn es um Hermeneutik geht. Damit ist die Deutung aufgrund von Verstehen bzw. eines tieferen, intuitiven Verständnisses gemeint. Hermeneutisch werden z. B. Kunstwerke oder Texte interpretiert und beurteilt. In diesen Fällen geht es gar nicht anders, weil es an objektiven Kriterien mangelt. Bei allem Verständnis für die Lage driftet die Hermeneutik damit bereits in die Tümpel der subjektiven Beliebigkeit. Das schmälert ihren Wert in Bezug auf die Ergebnisse.
Als Autor von Belletristik ist man selbstverständlich implizit von der ersten bis zur letzten Zeile zugegen, bei einer auktorialen Erzählung oft sogar expressiv verbis. Ein Essay räumt dem Autor jede Menge Raum ein, seine subjektiven Interpretationen, Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen usw. einzubringen, vorausgesetzt, sie werden als solche deklariert. In diesem Sinne stelle ich persönliche Erfahrungen, sowie die Erkenntnisse, die ich daraus destillierte, beispielhaft zur Diskussion. Ich tue dies keineswegs, weil ich mich für wichtig halte (glücklicherweise bin ich das nicht), sondern weil es sich über eigene Erlebnisse am treffsichersten schreiben lässt. Meiner demokratischen Grundhaltung folgend nahm ich Gastkommentare auf.
An den Erfahrungen und Erkenntnissen, welche das eigene Leben anbietet, vorbeizugehen, ist die einzige Sünde, die ich kenne. Dazu neigen Personen, die sich einem geisteswissenschaftlichen Zugang verschrieben haben, ganz besonders. Meinen diese doch, die eigene Person im Interesse einer objektivierten Erkenntnis als Instanz aus dem Diskurs nehmen zu müssen, und unterliegen dabei dem Irrtum, dies sei möglich. Da kann es denn geschehen, dass sich eine Soziologin kopfschüttelnd fragt, warum nicht mehr Mädchen klassische Männerberufe ergreifen, obwohl seit Jahren die obrigkeitliche Beeinflussung in dieser Richtung läuft. Sie findet keine Untersuchungen, keine Statistiken auf ihrem Schreibtisch, die Auskunft geben. Nie käme sie auf die Idee, sich selbst die Frage zu stellen, wieso aus ihr eine Wissenschaftlerin geworden ist, und keine LKW-Mechanikerin.
Der Essay vermag diese Lücke zu schließen. Insofern finde ich diese Textgattung ehrlicher und als Ausdrucksform authentischer. Freilich wird es sich mitunter um philosophische und wissenschaftliche Überlegungen oder gar Exkurse handeln, die in den Text einfließen. Bei allen Türen jedoch, die der Essay zu Philosophie und zur Wissenschaft aufstößt, ist und bleibt er letztlich ein literarisches Unterfangen. Folgerichtig leuchtet der Name de Montaigne weitaus heller in der Ahnengalerie der Literaten, als bei den Philosophen.
Indes stellen das wissenschaftliche und das essayistische Vorgehen nur zwei grundverschiedene Zugänge dar. Sie erübrigen sich gegenseitig keineswegs, sondern sollten als Ergänzung wahrgenommen werden. Zuweilen ergibt sich für den Autor bereits aus dem allgemeinen Kontext, wie etwa Thema, persönliche Interessenlage, usw., welcher Zugang adäquat ist. Der Essay eröffnet andere Möglichkeiten als die wissenschaftliche Abhandlung und entspricht überdies meinem Naturell.
Bevor aus diesem Vorwort jedoch ein Essay über den Essay wird ... Es ist mir lediglich ein Bedürfnis, meinen Lesern darzulegen, weshalb ich, als Erzähler, mich nun einer anderen Ausdrucksform bediene. Durch die enorme thematische Bandbreite und sprachliche Geschmeidigkeit der Textgattung fand ich ein Instrumentarium, dessen Klaviatur mich nach Belieben in dur und moll schreiben lässt. Ich hatte zwar bereits Ende der 80er-Jahre mit einer Veröffentlichung im Eigenverlag („Die Alchemie von Speis und Trank“) einschlägige Erfahrungen gesammelt, machte jedoch in meinem Buch „Die Dunkelfrau will herein“ 2012 erstmals professionellen Gebrauch. Wegen Platzmangels – immerhin beinhaltet der Band auch Kurzgeschichten und Gedichte –, entschied ich mich damals für ein eigenständiges Projekt mit ausschließlich Essays, die „Reichengasse“.
In diesem Sinne: Willkommen zum Buch. Sie finden inhaltlich sehr verschiedene Texte versammelt, wodurch hoffentlich jeder Leser ein Thema findet, auf das er sich näher einlassen möchte. Zudem stammen die Essays aus verschiedenen Epochen meiner schriftstellerischen Laufbahn. Insider erkennen bestimmt unschwer die Texte über den Vegetarismus und „Sieben Söhne für den Himmel“ als älter. Deren Urfassungen datieren in die 80er-Jahre. Ich habe diese Essays behutsam aktualisiert, ohne sie gänzlich des Flairs meiner früheren Sprache zu entkleiden. Grundsätzlich verbuche ich es positiv, wenn sich die Schreibe entwickelt. Was sollte ihre Lebendigkeit besser beweisen? Diese Texte liegen nun in der finalen Form vor und ich freue mich, sie endgültig loslassen zu können.
Der merkwürdige Untertitel „Auf der Suche nach dem Wesentlichen – Teil 2“ hat eine Geschichte, die zum besseren Verständnis in aller Kürze verraten sei. In meiner Jugend wollte ich, analog der 22 Karten des Großen Arkanums des Tarots, ein 22-bändiges Werk aus allen möglichen Wissensgebieten schaffen ... Nun ja, jedes Flugzeug startet die Schnauze spitz nach oben und mit eindrucksvoller Beschleunigung. In achttausend Metern Höhe und bei Reisegeschwindigkeit sieht es lange nicht mehr so beeindruckend aus. Dieser Effekt widerfuhr mir ebenso. Das Leben setzte mir andere Prioritäten, führte mich zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Insofern es sich um die Vermehrung meiner Fähigkeiten und meines Wissens, oder um die Entfaltung meines menschlichen Potenzials handelte, ließ ich mir das gern gefallen. Auf diese Weise entwickelte sich meine Literatur gemeinsam mit mir. Geblieben sind ein Sachbuch über den Tarot2, das den Untertitel „Auf der Suche nach dem Wesentlichen – Teil 1“ trägt, sowie der Plan, allen folgenden Veröffentlichungen mit Sachthemen die jeweilige Nummerierung zukommen zu lassen. Daher trägt dieser Band im Untertitel den Hinweis: Teil 2.
Die Abbildungen zwischen den einzelnen Kapiteln stellen Alltagsansichten in Graz 2013 dar. Ich habe mich für typisch urbane Szenarien und gegen touristische Motive entschieden, weil diese den allgemeingültigen Anspruch besser repräsentieren. Man soll diese Motive in jeder Stadt antreffen können. Aus ästhetischen Gründen sowie der Metaphorik halber ließ ich den Fotos eine quasi künstlerische Nachbearbeitung zukommen. Es möge den ungewohnten Blick auf das Gewöhnliche versinnbildlichen. Für manche Informationen benötigen wir Worte, für andere nicht. Viele wirklich gute Gedanken kommen bestens ohne Worte aus. Ich hoffe, diese werden trotzdem entdeckt.
Abbildungen sind aus konzeptuellen Gründen eine willkommene Idee, bilden sie doch einen Gegenpol zum Text und balancieren diesen aus. Eine ähnliche Überlegung liegt den Witzen unter den Abbildungen zugrunde. Wo auf der einen Seite abstrakte Überlegungen aller Art den Intellekt mit schwerer Kost beschäftigen, darf auf der anderen auch Lachen von innen wärmen. Im Alten Rom hat Seneca (1 – 65) so treffend gesagt: „Es ist des Menschen würdiger, sich lachend über das Leben zu erheben, als es zu beweinen.“ Humor gehört genauso zum Repertoire der fundamentalen Lebensäußerungen wie das Nachdenken ... Worin mehr Leben steckt? Ich weiß es nicht. Humor ist in der deutschen Literatur fast verpönt, will der Text ernst genommen werden. Gerne verfrachtet das Fachpublikum solche Veröffentlichungen in die Ecke der Trivialliteratur. Dieses Klischee will ich unterlaufen. In der anglo-amerikanischen Literatur sieht man Humor gelassener.
Des weiteren ist die Mischung zwischen Spaß und Ernst ohnehin ein Merkmal meiner Literatur, dem man sich am besten vorbereitet nähert. Meine Spezialität, wenn man so will, liegt in beiläufig eingestreuten, subversiven Boshaftigkeiten, Untergriffigkeiten oder Provokationen. Diese sollten jedenfalls mit Augenzwinkern zur Kenntnis genommen werden. Wirklich humorlosen Leuten sei geraten, das Buch aus der Hand zu legen. Dessen ungeachtet verwende ich ein Emoticon: damit sich niemand dabei über Gebühr aufhalte.
Ich habe Graz erwähnt. Grazer, allen voran der Bürgermeister, hören es nicht gerne, dennoch muss es gesagt werden: Graz ist eine Stadt wie jede andere. Wenn etwas diesen Ort besonders macht, ist es unsere eigene Geschichte, die wir über die Jahre darin schreiben. Und sollte in den Schlachten, die wir in diesem Verlaufe schlagen, bestimmte Themen als beherrschend auftauchen, mag es sein, dass Essays daraus entstehen, in der Hoffnung, sie mögen der Allgemeinheit dienlich sein. Das ist der Grund, aus dem es dieses Buch gibt.
Ein weiterer Hinweis, der mir sehr am Herzen liegt. Obwohl ich in den Essays stets männliche Bezeichnungen gebrauche, wende ich mich natürlich genauso an die weibliche Leserschaft. Nur ist es sprachlich sehr holprig, stets die männliche und die weibliche Form („der (die) Leser(in)“ z. B.) gleichzeitig anzuführen, zu gendern, wie sich die Fachleute ausdrücken. Das beliebte Binnen-I ist schlicht und ergreifend falsch, weil es im Deutschen keine Großbuchstaben im Wortinneren gibt. Ich habe im Buch „Die Dunkelfrau will herein“ penibel gegendert, musste aber feststellen: Sprachlich elegant liest sich anders.
In meinem Bemühen, politische Korrektheit mit sprachlicher Eleganz zu versöhnen, richtete ich 2015 eine E-Mail an die Duden-Redaktion. Darin regte ich an, Begriffe mit dem dritten Geschlecht für die Fälle einzuführen, in denen beide Geschlechter gemeint sind. Bis heute erhielt ich keine Antwort. Gerne wäre ich korrekt, schon aus Prinzip, leider ...
Schweren Herzens besann ich mich dessen, was der Duden3 schreibt: „Wie weit man in der (...) Kommunikation der Forderung nach einer geschlechterberechtigten Behandlung von männlichen und weiblichen Formen nachkommt, ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Texte, in denen viele Doppelnennungen oder Verkürzungen vorkommen, können schwerfällig und überkorrekt wirken. (...) Bei der sprachlichen Gleichbehandlung von Männern und Frauen kommt es also vor allem auf das richtige Augenmaß an. Manchmal steht die Kürze einer sprachlichen Äußerung im Vordergrund, dann wieder kommt es mehr auf Geschlechtergerechtigkeit an.“
Ich meine, der Umstand, dass ein Essay Literatur darstellt und nicht Wissenschaft, legt die Spur zu sprachlichen Ansprüchen. In wissenschaftlichen Publikationen sehe ich die Priorität bei der politischen Korrektheit. Folglich entschloss ich mich, wie viele andere Autorinnen und Autoren, zu der erwähnten, vereinfachenden Vorgangsweise, Generalklausel genannt. Meiner Beobachtung nach machen genauso schreibende Frauen von dieser Klausel Gebrauch. Insofern sollte es kein Problem geben.
Die Leserinnen sollen das bitte nicht als Diskriminierung missverstehen. Solange die Statistik mehr Frauen als Männer bücherlesend dokumentiert, weiß ich deren Bedeutung zu schätzen. Allerdings, so gesehen legte die Logik näher, grundsätzlich Frauen anzusprechen und Männer stillschweigend zu inkludieren, und diese um Verständnis zu bitten, usw. … Halt, da ist etwas dran! Warum praktiziere ich es dann anders? Was sollte mich veranlassen, die Minderheit der Leser gezielt anzusprechen, obwohl die Mehrheit just das andere Geschlecht hat? Ist doch widersprüchlich. Wenn ich schon das Unübliche für mich reklamiere, dann … Ich fürchte, ich brauche eine Pause. Die Leserinnen und Leser wollen mich bitte kurz entschuldigen ...
Nun habe ich einen Kaffee getrunken, denn als linientreuer Österreicher überdenkt man wichtige Fragen grundsätzlich bei Kaffee und Kuchen. Dabei traf ich folgende Entscheidung: Obwohl ich in den Essays stets weibliche Bezeichnungen gebrauche, wende ich mich natürlich genauso an die männliche Leserschaft. Die Leser sollen das daher bitte nicht als Diskriminierung missverstehen. Zur weiteren Begründung siehe oben.
Vielleicht ist Ihnen, liebe Leserinnen, aufgefallen, dass ich mich über das, an sich marginale, Gendern ein wenig detailverliebter verbreite. Wieso? Weil wir uns damit im Grunde bereits mitten im Buch und einem seiner Hauptthemen befinden, dem Unterschied zwischen Theorie und Praxis; hier: gesellschaftspolitischer Anspruch einerseits, praktische Umsetzung andererseits. Ich habe früh aufschlussreiche Bekanntschaft mit dem Konfliktfeld Theorie versus Praxis gemacht. Im Alter von 15 Jahren arbeitete ich in den Sommerferien als Nachtportier im Hotel Goldener Adler, Innsbruck. Hier wurden gelegentlich volkstümliche Musikabende gegeben. Eines Nachts waren die Töne gegen halb zwei Uhr zu meiner Freude wieder einmal verklungen, als ich bemerkte, wie sich der Sänger mit zwei jungen Damen im Schlepptau Richtung Zimmer auf den Weg machte. Ich darf durchaus sagen, dass man fröhlicher Dinge war.
Allerdings war mir bei Arbeitsbeginn eingeschärft worden, dass derlei in unserem Hause nicht erwünscht war und ich allenfalls einzuschreiten hätte. Hatten doch unter unserem Dach seinerzeit Goethe und Mozart genächtigt, vom Lokalmatador Andreas Hofer ganz zu schweigen. Von diesem Geiste beseelt rief ich den Sänger auf seinem Zimmer an. Ob sich die Damen denn gleich entfernen würden, oder wie der Herr gedenke, die Übernachtung zu regeln. Er legte auf. So einfach wollte ich mich nicht abspeisen lassen, also rief ich neuerlich an. Und gleich noch einmal. Und noch einmal. Konsterniert stellte ich fest, dass der Sängerknabe von Mal zu Mal ungehaltener, ja geradezu unwirsch, wurde. Ein Schwall unsachlicher Ideen kam auf mich zu. Ob ich es ihm nicht vergönne, ob ich gar selbst mitmachen wolle, usw. Mitnichten, protestierte ich, ging es doch nur darum, meine Arbeitsanweisung umzusetzen. Zu meinem Bedauern gab sich mein Gast unbeeindruckt. Nachdem er meine Anrufe konsequent ignorierte, gab ich zähneknirschend auf.
Zum nächsten Dienstantritt erklärte mir der Chefportier, ich möge weniger strikte sein, wir behandelten solche Fälle mit Augenzwinkern. Schließlich sei der Sänger kein gewöhnlicher Gast. Man mag nachvollziehen, wie unsympathisch mir Regeln und Gesetze wurden, die stillschweigend für einige Wenige außer Kraft sind, oder erhabene Schriften, deren nicht minder erhabene Lehren kein Mensch (wirklich) lebt. Oder Leichen im Keller, deren Gestank zwar aller Welt in die Nase weht, gleichwohl niemand ansprechen würde.
Wer es vermag, den Wahrnehmungsfilter Differenz von Praxis und theoretischem Anspruch zu benützen, bewegt sich durch ein schauerliches, irrationales Universum. Was leistet sich ein gütiger, liebender Gott im Alten Testament? Fragt Hiob, als einen unter vielen. Sind wir nicht vor dem Gesetz alle gleich und wie sieht die Praxis aus? Mit wie viel Schein (und wenig Sein) wird allenthalben das beste Geschäft gemacht? Welchen horrenden Preis lässt sich die Gourmet-Wirtin für das nicht viel mehr als Nichts auf ihrem üppigen Designerteller bezahlen, den sie mit einer verirrten Baby-Karotte auf einem exotischen Gemüseblatt verziert hat? Und, und, und …
Ich fange gar nicht erst an, sonst muss ich mich jetzt schon ärgern. In Summe wird jemand mit diesem Wahrnehmungssensorium das beklemmende Gefühl beschleichen, sich anhalten zu müssen. Ja, es gibt trotz alledem Halt und ich hoffe, Sie, liebe Leserin, finden etwas davon in diesen Essays.
Um was geht es noch? Ich bemühe mich vorrangig um die Themen, Meinungen und Argumentationslinien, die im Windschatten der öffentlichen Diskussion, dem sog. Diskurs, ein zu Unrecht missachtetes Dasein fristen. Niemand benötigt ein Buch eines Anton Christian Glatz, um – wieder einmal – festzustellen, wie ungerecht es ist, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger gezahlt erhalten als Männer. Ohne Frage eine Gemeinheit, doch finden sich glücklicherweise ausreichend Leute und Gelegenheiten, diesen Missstand zu thematisieren. Geht es hingegen beispielsweise um die Rechte (nicht die Pflichten!) der Väter, sieht die Lage betrüblicherweise anders aus. Dazu braucht es einen Anton Christian Glatz.
Wir finden in den Diskursen Hauptthemen vor, die allerorts behandelt werden und die ich mit der Autobahn der kollektiven Kommunikation vergleiche. Mir haben es die Nebenstraßen angetan. Äußerst treffend sagte Karl Marx: „Die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden.“ Abseits dieser gibt es Unberücksichtigtes, das seiner Enthüllung wartet, offene Geheimnisse, die auf die harren, die den Mut (oder den Vorwitz) aufbringt, sie öffentlich zu artikulieren. Hier tummeln sich die brachliegenden Erkenntnisse, die, aus welchen Gründen immer, mehr oder weniger verschwiegenen oder ignorierten Informationen. Da blitzen Strategien, ja sogar Visionen auf, die unserem Leben inspirative Kraft zu verleihen imstande wären, vorausgesetzt, wir lassen dies zu. Nebenwege, Ab- oder gar Irrwege? Wir werden sehen. Ich lade Sie ein, mit mir diese Wege zu erkunden. Es macht Spaß, gemeinsam ein bisschen gegen den Wind zu pinkeln. Natürlich unter Bedachtnahme aller Vorsicht, damit wir nicht … Lassen wird das.
Von diesem Punkt abgesehen finden Sie am Ende jeden Essays eine Seite, die Ihren persönlichen Bemerkungen vorbehalten ist. Verstehen Sie dies bitte als meine ausdrückliche Einladung, in das Buch hineinzuschreiben. Sie sollen das letzte Wort haben und dabei Ihr Exemplar im Fortschreiten der Lektüre zu einem persönlichen Gegenstand entwickeln. Haben Sie keine Bedenken, sollten Sie anderer Meinung sein als ich. Die funktionierende Demokratie lebt von der Unterschiedlichkeit der Ansichten und Argumente. In diesem Sinne wollen wir mehr tun als bloß den gerne bemühten ungewohnten Blick auf das Gewohnte.
Apropos ungewohnter Blick auf das Gewohnte. Wenn ich durch die Laudongasse gehe, passiere ich ein Fenster im Hochparterre, aus dem ab und an der Dackel des Hausmeisters neugierig seine schwarze, feuchte Schnauze streckt. Stets in derselben Haltung, die Vorderpfoten auf der Fensterbank, beobachtet er in stoischer Ruhe alles, was sich unter ihm auf der Straße abspielt. Ich habe es noch nie erlebt, dass er sich in irgendein Geschehen eingemischt hätte. Er hat mich noch nie angeknurrt, geschweige denn angebellt, und ich bin dessen sicher, er wird dies auch nie tun. Es ist zwar nicht außergewöhnlich wenn ein Hund neugierig zum Fenster hinaussieht, aber was dieser Hund betreibt, lauft bereits unter philosophischen Betrachtungen. Eigentlich fehlt ihm nur die Brille. Huldvoll schenkt er mir mit seinen glänzenden schwarzen Augen seine Aufmerksamkeit. Ich fühle mich, als täte er einen unbestechlichen Blick in die Tiefen meiner Seele und hole mit chirurgischer Präzision alle wesentlichen Erkenntnisse über meinen Charakter zutage.
Ich bin begeistert. Aber es geht mir ebenso mit schnurrenden Katzen, Nebelkrähen Ende Oktober, Dromedaren in der ägyptischen Wüste, Bachstelzen und ich weiß nicht, mit was noch allem. Eigentlich finde ich die ganze Welt großartig. Ich finde sie so toll, dass man sie direkt erfinden müsste, existierte sie nicht ohnehin. Und einem Teil dieser Großartigkeit wollen wir uns in den Essays dieses Buches mit Würde und ohne Respekt nähern.
Die Hausmeister-Töle, der ultimative Hund
1„Das Naturbild der heutigen Physik“, Reinbek 1962
2 „Tarot – Ich ging den Weg des Narren“, BoD, Norderstedt, 2010
3 Duden, „Der Deutsch-Knigge“, Mannheim 2008 S. 104
Die Weikhard-Uhr
Seit 1930 steht auf dem Grazer Hauptplatz in unveränderter Form die sog. Weikhard-Uhr. Seither ist sie der Treffpunkt in Graz schlechthin, ein Umstand, der sicher besonders auf die zentrale Lage und die dementsprechend leichte Erreichbarkeit zurückzuführen ist. In der Tat: Wer die Weikhard-Uhr nicht findet, hat sich mit einiger Wahrscheinlichkeit überhaupt in der Stadt geirrt.
Herbst 2014 kam ein Dokumentarfilm in ein Grazer Kino, den Boris Miedl und Jürgen Miedl gedreht hatten. Sie hielten sich 24 Stunden an der Weikhard-Uhr auf und interviewten die Leute. Es stellte sich heraus, dass die Uhr praktisch allen Menschen bestens bekannt war. Kaum jemand, der sich noch nie bei ihr verabredet hätte. Und wehe, sie würde abgetragen, oder auch nur ihr Aussehen verändert!
Dabei war diese Uhr nie Gegenstand eines offiziellen Diskurses, keiner wissenschaftlichen Arbeit, keines Symposiums etc. Schließlich handelt es sich streng genommen lediglich um ein zum Uhrengeschäft Weikhard gehörendes, privates Objekt. Erst der erwähnte Film machte die Uhr zu einem Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung. Dass die 47-Minuten-Dokumentation immerhin fünf Wochen im Kino lief darf als Hinweis interpretiert werden, wie lebendig der solcherart eingeleitete Diskurs war. Normalerweise wird ein Filmchen dieser Länge nach einer Woche wieder abgesetzt. Für ein Filmdebut ist das ein Erfolg, zu dem ich ausdrücklich gratulieren möchte.
Wir konstatieren also ein echtes Interesse der Grazer an dieser Uhr. Womit hängt das zusammen? Wie es in jedem Text einen Subtext gibt, der all das an Inhalten transportiert, was im Text nicht expressis verbis steht, so existiert in jeder Stadt ein inoffizielles Leben. Quasi schwingt dieses als Subleben des offiziellen mit, verleiht ihm eine Textur, benachbart es, oder wie immer man sich ausdrücken will. Dieses inoffizielle Leben bildet genauso Strukturen aus und überzieht das gesamte urbane Leben mit einer, mal mehr, mal weniger ausgeprägten Infrastruktur, inklusive dazugehörigem historischem Wandel. In diesem Leben allerdings hat die Weikhard-Uhr einen fixen Platz in Graz. Was ist ihr Geheimnis?
Am anspruchslosen, sachlich-nüchternen, betont funktionalistischen Design kann es nicht liegen. Uhren dieser Art findet man landauf, landab zuhauf an und in Bahnhöfen (so z. B. am Grazer Hauptbahnhof), oder sonstigen öffentlichen Plätzen. Ästhetisches Vergnügen scheidet definitiv aus. Die Uhr befindet sich auf Höhe des ersten Stockwerkes der anliegenden Gebäude, deutlich über den Köpfen der Passanten, und ist dadurch weithin sichtbar. Sie repräsentiert die objektive Zeit, die, die für alle gleich ist. Zehn Minuten sind zehn Minuten. Ob sie mit Zuhören einer voll motivierten Blasmusikkapelle verbracht werden, mit beschaulichem Dösen anlässlich einer Autorenlesung oder einem Begräbnis, spielt – für diese Zeit – keine Rolle. Die objektive Zeit verströmt sich gleichmäßig in alle Richtungen, soweit die Uhr sichtbar bleibt. Sie scheint von einer Art Zentrifugalkraft getrieben, deren Ausgangspunkt dort ist, wo die beiden Zeiger gemeinsam mit dem Uhrwerk verbunden sind. Interessanterweise da, wo sich die Zeiger am wenigsten bewegen.
Aus unserer alltäglichen Erfahrung ist jedoch evident, dass wir Zeit sehr subjektiv erleben. Eine rattenscharfe Viertelstunde im Bett fühlt sich ganz anders an als die letzten fünfzehn Minuten vor einer Blinddarmoperation. Deswegen sagt ein Sprichwort: „Die Zeit galoppiert mit dem Verbrecher zur Richtstätte und schleicht mit der Braut zum Brautgemach.“
Diese subjektive Zeit verursacht bei der Weikhard-Uhr den gegenteiligen Effekt: In ihrem Sog versammeln sich die Menschen unter ihr, sie strömen dem Zentrum entgegen. Auf diese Weise manifestiert sich eine Art Zentripedalkraft. Es klingt nach Ebbe und Flut, mit der Besonderheit, dass beides gleichzeitig passiert, bloß durch zwei Meter Höhenunterschied getrennt. Dies dürfen wir metaphorisch verstehen: Die objektive Zeit als übergeordnete Instanz, das wirkliche Leben und damit wir selbst darin eingebettet. Wohl dem, der darin seinen verdienten Platz findet.
Durch den Umstand bedingt, dass sich die Menschen gerne bei der Uhr verabreden, muss oft Einer auf den Anderen warten. Auf diese Weise entsteht so eine Art „Zeitblase“ für den Wartenden, aus der heraus er das Treiben um sich beobachten kann. Tausende Menschen täglich stehen ein paar Meter entfernt an den Straßenbahnstationen und steigen ein, aus oder um. Hier wird verkauft, eingekauft, es rascheln die Einkaufstaschen, noble Läden allenthalben. Geschäftiges Leben wogt um einen herum.
Die Damen der feinen Gesellschaft wallen selbstbewusst vorbei und beschenken das gemeine Volk huldvoll mit einer Duftspur ihres sauteuren Parfums. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hätte sicher kommentiert, es handle sich um eine zivilisatorisch angepasste Form des Reviermarkierens, ein Verhalten, wie es z. B. von Bärenweibchen und Wölfinnen bekannt ist.
Als im Feber 2011 der Landtag ein Bettelverbot erlassen hatte, musste der Herr Bürgermeister aus dem Fenster seines Büros im zweiten Stock des Ratshauses eine Zeit lang nicht mehr mitansehen, was Seinesgleichen in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, angerichtet hat. Inzwischen zieht das Bettelvolk (wie man früher gesagt hat) wie eh und je mit Plastikbechern in der Hand an der Weikhard-Uhr vorbei.
Wer immer hier steht und die Minuten des Wartens in sich selbst ruhend verbringt, vermag früher oder später zu verstehen, was der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau (1817 – 1862) gemeint hat, als er sagte: „Zeit ist nur ein Bach, an dem ich angeln gehe.“
Freilich entsteht eine Zeitblase und mit ihr ein solcher Angelplatz überall, wo und wenn wir warten. Der Umstand aber, dass sich an der Weikhard-Uhr so viele Leute über all die Jahre treffen, begründet einen symbolisch höchst aufgeladenen Ort von kollektiver Bedeutung. Mir drängt sich der Vergleich mit dem berühmten Fels in der Brandung auf, unterlasse es aber, ihn anzuführen, weil die Redewendung abgedroschen ist.
Wer an diesem Ort bewusst seine Angelrute in den Bach der Zeit wirft, wird bald fündig werden. Mag sein, dass die paar Minuten Zeit, die hier den Wartenden quasi als Bonus vergönnt sind, den Einen eine Spur mehr zu Gott führt, den Anderen bestürmen Inspirationen, je nach persönlicher Prädisposition. Wir ziehen immer ein Stück von uns selbst an Land.
Als Sciencefiction-Autor drängt sich mir zum Beispiel folgende Metapher auf. Wir können diese Uhr als Schwarzes Loch interpretieren. Der Ereignishorizont des Loches, repräsentiert durch die Reihe der Striche auf dem Rand des Ziffernblattes, ist die Welt der verschiedenen Erscheinungsformen und Qualitäten der Zeit, also die Welt, in der wir uns befinden. Nun kommt ein Paradoxon. Je mehr wir die Zeiger bis zur Mitte des Ziffernblattes verfolgen, bzw. mit unserem Raumschiff in die Mitte des Schwarzen Loches vordringen, uns dergestalt dem Ausgangspunkt allen zeitlichen Geschehens nähern, desto weniger tut sich augenscheinlich. Das Zentrum selbst eröffnet sich als großes Geheimnis, worin bereits das nächste Paradoxon liegt. Indem sich das Zentrum auf diese Weise offenbart, entzieht es sich uns in gleichem Maße.
In der Zeitblase partizipieren wir ein klein wenig an diesen Geheimnissen und das brauchen wir Menschen – zwischendurch, da und dort. Vielleicht macht auch das die Weikhard-Uhr so beliebt. Wir bedürfen keiner spektakulären Auszeiten, Jakobswege, Klausurwochen im Kloster und vergleichbare Albernheiten, mit denen wir ohnehin nur unsere Eitelkeit bedienen, und wenn wir uns zehnmal reif für die Insel halten. Das kleine Refugium, unauffällig eingestreut in den Alltag, genügt.
„Die Zeit ist ein milder Gott“, stellte der griechische Dichter Sophokles fünfhundert Jahre vor Christus fest. Allerdings hat es der moderne Mensch trefflich verstanden, aus diesem milden Gott einen Tyrannen zu machen. Ein Blick auf unseren Lebenslauf zeigt uns, wie sehr wir uns über Zeitpunkte und Zeiträume definieren. Verbringen wir nicht die meiste Zeit, sowohl des Tages als auch des Lebens, damit, uns als moderner Galeerensträfling im Job abzurackern, auf dass sich ein fremder Geldbeutel fülle? Oder denken wir daran, wie unser Alltag von der Zeit strukturiert wird. Hetzen wir nicht von einem Termin zum anderen, bis wir zuletzt aktives Zeitmanagement betreiben müssen, um dem Phänomen Herr (bzw. Frau) zu werden? Der Terminkalender, mein Zuchtmeister ... Und flugs mutieren die schlichten schwarzen Striche des Ziffernblattes zu Sprossen eines Hamsterrades, das uns ohne Gnade und Barmherzigkeit auf der Stelle laufen lässt. Lediglich der Tod bietet ein betrübliches Entkommen. Chronos, der altgriechische Gott der Zeit, ist ein Gott mit zwei total verschiedenen Gesichtern. Es heißt zwar, die Zeit heile alle Wunden, aber Chronos schlägt heute mehr Wunden, als er heilt. Das kann nicht gut enden. Wer sich in der Zeitblase der Weikhard-Uhr befindet, steht jedoch ein wenig außerhalb dieses Treibens, wenngleich für eine beschränkten Zeitraum.
Friedrich Schiller sagte einmal: „Der Menschen Engel ist die Zeit“ und knüpft damit an Chronos' freundliches Gesicht an, welches sich in diesem Raum zu entfalten vermag. Und vielleicht ist die spürbare Anwesenheit dieses Engels das eigentliche Geheimnis der Weikhard- Uhr.
Der Pessimist sieht die Finsternis im Tunnel, der Optimist das Licht an dessen Ende und der Realist sieht den Zug auf sich zukommen. Für den Lokomotivführer stehen drei Beklopfte auf dem Gleis.
Babsi, eine Sünderin vor dem Herrn
Juli 2014. Eine junge Oberösterreicherin drehte in der St. Jakobs-Kirche in Hörsching, Nähe Linz, zwei Pornofilmchen, ein Gebetbuch und einen Rosenkranz hielt sie in der Hand. Unabhängig davon, wie unanständig die Szenen wirklich waren, reichte es jedenfalls für kräftige Aufregung, infolge derer Pfarrer B. Brauer4 namens der Diözese Linz die Anzeige erstattete. Die Schuldige wurde wenige Wochen später leicht ausgeforscht, weil sie die Filmchen zu Werbezwecken fleißig in Umlauf gebracht hatte. Den Angaben der Polizei zufolge wollte die Frau, welche unter dem Künstlerinnennamen „Babsi“ dergestalt umtriebig war, durch den Eklat zum Star avancieren.
Daraufhin schrieb ich folgende E-Mail an den Pfarrer:
Sehr geehrter Herr Pfarrer Brauer,
mit Befremden entnehme ich den Medien, dass Sie eine Porno-Darstellerin mit dem Spitznamen „Babsi“ angezeigt haben, weil diese Sex in Ihrer Kirche hatte. Dabei sagt doch Gott im Alten Testament: „Gehet hin und vermehret euch.“ Wer zölibatär lebt, widersetzt sich diesem Gebot und begeht die Sünde des Ungehorsams. Das wenigstens kann man Babsi nicht vorwerfen. Gott hat die Frauen mit ihrem weiblichen Begehren erschaffen und es ist nur der nötige Respekt vor seiner Schöpfung, das zur Kenntnis zu nehmen.
Früher hat man derlei Frauen in den nächsten Isis-, Astarte- oder Ischtar-Tempel gesteckt, wo sie ihre Talente zum allgemeinen Wohl entfalten durften. Dies im Einklang mit den Gesetzen der Göttin. Leider bietet das Christentum diese Möglichkeit nicht.
Ich möchte Sie dringend daran erinnern, dass Ihr Meister, Jesus von Nazareth, sich liebend gerne unter gesellschaftlichen Außenseitern aufgehalten hat. Er zog Zöllner, Huren usw. den Vertretern der Amtskirche, den Pharisäern, vor. Jesus war nicht annähernd so puritanisch wie die Amtskirche, sowohl die jüdische von damals, als auch die christliche von heute.
Fragen Sie sich doch einmal in einer ruhigen Minute: „Zu welchem Gott bete ich? Einem rächenden, einem strafenden oder zu einem, der seine Geschöpfe liebt, und ihnen verzeiht?“ Welcher ist wohl der Gebete würdig?
Für ein Gespräch mit Babsi im Geiste christlicher Nächstenliebe zwecks Veredelung ihres deftig-sexuellen Verhaltens hätte ich noch Verständnis. Ihr Vorgehen, Herr Pfarrer, widerspricht aber eklatant den Lehren des Jesus von Nazareth. Der hat eine Ehebrecherin vor der Bestrafung durch Steinigung beschützt, indem er den Leuten gesagt hat: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“
Sie haben mit Ihrer Anzeige dafür gesorgt, dass Babsi dingfest gemacht wurde, auf dass man sie an das Kreuz eines weltlichen Gesetzes nagele. Damit haben Sie den ersten Stein geworfen und die Ideen Ihres Meisters verraten. Ich frage Sie, Herr Pfarrer: Sind Sie frei von Sünde?
Mit freundlichen Grüßen
Zum Thema gäbe es noch vielerlei zu sagen, was ich indes dem Herrn Pfarrer im Zuge meines ersten Kontaktes ersparen wollte. Für einen eventuellen Gedankenaustausch mit ihm plante ich diese weiteren Ideen und Argumente zu entwickeln. Zudem soll man eine E-Mail nicht überfrachten und einen Essay daraus machen. Allerdings befinden wir uns in einem solchen und deswegen halte ich es für angebracht, die Überlegungen fortzuführen:
Die rein rechtliche Seite ist kein Thema, hier hat sich Babsi eindeutig schuldig gemacht. Dies ist allerdings nur die weltliche Seite, welche der Vollständigkeit halber erwähnt sei. Der theologische Aspekt ist eine gänzlich andere Sache. Da liegt der Hase im Pfeffer und deswegen muss darüber diskutiert werden.
In der griechischen Antike wurden umfangreiche Orgien zu Ehren der Götter, speziell des Dionysos, abgehalten. Das waren mehr als bloß Saufgelage. Die Orgie bezeichnete ein kultisches Geheimtreffen bei Nacht als Zentrum des antiken Mysterienkultes. Desgleichen sehen die tantrischen Lehren im Hinduismus sexuelle Vorgänge als Teil des Heiligen, sogar als wichtigen. Man war nicht immer und überall so prüde wie im Christentum.
Es gibt zwar eine Trennung zwischen der Sphäre des Heiligen und des Profanen, auf die u. a. der Religionswissenschaftler Mircea Eliade („Das Heilige und das Profane“) hingewiesen hat und ich halte es für sehr sinnvoll, das Empfinden dafür zu schärfen. Sexuelle Vorgänge kategorisch dem Profanen zuzuordnen, entspricht unserer christlich dominierten Tradition und muss im Sinne des Querdenkens hinterfragt werden.
Weiters sollten die unzähligen Missbrauchsskandale in der Katholischen Kirche hinreichend aufgezeigt haben, wohin eine rigorose Verbannung des Sexuellen (Zölibat) führt: in die skurrilen Erscheinungsformen deformierter Sexualität, dadurch Schuld und Kriminalität für die Täter, Traumata für die Opfer, Entschädigungszahlungen durch die Kirche.
Ich will nicht so weit gehen, zu behaupten, dass angesichts der zahlreichen Missbrauchsfälle in der Kirche diese ihre moralische Legitimation, sich über den Vorfall zu entrüsten, gänzlich eingebüßt hätte, aber: Der Blinde schimpft den Lahmen. Wenigstens das muss in aller Deutlichkeit ausgesprochen werden. Ein wenig der so oft beschworenen christlichen Barmherzigkeit und Verzeihung wären angemessen gewesen. Es sei denn, diese existierten nur auf dem Papier ...
Mit der Anzeige wurde ein Medienecho losgetreten, das dem Bekanntheitsgrad Babsis den entscheidenden Kick verlieh. Pfarrer Brauer arbeitete den Interessen Babsis in die Hand, die in erster Linie bekannt werden wollte. In dieser Hinsicht hätte ihr nichts Besseres widerfahren können.
Jesus hat in der Bergpredigt
5
gesagt:
„Wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann halte ihm auch die andere Backe hin.“
Nach dieser Logik müsste eine vergewaltigte Nonne eine Zugabe anbieten, z. B. Oralsex. Wer mag – und vor allem kann – schon diese Maxime praktisch umsetzen? Was hätte wohl Pfarrer Brauer angeboten, hätte er sich an die Ethik der Bergpredigt gehalten?
Sinnigerweise steht im Neuen Testament (1. Johannes 2,1–6): „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.“ Und was erkennen wir an den Taten des Herrn Pfarrer? Jawohl, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Mit Schaudern stehen wir wieder einmal vor diesem schwindelerregenden Abgrund, der sich vor uns auftut wie der Grand Canyon, so bedrohlich, aber viel weniger faszinierend. Uralt ist der Konflikt zwischen Glaubensdogmen und sinnlicher Realität. Zwei Welten, die immer wieder „ordentlich“ aneinanderkrachen, dabei viel Unordnung stiften und manche Menschen sogar vor Gericht bringen.
Als Anhänger des fiktionalen Schreibens würden mir eine Menge Geschichten einfallen, die um dieses Thema kreisen. In diesen Erzählungen würde die Berechtigung beider zur Geltung kommen, zugleich die Grenzen aufgezeigt werden und wie man trotz allem etwas Nützliches aus beiden Welten macht. Mit Herz und Verstand gleichermaßen durch diese Welt zu gehen.
Auf der Kirchentüre hängt ein Zettel: „Bist du der Sünde müde, dann komm herein.“
Darunter steht mit Lippenstift: „Wenn nicht – ruf mich an. Tel. Nr. 01774-696969.“
4 Name geändert
5 Matthäusevangelium 4,25 – 5,1
Sind wir alle Charlie Hebdo?
Paris, 7. Januar 2015. Die Dschihadisten-Brüder Chérif und Saïd Kouachi stürmten maskiert und mit Sturmgewehren bewaffnet das Redaktionsbüro der satirischen Zeitschrift Charlie Hebdo. Sie schossen wahllos um sich und richteten ein Blutbad an. Dabei riefen sie Parolen, wie: „Allahu akbar“ („Gott ist am größten“) und „Nous avons vengé le prophète!“ („Wir haben den Propheten gerächt“). Zwölf Menschen, darunter fünf Karikaturisten aus dem Redaktionsteam, einschließlich des Herausgebers, wurden ermordet, zwanzig weitere verletzt, einige davon schwer. Auf der Flucht verschanzten die Attentäter sich am 9. Januar in einer Druckerei nordöstlich von Paris.
Ein weiterer Dschihadist erschoss am 8. Januar eine Polizistin. Er überfiel tags darauf einen Supermarkt für koschere Waren im Osten von Paris und nahm dort mehrere Geiseln, von denen er vier während der Geiselnahme erschoss. Er forderte freien Abzug für die Kouachi-Brüder und drohte mit der Tötung aller Geiseln. Bei der Erstürmung der beiden Schauplätze am frühen Abend durch die französische Polizei wurden alle drei Attentäter getötet. Die weiteren Geiseln blieben unversehrt.
Nach dem Anschlag kam es noch am selben Abend und den darauf folgenden Tagen in zahlreichen französischen und anderen europäischen Städten zu spontanen Solidaritätskundgebungen mit den Opfern. Allein in Paris demonstrierten am Abend des 7. Januar etwa 35.000 Menschen. Die meisten Teilnehmer verzichteten auf Fahnen, Banner und das Rufen von Parolen. Sie zeigten vielmehr Plakate mit der Aufschrift „Je suis Charlie“ („Ich bin Charlie“). Dieser Ausspruch war zuvor von Redaktionsmitgliedern auf der Internetseite von Charlie Hebdo in mehreren Sprachen veröffentlicht worden. Am 9. Januar versammelten sich etwa 700.000 Menschen in ganz Frankreich auf den Straßen. Am 11. Januar beteiligten sich im Land schließlich mindestens 3,7 Millionen Menschen an Trauermärschen. Solidaritätskundgebungen aus allen Teilen der Welt folgten umgehend. Um das Schlagwort „Ich bin Charlie“, bald abgewandelt zu: „Wir alle sind Charlie“, entwickelte sich ein beispielloser Hype.
Freilich verkaufte sich die folgende Ausgabe des Magazins sensationell. Sie wurde in 26 Sprachen übersetzt und war vielerorts bereits nach Stunden ausverkauft. Wurden vor dem Anschlag 60.000 Hefte gedruckt, waren es danach sieben Millionen. Charlie Hebdo war in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern sogar binnen Minuten ausverkauft. Noch während der Nacht harrten viele Menschen stundenlang vor den Zeitungsläden aus, um dann mit leeren Händen enttäuscht nach Hause zu gehen.
Nachdem (wie bei einem Satiremagazin vorhersehbar) wieder einschlägige Karikaturen enthalten waren, gingen in der halben islamischen Welt die Wogen hoch. Zum Beispiel wurden bei Unruhen im westafrikanischen Niger mindestens zehn Menschen getötet. In der Hauptstadt Niamey starben fünf Menschen, wie der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou im Fernsehen bekannt gab. Vier von ihnen wurden in niedergebrannten Kirchen oder Bars getötet. Mindestens sieben Kirchen, darunter das größte protestantische Gotteshaus, waren angezündet worden, wie die Polizei berichtete. In anderen afrikanischen Staaten wie Mauretanien, Mali und Senegal hatte es ebenso Proteste gegeben, die aber friedlich verliefen. Ausschreitungen gab es hingegen in Pakistan und Algerien. Kritik an den neuen Mohammed-Karikaturen kam zudem aus Afghanistan, Inguschetien sowie aus zahlreichen Ecken der Welt. Für oder gegen Charlie Hebdo – diese Frage riss weltweit einen tiefen Graben auf. Was sagt uns das?
1.) Welche Macht haben doch bedruckte Blätter! Es ist nicht das erste Mal, dass Karikaturisten mit der islamischen Welt in Konflikt geraten. Das war schon 2005 der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten passiert. Damals erschienen am 30. September unter dem Namen „Das Gesicht Mohammeds“ eine Serie von zwölf Karikaturen, die den Propheten und Religionsstifter Mohammed zum Thema hatten. Diese wurden im Oktober in der ägyptischen Zeitung Al Fager nachgedruckt. Durch zusätzliche Veröffentlichungen dieser und weiterer Mohammed-Karikaturen kam es in vielen islamischen Ländern zu Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen. Eine Lawine diplomatischer Konflikte zwischen der dänischen Regierung und Regierungen islamischer Staaten, sowie eine weltweite Diskussion über Religions-, Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit wurde losgetreten.
Anfang 2006 erstellten die dänischen Imame Ahmad Abu Laban und Ahmed Akkari ein Dossier, in dem neben den originalen zwölf Karikaturen auch solche abgebildet waren, die nicht aus der Jyllands-Posten stammten, die beleidigend-obszönen Inhalts waren und angeblich Abu Laban zugeschickt worden waren. Unter anderem wurde ein betender Muslim dargestellt, der während des Gebetes von einem Hund bestiegen wurde. Daraufhin kam es weltweit zu Protesten muslimischer Organisationen, vom Boykott dänischer Produkte bis hin zu erneut gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen mehr als 100 Menschen starben. Die Demonstranten auf den Straßen wurden teilweise gezielt mit falschen Informationen versorgt. Es wurden dänische und norwegische Botschaften angegriffen und teilweise zerstört.
Der Konflikt wurde bald „Karikaturenstreit“ genannt, ein Begriff, der bei der Wahl zum Wort des Jahres 2006 sogar den dritten Platz erreichte. Hintergrund ist, dass es im Islam ein sog. Bilderverbot gibt, demzufolge niemand gezeichnet werden darf; der Prophet und in satirischer Absicht schon gar nicht.
Insofern erlebte die Welt im Jänner 2015 lediglich eine Neuauflage eines alten Konfliktes. Nur wurde 2005 die Intoleranz der Islamisten nicht derart brutal geoffenbart, wie es durch die Ermordung von zwölf Menschen bei Charlie Hebdo der Fall war. Wenn wir uns jetzt nicht der Problematik stellen, frage ich mich, was noch alles passieren muss.
Ich entsinne mich des ersten Skandals in dieser Richtung, des berühmten Romans „Die satanischen Verse“ von Salman Rushdie aus dem Jahr 1988. Am 14. Februar 1989 gab der iranische Geistliche und Revolutionsführer Ajatollah Chomeini folgende Fatwa heraus6: „Ich möchte alle unerschrockenen Muslime in der Welt davon unterrichten, dass der Autor des Buches Die satanischen Verse, das in Opposition zum Islam, zum Propheten und zum Koran verfasst, gedruckt und veröffentlicht worden ist, sowie die Verleger, die sich des Inhalts bewusst waren, zum Tode verurteilt worden sind. Ich rufe alle pflichtbewussten Muslime dazu auf, dies rasch zu vollstrecken.“ Die iranische Stiftung 15. Chordat setzte ein Kopfgeld von einer Million US-Dollar aus.
Der Fairness halber sei erwähnt, dass die Fatwa in der islamischen Welt umstritten blieb. Verschiedene religiöse Autoritäten in Saudi-Arabien und Ägypten verurteilten sie als illegal und dem Islam widersprechend. Die Scharia gestatte es nicht, einen Menschen ohne ein Gerichtsverfahren zum Tode zu verurteilen. Eine Fatwa sei streng genommen bloß eine Rechtsauskunft einer islamischen Autorität. Zudem habe außerhalb der Staaten, in denen die Scharia angewandt wird, diese sowieso keine Rechtskraft. Auf der Islamischen Konferenz im März 1989 widersprachen alle Mitgliedsstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz (ohne den Iran) Chomeinis Fatwa.
Die Argumente zeugen von einer bemerkenswert modernen Rechtsauffassung. Wir müssen jedoch bedenken, dass die Auskunft einer Autorität in einer autoritären Gesellschaft ein ganz anderes Gewicht hat, als wenn bei uns jemand am Dienstag zum Amtstag des hiesigen Bezirksgerichtes geht, um sich dort einen Rat zu holen, z. B. wie das Testament der stinkreichen Erbtante anzufechten sei. So setzten viele Islamisten die „Auskunft“ mit einem offiziellen Urteil gleich.
Kurz darauf wurden mehrere Anschläge verübt. Der italienische Übersetzer wurde am 3. Juli 1991 in seiner Wohnung in Mailand durch Stiche verletzt, der japanische Übersetzer am 11. Juli 1991 im Gebäude seines Büros an der Universität Tsukuba erstochen. Der norwegische Verleger wurde durch Schüsse schwer verletzt. Rushdie musste sich jahrzehntelang unter Polizeischutz in England versteckt halten. Heute ist die Sache beinahe im Sand verlaufen. Rushdie braucht keinerlei Nachstellungen mehr befürchten, tritt seit Jahren wieder öffentlich auf und hält Workshops ab. Trotzdem wurde im Februar 2016 das Kopfgeld auf Rushdies Ermordung um € 540.000 erhöht. Der Betrag stammt aus einer Spendenaktion, die im Iran durchgeführt worden war. An Rushdies Status wird sich wenig ändern, weil er die Gemüter nicht mehr erhitzt.
Ich habe sein Buch gelesen und finde keinen Grund zur Aufregung. Die Überlänge des Buches ging mir viel mehr gegen den Strich. Es lässt sich allenfalls darüber diskutieren, wie geschmackvoll oder geschmacklos die Anspielungen auf den Propheten sind. Respektlos sind sie allemal und darauf hat die islamische Welt mit aller Härte und ohne jede Frustrationstoleranz reagiert.
Mir sind die islamistischen Reaktionen im Falle der Karikaturen und Rushdies „Verse“ äußerst wesensfremd, handelt es sich doch nur um bedrucktes Papier. Papier ist bekanntlich geduldig, wie mir schon in der Kindheit meine Oma eingeschärft hat, die dabei wahrscheinlich an Hitlers „Mein Kampf“