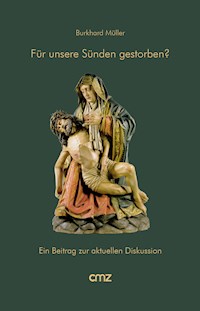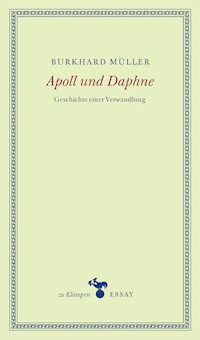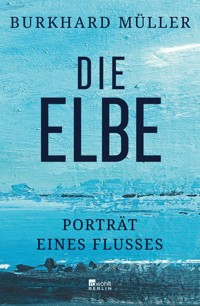
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Elbe ist der Strom des wiedervereinigten Deutschland. Sie verbindet die lange getrennten Teile des Landes, über die immer noch spürbare Fremdheit hinweg – und ist zugleich die geheime Achse Europas, an der Osten und Westen immer wieder neu aufeinandertrafen: in der Reformation, bei der Völkerschlacht von 1813, in Torgau, wo amerikanische und sowjetische Truppen sich 1945 über der zerstörten Elbbrücke die Hände reichten. Burkhard Müller hat sich auf eine Reise entlang der Elbe begeben, durch bekannte wie vergessene Gegenden. Er bricht im nordböhmischen Oberlauf des Flusses auf, an der Schneekoppe, reist durch die Sächsische Schweiz bis ins so prächtige wie widersprüchliche Dresden. Von dort zieht er in die Bauhaus-Stadt Dessau und die Lutherstadt Wittenberg, durch Gegenden des alten Braunkohletagebaus, wo heute die schönsten neuen Landschaften entstehen, weiter bis ins weltläufige Hamburg. Müller fragt nach der Geschichte der Orte und den Geschichten der Menschen – und erschließt damit nicht nur einen einzigartigen Kulturraum, sondern zeichnet zugleich ein eindrucksvolles deutsches Stimmungsbild.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Burkhard Müller
Die Elbe
Porträt eines Flusses
Über dieses Buch
Die Elbe ist der Strom des wiedervereinigten Deutschland. Sie verbindet die lange getrennten Teile des Landes, über die immer noch spürbare Fremdheit hinweg – und ist zugleich die geheime Achse Europas, an der Osten und Westen immer wieder neu aufeinandertrafen: in der Reformation, bei der Völkerschlacht von 1813, in Torgau, wo amerikanische und sowjetische Truppen sich 1945 über der zerstörten Elbbrücke die Hände reichten. Burkhard Müller hat sich auf eine Reise entlang der Elbe begeben, durch bekannte wie vergessene Gegenden. Er bricht im nordböhmischen Oberlauf des Flusses auf, an der Schneekoppe, reist durch die Sächsische Schweiz bis ins so prächtige wie widersprüchliche Dresden. Von dort zieht er in die Bauhaus-Stadt Dessau und die Lutherstadt Wittenberg, durch Gegenden des alten Braunkohletagebaus, wo heute die schönsten neuen Landschaften entstehen, weiter bis ins weltläufige Hamburg. Müller fragt nach der Geschichte der Orte und den Geschichten der Menschen – und erschließt damit nicht nur einen einzigartigen Kulturraum, sondern zeichnet zugleich ein eindrucksvolles deutsches Stimmungsbild.
Vita
Burkhard Müller, geboren 1959, studierte Deutsch und Latein in Würzburg, wo er mit einer Arbeit über Karl Kraus promovierte. Er lehrt Latein an der Technischen Universität Chemnitz, ist Autor und Kritiker der «Süddeutschen Zeitung». 2008 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet, 2012 mit der Übersetzerbarke des Verbands deutschsprachiger Übersetzer. Zuletzt erschienen «Deutsche Grenzen. Reisen durch die Mitte Europas» (mit Thomas Steinfeld, 2018) und «Apoll und Daphne. Geschichte einer Verwandlung» (2020).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Karte Peter Palm
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Christian Damerius
ISBN 978-3-644-01897-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort: Der andere deutsche Strom
Zwei große deutsche Flüsse gibt es: den Rhein und die Elbe. Der dritte Strom, die Donau, entspringt zwar auf deutschem Boden, strebt aber auf seinem Weg ins Schwarze Meer alsbald neun anderen Ländern entgegen. Der eine, an den alle zuerst denken, ist der Rhein. «Warum ist es am Rhein so schön?», fragt das Volkslied, und alle glauben es zu wissen: nicht nur, weil er so romantische Burgen und Rebhänge aufweist, sondern auch, weil hier das demografische und wirtschaftliche Zentrum der alten Bundesrepublik liegt, des schwäbischen Gewerbefleißes, des rheinischen Weinanbaus, des Frankfurter Bankenwesens und des riesigen Stadt- und Industriekomplexes in Nordrhein-Westfalen, nicht zu vergessen die alte Bundeshauptstadt Bonn. Diese Achse erwies sich allerdings bereits in der Epoche vor 1989 als leicht exzentrisch nach Westen verlagert; seit der Wiedervereinigung von 1990 hat sich dieses Ungleichgewicht verstärkt. Nur widerstrebend, das heißt mit knappem Mehrheitsbeschluss, zogen die Verfassungsorgane nach Berlin um und damit in den Einzugsbereich eines anderen Stroms: der Elbe. Damit honorierten sie die Tatsache, dass Deutschland nunmehr ein größeres Land war als bloß seine Westsektoren in der Zeit des Kalten Krieges; und einmal dehnte es sich sogar noch weiter aus, bis ins Baltikum. Die Mittellinie dieses Raums war die Elbe, die das Reich in zwei ungefähr gleich große Hälften zerlegte, ja die sogar als die geheime Achse Europas gelten kann. Als Adenauer 1955 nach Moskau fuhr, um die letzten Kriegsgefangenen herauszuholen, zog er, als sein Zug die Elbe überquerte, die Vorhänge seines Abteils zu, weil er, wie er sich ausdrückte, die asiatische Steppe nicht sehen wollte. So sprach ein treuer Sohn des Rheins.
Die Elbe wurde zum Strom der DDR, so wie der Rhein der Strom der BRD war. Der weitaus größte Teil ihres Staatsgebiets lag im Gewässernetz der Elbe, ausgespart blieben nur vergleichsweise schmale Randgebiete in Thüringen, an Oder und Ostsee. Mit dem Beitritt der fünf neuen Bundesländer hat das wiedervereinte Deutschland diesen zweiten Strom zurückgewonnen, seinen anderen Strom. Er ist der Strom des deutschen Ostens und damit jenes Gebiets, das vor einem Dritteljahrhundert der Bundesrepublik Deutschland beitrat. Ganz angekommen ist es dort nicht; und es scheint, dass die Vorbehalte in jüngerer Zeit eher noch gewachsen sind.
Aber die Elbe ist nicht bloß das Rückgrat des alten und neuen deutschen Ostens. Das entspräche ihr zu wenig in Raum und Zeit. Im Raum, denn sie entspringt weitab im Riesengebirge, direkt auf der polnisch-tschechischen Grenze, und erreicht ihren Unterlauf in Hamburg, das zweifellos Teil des alten Westens ist. Auch Berlin, das über Spree und Havel mit der Elbe zusammenhängt, gehörte in Zeiten des Kalten Krieges zur Hälfte dem Westen an. Ja, diese beiden größten deutschen Städte sind von jeher dem anderen Strom tributpflichtig, und schon darum sollte man ihn nicht unterschätzen. Die Elbe misst in ihrer Länge mehr als tausend Kilometer. Sie beginnt als ein südlicher Fluss, in Böhmen, zwischen Hügeln und Barock, bahnt sich ihren Weg durch die grotesken Felsformationen des Grenzgebirges; verwandelt sich in einen nördlichen Tieflandfluss, der aber nicht zahmer, sondern wilder wird, weil Orte, Straßen und selbst Schiffe ihm und seiner unberechenbaren Wasserführung ausweichen, zieht von Menschen weitgehend unbehelligt dahin; und öffnet sich endlich fast unmerklich zum Meer hin. Und auch in der Zeit überschreitet die Elbe die Grenzen des Ostens: Ehe die Elbe zur Achse der DDR und der fünf neuen Länder wurde, war sie die Achse Preußens und dank Preußens des Kaiserreichs. An der Elbe trafen die sowjetischen und die amerikanischen Truppen aufeinander: Das war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Schon kurze Zeit später verwandelte sich dieser Kontaktbereich jedoch in eine scharfe Grenze, wo Nato und Warschauer Pakt einander gegenüberstanden und sich von ihren Patrouillenbooten aus feindlich beäugten.
In der Frühen Neuzeit durchfloss die Elbe die Zentren der Reformation und des sächsischen Glanzes. An oder nahe ihren Ufern entstanden die gotischen Dome von Kuttenberg, Meißen, Magdeburg und Havelberg, der Dresdner Barock und das Dessauer Bauhaus. Holz und Silber, Braunkohle und Porzellan, Uran und Wein wurden an ihr und ihren Nebenflüssen gewonnen und verhandelt. Und noch weiter zurück, in der Erdgeschichte, bahnte sie sich ihren Weg durch ein Grundgebirge aus Gneis und Granit, schaffte sie in den Urstromtälern das Schmelzwasser der Gletscher ins Meer. In ihrem Einzugsbereich kam es zu den schlimmsten Umweltverwüstungen Mitteleuropas, und dennoch erhielten sich in den Elbauen einige der letzten mitteleuropäischen Naturräume. Die Bagger fraßen riesige Tagebaulöcher ins Land, aber gleich daneben bauten die Biber, die einzigen, die es im Deutschland des 20. Jahrhunderts noch gab, ihre Burgen.
Im Raum der Elbe fand sich ein Platz für die verschiedensten Menschentypen und Menschenbilder: den galanten Adligen am sächsischen Hof, den reuigen Christen in Wittenberg, den Bauern, den Krieger, den neuen Arbeiter des Sozialismus, den pädagogischen Reformer des 18. und den funktionalen Visionär des 20. Jahrhunderts; aber auch den Angler, der auf einem Klapphocker am Ufer sitzt, neben sich einen Eimer mit seinem meist eher unbedeutenden Fang; den Elbschwimmer, der den Flusslauf mit sportlicher Energie seiner ganzen Länge nach in nur zwölf Tagen zurücklegt; den Fährmann, der ihn gelassen vielmals täglich quert. Nicht vergessen seien auch jene, die in der Nervenheilanstalt Sonnenstein und im KZ Theresienstadt ermordet wurden, beides übrigens Orte mit besonders prächtigem Elbblick.
Im Jahr 1993, als sich der Osten öffnete, ging ich nach Chemnitz, um dort eine Stelle als Lateindozent an der Technischen Universität anzutreten. Ich kam aus dem Westen, aus Würzburg, wo ich eine Woche zuvor meine mündliche Doktorprüfung abgelegt hatte, in Germanistik; aber der Osten brauchte Latinisten dringender als Germanisten. Meine Stelle habe ich seit nunmehr einunddreißig Jahren inne, und hier werde ich bleiben. Ich habe also Anteil an beiden Sphären, der westdeutschen und der ostdeutschen, und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um über die Elbe zu schreiben.
Insgesamt zehn Reisen an die Elbe habe ich im Jahr 2023 zwischen erstem Frühling und spätem Herbst unternommen, vom Schnee der Schneekoppe bis hin zum Nebel von Brunsbüttel. Chemnitz, von wo ich gestartet bin, gehört zum elbischen Gewässernetz. Auf seinem Gemeindegebiet vereinigen sich die im Erzgebirge entspringenden Bäche Würschnitz und Zwönitz (dies vermutlich das letzte Gewässer im deutschen Flüsse-Alphabet) zum namengebenden Fluss Chemnitz, was in der Sprache der slawischen Urbevölkerung «steiniger Fluss» heißt. Die Chemnitz mündet in die Zwickauer Mulde, die sich ein Stück weiter mit der Freiberger Mulde zur Mulde überhaupt vereinigt, welche wiederum bei Dessau die Elbe erreicht. Ich lebe also an einem Elbenebenfluss dritten Grades, und wenn ich ein paar Kilometer außerhalb spazieren gehe, erreiche ich sogar den vierten.
Warum ist es an der Elbe so schön? Weil dieser Fluss ein so weites, reiches und tiefes Land durchfließt; und weil so wenige, auch wenn sie schon mal in Hamburg eine Hafenrundfahrt gemacht oder die Dresdner Semperoper besucht haben, ihn wirklich kennen. In diesem Buch soll er zu seinem Recht kommen: der Strom als Ganzes.
Erster TeilDie böhmische Elbe
Wo ist die Quelle?
Schneekoppe! Wer ungefähr so alt ist wie ich, das heißt plus minus sechzig, dem klingt dieses Wort, mit seiner lang gedehnten ersten Silbe und den zwei kürzeren verhallenden hinterher, noch immer wie ein Ruf der Sehnsucht in den Ohren. Kaum erinnere ich mich an die Produkte, die so im Fernsehen beworben wurden; es handelte sich wohl um Reformhauswaren. Bei uns kam so was nicht auf den Tisch. Spät erst sah ich den namengebenden Berg, aber gehört habe ich ihn schon viel früher.
Als ich historische Phasen zu unterscheiden lernte, meinte ich, dass das Warenzeichen «Schneekoppe» ein Erkennungssignal wäre, das Vertriebene aus Schlesien und dem Sudetenland untereinander verwendeten. Aber das stimmt nicht. Die Firma «Schneekoppe» existiert schon seit fast zweihundert Jahren, als es noch gar keine Marken im modernen Sinn gab. Damals wurden vor allem Leinölprodukte angeboten. Die Firma zog nach Westen um wie Zeiss oder Reclam. Es gibt sie übrigens immer noch (sie gehört inzwischen dem ehemaligen Fußballer Philipp Lahm), doch habe ich schon lange keine Reklame mehr für sie zu Gesicht bekommen.
Die Schneekoppe gab es für uns als Kinder aber nicht nur in der Werbung. Wir hatten ein Buch von Rübezahl, aus dem wir immer mal wieder vorgelesen bekamen. So wurden uns Riesengebirge und Schneekoppe zu einer märchenhaften Referenz: irgendwo weit weg, aber mit festem Namen behaftet. Ein gewaltiger Naturgeist war Rübezahl, von wandelbarer Gestalt, gütig zu guten und armen Menschen, die im schlesischen Gebirge ihr kärgliches Auskommen mit Weberei und Holzeinschlag fanden, aber auch der Tücke und Rachsucht fähig.
Und dann gab es natürlich auch noch den Rübezahl des Liedes. Mein Vater sang bei jeder Gelegenheit, beim Kochen, Spülen oder Autofahren, und eines dieser Lieder war: «Hohe Tannen weisen die Sterne / An der Iser wildspringender Flut. / Liegt das Lager auch in weiter Ferne / Doch du, Rübezahl, hütest es gut.» Die hohen Tannen, die wildspringende Flut, die hatten was, auch wenn ich nicht wusste, wo die Iser sprang. Ich kann alles immer noch auswendig, ohne mich je darum bemüht zu haben, einfach weil das Kinderohr eine Zisterne ist, aus der auch später nicht ein Tropfen verloren geht: «Komm zu uns an das flackernde Feuer / in den Bergen, bei stürmischer Nacht. / Schirm die Zelte, die Heimat, die teure. / Bleib bei uns, halte treuliche Wacht.» Das Schirmen, die teure Heimat: Das alles erkannte ich damals nicht in seinem jungen und mutmaßlich völkischen Charakter, der sich Mühe gab, wie uralt zu klingen. In mir zurück blieben stattdessen hohe Tannen und Rübezahl.
Wir sind, indem wir der Elbe nachgehen, nicht auf der schlesischen, sondern auf der böhmischen Seite des Grenzgebirges unterwegs. Rübezahl existiert auch auf Tschechisch, vor allem an Wirtshäusern und Volkskunstläden taucht er auf. Krakonoš heißt er hier und sieht aus, wie er klingt: grimmig, grob und mit einem Baumstamm bewaffnet. Er soll uns zur Elbquelle führen.
Wer den Ruf «Schneekoppe!» in der Reklamewelt der Kindheit gehört hat, den grüßt sie anders, als wenn sie ihm ganz fremd wäre. Sie grüßt wirklich: als einziger und höchster Berg, der sich im März, wo sich überall sonst schon der Frühling hervorwagt, in vollkommen baumfreies Weiß hüllt. Man sieht ihn schon aus weitem Abstand, wie er das sanft gewellte Hügelland überragt.
Die Schneekoppe, tschechisch Sněžka, ist der höchste Berg Mitteleuropas. Zwischen den Alpen und den nördlichen Meeren, einem Areal von rund einer Million Quadratkilometern (von denen Deutschland etwa ein Drittel einnimmt), gibt es keinen Berg, der die 1600 Meter erreichen würde oder überträfe, die die Schneekoppe misst. Wir starten im zögerlichen Frühling und kommen im Winter an.
Zur Quelle der Elbe wollen wir; und da diese sich unfern des Gipfels befindet, der Gipfel uns aber schon aus großer Ferne entgegenleuchtet, meinen wir, auf Sicht fahren zu können. Das erweist sich als Irrtum. Alles ist ausschließlich auf Tschechisch beschriftet. Die Hinweisschilder sehen anders aus als die deutschen, mit einem kleinen weißen Zieldreieck, der dem blauen Schild oben aufsitzt wie die Schneekoppe dem Horizont, und alle wirken, als wollten sie uns direkt zum Berg hinführen – doch wir verfranzen uns immer mehr. Wir haben es mit einem intensiv genutzten Wintersportgebiet zu tun, welches aber ausschließlich von den Bürgern jener kleinen Nation aufgesucht wird, auf deren Territorium es sich befindet. Das ist in den Alpen anders, wohin die Deutschen, Holländer, Briten zum Skifahren strömen, weil sie selbst keine wirklich hohen Berge haben. Vielleicht gibt es auch Tschechen in den Alpen, aber jedenfalls keine Nicht-Tschechen im Riesengebirge, denn so weit für ein letztlich subalpines Vergnügen zu reisen, fällt den Auswärtigen nicht ein. Der Schnee in den Höhenlagen ist jetzt im März zwar noch da, aber ziemlich matschig.
Wir folgen dem Schild «Pec pod Sněžkou», weil wir darin die tschechische Schneekoppe erkennen. Es handelt sich, wie wir später herausfinden, um den vormals deutschen Ort Petzer unter der Schneekoppe, der aber von unserem Ziel ein Stück abliegt. Lang fahren wir das enge Tal eines wilden Flusses voller Felsen hinauf, das an den Hängen überall mit Skihotels und Ähnlichem bebaut ist, und sind uns schon sicher, das wäre die junge Elbe. Es ist aber bloß die Úpa, die in die Elbe mündet; wir kehren um. Endlich finden wir die Elbe doch, sie durchquert den Ferienort Špindlerův Mlýn, früher auf Deutsch Spindlermühle, und sieht genauso aus wie die Úpa, das heißt vor allem: nicht größer. Wer hat wann entschieden, dass von zwei sich vereinigenden Wasserläufen der eine der Hauptstrom und der andere bloß der Nebenfluss sein soll? Festgelegt werden musste es offensichtlich, aber es geschah, wie es scheint, in einem Akt der Willkür. Das Problem wird uns weiter stromabwärts noch einmal beschäftigen, wo Elbe und Moldau zusammenfinden und es heißt, die Moldau münde in die Elbe, obwohl die Moldau der deutlich längere und größere Fluss ist. Ähnlich steht es ja auch mit Mississippi und Missouri sowie mit Donau und Inn in Passau. Dort lehrt der Augenschein, dass der mächtige Inn es ist, der die kleinere Donau in sich aufnimmt; aber so steht es eben nicht in den Karten.
Je mehr man sich ihm naht, desto fraglicher wird der Ursprung. Aus allen Schluchten und Spalten sprudeln die Wasser hervor, jedes davon könnte der entscheidende namengebende Quell sein. Schließlich stehen wir auf dem Kamm; ein weißer Adler auf rotem Grund verkündet, dass hier die polnische Grenze verläuft. Höher hinauf geht es nicht mehr. Es herrscht reger Fußgängerbetrieb. Ringsum stehen, weit auseinander, weil es hier mehr Platz gibt als im beengten Tal, große düstere Hotelkästen, Bauden genannt. Viele von ihnen sind mit dunklem Holz verkleidet und mit kleinen, hölzernen Balkonen geschmückt, sie stammen offenbar noch aus der Zeit der sozialistischen Moderne. Neuere Gebäude finden sich kaum, obwohl die Touristen mit ihren Geländewagen und glänzenden Skianzügen sich ganz auf der Höhe der Gegenwart bewegen.
Wir haben kein Navi, unsere Karten sind schlecht, die tschechischen Hinweise an den Straßen für uns nicht verständlich. Unser Schuhwerk eignet sich nicht für den tiefen, nassen Schnee. Wo soll hier die Quelle sein? Vermutlich nicht weit; aber doch außerhalb unserer Reichweite. Es kommt nicht zum Trophäen-Selfie. Klar ist: Wir befinden uns im Quellfeld, doch wir erreichen nicht jenes kleine Betonbecken, dessen Bilder wir gesehen haben, viel unscheinbarer als die bombastische Donauquelle in Donaueschingen, die offiziell als jener Punkt gilt, von dem der Strom, als kleiner Wasserfaden erst, seinen Ausgang nimmt. Wo wir der Elbe unzweifelhaft ansichtig werden, etliche Kilometer quellabwärts, hat sie schon eine Breite von mehreren Metern; und obwohl recht flach, verfügt sie doch sichtbar über die Macht, Steine zu rollen und Bäume zu stürzen. Auch die hohen Mauern, zwischen die man sie in den Ortschaften gezwängt hat, verraten den Respekt vor der Kraft des Stroms.
Das Problem des genauen Verlaufs wird sich am Ende wiederholen: Wo geht die Elbe in die Nordsee über? Immer weiter öffnet sich dann der Trichter, immer salziger wird das Wasser, Ebbe und Flut spielen herein. Gern wüsste ich, wer ihre Länge mit genau 1094 Kilometern angegeben hat. Auch beim Rhein glaubte man bis vor ein paar Jahren, die Länge genau zu kennen – und stellte eines Tages betroffen fest, dass er hundert Kilometer kürzer war als gedacht. Nun heißt es, er messe 1233 Kilometer; das wäre sogar um 12 Kilometer kürzer als die Elbe, wenn man als deren Quelllauf die längere Moldau ansetzt und damit auf 1245 Kilometer kommt. Damit wäre die Elbe nicht mehr als die Nummer zwei unter den deutschen Strömen abqualifiziert, sondern die strahlende Erste.
Die Donau ist natürlich noch viel länger, fast dreitausend Kilometer. Aber sie stellt keinen eigentlich deutschen Strom dar, sondern entspringt hier nur, um dann neun weitere Staaten zu berühren und sich ins Schwarze Meer zu ergießen, wo Europa in Asien übergeht. Die Elbe und der Rhein hingegen haben gemeinsam, dass sie rein deutsche Flüsse wo nicht sind, so doch waren, und wo nicht rein deutsch, so doch innerhalb jenes Gebildes verliefen, das fast ein Jahrtausend lang das Heilige Römische Reich hieß (erst spät mit dem Zusatz «Deutscher Nation»). Heute ist der Rhein ein internationaler Fluss, er entspringt in der Schweiz, hat Österreich, Liechtenstein und Frankreich zu Anrainern, durchquert Deutschland und erreicht in den Niederlanden das Meer. Bis zum Westfälischen Frieden 1648 gehörten alle diese Lande zum Reich. Dann traten Quelle und Mündung, die Schweiz und die Niederlande, aus dem Verband aus, Frankreich drang ins Elsass vor und setzte seine Festungen ans Ufer.
Die Elbe blieb noch länger ein Binnenstrom. Böhmen war seit dem 10. Jahrhundert Bestandteil des Reichs, seit dem 16. Jahrhundert stand es sogar unter unmittelbarer Kontrolle des Habsburger Kaisers und war damit dem Reich enger verbunden als zum Beispiel Bayern und Preußen, die sich von ihrem Oberherren nicht viel vorschreiben ließen. Auf das Reich folgte 1815 der Deutsche Bund; auch in ihm blieb Böhmen samt Mähren eingeflochten. Das änderte sich erst 1866 auf dem Schlachtfeld von Königgrätz, auf dem der Bund sein Ende fand. Seither erst bildet die lange Kammlinie, die vom Bayerischen und Oberpfälzer Wald über Erzgebirge, Zittauer Gebirge, Riesengebirge bis zu Isergebirge und Adlergebirge läuft und Böhmen und Mähren wie der Rand einer Schüssel umschließt, statt einer feudalen Geländemarke eine echte internationale Grenze, nämlich zwischen dem Kaiserreich Österreich und dem 1871 neu gegründeten Deutschen Reich. Noch einmal, für sieben kurze und schlimme Jahre, kehrte die Elbe in ihrer Gesamtheit «heim ins Reich», als Folge des Münchner Abkommens von 1938 und des deutschen Einmarschs in Resttschechien ein halbes Jahr später.
Nach dem Zweiten Weltkrieg aber wurde die Elbe noch weit grundhafter auseinandergerissen als der Rhein; denn quer zu ihrem Lauf ging der Eiserne Vorhang nieder. Es gab nunmehr zwei deutsche Staaten, einen östlichen und einen westlichen, und über eine bestimmte Strecke verlief die Grenze mitten im Strom oder auch an einem der Ufer (die unterschiedliche Interpretation dieser Linie führte zu politischen Verwicklungen). Für die DDR, die nach Abschottung strebte, war die Wassergrenze eine Verlegenheit, denn im Fließenden kann man schlecht Zäune bauen, und die Elbgrenze war für sie wie eine Wunde, welche sich der Vernarbung sperrte, die man bei Landgrenzen erzwingen kann. Damals wurde die Elbe offensichtlich wieder, was sie viele Jahrhunderte lang eher verdeckt gewesen war: die Achse Europas.
Damals also war die Elbe ein Fluss durch drei Staaten und zwei Blöcke, wobei dem Westen allerdings nur das kleinste Stück zufiel; das letzte und entscheidende, die Mündung, mit dem großen Hafen Hamburg. Eine unglückliche Zertrennung: der DDR, die sich mit dem überwiegenden Teil ihres Territoriums im Elbraum befand, mit vielen und teils auch schiffbaren Nebenflüssen, wurde ihr natürlicher Ausgang ins Weltmeer vorenthalten; der Westen dagegen behielt nur den Ausgang, ohne dessen flussverknüpftes Hinterland, zu dem vor allem Berlin gehört. Gleich oberhalb von Hamburg fing Feindesland an. Das ist nun zum Glück vorbei. Und auch an der Grenze zwischen Tschechien und dem, was einmal die DDR war, will kein Grenzposten mehr irgendwelche Dokumente sehen. Die Elbe fließt wieder von Anfang bis Ende in einem Raum, in dem es für Reisende keine Kontrolle gibt. Die Elbe: eine europäische Erfolgsgeschichte, die alles andere als selbstverständlich war.
Und wo kommt ihr Name her? Flussnamen pflegen die langlebigsten von allen zu sein. Wenn neue Bevölkerungen auf der Bildfläche erscheinen, benennen sie die Orte um oder gründen und taufen sie ganz neu, auch Berge und Regionen wechseln oft die Bezeichnung; Flüsse so gut wie nie. Flüsse heißen von jeher so wie heute, kleinere Lautverschiebungen abgerechnet. Und zwar führen sie im Grunde den immerselben Namen: Fluss. Der Rhein ist verwandt mit rinnen und dem griechischen rhéo, was ebenfalls fließen heißt; dasselbe gilt für den italienischen Reno, den märkischen Rhin und die westeuropäische Rhône. Auch Donau, Don, Donez, Düna und wiederum Iser, Isar, Isère, je einer anderen Familie des Flüssigen angehörig, laufen darauf hinaus. Und die Elbe ist verwandt mit dem nordischen älv, was, kaum erstaunlich, Fluss bedeutet. Albis heißt der Strom schon beim römischen Historiker Tacitus, der ihn nach der Schlacht im Teutoburger Wald, die die Römer zum Rückzug auf die Rheingrenze zwang, nur noch von ferne kannte: Elbe, ein Name, den man früher häufig hörte und heute gar nicht mehr … So trauert ein Imperialist. Orte und Berge existieren in der Mehrzahl, sie müssen unterschieden werden. Von Flüssen, großen Flüssen wenigstens, gibt es im Gesichtskreis der namensstiftenden Gemeinden offenbar immer nur einen, und da langt es, wenn der Fluss Fluss heißt.
Grafen, die sich wie Könige fühlen
Dort, wo das Riesengebirge in die Ebene ausstreicht, liegt der Ort Kuks mit der gleichnamigen Schlossanlage. Die Elbe ist hier schon recht breit, aber nur noch halb so wild wie ein paar Kilometer flussaufwärts. Das Schloss selbst steht zwar nicht mehr, aber das bemerkt man kaum vor der Pracht der überlebenden Nebengebäude. Vor allem das Hospital, in beherrschender Lage am steilen Elbhang, wirkt ganz und gar palasthaft. Graf Franz Anton von Sporck errichtete auf seinem Landbesitz eine private Badeanstalt, denn die Quellen hier galten als heilkräftig. Im frühen 18. Jahrhundert war das noch etwas Neues. Nicht nur adlige Standesgenossen reisten zur Kur an, sondern auch begüterte Bürgerliche wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach, mit dem der Graf befreundet war und der mehrfach hier weilte.
Die Elbe teilt das Gelände säuberlich in zwei Areale. Das linke Ufer war, wie eine Tafel am Fluss berichtet, dasjenige des Todes, gewidmet Tanz, Gesang und Festivitäten, was doch eigentlich recht lebhaft anmutet; das rechte das des Lebens, bestimmt zu Buße und Gebet. Das hört sich schon fast an wie der Eiserne Vorhang zwischen West und Ost, der über der Elbe doch erst viel später niederging. Wenn man den ziemlich langen Aufstieg auf der rechten Seite hinter sich gebracht hat, steht man erneut an einem Scheideweg: Auf der einen Seite zieht sich eine allegorische Reihe der zwölf Tugenden hin, ausgeführt als virtuose Sandsteinplastiken, abschließend mit dem Engel des guten Todes, und auf der anderen spiegelbildlich die Reihe der zwölf Laster. Wer den Lasterweg einschlägt, den erwartet am Ende jener Genius, der den bösen Tod bedeutet. Die Zwölfzahl erstaunt, denn üblich sind bei Tugenden wie Lastern bloß sieben – was wohl hüben wie drüben die zusätzlichen fünf sein mögen? Auch bei näherer Betrachtung kommt man nicht dahinter, was welcher Figur entspricht. Nur bei einer – dickbäuchig, mit einem vollen Teller und von einem Schwein begleitet – sind wir ziemlich sicher, dass es sich um die Völlerei handelt. Wenn man dann die frei stehenden Skulpturen längs ihrer Rückseite abschreitet, scheinen alle moralischen Unterschiede ausgelöscht und ein Jenseits von Gut und Böse erreicht. Tugenden wie Laster schwingen ihre steinernen barocken Faltengewänder in den Himmel empor und gehen in den freien Zug der Wolken über. Nicht einmal ein sandsteinernes Skelett, das sich zu Füßen des bösen Todesengels windet, flößt Grauen oder Zerknirschung ein, sondern in der feinen Behandlung seiner Knöchelchen vielmehr Bewunderung für die Kunst des Steinmetzen Matthias Bernhard Braun, der jahrzehntelang in einer Art kultureller Symbiose mit dem Schlossherrn das umfangreiche Ensemble schuf. Mit den christlichen Werten und Unwerten war es den beiden jedenfalls kaum ernster als ihren zeitgenössischen Kollegen, die ihre Gärten mit antiken Göttern zierten und dabei doch gute Christen blieben, wenigstens soweit es sich um süddeutsche Prälaten handelte. Das Ganze ist eigentlich reichlich frivol.
So schien es jedenfalls bestimmt den Jesuiten, mit denen der Graf im Dauerclinch lag. Er gilt als Begründer der böhmischen Aufklärung, verlegte auf eigene Kosten fragwürdige Schriften, die er im grenznahen Zittau drucken und an der Zensur vorbei ins Land schmuggeln ließ, wurde vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt, seine Bibliothek, die dreißigtausend Bände umfasste, eingezogen. Da schaltete sich der Kaiser ein, als dessen Stellvertreter der Graf in Böhmen amtierte, und sorgte für die Freilassung des Delinquenten sowie die Rückgabe der Bücher. Auch die Geldbuße wurde von hundert- auf sechstausend Goldstücke ermäßigt. Weniger glimpflich erging es seiner Badeanstalt, woran aber nicht die Jesuiten schuld waren, sondern die Elbe: Ein verheerendes Hochwasser im Jahr 1733 vernichtete nicht nur das Schloss samt einem großen Teil der Kuranlage, sondern es blieben danach auch die Heilquellen unauffindbar, bis heute.
Ist man auf die Höhe des Hospitalbergs mit seinen guten und bösen Allegorien gestiegen, erstaunt man, wie weit sich der Komplex ausdehnt – bestimmt annähernd so weit wie die Parkanlage Nymphenburg in München. Man beginnt die nahezu königliche Macht zu ahnen, die der böhmische Adel besaß. Überall sonst in Europa hätte diese Pracht allein dem Souverän zugestanden, und ein Vasall, der sich so etwas herausnahm, wäre als verdächtiger Konkurrent, wenn nicht als Hochverräter behandelt worden. Die Habsburger hingegen konnten offenbar auf ihre selbstherrlichen Magnaten nicht verzichten und fanden es klüger, sie gewähren zu lassen. Ihr Reich war riesig, aber kein Staat im modernen Sinn, und um es zu regieren, benötigten sie die Unterstützung der Feudalherren. Wo sonst wäre es denkbar gewesen, dass ein bloßer Graf, und noch dazu einer, der den Zorn der Staatskirche erweckt hatte, ein Opernhaus mit stehendem Ensemble unterhielt? Nur in den Weiten Böhmens.
Kuks ist kein Einzelfall. An der oberen Elbe begegnen wir noch zwei weiteren Königsresidenzen, die sich bloße Grafen bauen ließen. In Pardubice befindet sich der Sitz der Grafen von Pernštejn, auf Deutsch Pernstein – bei diesen Herren blieb es immer etwas ungewiss, welcher Nationalität im modernen Sinn sie angehörten. Man weiß nicht recht, ob man den Kasten eine Burg oder ein Schloss nennen soll, denn er legt schon Wert auf eine gewisse Ästhetik, die sich an Vorbildern der italienischen Renaissance orientiert, lässt sich aber mit seinen Gräben und dicken Mauern notfalls bestimmt auch noch verteidigen. Der Innenhof mit seinen übereinandergetürmten Arkaden verrät den noch etwas plumpen Schönheitssinn. Auf den Wällen stehen spätmittelalterliche Kanonen mit mehreren Rohren, zur Zeit ihres Einsatzes die modernsten Europas.
Am erstaunlichsten von allen aber präsentiert sich Schloss Kačina, an dem man vorbeikommt, wenn man nach Kutná Hora will. Wir trauen unseren Augen nicht, als wir mit einem Mal an dieser nicht enden wollenden Fassade aus weißem klassizistischen Stein vorüberfahren. Wir halten an und steigen aus, um sicherzustellen, dass es diese Fata Morgana wirklich gibt. Und von so etwas hatten wir noch nicht einmal gehört? Ja, so war es: In den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatten sich hier die Grafen Chotek von Chotkow und Wognin eine Residenz erbaut, die hinter dem Lustschloss Gattschina der russischen Zaren nicht zurückstehen wollte (und ihr vielleicht auch den Namen verdankt). Zwei riesige Flügel in strengem griechischem Stil greifen in weitem Bogen nach vorn und schwingen sich dem Besucher entgegen. Bald eine halbe Stunde braucht man, um den Komplex zu umrunden. Das Weiße Haus in Washington, einer ähnlichen Ästhetik verpflichtet, scheint eine Hundehütte daneben. Der Tempelgiebel des Hauptgebäudes verherrlicht Ackerbau und Jagd, doch nicht ganz gleichberechtigt. Der Wagen der Diana fährt vorn vorbei und überschneidet den der Ceres dahinter, denn die Jagd oblag den Herren selbst, während für die Landwirtschaft ihre Bauern zuständig waren. Die lateinische Inschrift verkündet, dass Graf Chotek dieses Anwesen für sich, seine Freunde und die Nachwelt habe errichten lassen – sibi, amicis et posteris, eine lässig stolze Widmung, die das Private und das Repräsentative in einer einzigen, quasi göttlichen Geste zusammenfasst.
Eine Gräfin dieses Geschlechts wurde, viel später, zur Gemahlin des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und fiel gemeinsam mit ihm im Juni 1914 dem Attentat von Sarajewo zum Opfer. Sie war also gleichberechtigter Anlass des Weltkriegs. Aber die Habsburger wollten ihr als bloßer Gräfin nicht mal ein ebenbürtiges Begräbnis gönnen. Auch Kronprinz Rudolf, eine Generation zuvor, hatte sich eine Gräfin zur Geliebten erkoren, und, weil sie vom regierenden Haus nicht als standesgemäß akzeptiert wurde, mit ihr zusammen Selbstmord begangen. Den Habsburgern hat es kein Glück gebracht, wenn sie ihren Grafen und namentlich ihren Gräfinnen den Rang bestritten. Was für Gräfinnen, was für Grafen!
Mental Maps
Einquartiert haben wir uns in Hradec Králové, weil es ungefähr in der Mitte jenes Oberelbraums liegt, den wir uns für unsere erste Reise vorgenommen haben. In Hradec Králové nimmt die Elbe einen wichtigen Nebenfluss auf, die Orlice oder Adler. Nachdem die Elbe ihren Ursprung hinter sich gebracht und auf wenigen Dutzend Kilometern bereits tausend Meter ihres Gefälles seit ihrer Quelle in tausendvierhundert Meter Höhe eingebüßt hat, also mehr als zwei Drittel auf lediglich fünf Prozent ihrer Strecke, fließt sie nun als noch rascher, aber schon deutlich beruhigter Gebirgsfolgefluss (ähnlich der Isar in München) durch Böhmen, in einem weiten, fast halbkreisförmigen Bogen, erst nach Süden, dann nach Südwesten, dann nach Westen, um schließlich das Land in nordwestlicher Richtung zu verlassen. So verbleibt sie für rund 370 Kilometer in Tschechien, mehr als einem Drittel ihres Gesamtlaufs. Das wissen theoretisch selbst die Hamburger. Praktisch aber ist diese Gegend in Deutschland so gut wie unbekannt.
Nicht dass sie eigentlich abgelegen wäre. Von Chemnitz, wo ich wohne, ist sie noch nicht einmal dreihundert Kilometer oder drei Stunden mit dem Auto entfernt. Das ist so viel wie von Chemnitz nach Berlin – oder von Würzburg, wo ich herstamme, nach Chemnitz. Auch die Entfernung nach Chemnitz wird von Westdeutschen (die meistens selbst nach über dreißig Jahren darüber nicht viel mehr wissen, als dass es einmal Karl-Marx-Stadt hieß) gewöhnlich überschätzt. So nah sind Dinge, die wir nicht kennen? Das mag sich keiner eingestehen, und so entstehen die «Mental Maps», die Landkarten im Kopf, die von den gedruckten öfters erheblich abweichen. Erstbesucher aus dem Westen, die nach Chemnitz kommen wollen, bitte ich im Vorfeld gern um eine Vermutung, wie weit sie fahren müssen. Sie kämen regelmäßig in Polen heraus.
Auf den Mental Maps von Tschechien existiert eigentlich nur ein einziger Ort: Prag. Elf Millionen Besucher kamen vor der Pandemie jedes Jahr ins Land, und diese Zahl dürfte ungefähr wieder erreicht sein. Von diesen besuchen zwei Drittel ausschließlich die Hauptstadt, und der Großteil des Rests benutzt Prag als Sprungbrett in die Umgebung. Man sieht sich Karlstein an oder Kutná Hora, beide in einem Tagesausflug von der Hauptstadt zu erreichen, gewissermaßen im Sternschritt, wie ihn der Basketball erlaubt. Außerhalb dieses Umkreises kommen höchstens noch die nordwestböhmischen Bäder in Betracht, Karlsbad, Marienbad, Franzensbad (ihre tschechischen Namen mag sich das deutsche Publikum nicht merken). Auf den böhmischen Nordosten verfällt von sich aus kaum jemand – höchstens die von hier stammenden Vertriebenen, eine Generation, die inzwischen hochbetagt oder tot ist. Die Jüngeren haben meist nicht einmal die Namen dieser schönen deutschlandnahen und einst auch deutsch besiedelten Städte gehört.
Man muss das nicht bedauern. Es gibt viele solcher Regionen in Europa und sogar in Deutschland selbst, Regionen, von denen die Leute nicht einmal wissen, dass sie sie nicht kennen. Kommen sie doch mal an einen solchen Fleck, so zeigen sie sich beeindruckt und sprechen von einer Entdeckung, die sie dann auch gern in den Tönen des Entdeckerstolzes weiterempfehlen. Das scheint etwas übertrieben, denn diese Gegenden waren keineswegs durch riesige Distanzen oder schwer überwindliche Barrieren abgeschieden, sondern lagen einfach ein Stück ab von den Trampelpfaden, zu denen Touristen immer tendieren, auch wenn sie das Gegenteil versichern. Die Hotspots des Tourismus addieren sich wohl zu nicht mehr als ein paar Dutzend Fußballfeldern. Wer Bekannte in Mykene oder auf der Alhambra trifft, pflegt in den erstaunten Ruf auszubrechen: Nein, so was! Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Münchner einen anderen Münchner trifft, an diesen Orten größer als in einer Autowerkstatt des Münchner Stadtrands.
«Entdecken» muss man Hradec Králové also wie gesagt nicht. Ein Erlebnis bedeutet es trotzdem, und zwar vor allem das Erlebnis, dass ein so unbekannter Ort so nah und hindernislos zu erreichen ist. Nicht Kolumbus bietet sich hier zum Vergleich an, sondern das Ei des Kolumbus: Draufkommen muss man! So muss man auch auf Hradec Králové kommen, ähnlich wie aufs Périgord oder das thüringische Vogtland. Es ist eine schöne, ersichtlich wohlhabende Stadt. Und gar nicht so klein: Knapp unter hunderttausend Einwohner zählt sie, wie so viele Städte in Tschechien, die es anscheinend vorziehen, knapp unter der Großstadtmarke durchzuschlüpfen, damit sie sich ihres provinziellen Status nicht zu genieren brauchen. Ich habe oft gefunden, dass große Provinzstädte die angenehmsten sind, gerade weil sie nicht viel von sich hermachen. Es ist alles da und verpflichtet zu nichts. Man hat die Auswahl, die man in Kleinstädten entbehren muss, und zugleich die Muße und den Raum, die man in Großstädten nicht findet. So ist Hradec Králové – oder zumindest kommt uns die Stadt in den drei Tagen, die wir hier sind, so vor. Es ist bemerkenswert, was drei Tage an einem fremden Ort bedeuten können, wenn man sich wohlfühlt. Sie werden zu einer Epoche mit Anfang, Mitte und Ende. Und wenn man weiterreist, dann mit einer Empfindung des Abschieds.
Wir kommen an einem Freitagabend im Vorfrühling an, kurz ehe es Nacht wird – die beste Zeit für eine Erstbegegnung. Dann ist auf Erden schon alles dunkel, speziell die Silhouetten der Gebäude, der Türme und Kirchen, aber der Himmel besitzt noch die Qualität von lichtem Porzellan, in pastellenen Grün- und Blautönen. Allerdings hat ein Freitagabend seine Tücken, wenn man etwas essen oder trinken gehen will. Die zahlreichen Restaurants, Bars und Cafés sind voll bis auf den letzten Platz. Man bedauert sehr … Und es sind viele junge Leute unterwegs, die wir durch die Fenster sehen, wie sie in lachenden Runden sitzen und Wein trinken. Wo junge Leute, ein ganzer Laden voll, sich Wein leisten können, geht es wahrscheinlich vielen Menschen gut.
Wir kriegen dann doch noch einen Platz und etwas zu essen. Es schmeckt uns ausgezeichnet, mir vor allem eine kräftige dunkle Rinderbrühe, die ich so noch nie bekommen habe. Kulturen, die auf Suppen halten, schenkt man gern Vertrauen. In Tschechien ist noch keiner verhungert. Außer vielleicht, in diesem Erz- und Kernland des Fleischgenusses, einige Vegetarier – aber auch das beginnt sich in Hradec Králové gerade zu ändern. Am Nebentisch sitzt – wie soll man es nennen: ein Weiberabend? Ein Damenkränzchen? Vielleicht doch das Zweite. Kolleginnen sind es vermutlich, vielleicht Lehrerinnen, schick und animiert. Wir verstehen kein Wort von dem, was sie sagen, aber an ihrer heiteren Stimmung besteht kein Zweifel.
Pestsäulen
Wir lernen in den nächsten Tagen noch mehr nordostböhmische Städte kennen: Pardubice, Kolín, Kutná Hora, Jičín, alle an der Elbe gelegen, die hier Labe heißt, oder nicht weit von ihr. Einige tragen den Zusatz «n.L.» für nad Labem. Sie weisen, ohne dass es langweilig würde, alle den gleichen Grundplan auf. Den Kern bildet immer ein großer Platz, in einigen Fällen augenscheinlich zu groß für den Ort, dem er dient. Offenbar ging es im 13. oder 14. Jahrhundert, als die Städte gegründet wurden, immer mit diesem Platz los, der seine Abmessungen schon zu Beginn ein für alle Mal erhielt. Das ist ein koloniales Muster und erinnert daran, dass in dieser Gegend nicht so sehr etwas wuchs als vielmehr gewollt wurde. Ein Stück abseits hält sich die gotische Hauptkirche, zumeist mit zwei Türmen, von denen jeder noch vier Nebenspitzen aufweist, sodass der Eindruck dem einer komplexen Hieb- und Stichwaffe gleicht, einer surrealistischen Hellebarde, namentlich als abendlicher Schattenriss. Das Gegengewicht bildet ein säkularer Turm, mit Tor oder Rathaus verbunden, der eine Höhe von sechzig oder siebzig Metern erreichen kann.
Und nie fehlt in der Mitte des Platzes die Mariensäule, ein barockes Ensemble, das sich ansteigend aus Heiligenfiguren aufbaut, über denen hoch erhoben die Gottesmutter steht und ihren Segen spendet; das Ganze stets von bemerkenswerter künstlerischer Qualität. Das Barock war der letzte europäische Stil, dem Meisterwerke auch in der Provinz gelangen. Die Inschriften sind doppelt verschlüsselt: Zum einen sind sie lateinisch, was schon zur Entstehungszeit nur wenige verstanden haben dürften und heute wohl so gut wie niemand mehr; zum anderen enthalten sie codiert das Jahr der Entstehung in Form eines Chronostichons – einige der Buchstaben sind größer ausgeführt als die anderen, sie entsprechen den Zahlzeichen des römischen Systems, und zählt man alle diese markierten I, V, X, L, C, D und M zusammen, erhält man ein bestimmtes Jahr. Dies ist wichtig, denn es erinnert an eine Epidemie, nach deren Beendigung die Bürger der Madonna dankten. Darum heißen diese Mariensäulen auch Pestsäulen. Wie kann man einer Macht danken, die eine Pest beendet hat? Heißt das nicht, dass sie auch imstande gewesen wäre, deren Anfang zu verhindern? So fragt ein Heide oder Protestant. Für einen Katholiken aber sieht es so aus, dass Gott die Pest zur Strafe für die Sünden der Menschen schickt, seine Mutter jedoch, als sie die Gestraften leiden sieht, von Mitleid bewegt wird und ihren Sohn um Erbarmen anfleht. Maria spielt in diesen Stadtbildern ersichtlich eine wichtigere oder jedenfalls populärere Rolle als Gott.
Nein, so richtig populär ist Gott hier nicht. Die Tschechen sind neben den Ostdeutschen das unreligiöseste, jedenfalls das am meisten entkirchlichte Volk Europas. Religion, das heißt die katholische, war hier zumeist die Angelegenheit der deutschen Herren und wurde mit Zwang gegen die tschechischen Untertanen durchgesetzt. Zwei religiös motivierte Fensterstürze, bei denen Entsandte der Obrigkeit zu Schaden kamen, einer aus dem Rathaus der Prager Neustadt, der andere vom Hradschin herab, markieren die Zäsuren der tschechischen Geschichte. Zweimal entspannen sich daraus langwierige Kriege, der Hussitenkrieg und der Dreißigjährige. In Hradec Králové trägt der große weltliche Turm die Inschrift Deus providebit / Tamen vigilandum: Gott wird Vorsorge treffen, trotzdem heißt es wachsam sein. Hier herrscht nicht ganz das Vertrauen, das sich in den Mariensäulen ausspricht. Es klingt eher wie das Diktum des Aufklärers Lichtenberg: Die Tatsache, dass man in der Kirche zu Gott um gutes Wetter betet, macht es nicht überflüssig, dass man auf deren Dach einen Blitzableiter installiert.
Heile Orte
Die Städte Böhmens haben fast alle eine Eigenschaft, die in Mitteleuropa eine Rarität bedeutet: Sie sind unzerstört. Der Zweite Weltkrieg hat nahezu überall auf dem Gebiet des Deutschen Reichs, dem Herzen Mitteleuropas, zur völligen Zerstörung der Zentren geführt. Im Westen und in der Mitte geschah das durch Luftangriffe, vielfach noch ganz am Ende, als bisher verschonte Kleinodien wie Dresden und Würzburg Anfang 1945 in Trümmer sanken. In Tschechien aber fanden bis ganz zum Schluss keine Kampfhandlungen statt, auch nur wenige Bombenangriffe. Denn Böhmen und Mähren waren ja nicht Feindesland, sondern vom Feind besetzt.
Alles an diesen Städten ist gerettet. Den großen Platz von Hradec Králové umringen barocke und teils noch ältere Bauten, akzentuiert von ein paar modernen, aber gut eingepassten Konstruktionen aus der goldenen Zeit der jungen Republik. Und doch wirkt das Ganze nicht heil, oder doch nur in dem Sinn, wie Waren in einem Schaufenster heil sind: unberührt und mit angehaltenem Atem. Die Historie ist da; aber ohne ihre Spuren. Wenn man zum Beispiel den Hochrhein bereist und die deutschen und Schweizer Städte zu seinen beiden Seiten betrachtet, die teils sogar hüben und drüben denselben Namen tragen (Laufenburg, Rheinfelden): Dann merkt man an unscheinbaren, aber deutlichen Zeichen, wie die Kontinuität auf der Schweizer Seite, im Gegensatz zur deutschen, über Jahrhunderte durch keinen Bruch gestört worden ist und alles in ruhiger Alterung von jeher fortbesteht. Das ist in Hradice Králové nicht so. Hier ist das Alte neu, was bedeutet: Man sieht ihm an, dass es mehr oder weniger auf einen Streich renoviert worden ist. Jede Fassade verkündet die EU-Fördermittel.
So sah das vor vierzig Jahren bestimmt nicht aus. Zu Silvester 1980/81 war ich zum ersten Mal in Prag, in der langen bleiernen Zeit nach Prager Frühling und Einmarsch der Staaten des Warschauer Pakts, und erschrak über die Finsternis dieser Stadt, die doch damals schon ein Magnet für Touristen war. Alles war schwarz und dem Verfall preisgegeben. In den Hauseingängen standen Geldwechsler, die wispernd ihre illegalen Dienste anboten, und die Dunkelheit half ihnen dabei, uns zu betrügen: Sie zählten uns jeden Schein zweimal vor, sodass wir zum Schluss verblüfft nur die Hälfte der versprochenen Summe in den Händen hielten. Nicht die Stadt Kafkas war es, sondern, um einige Grade verschatteter, die des Golems, eines Nachmittelalters mit mangelhafter Straßenbeleuchtung, wo man nicht wissen konnte, was um die nächste Straßenecke lauert. Und das war die Hauptstadt – man stelle sich vor, wie es in der Provinz aussah. Das alles ist heute vergessen und glattgebügelt.
Noch einen Bruch gab es in dieser Gegend. Die meisten dieser Städte hatten bis zum Kriegsende einen großen deutschen Bevölkerungsanteil, vielfach war es die Mehrheit. Sie wurde von einem Tag auf den anderen vertrieben, in einem Tempo, das selbst der gewiss nicht zimperliche Stalin übertrieben fand. Zwanzig Minuten bekamen die Leute, um ihre Sachen zu packen, dann mussten sie weg. Diese beiden Brüche also – der Bevölkerungsaustausch von 1945 und die postsozialistische Runderneuerung nach 1989 – drücken sich im wunderbar konservierten Stadtbild von Hradec Králové gerade dadurch aus, dass sie sich verleugnen. Hier fehlt nichts: Das ist es, was fehlt. In Ordnung ist es so bestimmt trotzdem. Wie sonst hätte man es machen sollen? Stolpersteine für die Sudetendeutschen? Da käme man aus dem Stolpern nicht mehr heraus.
Wir gehen an der Elbe entlang. Sie ist hier schon ein recht stattliches und nicht mehr allzu rasantes Gewässer. Oberhalb davon, auf dem Hügel, liegt die Altstadt; auf der anderen Seite, zur Ebene hin, erstreckt sich das große Gebiet der Stadterweiterung vom 19. und frühen 20. Jahrhundert, als Hradec Králové zum Industriestandort wurde. Mehr als andernorts am Oberlauf gehört der Fluss zur Stadt selbst, die Häuser treten teilweise dicht an ihn heran, wenngleich man überall eine mehrere Meter hohe Kaimauer für nötig befunden hat. Am Elbufer zieht sich ein Park mit reichem Statuenschmuck entlang, aber auch ein großes Wasserkraftwerk, das, befände es sich beispielsweise in Berlin, unbestritten als ein Hauptwerk des funktionalen Jugendstils bekannt wäre. Hier steht es einfach so in der Gegend herum, und es bleibt dem Besucher überlassen, seine Schönheit ohne Anleitung durch einen Reiseführer auf eigene Faust zu würdigen. Ein zweiter Fluss, die Orlice, deutsch Adler, mündet mitten im Stadtgebiet ein. Wo sie zusammentreffen, fragt man sich wieder, warum von den zwei augenscheinlich etwa gleichrangigen Flüssen der eine in der Namensgebung die Oberhand behielt und der andere nicht. Direkt am Zusammenfluss steht ein Familienvater, der mit einem Stock versucht, einen Ball aus dem Wasser zu angeln. Seine Frau und der kleine Sohn verfolgen von einer Parkbank aus seine Bemühungen. Schließlich schafft er es und weist lachend seinen Fang vor. Dieser Ball hätte tausend Kilometer weiter die Nordsee erreichen können. Das wird nun nicht passieren.
Jugendstil und Waffenschau
Der Weltreisende und Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul empfiehlt: Nimm stets das beste Hotel am Platz und verliere kein Wort darüber. Sonst nämlich behelligst du den Leser bloß mit einer Liste deiner Beschwerden, statt ihm eine Vorstellung des Orts zu geben. Das ist ein sehr guter Rat. Aber wie könnte man ihn angesichts unseres Hotels befolgen, das so unverkennbar eine Geschichte erzählt? Okresní Dům heißt es, Kreishaus, hat also zur Zeit seiner Entstehung vor rund hundertzwanzig Jahren eine offizielle Funktion erfüllt.
Das Gebäude, im Geschmack des Jugendstils errichtet, muss völlig verwahrlost gewesen sein, als es ab 2006 wieder als Hotel hergerichtet wurde. Nicht alles ist originalgetreu, vieles von den fragilen Details scheint verloren gegangen, sodass man zur Nachschöpfung griff. Speziell beim Jugendstil gibt es wenig dagegen einzuwenden, stellt er doch seinerseits eine Strömung der Stimmung und Anverwandlung dar. Die Wendeltreppe, die zu uns in den dritten Stock emporführt, verdankt sich unverkennbar einer Neuerfindung: Aus Glas ist sie, und die Stufen von einem opaken Rosa, das durch eine leichte bräunliche Eintrübung die kleinmädchenhafte Unschuld, die man mit dieser Farbe verbindet, von sich weist und einen plüschig-sinistren Unterton annimmt. Ist das ironisch? Ist das mondän? Schwer zu sagen; aber jedenfalls ist es vollkommen originell. Diese Treppe könnte ihren Platz in einem Horrorfilm einnehmen, ähnlich der kilometerlangen Auslegware in Stanley Kubricks The Shining. Obwohl ich nicht schwindelfrei bin und es einen Aufzug gibt, lasse ich mir dieses gläserne Wunder nicht entgehen und sehe beim Abstieg mit leichtem Schauer gern in den rosig getönten Abgrund zu meinen Füßen. Auch der riesige Frühstückssaal ist wiederhergestellt. Eine Reihe von Fenstern, in einer Apsis umlaufend, zeigt den Flug von Kranichen in buntem Glas, hoch über einer frühlingshaften Landschaft, inmitten herrlich strahlender Wolken.
Schräg gegenüber vom Hotel befindet sich das Ostböhmische Museum, auch dieses in der Architektur des Jugendstils – soweit von einer solchen die Rede sein kann, denn eigentlich mag der Jugendstil das Bauen nicht. Steine, Ziegel und Wände sind ihm zu viereckig und die Herausforderungen der Schwerkraft zuwider. Wenn seine Musen das Wort «Statik» hören, kriegen sie Migräne. Die Villa Esche in Chemnitz etwa, entworfen von Henry van de Velde und Visitenkarte der Stadt, weist wunderbare Heizkörper in Gestalt goldener Harfen auf. Doch sie heizten nicht, und Frau Esche starb in Schönheit an einer Lungenentzündung. Das Ostböhmische Museum jedenfalls gibt sich Mühe. Vor ihm steht ein bronzener Brunnen, welcher auf vier goldenen Kugeln ruht, geformt wie jene, die der Prinzessin hineinfiel und die der Frosch ihr heraufholen musste: ein Märchenmotiv. An der Fassade beiderseits des Eingangs thronen zwei streng blickende, barbusige Göttinnen oder Allegorien mit Mauerkrone. Schweigend scheinen sie dem Eintretenden zuzurufen: Man lache nicht! Innen dann trifft man auf ganz andere Dinge, als man nach solchem Auftakt erwartet hätte.
Dieses Heimatmuseum bietet sich vor allem als eine Leistungsschau der tschechischen Rüstungsindustrie und des zugehörigen Militärs dar. Kleinteilig erstrecken sich die Exponate auf viele Räume. Ein wenig gerümpelhaft wirkt das alles und erfüllt vom Stolz auf einen technischen Stand, der merklich nicht der neueste ist. Patronengurte gibt es zu besichtigen und Modelle von Düsenjägern aus einer Zeit, als diese Technik noch jung war, dazwischen lebensgroße Puppen von Kampffliegern in ihren Cockpits und Lederkluften, gut konserviert, dabei etwas modrig, wie Moorleichen. Ein Offizier ist da, der galant mit Gattin und Kinderwagen spazieren geht, in der Hand ein obskures Objekt in den tschechischen Farben, halb Wimpel und halb Fliegenwedel. Ein anderer begrüßt vor einer Ladentür eine Dame mit Glockenhut und Stola, der Chic von 1930. Nicht eine Silbe der umfangreichen tschechischen Beschriftungen verstehen wir, sie sind ein Geheimnis, das die Tschechen untereinander haben; mit auswärtigem Besuch wird hier nicht gerechnet. So verwandelt sich uns alles in ein Bilderbuch, was gegenüber den Anforderungen, die Museen durch ihre belehrenden Tafeln sonst zu stellen pflegen, eine gewisse Entlastung bedeutet. Selten wandert man so leichten Fußes durch eine historische Ausstellung. Was wir aber auch so begreifen: dass es vor allem um die goldene Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik geht, 1918 bis 1938, ein Doppeljahrzehnt, auf dem indes von Anfang an ein Schatten lag. Das viele Militär, in Bildern und Dioramen, wirkt bei aller zur Schau gestellten Effizienz so fesch, ja fröhlich, dass man sich sagen muss: Es ist doch am Ende das Beste gewesen, dass es nie zum Einsatz kam. Als 1938/39 die Deutschen einmarschierten, entschied sich das Land, keinen bewaffneten Widerstand zu leisten. Kein Schuss fiel (wenigstens kein offizieller). Sonst wäre es den Tschechen, Militärs wie Zivilisten, wohl ergangen wie wenig später den Niederländern oder gar den Polen. So blieb die Besetzung Tschechiens das vergleichsweise mildeste Regime, das vom Dritten Reich im östlichen Teil Europas ausgeübt wurde – was Repressalien und Massaker wie die Auslöschung des Dorfes Lidice nach dem Attentat auf den böhmischen «Reichsprotektor» Reinhard Heydrich natürlich nicht ausschloss.