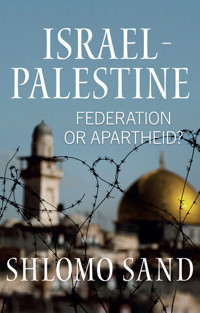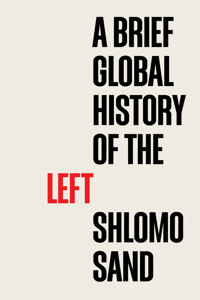11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gehört Israel den Juden? Was bedeutet überhaupt Israel? Wer hat dort gelebt, wer erhebt Ansprüche auf das Land, wie kam es zur Staatsgründung Israels? Shlomo Sand, einer der schärfsten Kritiker der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern, stellt den Gründungsmythos seines Landes radikal in Frage. Überzeugend weist er nach, dass entgegen der israelischen Unabhängigkeitserklärung und heutiger Regierungspropaganda die Juden nie danach gestrebt haben, in ihr "angestammtes Land" zurückzukehren, und dass auch heute ihre Mehrheit nicht in Israel lebt oder leben will. Es gibt kein "historisches Anrecht" der Juden auf das Land Israel, so Sand. Diese Idee sei ein Erbe des unseligen Nationalismus des 19. Jahrhunderts, begierig aufgegriffen von den Zionisten jener Zeit. In kolonialistischer Manier hätten sie die Juden zur Landnahme in Palästina und zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aufgerufen, die dann nach der Staatsgründung 1948 konsequent umgesetzt wurde. Nachdrücklich fordert Sand die israelische Gesellschaft auf, sich von den Mythen des Zionismus zu verabschieden und die historischen Tatsachen anzuerkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Matai ve’ekh humtzea Erez Israel? bei Kinneret Zmora-Bitan
Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHwww.propylaeen-verlag.de
ISBN 978-3-8437-0342-0
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
© Shlomo Sand 2012 © der deutschsprachigen Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Jan Martin Ogiermann Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin
Zur Erinnerung an die Bewohner von Al-Scheich Muwannis, die einst von dem Ort entwurzelt wurden, an dem ich heute lebe und arbeite.
Dank
Ich möchte aus tiefstem Herzen allen Freunden und Bekannten danken, die, auf die eine oder andere Weise, geholfen haben, diese Studie zu vollenden: Alexander Eterman, Dr. Eran Elhaik, Dr. Yehonatan Alsheh, Dr. Nitza Erel, Michel Bilis, Yoseph Barnea, Noa Greenberg, Prof. Israel Gershoni, Dr. Yael Dagan, Richard Desserame, Asaad Zoabi, Yuval Laor, Dr. Gerardo Leibner, Mahmoud Mosa, Ran Menahemi, Linda Nezri, Stavit Sinai, Anna Sergeyenkova, Bianka Speidi, Boas Evron, Prof. Christophe Prochasson und Dr. Nia Perivolaropoulou.
Meiner Frau Varda und meinen beiden Töchtern Edith und Liel schulde ich mehr, als ich mit Worten auszudrücken vermag.
Prof. Jean Boutier, Dr. Yves Doazan und Dr. Arundhati Virmani, alle drei von der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E. H. E. S. S.) in Marseille, bin ich zutiefst dankbar für ihre Gastfreundschaft und die überwältigende Herzlichkeit, die sie mir gegenüber an den Tag gelegt haben.
Ebenso bin ich Markus Lemke, der dieses Buch ins Deutsche übertragen hat, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Propyläen sowie insbesondere Jan Martin Ogiermann unendlich dankbar, die sich mit großer Gründlichkeit dieses Textes angenommen und nach Kräften versucht haben, Fehler auszumerzen, Fältchen zu glätten und alles dafür zu tun, um am Ende ein gut lesbares, schlüssiges Buch vorzulegen.
Auch möchte ich sowohl all denen meiner Studenten danken, die immer wieder aufs Neue meine historische Phantasie herausgefordert haben, als auch jenen, die gezwungen waren, geduldig meinen Ergüssen zu lauschen, und es kaum erwarten konnten, ich möge endlich den Mund halten.
All jenen, die Kritik an meinem letzten Buch geübt und es verrissen haben und mich im Gegenzug gereizt, geleitet und befruchtet haben, die vorliegende Studie zu verfassen, schulde ich mehr, als sie sich vorstellen können oder mögen. Der zentrale Vorwurf aller Kritikaster lautete, dass alles, was ich vorgelegt habe, zum einen hinlänglich bekannt und längst von ihnen selbst dargestellt worden sei, und zum andern schlicht falsch und unzutreffend. Ich muss gestehen, dass dies zumindest der halben Wahrheit entspricht: Alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt war, um hernach verdrängt, marginalisiert oder unter den Teppich gekehrt zu werden, ist in dem von mir rekonstruierten kritischen Narrativ von zentraler Bedeutung und damit zwangsläufig politisch inkorrekt und historisch anstößig geworden. Es bleibt mir nur zu hoffen, dass diese Arbeit – und wenn auch nicht im selben Umfang – das Gleiche zu leisten vermag.
Sämtliche Irrtümer, Fehler, Ungenauigkeiten, unnötigen Überspitzungen und extremen Ansichten habe allein ich zuwege gebracht, so dass ausschließlich ich für diese verantwortlich zu machen bin. Alle zuvor genannten Personen trifft nicht die geringste Schuld daran.
Tel Aviv – Marseille – Tel Aviv, 2012
Einleitung: Ein gewöhnlicher Mord, die Sehnsucht nach Erlösung und der Name eines Landes
Der Zionismus und sein Kind, der israelische Staat, die im Zuge einer militärischen Eroberung, als Verwirklichung eines territorialen Messianismus, zur Klagemauer gelangt sind, werden diese Mauer oder die eroberten Teile des Landes Israel niemals mehr aufgeben können, ohne den Kern ihrer historiographischen Auffassung vom Judentum aufzugeben… Der säkulare Messias kann sich nicht zurückziehen. Er kann nur sterben.
Baruch Kurzweil, 1970
Es ist völlig unlogisch, die jüdischen Bindungen an Israel, das Land der Vorväter… mit dem Wunsch gleichzusetzen, alle Juden in einem modernen Territorialstaat zu vereinen, der im geschichtlichen Heiligen Land liegt.
Eric J. Hobsbawm, Nationen und Nationalismus
Die Erinnerungsfetzen, die wie geheimnisvolle Vögel über meinem hier vorgelegten Werk kreisen, hängen mit meinem Leben als junger Mann und dem ersten von den Kriegen Israels zusammen, an dem ich teilgenommen habe. Mir ist wichtig, sie diesem Buch voranzustellen, um der Offenheit und Aufrichtigkeit willen den emotionalen Hintergrund meines intellektuellen Verhältnisses zu all den Mythen um nationalen Boden, Gräber der Ahnen und große behauene Steine freizulegen.
1. Erinnerungen aus dem Land der Väter
Am 5. Juni 1967 überschritt ich auf dem Radarhügel (Dschebel ar-Radar) in den Jerusalemer Bergen die israelisch-jordanische Grenze. Ich war damals ein junger Soldat und, wie viele andere, einberufen worden, mein Land zu verteidigen. Der Abend senkte sich bereits herab, schweigend und zögernd schritten wir über den zerschnittenen Stacheldraht. Diejenigen, die vor uns gingen, wurden von Minen in Stücke gerissen, ihr Fleisch wurde nach allen Seiten verstreut. Ich zitterte vor Angst, ich klapperte wie wild mit den Zähnen, und kalter Schweiß ließ mein Armeehemd am Körper kleben. Doch in meinem verstörten, überreizten Kopf konnte ich, während mein Körper sich vorwärts bewegte wie eine mechanische Puppe, nicht aufhören, daran zu denken, dass ich gerade zum ersten Mal ins Ausland kam. Ich war zwar mit zwei Jahren nach Israel gekommen, doch da ich in einem Armenviertel von Jaffa aufgewachsen war und von Jugend an hatte arbeiten müssen, waren alle Träume, das Land einmal zu verlassen und die Welt zu bereisen, Träume geblieben.
Sehr schnell musste ich erkennen, dass meine erste »Auslandsreise« kein abenteuerlicher Vergnügungstrip werden würde, denn meine Kameraden und ich wurden sogleich in die Kämpfe um Jerusalem geschickt. Meine Enttäuschung wuchs noch, als mir klarwurde, dass unser Grenzübertritt von den anderen nicht als Schritt ins Ausland angesehen wurde. Nicht wenige der Soldaten um mich herum betrachteten sich selbst schlicht als Heimkehrer, die die Grenzen des israelischen Staates überquerten, um nach »Erez Israel« zu gelangen, ins Land Israel. Schließlich war unser Stammvater Abraham zwischen Hebron und Betlehem umhergezogen und nicht zwischen Tel Aviv und Netanja. Und König David hatte jenes Jerusalem erobert und besungen, das östlich der Waffenstillstandslinie lag, nicht aber die moderne, pulsierende israelische Metropole im Westen. »Wieso Ausland? Das ist doch das wahre Land deiner Väter«, bekam ich schon damals von den Soldaten zu hören, die an meiner Seite in den schweren Kämpfen um das arabische Viertel Abu Tor in Jerusalem vorrückten.
Meine Kameraden glaubten, sie beträten einen Ort, der immer schon der ihre gewesen war. Ich hingegen hatte das Gefühl, einen Ort verlassen zu haben, der der meine war, weil ich dort fast mein ganzes Leben verbracht hatte, und ich fürchtete, nie wieder dorthin zurückzukehren, da ich die Kämpfe vielleicht nicht überleben würde. Doch das Glück war mir wohlgesinnt, und mit einiger Mühe blieb ich am Leben. Doch meine Sorge, nie mehr an den Ort zurückzukehren, den ich verlassen hatte, sollte sich letztendlich auf eine Art und Weise bewahrheiten, die ich mir damals noch nicht vorstellen konnte.
Am Tag nach den Kämpfen um Abu Tor führte man uns, die wir nicht verwundet worden waren, in die Altstadt, um die Klagemauer zu sehen. Mit entsicherter Waffe marschierten wir angespannt durch die schweigenden Straßen. Ab und an sahen wir verängstigte Gesichter aus den Fenstern lugen. Wenig später erreichten wir eine relativ schmale Gasse, an der sich eine hohe Mauer aus behauenen Steinquadern erhob. Damals waren die Häuser des alten Mughrabi-Viertels noch nicht abgerissen worden, um Raum für den riesigen Vorplatz zu schaffen, der alle Besucher der »Disco-Mauer« oder der »Diskothek von Gottes Gegenwart«, wie Jeshajahu Leibowitz diesen sonderbaren Ort zu bezeichnen pflegte, aufnehmen kann. Wir waren vollkommen erschöpft, unsere verdreckten Uniformen starrten vom Blut der Verwundeten und Toten. Mehr als alles andere beschäftigte uns, einen Ort zum Urinieren zu finden, da wir weder in einem geöffneten Café noch in den Häusern der unter Schock stehenden Anwohner Rast machen konnten. Aus Achtung vor den Religiösen unter uns pinkelten wir an die Wände der Häuser auf der anderen Seite der Gasse und vermieden so die »Entweihung« der äußeren Stützmauer des Plateaus, auf dem der »Bösewicht« Herodes und seine mit Rom treu verbündeten Nachfahren den Tempel errichtet hatten, um ihre despotische Herrschaft mittels gewaltiger Steinquader zu verherrlichen.
Tatsächlich flößte mir die schiere Größe der behauenen Felsblöcke Ehrfurcht ein. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr klein und schwach bei ihrem Anblick gefühlt habe, offenbar auch wegen der Enge der Gasse, die ihre Größe noch unterstrich, und auch aus Angst vor den arabischen Anwohnern, die noch nicht ahnten, dass sie schon sehr bald aus ihrem Viertel vertrieben werden würden. Zu jenem Zeitpunkt wusste ich nicht viel über König Herodes und die Klagemauer. Ich hatte sie bislang bloß auf alten Postkarten gesehen, die in unseren Schulbüchern reproduziert waren, und kannte niemanden, der das Bestreben gehabt hätte, zu ihr zu gelangen. Auch wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen, dass diese Mauer niemals Teil des Tempels gewesen war und die meiste Zeit nach dessen Zerstörung im Gegensatz zum Tempelberg etwa, dessen Betreten strenggläubigen Juden wegen der Unreinheit der Toten untersagt ist nicht als heilige Stätte gegolten hatte. Aber all jene säkularen Kulturschaffenden und Erinnerungspolitiker, die sich schon bald daranmachten, mit Hilfe triumphaler Erinnerungsalben eine neue Tradition zu erschaffen und zu überhöhen, kannten kein Zaudern bei ihrem nationalen Sturmangriff auf die Geschichte. Bewusst wählten sie die inszenierte Aufnahme dreier Soldaten der »Aschkenase« in der Mitte hat seinen Helm abgenommen und steht barhäuptig, als betete er in einer Kirche, deren Augen von der zweitausendjährigen Sehnsucht nach der geheiligten Mauer erfüllt sind und deren Herzen angesichts der »Befreiung« des Lands der Väter übergehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!