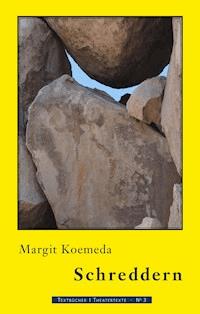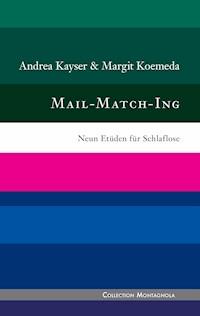Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Spuren hinterlassen oder nicht? Was soll bleiben von einem Menschenleben? Es gibt Geschichten, die variantenreich - gerne - erzählt werden. Über andere schweigt man sich aus. Lädt einer Schuld auf sich, der siebzehnjährig im Januar 1940 einem Gestellungsbefehl Folge leistet? Haben die Zusammenstöße zwischen einer heranwachsenden Tochter und ihrer Mutter mit solchen Vorgeschichten zu tun? Was wissen wir wirklich über das Leben unserer Eltern, von denen wir glaubten, dass sie uns die Nächsten sind? Der Autorin ist ein sensibel erzähltes Erhellungsbuch über das Leben ihrer Eltern gelungen. Eine Würdigung. Ein Denkmal aus Sprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARGIT KOEMEDA wurde als Österreicherin in Nürnberg geboren und ist dort aufgewachsen. Ein Jahr lang lebte sie in den USA. Seit vielen Jahren wohnt und arbeitet sie in der Schweiz – am Bodensee.
Sie ist Psychotherapeutin, als Ausbildnerin und berufspolitisch tätig. Verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.
Margit Koemeda hat drei Romane, zwei Erzählbände, Theatertexte, außerdem mehrere psychologisch-psychotherapeutische Fachbeiträge und Bücher publiziert.
Inhaltsverzeichnis
VATER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
MUTTER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
VATER
»Denn das Gedächtnis ist unausgesetzt dabei, das eine auszusondern, anderes an dessen Stelle zu rücken oder durch neue Einsichten zu über lagern.«
(Joachim Fest, Ich nicht, 2006)
1
Ich sah einen silbrig-grauen, in der Abendsonne glänzenden Wagen über die sandige Kante rollen. Für einen Augenblick hielt ich den Atem an. Ich befürchtete seinen Absturz. Das Gefälle vom Gipfelgrat herunter war mehr als steil. Der Berg bestand aus einer Mischung von Lavageröll und Sand.
Zu meiner großen Überraschung behielt der Wagen Bodenhaftung und bewegte sich langsam in unser Tal. Er kam auf uns zu, hielt kurz auf unserer Höhe an und fuhr weiter in die unter uns liegende Mulde, in die zu dieser Tageszeit kein Sonnenlicht mehr fiel. Dort fuhr er mehrmals im Kreis, scherte dann wieder aus und klomm Meter um Meter langsam und sicher zurück in die Höhe, zu uns, an uns vorbei. Nach weiteren Minuten, während derer wir in gebanntem Schweigen verharrten, verschwand er über dem scharfen Grat im Sonnenlicht.
Am Steuer saß mein Vater. Er hatte kein Wort mit uns gewechselt. Es gab keine Berührung, nicht einmal Augenkontakt.
Noch im Halbschlaf wurde mir bewusst, dass er tot war, dass meine Angst, er könnte abstürzen, grundlos gewesen war.
Wir setzten unsere Wanderung über die trockenen, aschgrauen, schwarz-sandigen Hänge fort und kamen an eine Gabelung, von wo aus ein Weg zum Talgrund und ein anderer über die Seitenflanke des Berges in unbekannte Gegenden führte. An den platt gewalzten und ausgeblichenen Gräsern sah man, dass diese Hänge im Winter als Skipisten genutzt wurden.
Ich war unschlüssig, welchen Weg ich wählen sollte. Ich hatte kein klares Ziel vor Augen. Und erwachte.
2
Wie rechtfertige ich, dass ich von Vater erzählen möchte, obwohl es wenig Spektakuläres zu berichten gibt? Zwar gab es Turbulenzen und bemerkenswerte Ereignisse in seinem Umfeld, trotzdem zog Vaters Leben scheinbar ohne große Hindernisse seine Bahn über unseren Planeten. Ein Leben, das sich nur marginal verwickelte. Es gehörte einem Menschen, dessen Verschwinden eine über Jahre hinweg wahrnehmbare Lücke hinterließ. Und vielleicht ist das das Erstaunliche.
Vor über fünf Jahren traf ich Freunde in Norditalien, die sich wie ich zu einer Rückschau entschlossen hatten. Wir saßen auf einem engen, überdachten, seitlich von zwei Wänden und im Rücken von einer Fensterfront eingefassten Balkon. In unseren Frisuren kämpfte Grau mit Blond oder Brünett, an unseren Händen traten Adern hervor. Unsere Hände waren breit geworden und mit dunklen Flecken besprenkelt. Die Fingerpalmenblätter auf dem Nachbargrundstück flirrten im Wind. Die Berge am Horizont versteckten sich an diesem Nachmittag hinter dunklen Wolken. Wer den Kopf hob, sah Grau. Es regnete in Strömen.
Auf dem Tisch lagen vier weiße Blätter, darauf waren waagrechte Linien zu sehen, Kreise und Vierecke, kürzere senkrechte Striche, die wieder zu Kreisen und Vierecken führten, einige davon rot schraffiert. Wir hatten vereinbart, jene Menschen rot zu schraffieren, die Fragezeichen oder etwas Unerlöstes hinterlassen hatten.
Wir hatten unsere Stammbäume gezeichnet. Einen Onkel viereckig, eine Großmutter rund, einen früh verstorbenen Zwillingsbruder, eine Fehlgeburt. Wir erzählten Geschichten, die wir in unseren Herkunftsfamilien gehört hatten, die dort ausgeschmückt und über Generationen weitergegeben worden waren. Armut und Leid, Anstrengungen, Erfolge. Mut und große Angst.
Am nächsten Morgen gingen wir auf den Friedhof unseres Ferienortes. Wir wollten wissen, wie die Menschen hier ihrer Toten gedachten. Auf vielen Grabsteinen waren Fotos angebracht, verblichene und noch farbintensive. Einer der Abgelichteten hatte die Augen geschlossen, eine andere schaute aus großen, wachen Augen durch dicke Brillengläser den Betrachter an, als frage sie: Was willst du von mir? Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte, habe getan, was zu tun war. Was kann man noch von mir wollen?
Gegenüber vom Eingang befanden sich ein paar Urnengräber. Auf einem katholischen Friedhof? Allen Namen dort war ein Sterbedatum aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 zugeordnet. Für Corona-Tote hatte es keine Wahl gegeben. Sie waren kremiert worden.
Mein Vater lebte seit fünf Jahren nicht mehr. 1922 geboren, würde er im Juli des folgenden Jahres seinen hundertsten Geburtstag feiern. Ich hatte sein Kästchen rot schraffiert. Weil er mir fehlte seit seinem Tod.
Ein unfertiges Bündel Mensch wird von einem Mann und einer Frau, die ein Paar sind, in eine aus Bast geflochtene Tasche gelegt und aus dem Krankenhaus nach Hause getragen. Sie betrachten es fortan als ihr Kind.
Und das Bündel, weil es nichts anderes kennt, lernt Papa und Mama zu den beiden zu sagen, weil sie es füttern und wärmen und wickeln und kleiden.
Eltern werden zu einem Grundgefühl, zu einem tragfähigen, wenn sie berechenbar sind, wenn sie auf die Signale und Äußerungen, die das Bündel aussendet, antworten, wenn sie sanft sind mit ihren Berührungen, wenn sie ihm helfen, seine Bewegungen abzustimmen und weiterzuführen.
Es hebt den Kopf, eine Hand schiebt sich darunter, eine andere greift unter den Rücken und hebt das Baby aus seinem Bettchen. Finger bieten sich zum Umklammern an. Ein Gesicht darf betastet werden, wenn Eltern freundlich sind.
Vater war berechenbar und zuverlässig. Er fand sich zurecht in der Welt, in der wir lebten. Er blieb ruhig, wenn Dinge außer Kontrolle zu geraten drohten. Wenn er sprach, hörte man ihm zu. Seine Rede war in aller Regel klar.
Wenn mir kalt war als kleines Kind, durfte ich zwischen seine warmen Oberschenkel und auf seinen Bauch kriechen. Dort blieb ich so lange, bis ich aufgewärmt war.
Sie könne sich an nichts dergleichen erinnern, hält meine Schwester dagegen.
Papa stand, wenn wir krank waren, nachts auf, um meiner Schwester oder mir Tee zu kochen, um Mama zu entlasten. Er konnte zuhören. Und wenn ich Fragen hatte, half er mir, Lösungen und Antworten zu finden.
3
Neben Mutters Bett im Pflegeheim hing ein Portrait von Vater. Mein Schwager hatte fotografiert und in der linken unteren Bildecke ein schwarzes Band zum Zeichen der Trauer angebracht. Vaters Tod hatte einen Krater in Mutters Leben gerissen.
Beide Eltern stammten aus Graz in Österreich. Der berufliche Weg des Vaters führte das frisch vermählte Paar Anfang der fünfziger Jahre in die Bundesrepublik Deutschland. Vater hatte in Graz Elektrotechnik studiert und sich als Diplom-Ingenieur auf ein Stellenangebot des Nürnberger Maschinen- und Apparatewerks (NMA) der Siemens-Schuckert AG beworben.
Man hatte großdeutsch gedacht in seiner Familie. Österreich erschien ihm rückständig und nach seiner Schrumpfung infolge des Ersten Weltkrieges unbedeutend. Er bewunderte die deutsche Klarheit, Zielstrebigkeit und Effizienz.
Bei der Wohnungssuche, berichtet unsere Mutter, seien sie noch über die Trümmer der im Krieg zerbombten Häuser gestiegen. Immer noch fehlten Straßenbezeichnungen. Anders als in Österreich standen sie hier nicht auf jedem Hausnummernschild, sondern nur an Straßenkreuzungen. Viele waren im Krieg verschwunden.
Ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit in der Umgebung unserer Neubausiedlung immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden, die entschärft werden mussten. Wir Anwohner wurden aufgefordert, unsere Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten. Abgesehen davon wusste ich als nachgeborenes Kind wenig vom Krieg.
Vater redete so gut wie nicht von dieser Vergangenheit. Nur unsere Mutter (Jahrgang 1927) erzählte manchmal von ihrer Flucht aus Graz vor den Russen – zusammen mit ihrer Cousine – auf Fahrrädern in Richtung Erzgebirge zu ihren mütterlichen Verwandten – dumm aus heutiger Sicht. Damals folgten sie wohl ihrem Instinkt – zurück zu den Wurzeln. Mehrmals mussten sie von ihren Rädern springen und sich vor Tieffliegern in Straßengräben verstecken. Den Russen begegneten sie im Erzgebirge auch, dort erst recht.
Mutter erzählte von Ernteeinsätzen während des Krieges mit äußerst mangelhaftem Schuhwerk, von Hunger und Luftschutzkellern und von der Kunst ihrer Mutter, immer irgendwo doch noch etwas zu essen aufzutreiben. Vom Verschwinden einer jüdischen Mitschülerin aus ihrer Klasse, ganz zu Beginn der vierziger Jahre. Niemand habe darüber geredet. Auch sie selbst habe sich damals keine Gedanken über dieses Verschwinden gemacht.
Als die Russen gegen Kriegsende nach Graz kamen, hätten sie den Einheimischen Taschen- und Armbanduhren abgenommen. Sie hätten Betten aufgeschlitzt und die Federn aus den Fenstern geschüttelt, wie kleine Kinder in Bücher gekritzelt, Notenhefte von Pulten und Klavieren gerissen, hätten diese zerfetzt und die Papierschnitzel auf die Straßen schneien lassen. Vom Bombenalarm erzählte Mutter manchmal und wie alle Hausbewohner in den Luftschutzkeller gerannt seien.
Vater erzählte selten vom Krieg. Wir wussten nur, dass er in Frankreich, in Russland und später in Italien gewesen war und dass man ihm, obwohl er noch blutjung war, früh und überall rasch Verantwortung übertragen hatte. Irgendwann einmal hörte ich ihn die bittere Kälte in Russland erwähnen, sprach er von den im Winter gefrorenen Exkrementen an Wegrändern und hinter den Häusern. Und dass er sich gefragt habe, wie das im Frühling und Sommer auszuhalten sein würde. Bizarre Bilder und Vorstellungen. Bei meiner Schwester und mir kam an, dass wir froh und dankbar sein mussten, weil wir in einem zivilisierten Land lebten. Vater erzählte von beschlagnahmten Pferden und wie er einmal einen Spähtrupp zu befehligen hatte, bei dem fast lautlos der Mann links und der rechts von ihm von Kugeln getroffen wurden und zu Boden fielen.
Mehr erzählte er nicht, vielleicht weil wir Kinder kaum reagierten. Weil wir es uns wahrscheinlich nicht vorstellen konnten. Oder weil wir erstarrt waren bei seiner Erzählung, weil er vermutlich selbst immer noch unter Schock stand und nicht mehr berichten konnte als die nüchternen Fakten. Links und rechts je einer. Drei minus zwei gleich eins. Er.
Meine Schwester erinnert sich daran, bei Vater, ohne genau zu wissen wodurch, immer wieder auf emotionale Tretminen gestiegen zu sein, dass sie ihn zur Weißglut oder zum Explodieren bringen konnte. Auch erinnert sie sich, dass er uns Kindern verboten hatte, seine linke Schreibtischschublade zu öffnen. Meine Schwester wäre sehr neugierig gewesen, aber wir hielten uns an Vaters Verbot. Sie habe eine Pistole oder eine Liebesgeschichte darin vermutet. Bei der Räumung des Elternhauses fanden wir jedoch nichts dergleichen.
Als unsere Eltern im Jahr 2016 eiserne Hochzeit feierten, kam ein Journalist zu ihnen in die Einfamilienhaussiedlung in einem Vorort von Nürnberg. Vater war es wichtig, dass in seiner Biografie die Kriegsteilnahme erwähnt würde, sechs seiner »besten Jugendjahre« lang.
Da wurde ich aufmerksam. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben.
Unglaublich. Während ich mich zwischen meinem achtzehnten und dreiundzwanzigsten Lebensjahr meinem Studium, meiner Berufswahl und sozialen Erfahrungen widmen konnte, war er in diesem Alter im Krieg gewesen. Welterfahrungen auch, soziale Lektionen sicher, aber immer in der Gefahr, Leib und Leben zu verlieren. Bedrohung, Angst, Überlebenskampf.
Meine Schwester und ich hatten Vater schon in den Jahren zuvor gebeten, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Was er tatsächlich tat. Nur kam es nie zu einem Gespräch darüber. Es ergab sich nicht. Wir fanden keine Zeit. Vielleicht war es die unerlöste Gefühlswelt, die ich hinter diesem Abschnitt im Leben meines Vaters ahnte, der ich mich nicht gewachsen fühlte und der ich mich nicht aussetzen wollte.
Mit einem zeitlichen Abstand von dreißig Jahren nehme ich mir nun seinen Lebensbericht vor und lese über Ereignisse, die mehr als achtzig Jahre zurückliegen. Es beginnt in Graz in einer Wohnung im vierten Stock, Technikerstraße 13 – im großen Zimmer (Sparbersbachstraßenseite)
An meinem Schreibtisch stehend hörte ich am Morgen des 1. September 1939 die Nachricht vom Beginn des Krieges gegen Polen. Obwohl durch die Propaganda alles vorbereitet war, fühlte ich tief die Bedeutung der Stunde. Die Geschichte vom Angriff Polens auf den Sender Gleiwitz kam mir äußerst merkwürdig vor, aber die geschickte Abfassung der weiteren Nachrichten ließ dies bald vergessen.
Erwartungsgemäß erklärten Frankreich am 3.1. um 11:00 Uhr und Großbritannien um 17:00 Uhr an Deutschland den Krieg.
Die Erfolge der Deutschen Wehrmacht in Polen hörten wir zwar nicht ungern, aber in der Erinnerung kommt mir diese Zeit vor wie durch eine Lähmung verdunkelt.
»… fühlte ich tief die Bedeutung der Stunde.« Hier würde, glaube ich, jeder heutige Lektor den Rotstift ansetzen. Das kann man so nicht schreiben. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf?, würde er den Autor vielleicht fragen. Was genau fühltest du? Beschreibe deine Körperempfindungen. Versuche, dich exakt zu erinnern und dich wieder hinein zu versetzen in diesen Zustand damals.
Aber das geht ja nun nicht mehr. Wir müssen diese wenig aufschlussreiche, dafür schwülstige – vor über achtzig Jahren vielleicht passende – Redewendung leider stehen lassen.
Ich begann damit, auf Google Maps die Orte zu suchen, die mein Vater in seinen Aufzeichnungen namentlich erwähnt: Graz, Obertraubling, Bechhofen, Crailsheim, Kremsmautern, Göttweig, Berlin, Mourmélon, Médréac, Berlin, Alexandrowo, Halle, Großborn, Antwerpen, Smolensk. Manche Orte sind hunderte von Kilometern, andere mindestens zwei Tagesreisen voneinander entfernt, zum Beispiel mit dem Pkw nach Bolschoj und Maly Bakajevo. Ich finde Bakajevo in der Ukraine, jenseits des Dnepr, der ins Schwarze Meer fließt, unweit des Kremtschiku-Stausees, es gibt keine Satellitenbilder, Welisch, Wien, Warschau, Bialystok, Smolensk, Wizebsk, Rudnja, Demidovo, Iwanowo. Von Bakajewo nach Smolensk sind es 831 Kilometer, mit dem Auto 10.5 Stunden; es wird auf unbefestigte Straßen und – heutzutage – auf einen Grenzübertritt hingewiesen.
Ein rotes Stecknadelsymbol zeigt auf den eingegebenen Ort. Ich tippe »minus«, »minus«, »minus«, um ihn im größeren Kontext zu sehen. Wie weit von Graz, wie weit von Wien, Paris, Moskau?
Ein Siebzehnjähriger, den seine Mutter zum Zug begleitet. Dort trennen sie sich. Mehr schreibt er nicht. Erwähnt nur noch, dass zum Glück ein guter Freund mit ihm eingerückt sei. Der Siebzehnjährige wird davon ausgegangen sein, dass er gesund zurückkehren werde. Und seine Mutter? Welche Gedanken sind ihr wohl durch den Kopf gegangen? Was wird sie empfunden haben in diesen letzten Augenblicken vor dem Abschied?
Aufbruch ins Leben. In die Welt. Der Junge folgt fremden Befehlen, zuerst hier- dann dahin. Und er fragt wahrscheinlich nicht, welcher Plan dahintersteckt. Beim Lesen der verschiedenen Ortsnamen und der Verschickung der Soldaten in immer andere Himmelsrichtungen wird mir schwindlig. Hat man absichtlich versucht, diesen jungen Männern die Orientierung zu vernebeln?
Die weiten Entfernungen, das Hin und Her, schon nach kurzer Zeit wieder neue Menschen, andere Unterbringungen, Gepflogenheiten, Tätigkeiten, Aufgaben, mit der Zeit fremde Sprachen, Französisch, Russisch, später Italienisch. Es gab Vieles zu lernen – militärisch, bautechnisch, geografisch, sozial. Vater war interessiert und lernbegierig.
Nach Wochen und Monaten der Ausbildung wird er nicht, wie er es sich gewünscht hatte, der Luftwaffe zugeteilt und in Funktechnik ausgebildet. Er wird an die Infanterie überstellt und nach Russland beordert.
Bolschoj Bakajewo – rundherum ist alles hellgelb auf dem Bildschirm, in einiger Entfernung schimmern weitere Ortsnamen auf. Keinen habe ich je zuvor gehört. Der nächste mir bekannte Städtename ist Kiew. Von meinem aktuellen Wohnort am Bodensee aus bin ich über 2000 Kilometer entfernt. Mit dem Auto mehr als zwei Tagesreisen? Wie seid ihr, Vater, damals dorthin gekommen?
Ich drücke mehrmals auf »plus«, »plus«, »plus« und dann auf »Satellitenbild«. Der Bildschirm bleibt schwarz und leer. Auf der Karte sind rechteckig und gleichmäßig angeordnete Straßen verzeichnet, eine künstliche Stadt? Ich kann mir kein Bild machen. Ich wüsste gern, wie kalt es war bei eurer Ankunft, wem ihr begegnet seid. Oder wie es gerochen hat. Irgendwelche Geräusche? Ihr habt Pferde beschlagnahmt. Und wie habt ihr euch verpflegt? Hattet ihr eigenen Proviant dabei? Oder habt ihr euch im Dorf bedient? Gekauft? Gab es Gespräche?
Als Kind hatte ich das Gefühl, meinen Eltern nahe zu sein. Bei der Lektüre der Aufzeichnungen meines Vaters stelle ich fest, dass er die Kriegsjahre seines Lebens zumindest uns Kindern gegenüber weitgehend verschlossen gehalten hatte.
Wie ist eine Armee organisiert? In der Schule haben wir nichts darüber gelernt. Rekrut, Gefreiter, Unteroffizier, Leutnant, Wachtmeister, Zugführer … General. Kompanie, Stabsbatterie, Messzug. Ordonanz im Kasino. Wo in der Rangordnung stehen Unterführer? Führer wovon? DER Führer? Oberst, Hauptmann. Bataillon, Kompanie, Regiment. Ich lerne diese Vokabeln, weiß aber nicht, aus welcher mir geläufigen Sprache ich ihre Bedeutung erschließen könnte.
4
Vater war ein eher zurückhaltender Mensch. Wenn er das Wort ergriff, versuchte er klar, fokussiert, präzise und zur Sache zu sprechen.
Jede Art von Aktivismus war ihm zuwider.
Menschliche, körperliche Nähe wusste er zu genießen. Wenn mir kalt war als Kind, durfte ich mich bei ihm aufwärmen.
Sinnlich. Er liebte das Meer, die Wärme, die südliche Sonne und mediterrane Düfte.
Er gab meiner Schwester und mir Denksportaufgaben und sah uns bei unseren Lösungsbemühungen zu. Er gab uns Hilfestellungen und freute sich mit uns, wenn wir Lösungen fanden.
Er selbst nahm Uhren auseinander und setzte sie wieder zusammen. Von ihm habe ich den Mut, Maschinen und Apparate, von denen andere sagen: »Kaputt, wirf sie weg«, zu öffnen, hineinzuschauen, Gehäuse zu demontieren, nachzusehen, welche Funktionskreise unterbrochen, was allenfalls durchgeschmort ist, ob man das Gerät reparieren kann, Ersatzteile zu besorgen und es Schritt für Schritt wieder zusammenzusetzen.
Papa hatte ein Studium der Elektrotechnik absolviert. Er war zuverlässig und berechenbar, anderen gegenüber manchmal besserwisserisch und arrogant. Wenn meine Schwester und ich etwas ausgefressen hatten, konnte er auch unerbittlich und streng sein.
Vorsichtig, überbehütend. Mit siebzehn Jahren musste ich noch um Erlaubnis fragen, wenn ich zu einer Klassenparty wollte. Und mit der letzten Straßenbahn, vor Mitternacht, hatte ich zu Hause zu sein, auch samstags.
Ich war sieben Jahre alt, als Papa eine Dienstreise in die USA unternahm. Eine Wegstrecke gönnte er sich auf der Queen Mary über den Ozean und gab dafür ein paar Urlaubstage hin. Er brachte mir von dieser Reise ein hellblauweißes Kleid mit Petty Coat mit und erhob mich damit augenblicklich auf Wolke sieben.
Als er ein anderes Mal von einer Frankreichreise zurückkam, ließ er mich die Augen schließen und gab mir wiederum ein Geschenk in die Hand. Es fühlte sich fest an, nicht kühl, und hatte geschwungene Konturen. Ich erriet es nicht.
Ich durfte, ja, ich musste die Augen öffnen: weiße Stöckelschuhe! Was meine Sitznachbarin seit ein paar Wochen besaß, womit sie seither täglich in die Schule klapperte und worum ich sie aus tiefster Seele beneidete. DAS hatte Vater mir aus Paris mitgebracht!
Für meine Mutter kam es nicht in Frage, mich damit zur Schule gehen zu lassen. In der Wohnung fürchtete sie, dass die Pfennigabsätze die echten Orientteppiche beschädigen würden. Also kamen nur die Küche, das Badezimmer und das Treppenhaus mit den in Travertin gefassten, mit Steinfließen belegten Stufen in Frage. Und immer nur, wenn gerade niemand schaute. Es waren die ersten und letzten Male in meinem Leben, an denen ich mich auf High Heels erhob und heimlich und stolz über den Fußboden tackerte.
Wenn ich an Vater denke, fällt mir kein wesentlicher Wunsch ein, den er mir versagt hätte. Beide Eltern unterstützten mein Schüleraustauschjahr 1969/1970 in den USA. Vater half mir, mein erstes Auto, einen zitronengelben VW-Käfer, von einer Rostschleuder in ein, wenn auch sichtbar geflicktes, doch fahrtüch tiges Vehikel zu verwandeln. Beim Einzug in meine erste Stu denten-WG, sympathische Leute, ein heruntergekommener Altbau ohne funktionierende Heizung mit schimmelnden Wänden, reiste er aus Nürnberg an und half Laugen, Farbeimer, geeignete Rollen und Pinsel zu besorgen. Auch hatte er eine Bohrmaschine dabei, um mein Bücherregal an die frisch getrocknete Wand zu schrauben, half Fenster zu dichten und den Ölofen wieder betriebsbereit zu machen. Er zog sich zurück, sobald Zimmer und Wirtschaftsräume bewohn bar waren.
Mehrere Jahre später, als ich für Weiterbildungen mehrtägige Kurse in weiter entfernten Orten zu besuchen hatte, kam er, um vorübergehend die Betreuung unserer beiden kleinen Kinder zu übernehmen.
Er war groß, schlank, sah gut aus. Ein bisschen weich und nachgiebig, nicht stramm, nicht zackig und insofern dem männlichen Ideal der Nationalsozialisten nur teilweise entsprechend.
Er hatte und behielt den Überblick in kritischen Situationen. Er rastete nicht aus, konnte aber durchaus laut werden, bestimmend und autoritär. Er war in der Lage, die Macht zu ergreifen und sich durchzusetzen.
5
Als Schulkind hatte ich vielfältige Gründe, keine nationale Zugehörigkeit zu empfinden. Meine Eltern waren Österreicher (geblieben). Unsere Familie lebte in Deutschland.
Einmal wurden wir in der Schule nach unserem Lieblingsessen gefragt. Ich gab »Schmarren« zur Antwort, ein österreichisches Gericht. Die ganze Klasse brach in schallendes Gelächter aus, weil »Schmarren« im Fränkischen »Unsinn« bedeutet. In den darauffolgenden Tagen verdoppelte ich meine Anstrengungen, das Fränkische zu erlernen. Meine Schwester und ich übten die richtige Aussprache vor dem Spiegel.
Auch abgesehen davon war Deutschland kein Land, auf das man in den fünfziger und sechziger Jahren stolz sein konnte. Wenn ich im Ausland gefragt wurde, woher ich kam, hatte ich mir angewöhnt, »Österreich« zu sagen. Nicht dass dies vor dem Hintergrund der politischen Geschichte besser gewesen wäre. Österreich war bloß in der Welt weniger bekannt als Deutschland. Sich als Österreicherin zu bekennen, war weniger verfänglich als zu sagen, man sei Deutsche – in Norwegen, in Griechenland. Und in den USA, wo ich ein Schüleraustauschjahr verbrachte, verkam »Austria« leicht zu »Australia«. Viele hatten von »Austria« noch nie gehört. Dabei beließ ich es nur allzu gern.
Ich staunte, wie meine amerikanischen Mitschüler bei bemerkenswert vielen Anlässen ihre Nationalhymne sangen, Montag morgens zum Wochenbeginn in der Schule, und wie sie sich hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs fraglos auf der Seite der »Guten« wähnten, obwohl sie diesen Krieg genauso wenig miterlebt hatten wie ich. Sie genierten sich auch nicht, mich zu Kinofilmen einzuladen, die vom Zweiten Weltkrieg handelten und in denen die Deutschen naturgemäß die »bad guys« waren.
Ich lernte meine Lektion – möglichst nichts von irgendwelchen nationalen Gefühlen und Loyalitäten zu zeigen. Ich bemühte mich, die Demütigung, eine Deutsche zu sein (die ich nicht war), augenscheinlich ungerührt zu ertragen. Eine Österreicherin zu sein, war natürlich um nichts besser. Aber das war weniger bekannt als die Schande der Deutschen.
Jahre später musste ich als Studentin zur Kenntnis nehmen, dass sich für den Weltfrieden ausschließlich die Sowjetunion einsetze. Jedenfalls behaupteten das meine Kommilitonen, die sich im MSB Spartakus (Marxistischer Studentenbund) engagierten. Und es beschämte mich, eingestehen zu müssen, daran erinnere ich mich noch sehr genau, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika Kriege vom Zaun gebrochen und völkerrechtswidrige Taten begangen hatten. Es tat weh, Gut und Böse als äußerst relative Begriffe zu erkennen. Aus deutscher Sicht war die Politik von Gorbatschow gut. Freunde aus ehemaligen Comecon-Ländern, die ich über meinen in Prag geborenen Mann kennenlernte, verurteilten oder hassten ihn sogar.
6
Obwohl ein Krieg begonnen hatte, der als Zweiter Weltkrieg in die Geschichte eingehen sollte, gestaltete sich Vaters Leben zunächst bemerkenswert alltäglich: Die erste geplante Maturareise nach Rom musste zwar aufgegeben werden, weil man der Schulklasse wegen des drohenden Krieges die Ausreise über die österreichisch-italienische Grenze verweigert hatte. Diese Fahrt wurde im Oktober mit einer Reise nach Wien »nachgeholt«. Vater besuchte einen Tanzkurs, nahm an einer Grenzlandfahrt der Hitlerjugend ins Burgenland teil, erwarb das HJ-Sportabzeichen und lernte nebenbei Italienisch und Schreibmaschine-Schreiben.
Und er berichtet: Noch in Friedenszeiten hatte ich mich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet – ich wollte Bordfunker werden – um diese Pflicht vor dem Studium zu absolvieren. Jetzt wollte und konnte ich meine Meldung nicht zurückziehen. Ich erhielt den Gestellungsbefehl und hatte mich nun darauf vorzubereiten. Von der Schule erhielt ich ein Abgangszeugnis mit Reifevermerk. (…) Es enthielt lauter ›sehr gut‹ mit Ausnahme von Latein und Leibeserziehung ›gut‹.
Der Gestellungsbefehl lautete: Graz Annensäle (das ist in der Nähe des Hauptbahnhofes) 7:30 Uhr am 15. Januar 1940. Bis dorthin konnte mich meine Mutter begleiten. Mit mir rückte ein lieber Klassenkamerad (…) ein (…).
Die Bahnfahrt und dann LKW-Verladung in eine Kaserne nach Obertraubling bei Regensburg, sowie die banalen Tätigkeiten der Einkleidung, der ersten Unterweisungen über das Verhalten als Soldat im Allgemeinen und gegenüber Vorgesetzten, sowie Spintordnung und Bettenbau hinterließen in meinem Gedächtnis kaum Spuren. Schon sechs Tage später wurden wir nach Roth bei Nürnberg in ein Barackenlager am Rande eines Feldflughafens verlegt. Groß war die Enttäuschung, daß wir zwar der Luftwaffe angehörten, aber eine Baukompanie bildeten. Die Grundausbildung begann sofort und zu meiner größten Überraschung wurde ich am 31. Januar zum Rekrutengefreiten (das ist Hilfsausbilder) bestellt. Wie merkwürdig da die Gefühle laufen: Es tat mir ausgesprochen wohl, aber ich merkte auch deutlich, daß ich nur ein winziges Schrittchen getan hatte, die Kälte biß mich beim morgendlichen Ausrücken genauso in die Nase wie die anderen Rekruten.
Baukompanie und Flak-Stabsbatterie 1940 – 1942 Meine fünfeinhalb Monate Baukompanie waren verhältnismäßig abwechslungsreich: Es gab eine Menge zu lernen, sowohl militärisch wie im Straßen- und Anlagenbau; ich konnte an einem Unterführerlehrgang teilnehmen und mich an das raue Soldatenleben gewöhnen. Äußerst erstaunt war ich nach einem gemeinsamen Marsch in ein Nachbardorf, daß ich nach dem Genuß einer ›Halben‹ Bier, wie alle andern sie tranken, doch etwas beschwipst war.
Die Verlegung der Kompanie nach Crailsheim und der dann folgende Einsatz zum Bau eines Feldflugplatzes bei Bechhofen brachte viel Bewegung.
Meine Beförderung zum Gefreiten mußte wieder zurückgezogen werden, weil dies vor einem halben Jahr Dienstzeit unzulässig war.
Die erste Möglichkeit, von der Baukompanie wegzukommen, nutzte ich mit einer Meldung zur Flak nach Krems-Mautern (Nie derösterreich), und zwar zur Stabsbatterie, wo Funker ausgebildet wurden. Dort hoffte ich, meine Vorkenntnisse im Morsen nutzen zu können.
Nach einer neuerlichen Rekrutenzeit wurde ich auch dort festgehalten. Hier war technisch sehr viel zu lernen: Theorie der Flugabwehrkanonen, Flugzeugerkennung und vieles andere.
Einige Kurzurlaube verschönten die Zeit, und meine Mutter konnte mich besuchen kommen. (…) Die Familie Reithofer in Mautern hat mir zeitweise ein wenig das Zuhause ersetzt.
Auch in dieser Einheit wurde ich sehr gefördert: Einem äußerst harten Unteroffizierslehrgang folgte die Beförderung zum Unteroffizier und Ernennung zum Reserveoffiziersanwärter, dann wurde ich auf die Luft-Kriegsschule 6 nach Berlin geschickt, die außerordentlich interessant, aber auch fordernd war (…) und schließlich konnte ich die PKW-Fahrschule mitmachen. Der Weg nach Krems, wo etwas Unterhaltung lockte, war sehr weit. Trotz Verbots wurde von vielen die Eisenbahnbrücke benützt – eine große Abkürzung. Als ich einmal meine Fahrstunde mit einem Kinobesuch in Krems kombinierte, gab es großen Ärger.
In schrecklicher Erinnerung ist mir eine Besichtigung, bei der ich als Stubenältester erst im letzten Moment gewahr wurde, dass wir ein Radio laufen hatten. Mit dem Abschalten trat der Kommandeur ein.
Unser Batteriechef war Oblt. Jungbauer. Gefreiter Sandig und ich waren gemeldet worden, dass wir morgens beim Wecken nicht sofort aufgestanden waren. Oblt. Jungbauer ließ uns mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen.
Lt. Bärenstecher war der forsche Zugführer, während Lt. Voellm, der Feinere, mit großen Kenntnissen aufwartete. Der Meß zug unter einem Wachtmeister bestand aus lauter Spezialisten, die fest zusammenhielten. Technisch interessant war für mich der Bau einer Telefonleitung, die zur Überprüfung der Schießergebnisse gebaut wurde.
Ein Mobbingerlebnis machte mir zu schaffen: andere Teilnehmer des Unteroffiziers-Lehrganges, die diesen nicht so gut bestanden hatten, machten mir die Hölle heiß.
Um zu lernen und vielleicht auch aus Langeweile meldete ich mich als Ordonanz ins Unteroffizierskasino, dort hatte ich zu servieren.
Von einem Lehrgang für Nachrichten-Offiziere in Halle wurde ich zurückbeordert, um an einem Lehrgang für Infanterie-Offiziere am Truppenübungsplatz Groß-Born in der 16. Luftwaffen-Kampfschule teilzunehmen. Am Schluß dieser harten Ausbildung wurde ich von Hermann Göring persönlich zusammen mit zweitausend Offizieren an die Infanterie überstellt.
Unser Kompanieführer, ein alter Hauptmann, war ein ausgezeichneter Taktiker: Er verstand es hervorragend, mit uns aus dem Gesichtsfeld der höheren (teilweise recht närrischen) Vorgesetzten zu verschwinden. Die Ausbildung war hart und ungewohnt, aber wir haben doch eine Menge Praktisches gelernt.
Manchmal herrschte eine etwas aufmüpfige Stimmung, und es konnte passieren, daß ein Lied angestimmt wurde: »Haben Sie schon ein Hitlerbild? Nein, nein, wir hab’n noch keins, Molotow besorgt uns eins!« … oder daß eine Stubentür aufging und sehr laut der Ruf erscholl: »Scheiße!«
Ein Urlaub wurde nach dieser völligen Umstellung gewährt. Eine Fünfergruppe, Oblt. Steingruber, Lt. Logenstein, Lt. Axterer, Lt. Albert und ich, wurde zu einem Infanterie-Regiment nach Frankreich zur weiteren Ausbildung versetzt.
Eine übermäßige seelische Zerreißprobe stellten die Wartetage in München dar. Nach dem Tiefschlag der Versetzung zur Infanterie ging es nun zum Einsatz – zwar nach Frankreich – , aber dennoch begann damit ein ganz neuer Abschnitt. Zusammen mit dem älteren und gewandteren Franz Axterer aus Voitsberg (der später in Rußland fiel) vertrieben wir uns in München die Zeit und suchten Ablenkung und Unterhaltung. Frauenbekanntschaften brachten größte Probleme.
Dann zunächst zum Truppenübungsplatz Mourmélon bei Reims, bald nach Antwerpen, schließlich nach Médréac bei Rennes. Die Ausbildung im Gelände war für mich außerordentlich hart, ich war kaum in der Lage, jeweils die taktische Ausgangssituation voll zu erfassen, noch weniger im Gelände – selbst unter großer Anstrengung stehend – die von mir erwarteten Befehle und Anweisungen an meine Gruppe zu geben.
Sehr viel schöner waren die wenigen Freizeitbeschäftigungen, wie Kutschenfahrten in die Umgebung und einmal auch eine Wasserfahrt zusammen mit Luftwaffenhelferinnen.
Traumatisch ist für mich die Erinnerung an ein Erlebnis in Antwerpen, als ich den Befehl von meinem Kompanieführer Oblt. Klett erhielt, zum Schutz unserer eigenen Fahrzeuge Kunststoffplatten aus einer bestehenden Anlage zu demontieren und zu holen. Mir war klar, daß dies nicht zulässig war, konnte mich dem Befehl aber nicht widersetzen. Wie zu erwarten, hat die Ortskommandantur die Rückgabe gefordert.
Märchenhaft war unsere Unterbringung in einer komfortablen Villa in wunderschöner Lage.
In unserem Privatquartier in Médréac war eine Apothekerin, der ich vergebens den Hof machte.
Ein Zwischenhalt in Paris wurde zum unvergeßlichen Erlebnis. Die METRO führte uns zu vielen Sehenswürdigkeiten, und eine Aufführung in der Comédie-Française entzückte uns. Danach verführten uns Schlepper in das Nachtleben.
Im September erhielten wir noch einmal Urlaub, um dann nach Smolensk zur Führerreserve-Ost überstellt zu werden.
7
Bevor ich dich, Vater, von meinem sicheren Schreibtisch aus »an die Front« begleite, möchte ich noch gerne wissen, wie das bei euch mit den »Frauenbekanntschaften« war.
»Wartetage in München« – du schreibst, dass sie »größte Probleme« brachten. Welche denn?
Ihr wart Österreicher, du jedenfalls noch unter 20, groß gewachsen, gut aussehend. Kann ich als Tochter das beurteilen? Wollten die Frauen etwas von euch? Oder nur ihr etwas von ihnen? Eine »seelische Zerreißprobe« sei das Warten gewesen, schreibst du, nach der Versetzung zur Infanterie, die du als »Tiefschlag« empfunden hattest vor deinem ersten Einsatz in Frankreich.
Da wolltet ihr euch »abreagieren«? Oder noch einen Nachkommen zeugen, bevor ihr ins Ungewisse zogt? Ich stelle mir vor, dass ihr Angst hattet, das aber unter keinen Umständen zeigen oder zugeben durftet. Also habt ihr euch bemüht, Frauen zu erobern. Geld, um sie zu einem Glas Wein oder ins Kino einzuladen, werdet ihr gehabt haben. Habt ihr Frauen auf der Straße angesprochen, in Parks? Hättet ihr notfalls auch Gewalt angewendet? Oder habt ihr Frauen angesprochen, die eh schon in Bars hockten? Wie viele wart ihr? Gab es Ältere, Wortführer darunter, Lustige, die unterhalten konnten? Hast du »genommen«, was übrigblieb, weil du der Jüngste warst? Kein Wortführer, kein Gruppenclown, auch damals nicht, vermute ich. Trotzdem strahltest du Selbstsicherheit aus. Auch wenn du auf den ersten Blick eher zurückhaltend wirktest. Welche Frau(en) sprach(en) auf dich an? Waren es lustige, laute, unbekümmerte? Freche? Frivole? Hast du dir mit einer Bestimmten Blicke zugeworfen, um euch einig zu werden, während die anderen noch ihre Balztänze aufführten?
Interessiert eine Tochter der Umgang ihres Vaters mit Frauen? Oder ist das unnatürlich?
Ich stelle diese Fragen. Sie interessieren mich.
Was waren die Probleme? Wollten die Frauen euch nicht gehen lassen? Haben sie euch ausgeraubt? Vorher betrunken gemacht? Professionelle? Bist du in Konflikt mit deiner Wohlerzogenheit und gelernten Moral geraten, Dir vor und nach dem Akt gewisser Widersprüche bewusst geworden?
Oder tauchten hinter den harmlos und lieb wirkenden Frauen plötzlich Zuhälter auf, die bedrohlich auftraten und Forderungen stellten? Zornige Ehemänner, Verlobte, Väter?
Ihr wart Soldaten, Wehrmachtsangehörige. Das galt damals etwas. Nicht? Und sehr bald wurdet ihr wegbeordert. War das das Problem?
Welche Lehren hast du aus diesen Frauenbekanntschaften gezogen?
Thema Vertrauen: Hat man dich hinters Licht geführt? Belogen? Mit falschen Versprechungen gelockt? Hat jemand von euch das Wort »Liebe« in den Mund genommen? Schwelgtest du anschließend in Frankreich in Sehnsüchten? Bliebst du in deinen Erinnerungen gefangen?
8
Nach einem Urlaub vor dem Fronteinsatz stellte sich noch eine Wartezeit in Wien ein, bis wir den Marschbefehl an die Ostfront erhalten sollten. Uneingestandene Spannung lag auf unseren Gemütern. Mit vier Kameraden in der gleichen Lage luden wir unsere Angehörigen noch einmal ein, zu uns nach Wien zu kommen, um den Abschied noch weiter hinauszuschieben. Die Frauen meiner Kameraden, sowie meine Mutter und auch eine Bekannte aus Voitsberg, Luise Ulli, waren angereist.
Schließlich war der Marschbefehl da. Wir reisten am 9. September 1942 mit der Bahn von Wien ab über Warschau (11. September) und Bialystock (15. September); während eines kurzen Aufenthaltes rannte ich vom Bahnhof in die Stadt, konnte allerdings nicht viel Interessantes sehen. Am 17. September trafen wir schließlich in Smolensk ein, wo wir der Führerreserve Ost zugeteilt waren. Die Reise war nicht unbequem, aber doch sehr lang gewesen. Und hier in Smolensk nun wieder einige Tage des Wartens.
Der allnächtliche Besuch des »lwan«, einer einzelnen Propellermaschine, löste zwar immer Fliegeralarm aus, es fielen auch einzelne Störbomben, es gab jedoch noch keine größere Beunruhigung.
Im Übrigen nützte ich die Zeit, so gut es ging. Ich hatte Fahrschule machen dürfen, so meldete ich mich jetzt zur Prüfung an. Die theoretische Note war »sehr gut«, das praktische Fahren »gerade genügend«, denn ich hatte den Wagen beim Anfahren am Berg zweimal abgewürgt. Immerhin war der Führerschein von einigem Wert für mich in der Zukunft.
Besonders schön fand ich, die Smolensker Kathedrale anschauen zu können. Das Gotteshaus war als Museum eingerichtet. Großen Eindruck machten auf mich der reich geschmückte Lettner und die in orthodoxen Kirchen übliche Zarenpforte.
Im Jahre 1948 konnte ich über diesen herrlichen Bau in einem studentischen Freundeskreis im Hause Riebler berichten, bei dem auch meine spätere Frau zugegen war.
In Erinnerung blieb mir eine Begebenheit, die mich doch verunsicherte: Unterwegs in Smolensk sah ich einen Soldaten, der sich abquälte, einen schwer beladenen Karren zu schieben. Ich half ihm ein Stück weit, hatte aber dann doch auch Bedenken, ob meine Aufgabe, auf diesem Feld tätig zu sein, richtig aufgefaßt war.
Am 1. Oktober 1942 konnte ich mit Ordonanzoffizieren mit einem Auto über Vitebsk, Rudnja, Demidow nach Iwanowo (5. Oktober), dem Gefechtsstand der 330. Infanterie-Division unter General Rothkirch, fahren. Ich wurde dem 556. Infanterieregiment unter Oberst Ritter von Doser zugeteilt und sollte die 1. Kompanie des 1. Bataillons übernehmen, welches von Hptm. Rosenstock geführt wurde.
Die Nächte wurden in russischen Blockhäusern zugebracht. Es gab viel zu lernen. Jeder hatte seine eigene Methode, sich der Wanzen zu erwehren, bald machte ich auch die Bekanntschaft mit Läusen. Der eigene Schlafsack tat gute Dienste.
Mit dem Bataillonskommandeur erreichten wir schließlich am 7. Oktober die Kompanie, die gerade in Ruhestellung in Alexandro wo war. Die unvermeidliche Bewegung im Ort hatte die Russen veranlaßt, uns mit Artilleriefeuer zu belegen. Die Landser bewegten sich sehr vorsichtig auf den Wegen zwischen den Häusern. Ich wunderte mich sehr, daß der Hauptmann die Männer schalt, sie sollten sich nicht so haben, sondern schnell und aufrecht gehen.
Wir traten in das Haus, in dem der Kompanietrupp untergebracht war, da krepierte gerade vor dem Eingang eine Granate. Splitter sausten herum und trafen den bisherigen Kompanieführer, Feldwebel Lotz, am Hals. Mich erwischte ein erbsengroßes Stück oberhalb der linken Schläfe, schlitzte die Kopfhaut auf, blieb aber an der Schädeldecke hängen. Der Sani, der zum Kompanietrupp gehörte und daher in dem Raum anwesend war, versorgte sofort den schwerer getroffenen Feldwebel – dieser mußte zum Verbandplatz gebracht werden – dann half er mir. Das warme Blut rann mir übers Gesicht, aber sonst ging es mir gleich wieder ganz gut. Zu meiner Verwunderung erhielt ich unmittelbar nach der Versorgung der Wunde vom Sani das Verwundetenabzeichen angesteckt. Es sollte mein erster und letzter Kratzer bleiben. – Daß ich mit meinem Kopfverband bei der Truppe blieb, gefiel meinen Männern.