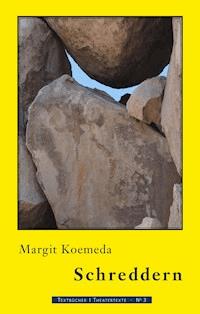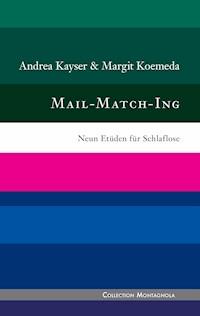Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Klippenflieger« ist eine Sammlung von Erzählungen über Menschen, die auf der Suche nach Verstehen, Sinn oder Liebe mehr oder weniger ausdauernd unwirtliche Felslandschaften umkreisen. Hinreißend das Dahinsegeln auf Illusionen und Hoffnungen. Manchmal taucht einer unvermittelt ins Wasser, andere lassen sich auf den Riffen nieder, um gebannt in die Tiefe zu starren, wieder andere werden von den Klippen angezogen und zerschellen daran. Flüchtige Verliebtheiten geben nur vorübergehend Halt, dazwischen Luftlöcher und die beständige Furcht, von inneren Dämonen oder den Gespenstern der Vergangenheit eingeholt zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Nachsitzen
Beteiligung ausgeschlossen
Koteletts
Wirklich verrückt
Stranden
Nach den Sternen greifen
Maus. Klick. Gefühle
Vielleicht fliegen
Unberührbar
Eine Handvoll Rubine
NACHSITZEN
Ich schloss die Tür und beeilte mich, das Haus zu verlassen. Ich war nicht bei mir. Meine Schritte lenkten mich zur U-Bahn-Station. Eine dunkle Fensterfront sog meinen Blick fest. Ich sah einen Mann, der sich langsamer als die übrigen Passanten bewegte. Von seinen Schultern hing ein schwerer dunkelgrauer Mantel. Sein Haar war füllig und leicht gewellt. ›Weich‹, dachte ich. Die Ampel schaltete auf Grün, und ich überquerte die Straße. Der Mann kam immer näher. Widerwillig erkannte ich mein eigenes Spiegelbild in ihm. Es stimmte: Mein Mantel war zu lang. Dass er außerdem nicht gut saß, genierte mich. Man sah, dass ich nicht zu den Geschäftsleuten gehörte, die mich zielstrebig überholten und an mir vorbei dem Bahnhof zuströmten. Selbstsicher trugen sie ihre Laptop-Taschen. Ich sah verbraucht aus, fand ich, und sträubte mich dagegen, aus der abgeschirmten Welt meiner Berufstätigkeit aufzutauchen. Der späte Nachmittag hier draußen in der Stadt war mir zu grell, die Geräusche zu laut.
Wie immer am Ende eines langen Arbeitstages fühlte ich mich schmutzig. Schmutzig wie diese überfüllten Züge. Einmal mehr bedauerte ich, dass meine Frau und ich so weit außerhalb der Stadt lebten. Die S-Bahn, die mich zum Hauptbahnhof bringen sollte, kam mit einem leisen Quietschen zum Stehen. Ich musste nur meinen Arm ausstrecken, um den Türöffner zu bedienen. Froh, mich nicht weiter bewegen zu müssen, fiel mir Herr Schatzmann ein, der seine Schuldgefühle bei mir abgeladen hatte; Schuldgefühle, weil er nicht aufhören konnte, seine Frau zu betrügen. Die Studentin Tina hatte eine Menge verweinter Taschentücher in meinem Behandlungszimmer liegen lassen. Frau Haffler war nicht zu bremsen gewesen. Aus purer Schwäche hatte ich ihren Redeschwall einfach über mich ergehen lassen. Fräulein Felber war in ihrer Sitzung zornig auf ihre Schwester geworden; wahrscheinlich das einzige Erfolgserlebnis, das ich an diesem Tag verbuchen konnte.
Dann kam mir Larissa in den Sinn und die finstere Miene, mit der sie das Sprechzimmer betreten hatte. Unsere förmliche Begrüßung. Die Sitzung begann mit einem langen Schweigen. Nach einer Weile fragte ich, was in ihr vorgehe.
»Ärger«, sagte sie.
»Was ärgert Sie?«, fragte ich.
»Ihre Behandlung hilft mir nicht!«
Das traf einen wunden Punkt. Ich hielt mich in der Tat für keinen besonders begabten Vertreter meiner Zunft. Aber das durfte ich natürlich nicht zugeben. Deshalb ermahnte ich Larissa, auch winzige Veränderungen zu beachten und kleine Fortschritte zu würdigen.
Hellhäutig saß sie mir gegenüber, mit langen rötlichblonden Wimpern. Sie schien mich nicht zu beachten. »Ich muss raus hier«, murmelte sie.
Als ihre Mutter mit ihr schwanger war … Diese ganze Geschichte fiel mir nun wieder ein. Raus aus dem Mutterleib?
»Ist es so schlimm?«, fragte ich. Sie nickte.
Aber ich dachte auch an unsere Gespräche über ihre Selbstmordgedanken. Raus aus dem eigenen Körper? Ich hasste meine Hilflosigkeit in solchen Situationen. Gerne hätte ich sie fest umarmt, um sie daran zu hindern, sich etwas anzutun: Tun Sie es nicht! Tun Sie das auf keinen Fall! Ein Suizid nach drei Jahren Behandlung würde meinem Ruf schaden! Andererseits verstand ich sie auch. Denn: Man begreift doch, dass jemand, der sich nicht wohl fühlt in seiner Haut, irgendwann einmal genug hat.
»Meistens rede ich zu viel«, fuhr sie fort. »In meinem Kopf geht es zu wie bei einer Raubtierfütterung. Und ich kann dieses Gedankenjagen nicht zur Ruhe bringen.«
Ich schwieg.
Dann holte Larissa tief Luft und breitete ihre Arme aus. Rothaarig und prall saß sie da. ›Ein barocker Putto‹, dachte ich. Die Sommersprossen aber durchaus irdisch, versprenkelt auf Nase und Wangen.
Während wir weiter schwiegen, wurde Larissas Körper ganz hell, fast durchsichtig.
»Ich steige«, sagte sie. »Mein Kopf wird kleiner, der Unterkörper leichter, der Druck im Hals lässt nach.«
Sie breitete die Arme noch weiter aus. Dann atmete sie hörbar und langsam aus, drehte ihre Handflächen nach unten und führte sie sanft auf die Armlehnen zurück. Sie schien selbst nicht zu verstehen, was sie tat. Sie wiederholte die Bewegung.
»Ich umschließe hier etwas, berühre es mit … mit meinen Schwingungen … Schwingen? … Vielleicht trägt mich die Luft.«
Die Morgensonne fiel schräg durch das Fenster und tauchte Larissa in goldenes Licht. Ihre Stimme war leise geworden. Ich wollte nicht stören. Larissa hielt die Augen geschlossen. Ihre Arme bewegten sich gleichmäßig, deuteten nun aber die kräftigen Flügelbewegungen nurmehr an. Wortlos.
Dann sagte sie: »Ich bin ganz erfüllt … von dieser … Wärme. Ich möchte Menschen berühren. Sie weisen mich jedoch ab.«
Larissa wehrte sich nicht, als ich ihr das Ende unserer Stunde ankündigte und sie einlud, auf die Erde zurückzukehren. Wir verabschiedeten uns. Ich war gerührt, einen Engel zu Gast gehabt zu haben.
Nachdem sie die Praxis verlassen hatte, fragte ich mich, ob ich auf einen ihrer ungezählten Fluchtversuche herein gefallen war? Hatte ich mir nicht vorgenommen, ihrer Enttäuschung und ihrem Ärger auf der Spur zu bleiben?
In diesem Augenblick fuhr die S-Bahn in die Untertunnelung des Hauptbahnhofs ein. Ich stand auf, schüttelte meinen Mantel etwas zurecht und ging zur Tür, um auszusteigen. Das Menschengewühl war hier noch dichter und bunter als an der Station, wo ich eingestiegen war. Dunkelhäutige Frauen in bunten Kleidern mit Kindern und Männern schoben schwer beladene Gepäckwagen vor sich her. Ich versuchte, mich auf die Abfahrtszeit meines Zuges zu konzentrieren und mir meinen Weg mitten durch die hin und her eilenden, gestikulierenden, einander unverständliche Dinge zurufenden Menschen zu bahnen.
›Was ist Larissas Problem?‹, fragte ich mich, sobald ich in meinem neuen Zug wieder einen Sitzplatz ergattert hatte. Es war beschämend, dass ich nach all unseren Gesprächen diese Frau einfach nicht verstand. Jetzt fiel mir ein, dass sie erwähnt hatte, sie sei ein ungeplantes und höchstens halb erwünschtes Kind gewesen.
»Meine Mutter«, hatte sie einmal erzählt, »war eben nicht sicher, ob sie mich haben wollte oder nicht. Sie war noch sehr jung, als sie meinen Vater kennen lernte. In einer sternklaren Nacht hätten sich die beiden im Schlosshof auf einer Holzbank unter der wuchtigen Kastanie geküsst und geliebt, bis ich bei ihnen war. Aber dann … meine Mutter hatte gerade die Schauspielschule abgeschlossen. Was also? Ich, das kleine Fischchen in ihrem Bauch, wurde gejagt zwischen Ja und Nein; gespalten zwischen Fort für immer, ausspülen, weg! und Komm, ich will dich, bleib, wachse! Sprengsätze für meine ephemere Existenz. Gehetzt, manchmal traurig schwamm ich den Wänden meiner Gefangenschaft entlang. Rastlos flimmernd schlugen meine zarten Flossen. Unerträglich dieser Zwiespalt.
Irgendwann brach die Verbindung zu meiner Mutter ab. Da wurde es still im Aquarium, totenstill und leer. Ich versuchte zu sterben.«
Larissa schien sich an eine vorgeburtliche Zeit zu erinnern. Sie hatte mit großen Pausen zwischen den einzelnen Wörtern und einer merkwürdig verwaschenen Stimme gesprochen. Mein Hirn spielte es mir jetzt noch einmal im Zeitraffer vor.
»Plötzlich spürte ich draußen«, fuhr sie fort, »helfende Hände wedeln, die mir Mut machen wollten, für später. Durchhalten! riefen sie mir zu. Ich litt also weiter. Wenn ich mich verliebe, glaube ich, nach solchen Händen zu greifen. Aber etwas mache ich dabei wohl falsch. Wozu immer wieder diese unsinnige Hoffnung?«
Larissa hatte versonnen und wie in Trance erzählt. Unbewegt. Ohne Gefühle. Ich spürte Zorn in mir aufkommen. Empörung. ›Warum‹, fragte ich mich, ›dieser Leichtsinn der Liebe?‹
»Was fühlen Sie jetzt?«, hatte ich sie gefragt.
»Verloren«, sagte sie.
›Schlechte Karten von Geburt an‹, schoss es mir durch den Kopf. ›Na ja‹, dachte ich weiter und zuckte unwillkürlich die Schultern. Unter solchen Umständen entwickelt sich kein starker Überlebenswille. Sollte unsereins etwas daran ändern können? Und die wedelnden Hände? Waren meine dabei? Vertröstungen auf später? Leere Versprechungen? Was gebe ich ihr? Fünfzig Minuten pro Woche!‹
Der Zug glitt nun in einem langen Bogen aus der Stadt. Die Schienen führten gleichmäßig aufwärts. Wir segelten an sechsten und siebten Stockwerken von Bürohäusern vorbei, durchschnitten einen Spielplatz und eine kleine Parkanlage, überflogen eine Straße, dann die Limmat. Später senkte sich die Trasse wieder. Wir wurden zwischen steile Betonwände gezwungen, die bunt besprayt waren. Nach etwa zehn Minuten fuhr der Zug in den Untergrund des Flughafens ein.
Plötzlich sitzt Larissa mir gegenüber – die Erinnerung wird auf einmal sehr lebendig – und lässt ihre grün lackierten Fingernägel einen nach dem anderen auf die lederne Armlehne tappen. Ich sehe es ganz deutlich vor mir: Wie dieses Fingernagellackgrün, das flammende Orange ihrer Haare und das Rot meines Teppichs im Sprechzimmer um die Wette schreien. Hellhäutig, rothaarig und prall sitzt sie da und schweigt. ›Larissa schafft es, wenn ich ehrlich bin, mich aus der Fassung zu bringen. Immer wieder. Wenn ich nicht verheiratet wäre … ihr Mut zu leuchtenden Farben und dieser leicht gepolsterte und doch straffe Körper …‹, dachte ich.
»Werner kriegt immer, was er sich in den Kopf gesetzt hat.«
Sie beklagte sich häufig über ihren Mann. Auch er noch jung, aber schon ein erfolgreicher Unternehmer mit über vierzig Mitarbeitern.
»Ich sage Nein. Er will. Ich wehre mich. Er setzt sich durch.« Sie erzählte von Weihnachten. Seine Eltern, seine Schwester mit Mann und zwei Kindern, ihre Mutter seien zu Besuch gewesen. Larissa habe viel zu tun gehabt. Statt ihr zu helfen, sei er rauchend und palavernd mit seiner Verwandtschaft herum gesessen. Nur ihre Mutter habe sie manchmal in der Küche unterstützt. Zur Demonstration der Besitzverhältnisse habe er ihr manchmal, wenn sie ein voll beladenes Tablett ins Zimmer brachte, den Arm um die Taille gelegt oder ihr einen Kuss auf die Lippen gedrückt, während sie frisch gewaschene Gläser in den Schrank stellte.
Es war mir peinlich, aber die Lust, sie zu begrapschen, konnte ich sehr gut nachempfinden. Ich musste sogar kurz auf ihre Brüste schauen, während sie mir das erzählte. Ich hüstelte und äußerte ein zustimmendes »mhm«. Ich wollte nicht, dass sie etwas merkte.
»Als am Morgen des sechsundzwanzigsten die letzten Gäste wieder abgereist waren«, erzählte sie weiter, »teilte er mir mit, dass die Beiblätter für die Steuererklärung noch getippt werden müssten. Ich war sprachlos. Dann sagte ich: ›Wir wollten doch heute in den Skiurlaub fahren!‹«
»Ja, aber wie du auch weißt«, habe er darauf geantwortet, »haben wir bereits die zweite Mahnung für unsere Steuererklärung erhalten.«
»Dein Versäumnis«, habe sie erwidert. Und: »Zwischen Weihnachten und Neujahr wird die Behörde andere Sorgen haben, als auf unsere Unterlagen zu warten.«
»Er hasst es, wenn ich ihm widerspreche«, erklärte mir Larissa.
Darauf er: »Ich reise erst, wenn unsere Unterlagen versandbereit im Umschlag stecken.«
Damit sei für Werner die Diskussion beendet gewesen. Sie könne es selbst nicht fassen, wie er das fertig bringe: Jedenfalls sei sie schon kurze Zeit später vor dem Computer gesessen und habe Zahlenkolonnen getippt. Er, schräg hinter ihr, diktierte. ›Er stinkt!‹, habe sie gedacht und sich mit dieser Feststellung erstaunlicherweise beruhigt.
›Zweifellos bedauerlich‹, dachte ich. ›Wir haben ja schon öfter daran gearbeitet, sie beim Nein-Sagen zu unterstützen. Diese fatale Abhängigkeit von ihrem Mann!‹, fand ich. Nicht zum ersten Mal ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ich sie erlösen könnte, wenn ich ihr zeigte, wie begehrenswert sie ist. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ein Psychiater eine jüngere Patientin … Ich meine, was wäre denn dabei, wenn sie sich einmal entkleiden und ihre Beine auch für mich … ›als Gegengewicht zu ihren Abhängigkeitsgefühlen Werner gegenüber‹, dachte ich.
Ich erinnerte mich nun daran, dass Larissa weiter erzählte, wie sie wütend auf die Tastatur gehackt und ungeduldig mit den Füßen gescharrt habe, was ihren Mann je länger je mehr zum Kochen brachte. Um ein Haar wäre es zu einem handfesten Krach zwischen ihnen gekommen.
Danach hätten sie wortlos ihre Koffer gepackt und ihre Ski und sein Snowboard aufs Dach geladen. In Samedan seien sie bei tiefer Dunkelheit angekommen. Larissa sei in den ersten zwei Tagen ihres Urlaubs schweigsam gewesen. Danach habe es, so glaubt sie, mit diesem Betäubungszustand angefangen, aus dem sie bis heute nicht wieder erwacht sei. Seit jenem Tag habe sie ihrem Mann nie mehr Vorwürfe gemacht, auch nicht mehr protestiert oder sich beklagt. Sie antworte stets sachlich auf seine Fragen und erzähle ihm nur noch Belanglosigkeiten.
Nach diesen Mitteilungen schwieg Larissa. Ihre Hände krallten sich etwas fester um die Armlehne. Ich schaute sie eine Weile lang an. Dann hielt ich ihr ein Handtuch hin.
»Möchten Sie«, fragte ich, »Ihren Zorn an diesem Tuch auslassen? Sie können es würgen, zusammendrücken, in Stücke reißen.«
Sie mied meinen Blick und zuckte die Schultern. Ich fragte, ob sie mich anschauen könne. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich eine ohnmächtige Wut aus ihren Augen blitzen und war froh, dass ihre dolchspitzen Blicke nicht mir galten.
Sie ging auf meine Frage mit dem Handtuch nicht ein, zuckte noch einmal kaum merklich die Schultern, atmete flach, ein wenig schneller als gewöhnlich.
Dieses Gespräch hatten wir vor drei Wochen geführt.
Der Zug hatte inzwischen das Stadtgebiet verlassen und pfeilte fast lautlos durch die weiße Landschaft. Auf einem Stoppelacker ließ sich unordentlich ein Krähenschwarm nieder. Milchiger Nebel lag über den verschneiten Wiesen. Die Klimaanlage hauchte Spuren von kaltem Rauch ins Abteil. Eine Zellophanverpackung raschelte.
Ich war nicht mehr ganz wach und dachte: ›Sie müsste sich trennen können.‹ Bilder und Gedanken träufelten mir unbesehen in den Kopf. Larissa zog als Sehnsucht an mir. Ihre Verschlossenheit reizte mich. Ihr untergründiger Zorn rührte an ein auch mir vertrautes Gefühl … Letztes Sonnenlicht schmolz den wabernden Nebelbausch, leckte ihn noch einmal weg, verbarg sich dann wieder. Eine weiß gekleidete Frau joggte an der Bahnlinie entlang, neben ihr ein großer Foxterrier. Beide stießen dicke Atemwolken aus.
›Du hast dich also‹, hörte ich mich zu Larissa im Wachtraum sagen und erschrak, weil ich sie plötzlich duzte, ›um deinen Mann zu kränken, in einen anderen verliebt. Dein Mann setzt dich unter Druck, beansprucht dich … sind das Gründe, eine Nebenbeziehung zu beginnen? Dass ihr nicht mehr miteinander redet, ist vermutlich nicht nur seine Schuld. Und der Neue? Ein selbst-verliebter Muttersohn, sagst du. Hat sich kurz, nachdem ihr füreinander entflammt wart, wieder in andere Augen verliebt. Was hattest du dir erhofft, Larissa? Bald schon steckte er in Hochzeitsvorbereitungen mit der Neuen, seine vierte Heirat, sagst du, Flitterwochen auf einem Inselparadies der Philippinen, und erwähnt im Vorbeigehen, wie glücklich ihn das mache, wie sein Herz Ja! und immer wieder Ja! poche. Warum erzählt er dir das? Du kennst das, sagst du. Was du liebst, wird fortgerissen.‹
Ich öffnete die Augen nur halb: Sah die Fenster der Waggons als eine nicht enden wollende Reihe von Zähnen. Mein Zug fuhr zu einem Halbrund zusammengekrümmt nach Winterthur ein. Die Sonne schien jetzt noch einmal direkt herein und machte sichtbar, dass die Fenster nicht geputzt waren. Ein grauer Schmutzfilm bedeckte sie. Regentropfenrückstände, verdunstete Rinnsale hatten ihre Spuren auf den Scheiben hinterlassen. Und auf der Innenseite – man sah es deutlich – war ein schlecht ausgewrungener Schwamm darüber gefahren.
Am Ende der Sitzung hatte Larissa mir einen Traum erzählt: Sie sei besinnungslos vor einem erbärmlich zerwürgten Hals gesessen, darin eine klaffende, etwa fingerlange Wunde. Als sie die blanke Schneide zurückzuziehen begann, sei dickflüssiges Blut aus der Wunde gequollen. Leere Augen starrten sie an. Stumpf vor allem das linke. Triumph und Entsetzen. Nun würde dieser Mensch niemanden mehr erwählen, lieb haben oder glücklich machen können. Dann habe sie gesehen, wie sich ein letzter Speichelfaden zwischen Unter- und Oberlippe spannte und sei erwacht.
›Gut‹, hatte ich gedacht, ›hier ist sie, ihre Wut.‹
Larissa hatte geschwiegen, anschließend den Kopf gehoben und – vielleicht zum ersten Mal, seit wir uns kannten – ihre Augen klar auf meine gerichtet.
»Hier Winterthur, hier Winterthur. Ihre nächsten Anschlüsse …«
Ich fühlte mich plötzlich sehr müde, erlaubte mir, die Augen zufallen zu lassen. Es ärgerte mich, dass mein Praxistag zwar zu Ende war, ich mich aber trotzdem noch mit meinen Patienten beschäftigte. Ob die Bankangestellten auch ihre Rechnungsabschlüsse und die Stewardessen ihre Passagiere und deren Ängste mit auf den Heimweg nahmen? Ich stellte mir plötzlich vor, wie laut es im Zug wäre, wenn all diese Seelen, Sorgen und Gespenster Stimmen hätten und was für ein hoffnungsloses Durcheinander herrschen würde. Unwillkürlich führte ich beide Hände an meine Schläfen und presste sie fest zusammen.
Ich öffnete und schloss die Augen. Ich blinzelte und sah draußen unruhiges Tautropfengefunkel. Die Landschaft unter der geschlossenen Schneedecke strahlte nun flamingofarben und violett. ›Ich darf, was Larissa mir anvertraut, niemandem erzählen‹, dachte ich.
Dann fiel mir wieder Herr Schatzmann ein. Die Art, wie der über Frauen sprach! Das Wichtigste an ihnen sei, dass sie dieses extra Loch hätten. Und dazu lachte er so, dass mir kein Platz zum Ausweichen blieb. Während ich meinen Mantel vom Haken nahm und meine Mappe aus der Gepäckablage zog, bemühte ich mich, ihn und seine schleimige Art wegzuwischen. Die Bankangestellten, Kleinunternehmer, Geschäftsleute, die mir auf dem S-Bahnhof in Zürich beneidenswert erschienen waren, kamen mir nun ebenfalls müde vor. Auch ihre Gesichter waren jetzt fahl. Ich musste ein zweites Mal umsteigen. Mein Bus stand schon bereit. Ich wünschte mir einen Platz ganz für mich, wollte niemandem begegnen. Aber auch der Bus war voll. Zielstrebig steuerte ich einen Fensterplatz an, hängte meinen Mantel an den Haken, zog ihn mir vors Gesicht und tat, als schliefe ich. Nun war ich froh, dass dieser Mantel lang war und ausgebeult und bewohnbar. Nach wenigen Minuten ließ der Chauffeur den Motor an und fuhr los. Kurz darauf muss ich eingenickt sein. Die Dämmerung war nun zur Nacht geworden. Da schimmerten plötzlich vor mir smaragdgrüne Fingernägel auf und irrlichterten mir entgegen. Aus der Dunkelheit löste sich eine Gestalt. Weiblich. Füllig – in hautengen grün-schwarzen Hosen. Sie schien von irgendwo her beleuchtet und kam aus einem langen U-Bahn-Tunnel langsam auf mich zu. Larissa schaute knapp an mir vorbei.
Dann hob sie die Arme. Starr vor sich gestreckt, hielt sie mit beiden Händen einen Revolver. Dessen Mündung zielte genau zwischen meine Augen.
Ich öffnete den Mund.
Wollte schreien.
Und erwachte.
Fassungslos.
Verstehen Sie das?
Warum ich?
BETEILIGUNG AUSGESCHLOSSEN
Er schaute ihr nach, bis sie im Schatten des Bahnhofgemäuers verschwand. Dann griff er nach der Tempopackung, fingerte knisternd ein Taschentuch heraus und tupfte das Himbeereis aus dem Gesicht des Kindes. Er ließ den Motor an und fuhr behutsam los. Bei seiner Ankunft zu Hause war das Kind eingeschlafen.
»Wie war dein Nachmittag?«, fragte seine Frau.
»Gut«, antwortete er knapp. »Wir bekommen den Auftrag.«
Er versuchte, die kleinen Peinlichkeiten der zurückliegenden Stunden wegzuwischen.
Er hatte Nadja sehen wollen, das stimmt. Er wusste, dass sie an der Vergabe von Aufträgen beteiligt war. Allerdings stellte er diesen Zusammenhang erst jetzt im Nachhinein her. Er hatte bis zu dieser Begegnung nicht daran gezweifelt, dass man seine Firma bei dem Projekt berücksichtigen würde. Dass Nadja Mitglied des Vergabegremiums war, hatte ihm eher ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Er war neugierig gewesen, sie wieder zu sehen. Lust, seinem Alltagseinerlei eine Abwechslung hinzuzufügen? Oder hatte er ihr seinen jüngsten Spross präsentieren wollen?
Auf den letzten Stufen zum Eingang des Konferenzsaals zog das Kind heftig am Arm seiner Mutter. Es schien zu spüren, dass ein nicht alltäglicher Nachmittag bevorstand. Karin öffnete die Tür. Der Bub stürmte in den Konferenzsaal, geradewegs zu seinem Vater. Der wendete sich ihm zu, breitete seine Arme aus und fing ihn auf. Dann nickte er freundlich in die Runde, erhob sich und ging mit seinem Sohn an der Hand zum Ausgang. Als wenige Minuten später der Referent seine Ausführungen geschlossen hatte, nützte Nadja den Applaus, um ebenfalls aufzustehen und die Sitzung zu verlassen. Draußen wartete die kleine Familie. Nadja setzte ein wohlwollendes Lächeln auf, begrüßte Martins Frau mit zwei knappen Wangenküssen. Dann blieb das Lächeln auf ihrem Gesicht stehen. Sie wusste nichts zu sagen. Karin trug ursprünglich weiße, inzwischen grau gewordene Turnschuhe und hatte ihre Fingerspitzen in die Hosentaschen gesteckt. »Dann gehe ich mal«, beeilte sie sich, die Stille zu beenden. Ohne gefragt worden zu sein, fügte sie hinzu: »Ich muss zum Arzt. Sehen wir uns noch?«
»Ich fürchte, nein«, antwortete Nadja. »Ich muss heute Abend nach Hause. Die Zugfahrt dauert über drei Stunden.«
»Dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag«, sagte Karin und drehte sich rasch zur Treppe.
Wie viele junge Mütter vernachlässigte sie ihr Äußeres. Ein paar überflüssige Pfunde, ein verwaschenes T-Shirt, kein Schnitt, sondern halblanges, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes Haar.
›Nichtssagend braun, ohne besondere Note‹, dachte Nadja.
»Wohin möchtest du?«, fragte Martin, nachdem Karin gegangen war. »Ich kenne einen schönen Ort außerhalb der Stadt. Einverstanden?«
Warum fragte er überhaupt? Sie war zu Gast hier und kannte sich nicht aus.
Unten auf der Straße reckte das Kind die Arme in die Luft. Martin hob es auf seine Schultern. Das Kind hielt sich an Martins Ohren fest, zwirbelte daran. Nutzte den Schwung von Martins Schritten, hob und senkte seinen Po wie ein Reiter, der sein Pferd antreibt.
Beim Auto angekommen, öffnete Martin die rückwärtige Tür und hob den Buben in den Wagen. Aber der widersetzte sich. Sein Lockenkopf wand sich hin und her. Martin gab nach und setzte ihn auf die Bank neben dem Kindersitz. Er befestigte den Sicherheitsgurt vor dem kleinen Körper und schob den Arm des Kindes durch eine extra Schlaufe, damit der Gurt den Hals nicht strangulierte. Dann küsste er das Kind auf den Mund.
Während er den Motor anließ, streifte er Nadjas Gesicht mit einem fragenden Blick. Sie reagierte nicht. Er gab Gas, schlängelte mit überhöhter Geschwindigkeit nervös an geparkten oder wartenden Fahrzeugen vorbei, schloss knapp auf die vor ihm fahrenden Autos auf, bremste scharf, gab wieder Gas. Niemand wusste etwas zu reden.
Ein, zwei Mal warf Nadja über ihre rechte Schulter dem Kind ein Lächeln zu. Wollte sie sich einschmeicheln? Man konnte ja nicht wissen, was ein Dreijähriger seiner Mutter erzählen würde.
»Ein hübsches Kind habt ihr«, sagte Nadja. »Es hat deine dunklen Augen.«
»Ja«, sagte er. »Ich bin froh, dass wenigstens dieses Kind in einer guten Beziehung aufwächst. Seine Mutter und ich haben es schön miteinander.«
Das tat weh.
»Wie geht es den anderen?«, fragte Nadja, ohne auf Martins Bemerkung einzugehen.
Er bog in einen Waldweg ein.
Die Anwesenheit des Buben zwang die beiden Erwachsenen zur Kühle und gab ihnen ein lächerliches Gefühl der Sicherheit.
›Sie ist älter geworden‹, dachte Martin.
Mit einiger Verzögerung begann er, ihre Frage zu beantworten: »Roman, Kim, Selina? Schwierig. Ich habe wenig Kontakt zu ihnen. Ihre Mutter missbraucht sie, um mich zu erpressen. Das ist sehr unangenehm.«
Nadja hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie trug dasselbe ärmellose, mit leuchtend blauen Kornblumen bedruckte Kleid wie am Vortag, beige und schilfgrün, dazu passende Mokassins. Das anhaltend sommerliche Wetter hatte sie dazu verführt, keinen Pullover einzupacken. Nun fröstelte sie. Der Vortag war brütend heiß gewesen. Am Abend waren Gewitterregen niedergegangen, danach hatte es bis in die Nacht hinein in Strömen gegossen. Der Himmel war nun bedeckt, die Luft deutlich abgekühlt und die Erde in den Vorgärten nass und schwarz. Von den Pflanzen dampfte Feuchtigkeit. Winzige Tautropfen auf Nadjas Haar schimmerten wie Perlmutt. Mit jeder Kopfbewegung baumelten ein paar feucht gewordene Strähnen vor ihren Augen hin und her. Ihre helle Haut kontrastierte mit ihren dunklen Augen: Martin musste immer wieder hinsehen.
Er parkte sein Auto zwischen eine silbergraue Limousine und einen dunkelblauen Mercedes. Das Kind hatte mit dem Fenster gespielt, hatte es per Knopfdruck hoch und nieder fahren lassen. Als Martin den Motor abstellte, blieb das Fenster auf halber Höhe stehen. Der Bub war müde und wollte nicht aussteigen. Schließlich ließ er sich doch aus dem Auto heben und quengelte so lange, bis er wieder getragen wurde. Nadja und Martin gingen nebeneinander her und sahen wie eine ganz normale Familie aus: Papa, Mama, Kind. Martin ein engagierter Vater. Und Nadja eine nicht so eifrige Mutter. Oder eine, die es genießt, die Betreuungsarbeit am Wochenende ihrem Mann zu überlassen.
Trotz der Last, die er trug, wirkten Martins Schritte federnd. Seine Haut war sonnengebräunt, seine Bewegungen geschmeidig.
»Und deine Ex-Frau?«, fragte Nadja weiter. Sie hatte ihren Namen vergessen.
»Eva.« Es schien Martin wichtig zu sein, Nadja auf die Sprünge zu helfen. »Eva hat einen Anwalt genommen. Sie will das Scheidungsurteil anfechten. Sie brauche mehr Geld. Die Kinder, vor allem der jüngste, machen es ihr genau nach. Kim ruft an, wenn er Geld von mir will.«
»Ach«, sagte Nadja, »das ist hässlich.«
»Und du?«, fragte Martin.
»Nichts Neues«, gab Nadja ausweichend zurück. »Mit Gerhard geht es manchmal besser, manchmal weniger gut.«
Sie hatte sich daran gewöhnt, dass sie schon seit Jahren nurmehr dem Schein nach mit Gerhard zusammenlebte, dass ihre Gefühle ziellos umher irrten und meistens irgendwo versickerten. Dass sie von gelegentlichen, kurzzeitig aufflackernden Strohfeuern zehrte und sich im Übrigen meistens sehr allein fühlte.
Die kleine Ad-hoc-Familie war inzwischen im Gartenrestaurant angekommen. Der Kellner brachte rasch eine überdimensionierte Speisekarte. Nadja bestellte einen Salat und einmal Latte Macchiato. Es gab einen kleinen Klettergarten und einen riesigen Sandkasten für das Kind. Aber der Junge wollte nicht spielen, sondern blieb bei seinem Papa.
Nadja fing an, über das geplante Projekt zu sprechen und erwähnte, dass es leider Einwände gegeben habe, wonach nicht sicher sei, ob Martins Firma berücksichtigt werden könne.